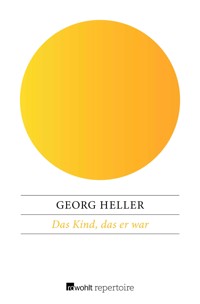
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Johann Avellis' Familie wird vom Hitlerregime verfolgt. Der jüdischstämmige Vater ist ins rettende Ausland geflohen, die Mutter, eine mutige Nazigegnerin, zieht mit ihren Kindern nach Bayern. Doch bald wird jedes Untertauchen unmöglich. Die Gefangenschaft im Zwangsarbeitslager bleibt Johann nicht erspart. Und auch nach 1945 lebt das Kind, das zwischen zwei Welten zu kämpfen hatte, in ihm fort.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Georg Heller
Das Kind, das er war
Die Geschichte des Johann Avellis
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Johann Avellis’ Familie wird vom Hitlerregime verfolgt. Der jüdischstämmige Vater ist ins rettende Ausland geflohen, die Mutter, eine mutige Nazigegnerin, zieht mit ihren Kindern nach Bayern. Doch bald wird jedes Untertauchen unmöglich. Die Gefangenschaft im Zwangsarbeitslager bleibt Johann nicht erspart. Und auch nach 1945 lebt das Kind, das zwischen zwei Welten zu kämpfen hatte, in ihm fort.
Über Georg Heller
Georg Heller (1929–2006), in Berlin geboren, studierte Wirtschaftswissenschaften und arbeitete als Journalist für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung», das «Handelsblatt» und die «Stuttgarter Zeitung». 1972 wurde er mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet. 1997 erschien «Lügen wie gedruckt. Über den ganz alltäglichen Journalismus», 2002 «Endlich Schluß damit? ‹Juden› und ‹Deutsche› – Erfahrungen».
Inhaltsübersicht
I
Nil mali intret
Selten war es, daß Johann Avellis alte Fotos ansah. Niemals stellte er welche auf seinen Schreibtisch oder hängte sie irgendwohin. Jedenfalls nicht von «den Lieben», von Orten womöglich schon. Orten der Sehnsucht, wie bei jenem Blick durch das gitterne Portal in einen Garten: Die Sonne überlichtet die geschmiedeten Muster, sie durchscheint die Blütenblätter der Magnolien dahinter und glänzt auf ihrem Laub. Von Orten schon, nicht von Frau und Kindern in silbernem Rahmen hinter Glas. Sie leben doch, jetzt holt Rose sie gerade von der Schule ab, heute abend liegen sie in ihren Betten, wenn du nach Hause kommst.
Auch dort hängen keine Fotos an der Wand, Ablichtungen der Eltern nicht, die noch leben, doch auch die Bilder der Gestorbenen nicht. All die Porträtaufnahmen, die auf eine Säule im Atelier des Fotografen sich stützenden Figuren, die Gesichter im bräunlich-vergilbten Oval, sie sind bei Johann Avellis in eine Schuhschachtel verbannt. In einem Moment ihres Lebens sind sie eingefroren, versteinert. Wie dieser fremde Mann in Uniform, der sein Vater sein sollte. Da kannte er ihn noch gar nicht. Auch eingefrorenes Glück ist ihm zuwider: da – Priesterweg!
Je näher Johann Avellis das Foto betrachtet, das er aus der Schublade geholt hat, desto ferner rückt ihm die Vergangenheit. Der Bahndamm an der Haltestelle Priesterweg schrumpft zu einem blassen Sechs-mal-sechs-Quadrat, auf dem ein unerkennbares Kind an Schienen entlangläuft. Er knüllt das Foto zusammen und wirft es weg. Es soll nicht töten, was er lebendig in sich hat. In der Sonnenglut knistern Disteln und Kornrade, nach Heu und Hafer riecht die Hitze, sie summt in den Ohren. Da muß er ganz klein gewesen sein, als er dort gelaufen ist, doch die Bilder und Gerüche haben ihn nicht verlassen. Die sind immer drin in ihm. Zeitlos. Erdbeben an einer Bruchzone, im Lebenslauf bricht etwas auf. Johann spürt, es bedeutet etwas, es hat ihn verändert, aber er weiß nicht, was das war, er weiß nur, daß er es bis heute ist.
Johann Avellis lebt hier und jetzt. Er lebt nicht in der Vergangenheit. Was hier und jetzt ist, weiß er allerdings so wenig, wie er sagen könnte, was vergangen ist. Hier und jetzt ist «Priesterweg», obwohl es Jahrzehnte her ist. Hier und jetzt war er und ist er, wenn er sich mit Sohn Matt im Regen auf der Hafenmole von Esbjerg stehen sieht, wo sie, als der Matt noch klein war, stundenlang den anlandenden und ablegenden Schiffen zusahen. Hier und jetzt war er, als er sich auf der Rheinbrücke in Bonn, auf dem Weg zur Uni, in dem unten dahinströmenden Wasser verlieren konnte. Wenn er in Gedanken dort steht, ist er lebendig.
Was ist dagegen ein Foto an der Wand! Damals am Priesterweg, da ging seine Mutter mit ihm in das Freibad dort, das für ihn diesen Namen trägt und, in seiner Erinnerung, ganz auf Holzpfählen über dem Wasser steht. Überall konnte man auf sonnengewärmten Brettern liegen. Seine Mutter nahm ihn mit ins Frauenbad. Sie sagte, da dürfe er noch rein, keine von denen, die sich dort ohne Badeanzug sonnten, habe etwas dagegen. Und Johann Avellis erinnert sich auch nicht an nackte Körper. Doch bis heute fühlt er sich geborgen, wenn er diesen geschützten Raum denkt, der nur der Sonne geöffnet ist.
Wenn er jetzt, hier und jetzt, «Priesterweg» denkt, ist er dann hier oder in «Priesterweg»? Ist er jetzt hier, an «Priesterweg» denkend, oder ist er in der Vergangenheit «Priesterweg» gegenwärtig?
Da liegen die Fotos vor Johann Avellis auf dem Tisch. Er denkt an das Kind, das er mal war. Vertraut ist es ihm und fremd zugleich der Person, die er heute zu sein meint, vergangen und gegenwärtig zugleich. Deshalb nennt er sich in seiner Erinnerung lieber David, so, wie er heute hieße, wenn es nach seiner Mutter gegangen wäre; doch sein Vater wollte keine hebräischen Namen. Seit Johann das von seiner Mama wußte, hätte er lieber so geheißen. Seinen eigenen Sohn würde er David genannt haben, wenn nicht später auch er befürchtet hätte, das könnte dem Jungen schaden in der Welt, in die der dann hineingeboren wurde.
Einen dicken Fischgrätmantel hat das Kind an, das auf dem Foto eine Schultüte im Arm hält, beim Lächeln gibt es eine Zahnlücke preis. Noch keine sechs Jahre alt war David, als er in die Schule kam. Auf dem nächsten Foto spielen Kinder Ball. Wir hatten ein Siedlungshaus in einem Vorort von Berlin, sagt Johann Avellis, wenn er davon erzählt. Die Kinder rennen auf einem großen Platz herum, am Rand sind niedrige Häuser zu erkennen, hinter Hecken und erwachsenen Birken. Kam der Bolle, der die Milch ausklingelte, noch mit einem Pferdewagen? Johann Avellis weiß es nicht mehr genau. Er erinnert sich an vorgespannte Pferde, hält das aber kaum für möglich. Sicher ist er, daß der Eismann mit einem Elektrowagen kam, das sägende Geräusch, mit dem die Kette außen über Zahnräder lief, hat er noch im Ohr.
Über der Eingangstür eines durch einen Vorbau betonten Hauses kann man in goldenen Lettern auf schwarzem Grund eine Inschrift lesen: HIC HABITET FELICITAS NIL MALI INTRET. Das sei Latein und heiße: Hier möge das Glück wohnen, niemals Unglück über die Schwelle treten. So war David gesagt worden, als er klein war, und so gaben die Avellis-Kinder es ihren Spielfreunden weiter. Aber wie alt war David, als er das seinen Freunden nicht mehr übersetzen konnte, ohne dabei bitter zu sein? Er wird wohl schon aufs Gymnasium gegangen sein und selber Latein gehabt haben, als er des Mißverhältnisses gewahr wurde zwischen dem, was sich sein Vater da gewünscht hatte, und dem, was nun war. Und daß einer das verkündet, in Latein verkündet, sich so hervortut, das lehnte er ab.
Hatte er die Bitterkeit über diese Inschrift von seiner Mutter übernommen? Hatte die nicht zeitweise mit dem Gedanken gespielt, die lateinischen Lettern von der Hauswand entfernen zu lassen? Die Diskrepanz war so ungeheuerlich, daß Johann Avellis sein Leben lang abergläubisch vorsichtig blieb, wenn er drauf und dran war, etwas vorauszudenken, was er sich wünschte. Als «Der Ring des Polykrates» in seinen Erfahrungskreis trat, sah er diese schwarze Tafel vor sich. Wie kann man einen solchen Spruch an sein neuerbautes Haus schreiben? Was ist das für ein Mensch gewesen, der das tat?
War sein Vater wirklich so glücklich gewesen, als er dort einzog? fragt sich Johann Avellis. Babette und Lisa müssen schon da gewesen sein, und seine Frau mußte schwanger gewesen sein, mit David. Wie sicher in seinem Glück muß sich einer fühlen, wenn er so was an sein Haus schreibt! Oder war das nur seine Fassade für «die andern»? Das hat David früh schon gedacht, erinnert sich Johann Avellis. Er konnte sich nicht vorstellen, daß dieser Vater Glück für sich und sie alle im Kopf gehabt haben sollte.
Er hat es dem, der so was über seine Haustür geschrieben hatte, bald nicht geglaubt. Es war ein Vater, den er nicht kannte, sein Vater. Ein Vater, den seine Mutter haßte, weil er sie und die Kinder verlassen hat. Von klein auf hat David mißtrauisch bei sich jede Regung verfolgt, die der eines solchen Vaters gleichen könnte.
Babette hat den Vater noch gekannt, der war mit ihr schon in die Oper gegangen, in Ausstellungen und Galerien. Sie schreit die Mutter an, wenn die was über «den Alten» sagt, der sie «alle verlassen» hat. Mit Mama hat Babette furchtbare Kämpfe. Mit ihrer Schulklasse könnte sie rudern, auf dem Wannsee, bei den Nazis darf sie das nicht, weil sie bei denen nirgends mitmachen darf. Babette will aber gar nicht rudern, schon deshalb nicht, weil ihre Mutter will, daß sie es wollen soll.
David begegnet dem Vater im Rollschrank, der in der Diele steht. Da soll er eigentlich nicht ran, aber als die Mutter weg ist, tut er es doch. Bücher sind drin und Stöße von Kartonseiten, auf die immer die gleichen girlandenumrankten Bilder aufgedruckt sind, Aktien. Aktien der Russischen Eisenbahn, erklärt ihm die Mutter später, sie seien nichts wert, die Wände könnten sie damit tapezieren. Die Bücher hätte er nicht angucken sollen, meint sie, weil es Kriegsbücher seien. David hat Fotos und Zeichnungen von Kanonen darin entdeckt, «Dicke Berta» liest er unter einem riesigen Geschütz, das auf einem Eisenbahnwagen steht. Zwischen den Seiten liegen Fotos von Soldaten. Das sei sein Vater, zeigt sie ihm auf einem davon. Hauptmann sei er gewesen, an der Front, das EK I habe er gehabt.
Manchmal kommt Onkel Molden zu Besuch. David sitzt ganz oben auf der Trauerweide im Garten. Onkel Molden lockt ihn herunter, er hat ihm was mitgebracht, eine Kipplore für seine Eisenbahn. David merkt, daß sich Onkel Molden um ihn kümmert. Es war das erste Mal, blieb auch das einzige, denn Onkel Molden kam nicht wieder. Er wollte Davids Mutter heiraten, aber die wollte nie mehr mit einem Mann zusammenleben. Wahrscheinlich wegen dem «einen», woran alle Männer «nur» denken, dachte David. So verstand er die Mutter, die mit Frau Jünger, die mit Onkel Molden «mal was gehabt hatte», stundenlang über die schrecklichen Gewohnheiten dieses «eingefleischten Junggesellen» sprach. Der war witzig, das konnte David heraushören, merkte es auch. Aber Russe war er, «ohne jedes Zeitgefühl», sagte Mama. Wenn er um fünf Uhr eingeladen war, kam er vielleicht um acht, ein Mann war das, der sich, Schrecken aller Schrecken: filzpantoffelig!, in einem mit schäbigen Möbeln vollgepfropften Untermieterzimmer stundenlang über seine Orchideen beugte. Er züchtete sie aus Samen, begeistert sieht David die winzigen Keime in der feuchten Watte unter Glas, weil Onkel Molden ihm alles erklärt. Schwierig ist das, und viel Geduld muß man haben, bis eine Orchidee endlich diese wunderschönen Blüten bekommt.
Der gepriesene Duft der Orchideen ist David zu süß und zu schwer. «Unmöglich» findet seine Mutter in ihren Gesprächen mit Frau Jünger diesen «Mathematiker», der, «russischer Emigrant», in einer «kleinen Stelle als Statistiker» arbeitet. David hätte gern einen Vater gehabt. Den Fleischer Ludewig, der auch Gefallen an seiner Mutter gefunden hatte, vielleicht weniger. Aber den Onkel Molden, der sich so mit ihm beschäftigte, schon, und das, obwohl er durchschaute, warum der nett zu ihm war. Den Ludewig hielt sich seine Mutter «warm», weil der immer mehr einpackte, als sie Fleischmarken hatten. Das mißfiel David, wie sie freundlich zu dem war, und zu anderen immer nur von oben herab über «den Fleischer» sprach. Der war nämlich eigentlich sehr nett, aber der konnte sein, wie er wollte, nie hätte Mama einen Fleischer geheiratet.
Schulweg
Mit Mama ist er zweimal probegefahren, und jetzt kann er das. David fährt seit ein paar Wochen jeden Tag allein von Neu-Tempelhof aus zum Französischen Gymnasium an der Spree. Und heute wartet doch tatsächlich seine große Schwester Babette vor der Haltestelle am Tiergarten, da, wo er mittags immer einsteigt, um nach Hause zu fahren, und die will ihn abholen! «Mobilmachung» sei, sagt sie. David ist so beleidigt, daß er kaum mit ihr spricht. Was sie ihm erklärt, das versteht er nicht. Warum soll er bei «Mobilmachung» nicht allein nach Hause fahren wie jeden Tag?
Am Nachmittag, als er begriffen hat, daß «Krieg» ist und daß da vielleicht «alles knapp» wird, geht er sofort zum Spielwarenladen am Hohenzollernkorso. Im Schaufenster von dem hat er schon lange eine Lokomotive für seine Märklin-Eisenbahn ins Auge gefaßt. Sie kostet acht Mark, sieben hat er gespart, eine leiht ihm Lisa. Heute kann er die Lokomotive bestimmt noch kaufen. Ja, David ist der einzige, der was kaufen will, der Ladeninhaber holt ihm das ersehnte Stück aus der Auslage und sagt ganz nett zu ihm: Du kriegst sie. Einem Kind gibt er sie gern, sagt er, wer weiß, wann er so was wieder reinkriegt. Und wie lange er noch Spielzeug an Kinder verkaufen kann … Der Mann guckt traurig auf die Hand, die sich der schmalen Märklin-Packung entgegenstreckt, still ist es in dem leeren Laden, fast ein bißchen Angst kriegt David vor dem Krieg. Doch dann rennt er durch die sonnendurchflutete Akazienallee nach Hause, glücklich die Treppe hoch in sein Zimmer, holt Transformator und Schienen aus dem großen Karton und läßt die neue Lokomotive fahren.
David ist stolz darauf, daß er allein zur Schule fahren kann. Babette hätte ihn nicht abholen müssen. Mit dem Achtundzwanziger geht es am Anhalter Bahnhof vorbei, über den Potsdamer Platz mit dem Haus Vaterland auf der einen und Wertheim auf der anderen Seite, danach kommt rechts, ziemlich lange fährt man daran vorbei, die Reichskanzlei. Sie liegt gegenüber dem Tiergarten. Vor dem Brandenburger Tor steigt David aus. Am Reichstagufer lang oder über die Neue Wilhelmstraße kann er jetzt zum Französischen Gymnasium laufen. Auf dem Weg über die Wilhelmstraße geht es an dem großen Platz vorbei bis zum Anfang der «Linden». Drüben liegt das Hotel Adlon, dahin geht seine Mutter zum Friseur, «der beste von Berlin» sei das, sagt sie.
Immer wieder mal sollte David sie da «abholen» kommen, nachdem die Schule aus war. Überwinden mußte er sich, um an dem Portier vorbeizugehen, schon draußen vor der Tür stand einer mit Schnüren auf der Brust, durch die Halle mußte er durch, die ihn klein machte. Auf der Treppe ins Untergeschoß fing es an, nach Friseur zu riechen, bis David schließlich drin war in dieser süßlichen Wolke. Es war gar nicht so leicht, die unter der Haube sitzende Mutter zu finden, zwischen all diesen Gestalten in den Friseurmänteln.
Sie genoß das, David weniger. Er ging nie gern zum Friseur, obwohl man ihm immer wieder, wie witzig, sagte, es tut nicht weh. Aber manchmal schneiden sie dich eben doch, mit dem Rasiermesser hatte ihm einmal einer fast das ganze rechte Ohr rausgeschält. Immer wollten die es kürzer haben als er, Mutter und Friseur gegen ihn. Sie sagte, bitte kurz, und er traute sich nicht, sich zu wehren, wenn er im Spiegel sah, daß sein Kopf wieder zu kahl wurde. Jetzt übergab sie ihn einem dieser Adlon-Friseure! Sie war noch nicht fertig, und da konnte man doch gleich ihrem Sohn die Haare schneiden (bei dem «besten Friseur von Berlin», dachte David voller Abscheu). Schön kurz, sagt die Mutter noch. Sie setzen ihn auf so einen Friseurstuhl, und der mit dem Mantel schneidet und schneidet – David hat schon Tränen in den Augen – und schneidet und schneidet … Als der stumme Junge der Mutter vorgeführt wird, die inzwischen fertig geworden ist und schon bezahlt hat, findet sie es sehr schön, wobei sie das «sehr» betont. Kaum draußen aus dem Adlon, springen ihm die Tränen aus dem Gesicht. So gehe ich nicht in die Schule, nie werde er so in die Schule gehen, heult er seine Mutter an. An der Straßenbahnhaltestelle tritt ein gutgekleideter Herr – «Herr» sagte seine Mutter zu so einem, im Unterschied zu «Männern», wie dem Fleischer Ludewig oder auch Onkel Molden –, ein Herr tritt also an sie heran und spricht, David hört es ungläubig: Entschuldigen Sie, gnädige Frau, wo haben Sie denn Ihrem Sohn die Haare schneiden lassen? So gut geschnitten, das habe ich lange nicht gesehen. Im Adlon, antwortet seine Mutter gerne. Das glaubt David ihr nie im Leben, daß sie den nicht bestellt hatte.
Gleich nach der Schule fuhr David manchmal auch zu Wertheim am Potsdamer Platz. Vor Weihnachten kam die Mutter mit Lisa dahin, und man traf sich am Eingang zu der Spielzeugschau. Erst außen, fast endlos die Leipziger Straße lang, ein Schaufenster hinter dem anderen. Drinnen bewegen sich Zwerge, Hasen, Rehe, Hänsel und Gretel wie lebendige Kinder vor einem richtig großen Haus aus Pfefferkuchen, und Nikolaus auf seinem Schlitten, von Hirschen wird er gezogen durch stiebenden Schnee. Am schönsten war das, wenn es schon dunkel war und gar noch wirklich schneite, und die Schaufenster und die vielen Sterne und die Lichtgirlanden leuchteten. Richtig wütend wurde seine Mutter, wenn David «AWAG» sagte, so, wie später dann der Straßenbahnschaffner das Kaufhaus an der Leipziger Straße ausrief. Das ist Wertheim, sagte sie, das haben die Nazis denen gestohlen.
Am Heiligabend selbst tauchten sie, wenn sie zum Weihnachtsgottesdienst in den Berliner Dom gingen, immer am Gendarmenmarkt aus der U-Bahn auf. Es war schon dunkel, und manchmal schneite es leicht. Der Weg über die Linden, an Staatsoper und Schloß vorbei zu der erleuchteten riesigen Kuppel, das ist für David das Fest. Die Feier selbst in dem von Menschen überfüllten Rund, auf die sie von hoch oben herabblickten, war für ihn mehr eine Qual, weil er jedesmal mußte. Nur mit zusammengekniffenen Beinen und auf der engen Bank hampelnd kannte er das. Einmal hatte es Babette auf sich genommen, ihn durch die vollen Sitzreihen und das Labyrinth von Treppen und Gängen aufs Klo zu bringen. Sie kamen nicht zurück, die ganze Zeit standen sie irgendwo unten im Gang. Da sah er nur den Mantel von dem Mann vor ihm.
Den Französischen Dom, vor dem sie aus der U-Bahn hochkamen, wenn sie am Gendarmenmarkt ausstiegen, lernte David später erst kennen. Dort trafen sich die Schüler des Französischen Gymnasiums jedes Jahr zum Schuljahresbeginn und liefen nach dem Gottesdienst zur Schule rüber. David suchte bei dieser Gelegenheit den Weg durch die Friedrichstraße, nahm sicherheitshalber einen Klassenkameraden mit. Die Friedrichstraße war nicht gerade verboten, aber von seiner Mutter so beschrieben, daß er sie als gefährlich und lockend zugleich empfand. «Bars» waren da und so was, an dem sie an einem solchen Vormittag scheu vorbei bis zur sicheren Schule gingen.
In die Neue Wilhelmstraße, nur um die Ecke vom Eingang des Französischen Gymnasiums, durften sie – während der Unterrichtszeit! – gehen, wenn «Staatsbegräbnis» war. Das häufte sich. Das wäre David aufgefallen, auch wenn seine Mutter es nicht höhnisch bemerkt hätte. Der Weltkriegsheld Udet zog vorbei in seinem Sarg, der Jagdflieger und Ritterkreuzträger Mölders, und noch mal irgendein General. Feierlich aufgebahrt sind die Särge, mit Ordenskissen drauf, langsam vorbeigefahren worden, zwischen lauter zu Trauermarschklängen Marschierenden. In diesem langsamen Schritt hat David auch den dicken Göring vorbeigehen sehen, leibhaftig, auf ein paar Meter Entfernung. Davids Mutter interessierte nur, daß mit dem Tod von dem Udet irgendwas nicht gestimmt hat. Davon «munkelt» man in Berlin, sagte sie, den hätten «sie» umgebracht, oder er sich selbst. Viel später erst hat David mitbekommen, daß sie solche Sachen wußte, weil sie BBC hörte.
Sie telefonierte über so was immer mit Frau Jünger. Stundenlange Gespräche führt Davids Mutter mit der, dabei liegt sie gern auf ihrem Bett oder im Bett. Wenn sie mit Frau Jünger «quatscht», darf sie nicht gestört werden. Manchmal schmuggelt sich David ins Zimmer, übersieht heftiges Handwedeln der Telefonierenden, legt sich ans Fußende und hört zu.
Als er heute aus der Schule kommt, rennt er die Treppe rauf, platzt in das Zimmer rein und ruft: Ich hab den Adolf gesehn! Hoch fährt seine Mutter, ins Telefon sagt sie: Warte mal, Marianne, und zu David: Was? Das Schwein ist tot! David erzählt, wie die Straßenbahn so gebremst hat, daß er an den Sitz vor seinem geknallt ist. Eine Wagenkolonne sei vorbeigerast und in die Reichskanzlei eingebogen. In einem offenen Wagen habe der Adolf gesessen, er habe ihn genau erkannt, blau habe der ausgesehen, sagt er wichtig. Die Mutter will’s nicht glauben. Gerade telefoniert sie mit Frau Jünger, Bombe im «Bürgerbräu», sie glauben beide nicht, was das Radio meldet, daß er davongekommen ist, und jetzt will David ihn gesehen haben! David hat ihn gesehen, mit eigenen Augen, merkwürdig blau hat er ausgesehen, und die Autos sind schnell in die Reichskanzlei eingebogen. David will ihn gesehen haben, sagt sie jetzt zu Frau Jünger, ob das Schwein doch noch lebt? Vielleicht ist er mit Absicht so auffallend durch die Straßen gefahren, damit die Leute ihn lebendig sehen? Oder haben sie die Leiche durch Berlin gefahren, extra sichtbar, damit die Leute denken, er lebt? Das fragt Davids Mutter, die das gerne glauben wollte, nun verzagt ins Telefon.
Flaksplitter
Gemein. Die sind so gemein. Davids Mutter schluchzt wütend, vornübergebeugt sitzt sie am Eßzimmertisch, ruckt mit dem Oberkörper, schlägt mit halbgeballten Händen auf die hölzerne Platte. Sie hat gerade den Telefonhörer aufgelegt. Die sind so gemein. Jetzt haben sie ihnen auch noch das Radio weggenommen. Ins Kino dürfen sie nicht. Keine Zeitung lesen. Jetzt noch das Radio … Die Guttmanns …, stößt sie hervor. Die Guttmanns hat David mal kennengelernt, sagt sie, als sie mit ihm bei Frau Jünger gewesen ist. Frau Jünger hat gerade angerufen. Die gehen sowieso schon kaum noch auf die Straße, die Guttmanns, wegen dem gelben Judenstern, und jetzt können sie nicht mal mehr zu Hause Radio hören. Frau Jünger kann die Guttmanns nicht mehr besuchen, immer wieder mal hatte sie ihnen was bringen können, jetzt bringt sie sich und die Guttmanns in Gefahr, wenn sie sie besucht. Das Telefon haben die Nazis den Juden sowieso schon lange «weggenommen». Auf der Straße hat Frau Jünger beide getroffen, mit dem Stern auf ihren Mänteln. Sie ist rüber zu ihnen auf die andere Seite, und Frau Guttmann hat ihr zugezischelt, daß sie jetzt auch kein Radio mehr hören können. Herr Guttmann habe «furchtbar» ausgesehen, er sei «am Ende», krank seien beide von den vielen Kränkungen. Vielleicht wäre es das Beste, sagt Davids Mutter, wenn sie beide stürben …
Das hat David noch einmal gehört. Als Feststellung. Zu Berliners. Als die tot waren, unter den Trümmern ihres Hauses lagen. Aus einer Pyramide von Gipsbrocken, Ziegeln, zerfetzten Holzbalken ragte in der Mitte der Schornstein auf, das einzige, was die Luftmine von dem Siedlungshaus hatte stehenlassen. Darunter wußte David die Berliners. Sicherlich habe es ihnen die Lungen zerrissen und sie seien sofort tot gewesen, sagte Davids Mutter, das sei «das Beste für sie» gewesen. David hatte die alten Berliners, sie wohnten um die Ecke rum, am Paradeplatz, nur einmal mit dem gelben Stern gesehen. Da kamen sie auf ihn zu, sie vorne, er schräg dahinter. Das Gesicht der alten Frau Berliner, die niedergeschlagenen Augen, der Mund, David hat Angst. Auch die anderen Leute gehen ihnen aus dem Wege. Es war, als schöben die beiden eine unsichtbare Mauer vor sich her.
Die Luftmine war ziemlich genau auf Berliners Haus niedergegangen, sie hatte Avellis’ Dach abgedeckt, und bei Davids Freund Peter war keine Fensterscheibe mehr ganz. Peter hatte hinten am Ende des Kellerganges gesessen, der vorne zu ebener Erde in den Garten hinausführte. Ein Splitter der Luftmine hatte ihn am Knie verletzt, ein Splitter nur. Peter hat David das «Wunder von Tempelhof» gezeigt. Die Wand, an der er gesessen hatte, war mit Einschlägen von Bombensplittern übersät. Sie hatten Peters Körpersilhouette ausgespart, wie die Messer eines Messerwerfers das Abbild seiner Assistentin auf der Holzwand hinter ihr, nachdem sie mit strahlendem Lächeln von ihrem Podest heruntergestiegen ist. Peter war allein im Haus, seine Mutter verreist gewesen. Er hätte sofort in den Bunker gehen müssen, wenn Fliegeralarm kam. Natürlich hatte er das nicht gemacht; er wollte mal alles richtig sehen. Das hatte er ja nun gehabt! Bei Avellis in der Diele, auf dem Treppenabsatz sitzt er, mit blutendem Knie, sehr mitgenommen, mit schwacher Stimme wehrt er jede Hilfe ab: Ach, Kinder, nu laßt mich doch. Davids Mutter bringt ihn dazu, zum Roten Kreuz zu gehen; das muß ein Arzt verbinden. Peter hat für sein Knie das Verwundetenabzeichen bekommen. In der Schule hat er es aus Jux getragen. Was haben sie den «Kriegshelden» veräppelt!





























