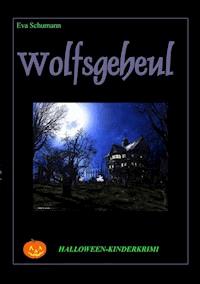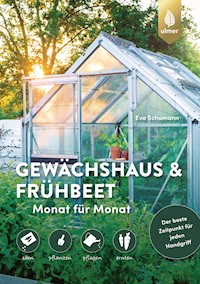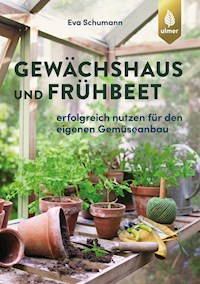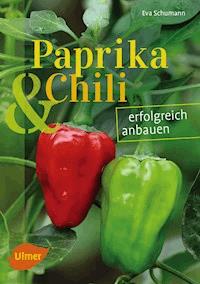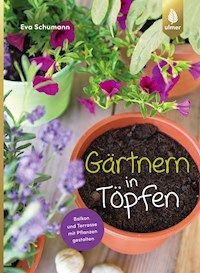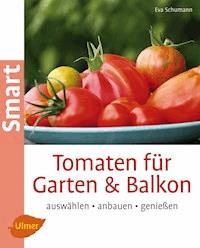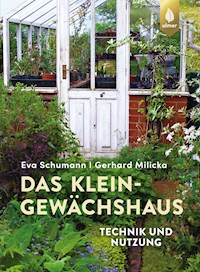
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
The Small Greenhouse Small greenhouses are currently a hot topic among private gardeners. But which greenhouse is the right one for your needs? This practical book gives you valuable tips, right from the outset – from designing and building a greenhouse yourself, to its interior fittings and use. The author describes both the function of a greenhouse and also particular ‘tricks’, such as how to influence flowering times, in simple, easily understood and practical terms. Additionally, a wide range of use options are presented: growing seedlings or fruit and vegetables for the garden, overwintering frost-sensitive plants, growing cut flowers and even collecting and raising exotic plants. A supplementary section gives information on special plant groups such as alpine plants, cacti and succulents, bonsai plants, palms, orchids and tropical plants.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Eva Schumann | Gerhard Milicka
DAS KLEIN-GEWÄCHSHAUS
TECHNIK UNDNUTZUNG
5. Auflage158 Fotos, 68 Zeichnungen
Vorwort und Dank der Autorin
Der Weg zum eigenen Gewächshaus
Was soll das Gewächshaus „leisten“?
Kauf oder Selbstbau?
Die Größe des Gewächshauses
Der Platz und die Aufstellungsrichtung
Behördliche Auflagen
Das Gewächshaus, seine Ausstattung und spezielle Einrichtungen
Wie funktioniert ein Gewächshaus?
Bauweisen, Bauformen, Gewächshaustypen
Die Bestandteile des Gewächshauses
Die Temperierung
Bewässerungseinrichtungen und Luftbefeuchtung
Strom im Kleingewächshaus
Mess-, Steuerungs- und Regelgeräte
Die Ausstattung des Kleingewächshauses
Ein Kleingewächshaus selber bauen
Pflege, Wartung und Reparatur des Gewächshauses
Klima und Wachstum im Kleingewächshaus
Die Temperatur
Licht und Schatten
Wasser und Luft
Böden, Erden, Substrate, Kompost und Düngung
Die Anzucht von Pflanzen für den Garten
Das Gewächshaus, seine Ausstattung und Kulturmaßnahmen
Termingerechte Aussaat von Gemüse und Sommerblumen
Anzucht von Gemüse und Kräutern für Balkon und Terrasse
Gemüse und Kräuter anbauen
Das Gewächshaus, seine Ausstattung und die Kulturmaßnahmen
Der Anbau im Verlauf des Gartenjahres
Von der Aussaat bis zur Ernte – neue und altbewährte Gewächshausgemüse
Anbau von Heil- und Gewürzkräutern
Kübelpflanzen und heimische Obstgehölze überwintern
Das Gewächshaus, seine Ausstattung und Kulturmaßnahmen
Beliebte Kübelpflanzen
Überwinterung von heimischen Obstgehölzen in Kübeln
Kultur von exotischen Früchten und Wein
Das Gewächshaus, seine Ausstattung und Kulturmaßnahmen
Beschreibung der beliebtesten Arten
Vom Treiben, Verfrühen und Verspäten
Blumenzwiebeln und Knollen
Blütenzweige
Erdbeeren
Das Gewächshaus im Gartenjahr
Kalender für die intensive Nutzung
Besondere Pflanzengruppen im Gewächshaus
Das Alpinenhaus
Kakteen und andere Sukkulenten
Farne und Palmfarne
Palmen
Orchideen
Zimmer- und Tropenpflanzen
Gesunde Pflanzen
Vorbeugen ist besser als Heilen
Umweltverträgliche Unkrautbekämpfung
Service
Vorwort und Dank der Autorin
Anfang der 1990er-Jahre kam der damalige Verleger Roland Ulmer zu mir und fragte, ob wir nicht gemeinsam etwas dafür tun sollten, dass mehr Freizeitgärtner ihr Kleingewächshaus erfolgreich nutzen können. Ich arbeitete damals als Gartenbau-Ingenieurin in der Informationsstelle Weihenstephan, direkt am Puls von Hobbygartenbau, Erwerbsgartenbau und praxisnaher Forschung. Aus der Idee des Verlegers wurde dieses Standardwerk zur Technik und Nutzung von Kleingewächshäusern.
„Wer Pflanzen liebt, hat mit einem Gewächshaus noch mehr Freude an seinem Hobby.“ Mit diesem Satz begannen die ersten Auflagen dieses Buches, und das stimmt immer noch. Doch gab es in den letzten Jahren technische Entwicklungen, neue Erkenntnisse und Trends, die wir in das Buch einfließen lassen wollten. Dazu gehören beispielsweise die jüngsten Forschungsergebnisse zum Thema Energieeinsparung und das veränderte Sortenangebot. Gärtnern in der Stadt wurde auch immer beliebter und Gewächshäuser stehen daher immer häufiger auf Balkonen, Dachterrassen und Garagen. Für die einen Kleingewächshausgärtner steht dabei die Selbstversorgung nach ökologischen Gesichtspunkten im Vordergrund, für andere die Beschäftigung mit Pflanzen, die sie besonders mögen. Auch bei den Sortenvorlieben gibt es unterschiedliche Strömungen: Die einen Freizeitgärtner schätzen die neuen, manchmal besonders auffälligen und / oder ertragssicheren Sorten, andere setzen sich für den Erhalt alter, samenechter Sorten ein – bei der Vernetzung Gleichgesinnter helfen heutzutage Internet und soziale Netzwerke.
Im Laufe der Jahre haben wir alle Kapitel des Buches immer wieder einer sorgfältigen Prüfung unterzogen: Bewährtes Kleingewächshaus- / Gärtnerwissen ist geblieben, aber neue Erkenntnisse, Tipps und Trends aus Gartenbau und Freizeitgartenbau sind hinzugekommen.
Ich möchte mich sehr herzlich bei allen bedanken, die direkt oder indirekt an diesem Buch mitgewirkt haben, vor allem bei ehemaligen Kollegen, Vorgesetzten und Vorgängern an der Fachhochschule Weihenstephan (heute Hochschule Weihenstephan-Triesdorf), auf deren Wissen und Erfahrungen ich zurückgreifen konnte: Dr. F.-W. Frenz, Ernst Niller, Thomas Jaksch, Dr. Michael Beck, Hieronymus Schlereth, Katrin Kell, Dr. W. Gerlach, Martin Jauch, Thomas Lohrer, Hedwig Klinkan, die Mitarbeiter der Kleingartenanlage und viele andere geschätzte Kollegen. Herzlichen Dank auch an die Kleingärtner, die ihre Erfahrungen mit mir geteilt und mir ihre „Gewächshausschätze“ gezeigt haben. Beim technischen Teil hatte ich außerdem äußerst wertvolle Hilfe von meinem Coautor Gerhard Milicka, und sehr viel mehr als nur den letzten Schliff erhielt das Buch von den Lektoren – zunächst Gerhard Bley, später Doris Kowalzik – mit ihren jeweiligen Teams. All diesen Personen sowie dem Verlag Eugen Ulmer möchte ich sehr herzlich danken.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesem Buch und Ihrem Gewächshaus.
Eva Schumann
Der Weg zum eigenen Gewächshaus
Wer bei der Anschaffung des Gewächshauses und seiner Einrichtung die richtigen Entscheidungen trifft, hat hinterher mehr Freude daran. Zwar werden Kleingewächshäuser inzwischen nicht nur in jedem Baumarkt und in Gartencentern angeboten, sondern auch über den Katalog-Versandhandel und im Internet, doch nicht jedes Gewächshaus ist für jede Nutzungsart gleich gut geeignet. Je nachdem welche Pflanzen man darin kultivieren möchte, unterscheiden sich Bauweise, Form, Ausstattung und Einrichtung des Gewächshauses. Beispielsweise sind die Anforderungen an das Gewächshaus für den Gemüsebau hinsichtlich Klimatisierung ganz anders als für eine Orchideenzucht. Wärmeliebende Pflanzen benötigen nicht nur eine Heizung, sondern Konstruktion und Eindeckungsmaterial müssen besser isolierend sein. Für die Kultur lichtbedürftiger Pflanzen und solcher, die ultraviolettes (UV-)Licht für ein gesundes natürliches Wachstum benötigen, spielen außerdem Lichtdurchlässigkeit bzw. die Durchlässigkeit für UV-Licht des Eindeckungsmaterials eine größere Rolle. Manchen Pflanzen bekommt eine niedrige Luftfeuchtigkeit, andere wollen es tropisch feuchtwarm. Während man Gemüse vorwiegend in Grundbeeten anbaut, wird man Kakteen oder Orchideen eher auf Tischen kultivieren, um sich die Pflege zu erleichtern. Palmen und andere hochwachsende Pflanzen wiederum brauchen hohe Gewächshäuser, die ein größeres Maß an Windstabilität erfordern. Je nach Nutzungsart sind Strom-, Wasser- und Kanalanschlüsse wichtig und müssen frühzeitig geplant werden.
Was soll das Gewächshaus „leisten“?
Ausgangspunkt für die Wahl eines Gewächshauses ist die vorgesehene Verwendung. Es gibt nicht ein Gewächshaus und ein Gewächshausklima, das für alle Pflanzen geeignet ist. Man kann nicht im gleichen Gewächshaus tropische Orchideen züchten und gleichzeitig alpine Pflanzen kultivieren. Es ist daher sinnvoll, sich mehr oder weniger zu spezialisieren. Die Pflanzen in einem Gewächshaus oder in einem Gewächshausabteil sollten ähnliche Ansprüche haben, denn je besser man diese erfüllen kann, desto gesünder wachsen die Pflanzen und desto weniger Pflanzenschutzprobleme treten später auf.
Jede Nutzungsart stellt andere Ansprüche an das Gewächshaus. Die Tabelle gibt einen Überblick, wie das Gewächshaus für die jeweilige Nutzungsart beschaffen sein sollte. In den pflanzenbaulichen Kapiteln findet man weitere Einzelheiten zum jeweils geeigneten Gewächshaus, seiner Ausstattung, Einrichtung und Klimatisierung.
Am häufigsten werden Kleingewächshäuser für den Anbau von Gemüse genutzt. Die Vorteile des geschützten Gemüseanbaus im Gewächshaus sind vielfältig: Man kann bereits früher im Gartenjahr Gemüse ernten, wärmebedürftigeren Gemüsearten wie Gurken, Tomaten im Sommer gleichmäßig Wärme und Schutz vor Wind und Niederschlägen bieten und das Gartenjahr in den Herbst und Winter hinein verlängern. Für den Gemüseanbau lassen sich schon die einfachsten und damit preiswertesten Kleingewächshäuser nutzen. Das Gewächshaus muss nicht einmal beheizbar sein (trotzdem gehört in jedes Gewächshaus ein Luft- und ein Bodenthermometer) und außer guten Lüftungseinrichtungen ist eigentlich keine besondere Ausstattung notwendig.
Das richtige Gewächshaus für jede Nutzungsart
Ein anderer Beweggrund für die Anschaffung eines Gewächshauses ist, eine bereits bestehende Pflanzensammlung zu erweitern oder ihr einen geeigneteren Platz zu geben. Diese Sammlungen sind oft sehr spezialisiert. Für einen Orchideenfreund, für dessen Sammlung die Pflanzenvitrine inzwischen zu klein geworden ist, ist die Anschaffung eines Gewächshauses, das den Pflanzen ein warmes Klima mit hoher Luftfeuchte bieten kann, die richtige Lösung. Hierzu ist vor allem eine leistungsfähige Heizung notwendig, wobei der Energieaufwand mit einem gut isolierenden Eindeckungsmaterial und entsprechenden Konstruktionsprofilen möglichst niedrig gehalten werden sollte. Aber auch die Wahl des Fundamentes wird nicht nur von der Größe, sondern auch von der späteren Nutzungsart bestimmt, denn je nach Art verhindert es Wärmeverluste seitlich durch den Boden.
Für eine Kakteensammlung eignet sich ein helles, frostfreies Gewächshaus mit Temperaturen von 6 bis 12 °C im Winter und einem ganzjährig trockenen Raumklima. Der Liebhaber von Steingartenpflanzen dagegen kann schon in einem unbeheizten Erdgewächshaus schutzbedürftige Alpinpflanzen kultivieren.
Im Gewächshaus hat der Pflanzenliebhaber zudem die Möglichkeit, Biotope im Kleinen nachzubilden. Beispielsweise wirken Kakteen am „natürlichsten“, wenn sie ausgepflanzt werden. Deckt man das Substrat zwischen den Pflanzen mit Sand ab, wirkt das Ganze wie eine kleine Wüstenlandschaft. Mit den entsprechenden Maßnahmen kann man im Tropenpflanzenhaus einen kleinen Dschungel einrichten und im Alpinenhaus eine „Gebirgslandschaft“ mit zerklüfteten Gesteinsbrocken schaffen.
Ein Gewächshaus kann aber auch eine kleine Oase, ein Ruhepunkt inmitten von Pflanzen sein. Zwar ist das Gewächshaus für fast jeden Hobbygärtner ein Rückzugsort, in dem er seinem Hobby in Ruhe nachgehen und sich auch im Winter am Wachsen und Gedeihen seiner Pflanzen erfreuen kann, ein Gewächshaus eignet sich aber ebenfalls zum „Wohnen im Grünen“, vielleicht mit einer Sitzecke inmitten von Pflanzen, wo man in aller Gemütlichkeit alleine oder mit Gästen Kaffee oder Tee trinkt. Ein Wintergarten oder ein Anlehngewächshaus, aber auch ein frei stehendes Gewächshaus sind dafür ideal.
Kauf oder Selbstbau?
Nicht jeder, der ein Gewächshaus nutzen möchte, will es auch selber bauen, geschweige denn es entwerfen und sich mit Berechnungen über Windlasten, Eigenlasten, Schneelasten usw. auseinandersetzen. Das ist auch gar nicht nötig, denn das Angebot an Kleingewächshäusern ist inzwischen sehr groß. Man kann sie bei Herstellern direkt (vor Ort, per Katalog oder über deren Internetshop) oder aber über Baumärkte, Gartencenter bzw. deren und andere Onlineshops kaufen.
Grundsätzlich hat man folgende Möglichkeiten:
>Kauf eines Gewächshauses oder Wintergartens einschließlich Montage durch den Lieferanten
>Kauf eines Gewächshausbausatzes zum Selberaufbauen, zum Teil wird auch Vormontage gegen Aufpreis angeboten
>Eigenentwurf, Bauteile selbst besorgen, Selbstbau
Wer gar nichts mit dem Gewächshausbau im Sinn hat, der lässt sich eines in seinem Garten aufbauen. Viele Gewächshausanbieter stellen das Gewächshaus auf Wunsch fertig zur Nutzung in den Garten. Das hat zwar seinen Preis, dafür kann man aber sicher sein, dass das Gewächshaus fachmännisch montiert wird.
Wer sich für die zweite Variante entscheidet, muss sein neues Gewächshaus mithilfe von Fundamentplan und Aufbauanleitung zuhause selbst aufbauen. Es ist unbedingt zu empfehlen, noch vor dem Kauf einen Blick auf den Fundamentplan und die Aufbauanleitung zu werfen, um festzustellen, ob man in der Lage ist, die notwendigen Schritte auszuführen. Man findet die Unterlagen oft auf den Webseiten der Hersteller (Firmen samt Webadressen im Serviceteil). In der Regel sind Kleingewächshausbausätze zwar auch für den Laien zusammensetzbar, es gibt jedoch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Man muss je nach Größe und Art des Gewächshauses mit mehreren Tagen zum Aufbau rechnen. Außerdem sind in der Regel mehr als eine Person für das Halten und gleichzeitige Verschrauben der Einzelteile notwendig.
Wer sich den Aufbau etwas erleichtern will, kauft ein vormontiertes Gewächshaus. Giebel und Seitenwände sind einschließlich der Fenster und Türen vormontiert und müssen vom Käufer nur noch zusammengeschraubt und am Fundament befestigt werden. Dann kann man mit den Verglasungsarbeiten beginnen.
Ein Gewächshaus nach Eigenentwurf selbst zu bauen, kann man nur jemandem empfehlen, der gerne tüftelt, bautechnisches Grundwissen hat, handwerklich begabt ist und günstige Bezugsmöglichkeiten für die Bauteile hat. Das gilt besonders für anspruchsvollere Gewächshäuser. Ist ein kleines Folienhaus mit einer Holzkonstruktion, das man ungeheizt bewirtschaften möchte, noch relativ einfach selbst zu planen und zu bauen, wird die Eigenerstellung von großen, stabilen Gewächshäusern oder Wintergärten, die als Warmhaus genutzt werden sollen, doch ungleich schwieriger und ist eigentlich nur in Zusammenarbeit mit einer Fachfirma oder einem Architekten zu empfehlen.
Kosten lassen sich vor allem durch den eigenen Aufbau im Vergleich zur Montage durch die Gewächshausfirma einsparen. Gerade Wintergärten und Gewächshäuser für den anspruchsvolleren Bedarf sind meist mit besonderen Konstruktionsprofilen und Eindeckungsmaterialien versehen, die selten als „Meterware“ angeboten werden.
Für manchen Selbstversorger können aufgegebene Erwerbsgewächshäuser interessant sein. Manchmal sind solche Häuser kostenlos gegen Abbau erhältlich.
Die Größe des Gewächshauses
Die Größe richtet sich zunächst einmal nach den gegebenen Möglichkeiten im Garten und nach den Vorschriften, die es zu beachten gilt. In einem „handtuchgroßen“ Garten kann kein riesiges Palmenhaus stehen. Und nicht nur die örtlichen Behörden, sondern auch manche Kleingartenanlagen schreiben genau vor, wie groß Gewächshäuser höchstens sein dürfen.
Die Gewächshaushöhe sollte auf jeden Fall ein Arbeiten ohne Bücken ermöglichen. Sie richtet sich außerdem nach der Höhe der Pflanzen, die hier später gedeihen sollen. Für hoch wachsende Pflanzen, wie beispielsweise große Kübelpflanzen oder Palmen, benötigt man ein höheres Gewächshaus als für klein bleibende Alpinpflanzen, die man auch auf Tischen in einem Erdgewächshaus kultivieren kann.
Die Gewächshausgrundfläche muss so bemessen sein, dass man ungehindert Werkzeuge wie Rechen, Grabgabel usw. benutzen kann, ohne mit dem Stiel auf der anderen Seite durch die Plastik- oder Glashaut zu schlagen. Für ein gemüsebaulich genutztes Gewächshaus empfiehlt sich beispielsweise eine Grundfläche von mindestens 3 × 4 m und eine Firsthöhe von mindestens 2 m.
Gewächshäuser mit großer Grundfläche erwärmen sich schneller und haben einen größeren Wärmepuffer. Bei beheizten Gewächshäusern sinken die Heizkosten pro m2 mit zunehmender Grundfläche, weil das Verhältnis von wärmeabgebender Außenhaut zum inneren Luftvolumen mit zunehmender Fläche günstiger wird.
Wenn genügend Platz im Garten vorhanden ist, der Geldbeutel und die Vorschriften es zulassen, entscheidet man sich im Zweifelsfall für das größere Gewächshaus. Die Erfahrung zeigt, dass die Zahl der kultivierten Pflanzen sehr schnell wächst und das Gewächshaus schon in kürzester Zeit zu klein wird.
Der Platz und die Aufstellungsrichtung
Rein optisch sollte sich ein Gewächshaus harmonisch in den Garten einfügen, denn in der Regel will man sich über viele Jahre an seinem Pflanzenhaus erfreuen. Wird das Gewächshaus auch im Winter genutzt, so sollte es nicht allzu weit vom Wohnhaus entfernt stehen. Besonders Gewächshäuser, die über die Heizung des Wohngebäudes mitversorgt werden sollen, platziert man nah an diesem, um die Energieverluste möglichst gering zu halten.
Ein anderer wichtiger Gesichtspunkt für die Standortwahl ist die Lichtversorgung der Gewächshauspflanzen. Die meisten der im Gewächshaus kultivierten Pflanzen benötigen viel Licht. Sie stammen zum großen Teil aus Gebieten mit ganzjährig hoher Lichteinstrahlung. Bei uns dagegen ist das Winterhalbjahr geprägt durch niedrige Einstrahlung und tiefen Sonnenstand. Ein Teil des Lichtes geht zudem durch die Gewächshaus-Eindeckung und winterliche Isolierungsmaßnahmen verloren. Aus diesen Gründen ist für das Gewächshaus in der Regel ein Platz frei von Beschattung durch Bäume oder Wohnhaus zu wählen. Nur wenn ausschließlich Schatten liebende Pflanzen kultiviert werden, kann die Aufstellung im lichten Schatten von Laubbäumen sinnvoll sein. Ihr Schattenwurf schützt im Sommer vor zu starker Sonneneinstrahlung und sorgt für ausgeglichene Temperaturen. Im Winter dagegen ist die Beschattung durch das fehlende Laub nur gering.
Die Lichtausbeute der Pflanzen im Gewächshaus wird außerdem durch die Dachneigung und die Aufstellungsrichtung des Gewächshauses bestimmt. Ein Teil des Lichtes, das auf das Gewächshaus trifft, wird reflektiert. Je flacher der Einfallwinkel ist, desto mehr Licht wird reflektiert. Bei senkrechtem Einfall (Winkel von 90°) der Lichtstrahlen auf Glas sind das beispielsweise nur 10 % des Lichtes, bei 10° (flacher Einfallwinkel) bereits über 50 %. Im Sommer spielt das zwar kaum eine Rolle, im Winter, wenn die Strahlungsintensität niedrig ist, aber sehr wohl. Da die Sonne im Winter bei uns in Mitteleuropa tief steht, reflektiert ein steiles Gewächshausdach weniger Licht als ein Flachdach.
Für eine möglichst hohe Lichtausbeute in der lichtarmen Jahreszeit wird das Gewächshaus am besten in Ost-West-Richtung aufgestellt, damit die Dachseite zur Sonne hin geneigt ist. Ein Gewächshaus mit einer Dachneigung von 30° hat bei einer Ost-West-Aufstellung eine etwa 12 % höhere Lichtausbeute im Winter als ein Gewächshaus in Nord-Süd-Aufstellung. Mehr Licht im Gewächshaus führt auch zu einem stärkeren Gewächshauseffekt, das heißt, je mehr Licht ins Gewächshaus dringt, desto besser erwärmt es sich alleine durch die Sonne.
Der Lichtbedarf der Pflanzen ist unter anderem temperaturabhängig. Je wärmer es ist, desto mehr Licht benötigen Pflanzen, sonst werden sie langbeinig und schwach. Geheizte Gewächshäuser, die man auch im Winter nutzt, sollte man daher am besten in Ost-West-Richtung aufstellen. Bei unbeheizten Gewächshäusern (z. B. für den Gemüsebau von März bis November) hat sich aber auch die Nord-Süd-Aufstellung bewährt. Diese Aufstellungsrichtung hat außerdem den Vorteil, dass sich das Gewächshaus im Sommer mittags weniger schnell „überhitzt“.
Anlehngewächshäuser und Wintergärten werden am besten an die Südseite des Wohnhauses gebaut. Weniger günstig, aber doch einigermaßen geeignet sind die Ost- und die Westseite. Die Nordseite ist nicht zu empfehlen, weil hier ganzjährig Vollschatten herrscht.
Das Gelände, auf dem das Gewächshaus errichtet wird, sollte möglichst eben sein, ansonsten muss es in diesem Bereich eingeebnet werden. Außerdem ist zu beachten, dass der Grundwasserspiegel am besten unter 1,50 m liegt, damit das Fundament nicht feucht wird. Stark windexponierte Standorte sollte man nach Möglichkeit vermeiden, da hier die Wärmeverluste und damit die Heizkosten höher sind.
Bevor man sich endgültig für ein Gewächshaus entscheidet, legt man seine Größe, Form und Position mithilfe einer Schnur im Garten aus. Mit Pflanzstäben oder Ähnlichem stellt man die Höhe dar. Wenn alle Kriterien berücksichtigt wurden und der Standort gefällt, hat man den richtigen Platz für das Gewächshaus gefunden.
Behördliche Auflagen
In Deutschland gibt es keine bundesweit einheitliche Genehmigungspflicht bzw. Genehmigungsfreiheit von Hobbygewächshäusern, da das Bauordnungsrecht in der Kompetenz der Bundesländer liegt. Man findet die Vorschriften in den jeweiligen Landesbauordnungen (LBO). Meist sind die angebotenen Kleingewächshäuser nicht genehmigungspflichtig, Wintergärten und Gewächshäuser, die über einen Aufenthaltsraum oder eine Feuerstelle verfügen, dagegen schon. Zuverlässige Auskunft erhält man bei der zuständigen Genehmigungsbehörde (Stadtbauamt, Bauamt des Landratsamts, Servicezentrum des Referats für Stadtplanung und Bauordnung etc.). Ist das Bauvorhaben genehmigungspflichtig, erhält man dort auch gleich Auskunft, welche Unterlagen benötigt werden. Einige Wintergartenanbieter kümmern sich auf Wunsch selbst oder über einen Vertragsarchitekten um den Bauantrag.
Aber auch bei der Aufstellung genehmigungsfreier Konstruktionen sind Baulinien und Grenzabstände einzuhalten und es müssen unter Umständen Bestimmungen des Denkmalschutzes beachtet werden. Will man ein Kleingewächshaus in einer Kleingartenanlage aufstellen, muss man sich außerdem nach deren Satzung richten, genauso wie man in der Regel die Erlaubnis der Eigentümergemeinschaft einholen muss, wenn man als Besitzer einer Eigentumswohnung ein Gewächshaus im gemeinsamen Garten, auf dem Garagendach oder auf der Terrasse aufstellen will. In den meisten Fällen empfiehlt es sich zudem, den Nachbarn bereits in der Planungsphase über das Vorhaben zu informieren, damit sich dieser von der Veränderung seines „Blickfeldes“ nicht überrumpelt fühlt. Viele Streitigkeiten lassen sich durch ein Gespräch vorab vermeiden.
Das Gewächshaus, seine Ausstattung und spezielle Einrichtungen
Wie funktioniert ein Gewächshaus?
Das Gewächshaus ist ein Haus für Pflanzen. Hier sollen sie sich wohlfühlen und besonders gut wachsen und gedeihen. Ein Gewächshaus bietet Schutz vor Wind und Niederschlägen. Es ist ein Kulturraum, in dem mit der entsprechenden technischen Ausstattung beinahe jedes gewünschte Klima geschaffen werden kann. Licht ist die Grundvoraussetzung für Leben und Wachstum von Pflanzen. Daher sind Gewächshäuser mit einem lichtdurchlässigen Material eingedeckt.
Selbst im ungeheizten Gewächshaus herrschen gegenüber dem Freiland höhere Temperaturen. Das ist auf den Gewächshauseffekt zurückzuführen: Das lichtdurchlässige Eindeckungsmaterial lässt das aus vorwiegend kurzwelliger Strahlung bestehende Sonnenlicht hindurch. Trifft es auf den Boden, die Pflanzen oder Einrichtungsgegenstände, wird ein Teil dieser Strahlung absorbiert und in Wärme umgewandelt. Von den erwärmten Flächen geht dann eine langwellige, für uns nicht sichtbare Wärmestrahlung aus, für die die Gewächshaushülle (Glas etc.) nicht mehr durchlässig ist. Durch diese Umwandlung von kurzwelliger Sonnenstrahlung zu langwelliger Wärmestrahlung, funktioniert ein Gewächshaus also wie ein thermischer Sonnenkollektor.
Wärme wird aber nicht nur als Wärmestrahlung übertragen, sondern auch durch Wärmeleitung. Dies ist der „Wärmefluss“ innerhalb einer Materie von der wärmeren zur kälteren Seite. Dieser erfolgt so lange, bis beide Seiten die gleiche Temperatur haben. Dieser Vorgang findet beispielsweise im Eindeckungsmaterial statt. Von der wärmeren Innenseite des Glases „fließt“ die Wärme zur kälteren Außenseite.
Konvektion ist in diesem Zusammenhang die Wärmeabgabe von einer Materie an die Luft. Im Gewächshaus geben die von den Sonnenstrahlen erwärmten Flächen Wärme durch Konvektion an die Umgebungsluft ab. Die Temperatur der Gewächshausluft steigt dadurch an. Bei geschlossener Lüftung kann die so erwärmte, aufsteigende Luft nicht entweichen und heizt das Gewächshaus zusätzlich auf.
Das Gewächshausgebäude gibt nach außen auch Wärme durch Konvektion ab, wobei das Eindeckungsmaterial und die Konstruktion Wärme von innen nach außen nachleiten. Verschiedene Materialien lassen die Wärme unterschiedlich stark abfließen. Des Weiteren wird Wärme über die Lüftung, Undichtigkeiten des Gewächshauses und seitlich über den Boden verloren.
Bei starker Sonneneinstrahlung kann sich ein Gewächshaus durch den Gewächshauseffekt sehr aufheizen. Die Temperatur kann in einem geschlossenen Gewächshaus im Sommer unter Umständen so stark ansteigen, dass Pflanzenschäden möglich sind. Überschüssige Wärme wird durch Öffnen der Lüftungsklappen und Türen abgeführt. Reicht das nicht aus, kann zusätzlich schattiert werden, damit weniger Sonnenlicht in das Gewächshaus dringt und in Wärme umgewandelt wird.
Nachts dagegen kühlt das Gewächshaus ab. Im unbeheizten Gewächshaus ist es dann nur wenige Grade wärmer als draußen. Wärmebedürftigen Pflanzen ist es im Winter im unbeheizten Gewächshaus zu kalt. Für sie muss das Gewächshaus mit einer Heizung ausgestattet werden, um die benötigten Temperaturen schaffen zu können. Je nach Temperierung können Energieaufwand und damit auch die Heizkosten sehr hoch sein – vor allem, wenn man ein Gewächshaus mit hoher Wärmedurchlässigkeit hat.
Das Gewächshausklima steht immer in einer Wechselbeziehung zum Außenklima. Je mehr das Gewächshausklima von diesem abweichen soll, desto mehr Technik und Energieeinsatz ist notwendig und desto höher sind die Kosten für das Gewächshaus, seine Ausstattung und für den Betrieb.
Bauweisen, Bauformen, Gewächshaustypen
Bei der Bauweise wird die Stabilbauweise von der Leichtbauweise unterschieden. Gewächshäuser in Leichtbauweise sind nicht dauerhaft an einen bestimmten Platz gebunden. Es sind meist einfache, leichtere Konstruktionen, die ohne allzu viel Aufwand auf- und abgebaut werden können. Dazu gehören die meisten Foliengewächshäuser oder Eigenkonstruktionen aus folienbespannten Rahmen oder Frühbeetfenstern. Wegen ihres meist schlechteren Wärmehaltevermögens eignen sie sich jedoch eher als Kalthäuser (ungeheizt oder gerade frostfrei geheizt, wenn sie entsprechend isoliert werden).
Gewächshäuser in Stabilbauweise dagegen verbleiben in der Regel dauerhaft an dem einmal gewählten Platz. Sie haben stabilere, stärkere Konstruktionen und werden auf ein solides Fundament gesetzt. Sie sind „dichter“ als solche in Leichtbauweise und lassen sich gut mit technischem Zubehör ausstatten. Die Stabilbauweise ist besonders für Gewächshäuser zu empfehlen, die man im Winter beheizen möchte.
Welches Gewächshaus sich für welchen Garten eignet, hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der späteren Nutzungsart ab.
1First
2Türe
3Dachfenster
4automatischer Fensteröffner
5Außenschattierung
6Luftbefeuchter
7Umluftventilator
8Stellwandfenster
9Eindeckungsmaterial
10Tropfbewässerungsanlage
11Düngerbeimischer
12Gießgerät
13Gießwasser-Pumpautomat
14Erdthermometer
15Bodenheizkabel
16Betonplattenweg
17Fundament
18Konstruktion
19Rippenrohrheizung
20Gewächshaustisch
21Vermehrungsbeet
22Zusatzbelichtung
23Einbauventilator zur Zwangsent- und -belüftung
24Arbeitsbeleuchtung
25Traufenhöhe mit Dachrinne
Das frei stehende Gewächshaus
Ein frei stehendes, rechteckiges Gewächshaus ist durch 2 Stehwände, die durch 2 Giebelseiten verbunden sind, gekennzeichnet. Giebel, Dach und Stehwände sind mit einem lichtdurchlässigen Material eingedeckt, sodass das Licht von allen Seiten ins Gewächshaus dringen kann. Nachteilig ist die vergleichsweise hohe Wärmedurchlässigkeit in alle Richtungen. Wird auf Tischen kultiviert, wie das bei kleinen Kakteen, Alpinpflanzen und Ähnlichem üblich ist, kann das Fundament bis zur Tischhöhe hochgezogen werden. Der Vorteil ist eine geringere Wärmedurchlässigkeit der Stehwände, ohne dass dies den Lichtgenuss der Pflanzen auf den Tischen beeinträchtigt. Ist die Gewächshauswand jedoch bis zum Boden lichtdurchlässig, so können unter den Tischen Pflanzen aufgestellt werden, die einen geringeren Lichtbedarf haben.
Die gebräuchlichste Dachform für ein frei stehendes Gewächshaus mit rechteckigem Grundriss ist ein gleichschenkeliges Satteldach, jedoch gibt es auch solche, bei denen eine Dachseite bis zum Boden heruntergezogen ist. Das Dach sollte an dieser Seite von außen zu öffnen sein, um bequemen Zugang zu den Pflanzen unter der Dachschräge zu haben.
Neben der eingiebeligen Bauweise gibt es bei größeren Gewächshäusern auch sogenannte Blockbauten (Reihenhäuser) mit und ohne Trennwände. Gegenüber mehreren, kleinen Einzelgewächshäusern haben sie einen geringeren Heizbedarf, sind dafür jedoch häufig schlechter zu lüften.
Zunehmend sind auch runde oder ovale Pavillongewächshäuser mit manchmal türmchenähnlichen Dächern erhältlich. Ihr Grundriss ist 6- bis 24-eckig, und sie lassen sich zum Teil „wabenartig“ zusammenstellen. In einem größeren Garten kann ein Pavillongewächshaus ein attraktiver Blickfang sein. Im Prinzip kann es wie jedes andere Gewächshaus genutzt werden, wenn auch der Gemüseanbau im Pavillongewächshaus unüblich ist. Eher wird es mit dekorativen Pflanzen ausgestattet und als Gartenpavillon oder „Wohngarten“ genutzt. Mit der richtigen Ausstattung eignet es sich auch als Voliere oder Terrarium.
Frei stehende Foliengewächshäuser mit rechteckigem Grundriss haben oft ein tunnelartiges oder ein „gotisches“ Dach, das „nahtlos“ in die Seitenwände übergeht. Die Folie ist in diesem Fall wie bei einem Zelt über gebogene Stahlrohre gespannt.
Frei stehende Gewächshäuser gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen und für alle Nutzungsarten. Gegenüber Erdhäusern und Anlehngewächshäusern haben sie einen höheren Heizbedarf, was wiederum durch die Wahl besser isolierender Konstruktions- und Eindeckungsmaterialien ausgeglichen werden kann.
Das Erdhaus
Ein Erdhaus bzw. Erdgewächshaus ist im Grunde genommen ein frei stehendes, begehbares Gewächshaus, bei dem allerdings nur das Dach mit einer niedrigen Stehwand über die Erdoberfläche herausragt. Ins Gewächshausinnere gelangt man über eine Treppe.
Ein Erdhaus hat geringere Wärmeverluste als ein ebenerdiges, frei stehendes Gewächshaus, da der umgebende Boden als isolierendes Polster wirkt. Es eignet sich jedoch eher für die Kultur klein bleibender Pflanzen, die auf Tischen aufgestellt oder in Tischbeeten angebaut werden. Erdhäuser sind besonders als Alpinen- und Kakteenhäuser beliebt, da man nur wenig heizen muss, um sie frostfrei zu halten. Aber auch klein bleibende Gemüse wie Kopfsalat, Radieschen oder Ähnliches kann man auf Tisch- oder Hochbeeten in Erdhäusern kultivieren. In Erdhäusern ohne Tische ist es möglich, Kübelpflanzen zu überwintern oder im Herbst und Winter Gemüse zu lagern.
Ein Erdhaus verändert das „Gesicht“ des Gartens weniger als ein ebenerdiges Gewächshaus. Es versperrt nicht so sehr die Aussicht und lässt sich leichter harmonisch in das Gelände einfügen. Erdhäuser sind in der Anschaffung und hinsichtlich der Betriebskosten (Heizung) in der Regel preisgünstiger als ebenerdige, frei stehende Gewächshäuser. Auch sogenannte passivsolare Gewächshäuser (siehe Kapitel „Die Temperierung“) werden oft als Erdgewächshaus konzipiert.
Das Anlehngewächshaus
Anlehngewächshäuser werden mit einer Seite an einer Wohnhaus- oder Garagenwand befestigt. Sie stehen am besten auf der Südseite oder, falls dies nicht möglich ist, an der Ost- oder Westseite des Gebäudes oder der Mauer, an der sie angebracht werden. Anlehngewächshäuser sind meistens Häuser mit einem Pultdach. Aber auch Satteldachgewächshäuser können giebelseitig an eine Wand gebaut werden.
Anlehngewächshäuser erwärmen sich schneller und halten die Wärme besser als frei stehende Gewächshäuser. Das ist im Winterhalbjahr ein Vorteil, kann aber im Sommer ohne Schattierung problematisch sein. Sie sind in der Regel preisgünstiger als frei stehende Gewächshäuser.
Anlehngewächshäuser gibt es für alle Ansprüche, vom einfachen Folienanlehngewächshaus bis zur Konstruktion aus thermisch trennenden Kunstoffprofilen mit Stahlkern und einer Eindeckung mit 24 mm Wärmeschutzglas bzw. 32 mm Plexiglas Resist 4-Fach-Stegplatte.
Der Wintergarten
Im Prinzip ist auch der Wintergarten ein Anlehngewächshaus, bei dem jedoch das Wohnen mit Pflanzen im Vordergrund steht.
Ein Wintergarten soll das Wohnhaus erweitern und verschönern und muss daher höchsten Ansprüchen hinsichtlich Aussehen und Klimatisierung gerecht werden.
Auch im Wintergarten wirkt sich der Gewächshauseffekt aus: Sonnenlicht wird in Wärme umgewandelt, wovon zusätzlich das Wohnhaus profitieren kann. Ein Wintergarten ermöglicht selbst im Winter, wenn draußen noch alle Pflanzen ohne Laub dastehen, ein gemütliches Sonntagsfrühstück auf der Terrasse inmitten üppiger Pflanzen. An einem sonnigen Tag kann das Thermometer im Wintergarten bei –5 °C Außentemperatur auch ohne Heizung bis auf 25 °C klettern. Bei trübem Wetter und vor allem nachts werden diese Temperaturen jedoch nicht erreicht. Um den Wintergarten frostfrei zu halten, muss er in der Regel beheizt werden. Will man den Wintergarten ganzjährig wie ein Wohnhauszimmer benutzen können, muss seine Temperatur dementsprechend auf etwa 18 °C gehalten werden.
Damit die Wärmeverluste, besonders nachts, möglichst gering sind, werden beheizte Wintergärten mit sehr gut isolierenden Konstruktionsprofilen und Eindeckungsmaterialien gebaut.
Bei der Klimatisierung des Wintergartens wird häufig vergessen, dass er nicht nur eine überdachte Terrasse ist, die man ab und zu nutzt, sondern auch Pflanzenhaus. Wenn man Pflanzen aufgestellt hat, kann man nicht bei –15 °C Außentemperatur die Heizung des Wintergartens abschalten, weil man selbst in den Winterurlaub fährt. Genauso wenig dürfen an einem sonnigen Sommertag alle Lüftungsklappen geschlossen bleiben, wenn man über das Wochenende verreist. Eine Automatisierung der Lüftung, Schattierung und Heizung erleichtert die pflanzengerechte Temperierung. Das gilt nicht nur für Wintergärten, sondern für alle Gewächshäuser.
Pflanzen für den Wintergarten
Deutscher Name /Botanischer Name
Blütenfarbe
Wuchs
Sonstiges / Besonderheiten
Wintertemperatur 2 bis 10 °C
Schönmalve
Abutilon
-Hybriden
weiß, rot, orange, gelb
strauchförmig, hoch wachsend
Dauerblüher
Schmucklilie
Agapanthus
-Arten
weiß, blau
50–150 cm hoch
Hauptblüte im Sommer
Agave
Agave
-Arten
weiß
Rosette aus dickfleischigen Blättern
anspruchslos, blüht erst nach vielen Jahren und stirbt dann ab
Akazie
Acacia
-Arten
gelb
strauch- oder baumförmig
Hauptblüte von Winter bis Frühjahr
Erdbeerbaum
Arbutus unedo
weiß, rosa
strauch- oder baumförmig
Herbst- / Winterblüher, danach auffällige rote Früchte, immergrün
Aukube
Aucuba japonica
rot bis lila
Strauch
Frühlingsblüher, auch Fruchtschmuck durch rote Beeren, immergrün
Bougainvillea
Bougainvillea glabra
rosa, rot, lila, orange oder gelb gefärbte Hochblätter
Kletterpflanze
Sommerblüher, Temperatur nicht unter 5 °C
Engelstrompete
Brugmansia
-Arten
weiß, gelb, orange, rosa
strauchartig
Sommerblüher, sehr große glockenartige Blüten
Zylinderputzer
Callistemon
-Arten
rot, gelb
strauch- oder baumförmig
Frühjahr- bis Sommerblüher
Kamelie
Camellia japonica
weiß, rosa, rot
strauch- oder baumförmig
Winterblüher, meist immergrün
Hottentottenfeige
Carpobrotus
-Arten
rosa
sukkulenter Bodendecker
blüht bei uns selten
Gewürzrinde
Senna corymbosa
(Syn.
Cassia corymbosa
)
gelb
Strauch
Herbstblüher, nahezu immergrün
Hammerstrauch
Cestrum aurantiacum
orangegelb
Strauch oder Stämmchen
Hauptblüte im Winter
Zwergpalme
Chamaerops humilis
gelb
baum- oder strauchförmig
gelbe Früchte, immergrün
Zitrus
Citrus
-Arten
weiß
strauch- oder baumförmig
viele Arten, Frühjahr- / Sommerblüher, Früchte grün, gelb oder orange
Keulenlilie
Cordyline australis
weiß
strauch- oder baumförmig
immergrüner Frühjahrsblüher
Baumtomate, Tamarillo
Solanum betaceum
(Syn.
Cyphomandra betacea
)
weiß
baumförmig
Blüten duftend, Sommerblüher, Früchte rot, essbar
Eukalyptus
Eucalyptus citriodora
weiß
strauch- oder baumförmig
Sommerblüher, Blätter duften nach Zitronen, immergrün
Echte Feige
Ficus carica
kein Blütenschmuck
strauch- oder baumförmig
Feigen grün bis dunkellila
Fuchsien
Fuchsia
-Arten
rosa, violett, weiß und Kombinationen daraus
strauchförmig oder Stämmchen
Blütezeit von Sommer bis in den Winter
Silbereiche
Grevillea
-Arten
weiß, orange, rot
strauch- oder baumförmig
blüht von Frühling bis Herbst
Jasmin
Jasminum nitidum
weiß
Strauch
duftende Blüten im Frühling und Sommer
Wandelröschen
Lantana
-Arten
weiß, gelb, orange, rot, violett
Strauch, auch als Stämmchen
blüht von Sommer bis Spätherbst
Lorbeer
Laurus nobilis
gelblich
strauch- oder baumförmig
Frühjahrsblüher, die Früchte sind schwarz, immergrün
Mahonie
Mahonia
-Arten
gelb, orange
Strauch
Frühjahrsblüher
Japanische Faserbanane
Musa basjoo
grünlich
baumförmig wachsende Staude
bildet Bananen, die jedoch bei uns selten ausreifen
Oleander
Nerium oleander
rosa, weiß, rot, gelb
strauchförmig oder als Stämmchen
blüht von Frühjahr bis Herbst, immergrün
Olive
Olea europaea
gelblich
kleinkroniger Baum
Sommerblüher, Früchte grün, später violett bis schwarz, langsam wachsend, immergrün
Passionsblume
Passiflora caerulea
cremeweiß
Kletterpflanze
blüht von Sommer bis Herbst
Dattelpalme
Phoenix canariensis
gelb
baumförmig
blüht von Spätwinter bis Sommer, orangefarbene Früchte
Bleiwurz
Plumbago auriculata
blau, weiß
strauchförmig oder als Stämmchen
blüht von Frühsommer bis Herbst
Granatapfel
Punica granatum
orangerot bis hellgelb
strauch- oder baumförmig
Sommerblüher, Früchte orangerot
Rosmarin
Rosmarinus officinalis
hellblau bis violett
strauchförmig oder kriechend
blüht von Spätwinter bis Frühling. Die Sorte ‘Repens’ ist ein Bodendecker.
Kapgeißblatt
Tecomaria capensis
orangerot
strauchförmig, Stämmchen, als Spalierpflanze
blüht vom Sommer bis Winter sehr auffällig
Veilchenbaum
Tibouchina urvilleana
violett
strauch- oder baumförmig
blüht von August bis Winter
Wintertemperatur 10 bis 15 °C
Seidenpflanze
Asclepias curassavica
orange bis rot
Kleinstrauch
Frühjahr- und Sommerblüher, fast immergrün
Orchideenbaum
Bauhinia
-Arten
rosa, violett, weiß
strauch- oder baumförmig
es gibt laubabwerfende und immergrüne Bauhinien
Bougainvillea
Bougainvillea
-Hybriden
in vielen Farben gefärbte Hochblätter
Kletterpflanze
größere Pflanzen benötigen eine Kletterhilfe
Puderquastenstrauch
Calliandra tweedii
rosa, weiß, rot
strauchförmig
nadelkissenähnliche Blüten von Sommer bis Herbst
Drachenbaum
Dracaena draco
weiß
baumartig
blüht erst nach vielen Jahren
Efeu
Hedera helix
weißlich
Kletterpflanze oder Bodendecker
ältere Pflanzen blühen ab September, die Früchte sind dunkellila
Gardenie
Gardenia jasminoides
weiß
strauchförmig
Sommerblüher, immergrün
Baumwollrose
Hibiscus mutabilis
rot, rosa, weiß
strauchartig
blüht von Sommer bis in den Herbst
Palisanderbaum
Jacaranda mimosifolia
blau
baumförmig
blüht im Frühjahr, schönes, gefiedertes Laub
Jakobinie
Jacobinia pauciflora
gelbrot
strauchförmig
blüht von Herbst bis Spätwinter
Yucca
Yucca
-Arten
weiß
baum- oder strauchartiger Wuchs
nur ältere Pflanzen blühen
Wintertemperatur über 15 °C
Goldtrompete
Allamanda
-Arten
gelb oder rosa
Schlingpflanze
blüht von Sommer bis Herbst, benötigt hohe Bodentemperatur
Cherimoya
Annona
-Arten
blassgrün
baum- oder stauchförmig
Fruchtgehölze. A.
cherimola
verträgt bis etwa 10 °C, A.
squamosa
besser über 18 °C
Brunfelsie
Brunfelsia
-Arten
weiß, purpurfarben
strauchförmig, aber klein
blüht ganzjährig
Papaya
Carica papaya
gelblich
baumartig
blüht im Sommer, bildet essbare Papaya-Früchte
Kerzenstrauch
Senna didymobotrya
(Syn.
Senna didymobotrya
)
gelb
strauchförmig
sehr dekorative Blütenstände von Sommer bis Herbst
Zypergras
Cyperus papyrus
grüne, gelbliche oder bräunliche Ähren
Gras
Zypergras wirkt wie ein Luftbefeuchter
Dieffenbachie
Dieffenbachia
-Hybriden
Grünliche Hochblätter mit hellem Kolben
krautig bis strauchartig
geschätzte Blattschmuckpflanze
Zierbanane
Ensete ventricosum
‘Maurelii’
rot
baumartig wachsende Staude
Ensete ventricosum
‘Maurelii’ hat rote Blattstiele und Blattunterseiten, bildet kleine Bananen
Benjamin / Gummibaum
Ficus
-Arten, die als Zimmerpflanzen angeboten werden
kein Blütenschmuck
baumartig
ältere Exemplare bilden ungenießbare Feigen
Ruhmeskrone
Gloriosa rothschildiana
rotgelb
Kletterpflanze
sehr attraktive Blüten, blüht im Sommer
Hibiskus
Hibiscus rosa-sinensis
weiß, rosa, rot, orange
strauchförmig
kann ganzjährig blühen
Wachsblume
Hoya
-Arten
weiß, rosa
Kletterpflanze, Hängepflanze
duftende Blüten von Frühjahr bis Herbst
Ixore
Ixora coccinea
leuchtend rot
strauchförmig
Frühjahr- und Sommerblüher, immergrün
Passionsfrucht
Passiflora edulis
weiß
Kletterpflanze
blüht im Sommer, ältere Pflanzen können etwas kühler stehen
Frangipani
Plumeria
-Arten
rosa oder weiß mit gelbem Zentrum
baumförmig oder strauchartig
die duftenden Blütenerscheinen bei uns meist im Sommer
Nach der geplanten Temperatureinstellung richtet sich die Pflanzenauswahl – oder umgekehrt. Am besten entscheidet man sich schon vor dem Kauf des Wintergartens, ob und wie hoch man ihn im Winter beheizen möchte, nicht zuletzt um eventuell Kosten einsparen zu können.
Sobald man die entsprechenden Pflanzen angeschafft hat, muss die Temperierung des Wintergartens konsequent durchgeführt werden. Hat man sich beispielsweise für einen gerade frostfreien Wintergarten entschieden und diesen mit den entsprechenden Pflanzen ausgestattet, dann muss im Winter mit Heizen, Lüften, Schattieren usw. dafür gesorgt werden, dass die Temperatur weder unter die Nullgradgrenze sinkt, noch allzuweit nach oben (möglichst nicht über 10 bis 15 °C) klettert. Hat man sich dagegen für einen zimmerwarmen Wintergarten entschieden und diesen mit Wärme liebenden Pflanzen bestückt, so muss die Temperatur ganzjährig über 16 bis 18 °C gehalten werden.
Wintergärten sollten mit großzügig bemessenen Türen und Lüftungsfenstern versehen sein, damit sie sich im Sommer nicht zu stark aufheizen. Auch außen angebrachte Markisen und andere Beschattungstechnik sorgen bei intensivem Sonnenschein für Schatten und moderate Temperaturen.
Balkongewächshaus, ausgebautes Blumenfenster, Pflanzenvitrine, Zimmergewächshaus
Balkongewächshäuser sind meistens kleine Anlehngewächshäuser mit Pultdach. Auch wer keinen Garten hat, muss also nicht auf ein Gewächshaus verzichten. Wie andere Gewächshäuser kann man sie abhängig von der Temperierung als Kalthaus, temperiertes Gewächshaus oder Warmhaus nutzen – wobei eine durchgehende Beheizung im Winter eher für größere Anlehngewächshäuser auf großen Balkons infrage kommt. In einem Balkongewächshaus kann man Kübelpflanzen oder Kübelobst überwintern, Jungpflanzen heranziehen, Kakteen überwintern und vieles mehr.
Auf einer „normalen“ Fensterbank hat man nur sehr beschränkte Möglichkeiten der Pflanzenkultur. Meist reicht der Platz nur für ein paar Topfpflanzen, denen das jeweilige Zimmerklima bekommt. Mehr Möglichkeiten eröffnet da ein ausgebautes Blumenfenster. Man unterscheidet zum Zimmer hin offene und geschlossene Blumenfenster.
Schon eine normale Fensterbank lässt sich ohne großen Aufwand verbreitern. Reicht das Licht im hinteren Bereich nicht aus, wird eine Pflanzenleuchte installiert. An so einem Platz in einem warmen Wohnraum lassen sich beispielsweise Aussaaten aufstellen oder Zimmerpflanzen unterbringen. Am Blumenfenster eines ungeheizten, aber frostfreien Raumes können Bonsai, Kakteen und kleine Kübelpflanzen überwintert werden.
Im Winter kann den Pflanzen die trockene Luft über der Heizung zu schaffen machen. Eine Möglichkeiten, die Luftfeuchte im Pflanzenbestand zu erhöhen, ist die Verwendung einer Fensterbankschale mit Gitterrost. Die Pflanzen stehen über dem Wasser, ohne nasse Füsse zu bekommen. Man kann ein Blumenfenster auch mit einem Pflanzkasten ausstatten. Dadurch wird eine höhere Luftfeuchtigkeit erreicht als bei der Pflanzung in Einzeltöpfe.
Im geschlossenen Blumenfenster kann je nach technischer Ausstattung das Klima beinahe unabhängig vom Wohnraumklima eingestellt werden. Sie werden meist mit einer Bodenheizung, Luftbefeuchter, Pflanzenlampen sowie Thermostat, Hygrostat und einer Schaltuhr für die Beleuchtung ausgestattet. Hier wird man in der Regel Pflanzen unterbringen, die hohe Ansprüche an die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit haben.
Die Bepflanzung des offenen und des geschlossenen Blumenfensters richtet sich nach der Himmelsrichtung des Fensters und ob es schattiert werden kann sowie nach der sonstigen technischen Ausstattung.
Eine Pflanzenvitrine ist im Grunde ein bewegliches, geschlossenes Blumenfenster mit den gleichen technischen Ausstattungsmöglichkeiten. Hat sie Rollen oder Räder, kann man sie ohne viel Kraftaufwand beliebig umstellen.
Da die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur in der Pflanzenvitrine unabhängig vom Raumklima eingestellt werden kann, wird sie gerne zur Bepflanzung mit ausgesprochenen Tropenpflanzen genutzt. Eine attraktiv gestaltete Pflanzenvitrine kann den Wohnraum oder den Wintergarten verschönern. Sie kann auch als Tropenkabine in einem Gewächshaus verwendet werden.
Sogenannte Zimmergewächshäuser sind meist recht klein und bieten nur wenigen Pflanzen Platz. Dafür sind sie aber sehr kunstvoll gestaltet. Sie dienen eher der Dekoration und sind kaum als Pflanzenkulturraum zu nutzen.
Die Bestandteile des Gewächshauses
Ein Gewächshaus besteht im Wesentlichen aus Fundament, Konstruktion und Eindeckungsmaterial. Diesbezüglich sind beim Kauf oder der eigenen Planung die schwierigsten Entscheidungen zu treffen. Will man sich späteren Ärger ersparen, sollte auch der Ausstattung mit Türen und Fenstern von vorneherein größte Beachtung geschenkt werden. Je nach Art, Größe und Nutzung des Gewächshauses müssen die Bestandteile unterschiedliche Ansprüche erfüllen. Gleichzeitig sollten sie miteinander ein harmonisches Ganzes bilden.
Das Fundament
Das Fundament ist der Unterbau des Gewächshauses, durch den es fest mit dem Untergrund verbunden wird. Wie beim Wohnhaus, so muss auch das Fundament eines Gewächshauses die Standsicherheit des Gebäudes gewährleisten. Es muss alle anfallenden Kräfte wie Eigenlast, Dachlast, Windsog und Winddruck aufnehmen können und das Gewächshaus einerseits vor dem Einsinken in das Erdreich und andererseits vor dem Abheben bewahren. Je nach Art des Fundamentes kann es außerdem als Schutz gegen Wärmeverluste über den Boden wirken.
Bei allen Fundamenten ist darauf zu achten, dass sie waagrecht verlaufen, was mit einer Wasserwaage kontrolliert werden sollte, bevor man die Gewächshauskonstruktion am Fundament befestigt.
Kein Fundament im eigentlichen Sinne benötigen kleine Folienhäuser in Leichtbauweise. Rohrkonstruktionen werden meist einfach in den Boden gesteckt und mit Erdankern aus (imprägniertem) Holz oder Metall zusätzlich gesichert. Ein einfacher Holzrahmen am Gewächshausgrund sorgt für einen dichten, optisch „sauberen“ Abschluss und verhindert das „Auseinanderdriften“ der Stehwände. Die Kombination von Holzrahmen und Erdanker wird auch als Holzrahmenfundament bezeichnet.
Größere Gewächshäuser und / oder Gewächshäuser mit schwereren Konstruktions- und Eindeckungsmaterialien benötigen ein entsprechend stabileres Fundament. Die gebräuchlichsten Fundamente für Kleingewächshäuser sind:
>Holzbalkenfundament
>Stahl- oder Aluminium-Fundamentrahmen mit Erdspornen
>Beton-Ringfundament (Streifenfundament)
>Beton-Punktfundament
Holzbalkenfundamente wurden früher häufig aus Eisenbahnschwellen hergestellt, was wegen der möglichen Belastung durch die für die Imprägnierung verwendeten Teeröle nicht zu empfehlen ist. Doch kann man geeignete Holzbalken im Holzfachhandel kaufen. Diese werden auf eine etwa 20 cm dicke, dränierende Kiesschicht in den Boden, dem Grundriss des Gewächshauses entsprechend, eingelassen, sodass oberirdisch nur noch ein Sockel verbleibt, auf den das Gewächshaus geschraubt wird. Auch die Holzbalken müssen miteinander fest und unverrückbar verbunden werden. Holzbalkenfundamente sollten zusätzlich mit Erdankern gesichert werden, da das Eigengewicht des Gewächshauses bei Stürmen nicht unbedingt ausreicht, das Gewächshaus am Boden zu halten. Holzbalkenfundamente sind kein tief gehendes, isolierendes Fundament, sondern eher als Sockel mit Erdankern anzusehen. Sie eignen sich gut für kleinere, unbeheizte oder nur frostfrei geheizte Gewächshäuser.
Von den Gewächshausanbietern gibt es häufig passend zum jeweiligen Gewächshaus Stahl- oder Aluminium-Fundamentrahmen mit Erdspornen. Beide Materialien sind nahezu unverrottbar. Die Erdsporne werden entweder direkt in den Boden eingesenkt oder einbetoniert (Beton-Punktfundament). An den Rahmen schraubt man später die Gewächshauskonstruktion. Auch Stahl- oder Aluminium-Fundamentrahmen sind keine tief gründenden, isolierende Fundamente. Sie eignen sich für kleinere, unbeheizte oder nur frostfrei gehaltene Gewächshäuser.
Ein sehr stabiles Fundament ist das Beton-Ringfundament, das unterhalb der gesamten Gewächshauswände verläuft. Beton-Ringfundamente haben den Vorteil, dass sie gleichzeitig auch als Isolierung gegen den Verlust von Bodenwärme zur Seite wirken. Außerdem werden Bodenschädlinge ferngehalten. Zur weiteren Isolierung können zusätzlich Dämmplatten an der Fundamentinnen- und / oder der Fundamentaußenwand angebracht werden. Den Montageanleitungen der Gewächshausbausätze liegt in der Regel ein Fundamentplan für ein Beton-Ringfundament bei, den man, wenn man das Gewächshaus auf ein Beton-Ringfundament setzen möchte, genau einhalten muss. Die Fundamentsohle sollte auf frostfreier Tiefe (80 bis 100 cm) liegen. 20 bis 30 cm Breite sind in der Regel für Kleingewächshaus-Fundamente ausreichend. Die Gewächshauskonstruktion wird entweder direkt auf das Fundament oder auf einen daraufgesetzten Sockel befestigt. Ein Beton-Ringfundament ist für größere Gewächshäuser sowie für temperierte Häuser und Warmhäuser zu empfehlen.
Ein Beton-Punktfundament ist nach dem Beton-Ringfundament die zweitstabilste Lösung, ein Gewächshaus kraftschlüssig zu verankern. Die Fundamentpunkte aus Beton werden an den Ecken und bei längeren Konstruktionen zusätzlich in die Mitte der Längsseiten gesetzt. Wie man Fundamente erstellt, wird im Kapitel „Ein Kleingewächshaus selber bauen“ beschrieben.
Mitunter werden Gewächshaus-Fundamente auch mit Ziegelsteinen gemauert oder mit Betonsteinen gebaut. Bei allen Ausführungen, die nicht bis in frostfreie Tiefe gründen, sollte unterhalb der Gründungssohle eine etwa 20 cm dicke, gerüttelte Kies-Dränageschicht eingebaut werden. Sie verhindert, dass das Fundament auffriert und das Gewächshaus dadurch instabil wird.
Die Konstruktion
Die Konstruktion bildet das Skelett des Gewächshauses oder Wintergartens. Sie gibt ihm die Form und hat die Aufgabe, alle auftretenden Kräfte und Lasten auf das Fundament zu übertragen sowie die jeweiligen Eindeckungsmaterialien aufzunehmen. Als Konstruktionsmaterialien kommen vorwiegend Holz, feuerverzinkter Stahl, Aluminium und Kunststoff mit Stahlkern zum Einsatz.
Holz ist ein gewachsenes, organisches Material, das auch nach längerer Trocknung und Lagerung unter Temperatur- und Witterungseinflüssen arbeitet. Als Folge davon können Undichtigkeiten oder Glasbrüche durch Zwängung auftreten. Ein weiterer Nachteil von Holz ist, dass es von Fäulnis, Pilzen und Schädlingen befallen werden kann. Um Holz in der relativ feuchten Gewächshausluft davor zu schützen, kann es mit pflanzenverträglichen Mitteln imprägniert werden. Diese Maßnahme muss alle paar Jahre wiederholt werden, weshalb eine Holzkonstruktion relativ pflegeintensiv sein kann. Andererseits kann Holz je nach Holzart ein günstiges Konstruktionsmaterial sein und wird gerne für Eigenbau-Gewächshäuser mit Folien verwendet. Wegen seiner optisch ansprechenden Wirkung und der traditionellen Verwendung im Hausbau wird Holz auch gerne für Wintergartenkonstruktionen, für Sonderanfertigungen und für nostalgische Gewächshäuser genutzt. Für hochwertige Konstruktionen wird entsprechend verarbeitetes Kernholz in massiveren Stärken verwendet.
Feuerverzinkter Stahl ist ein altbewährtes, inzwischen aber weniger gebräuchliches Konstruktionsmaterial für Kleingewächshäuser. Die fertig bearbeiteten Stahlprofile werden in ein Zinkbad getaucht und dadurch mit einer porenfreien, korrosionsbeständigen Zinkschicht überzogen. Nachträgliche Bohrungen und Bearbeitungen verletzen diese Schutzschicht. Die dabei entstehenden blanken Stahlflächen sollten mit Zinkstaubfarbe versiegelt werden. Diese Zinkstaubanstrichmittel enthalten etwa 96 % Zinkpulver und lassen sich gut mit einem Pinsel auftragen oder spritzen. Aus Stahl lassen sich nur relativ einfache Profile fertigen, die zwar ausreichende Stabilität gewährleisten, aber ein hohes Eigengewicht haben.
Aluminium ist derzeit das meist verwendete Material für Kleingewächshauskonstruktionen. Es reagiert mit dem Sauerstoff der Luft und bildet eine witterungsbeständige Schutzschicht an der Oberfläche. Auch bei nachträglichen Bohrungen und Bearbeitungen wird dieser Korrosionsschutz selbsttätig aufgebaut. Aluminiumprofile sind leicht, was ein Vorteil bei Transport und Handhabung ist. Aus Aluminium lassen sich wesentlich aufwendigere Konstruktionsprofile unter dem Gesichtspunkt der optimalen Wärmedämmung und Stabilität fertigen.
Da Metalle eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzen, stellen die Konstruktionselemente eine permanente Wärmebrücke dar. Um diese Wärmeverluste zu minimieren, werden im Gewächshaus- und Wintergartenbau auch sogenannte thermisch getrennte Profile eingesetzt: Zwischen dem nach innen gerichteten und dem nach außen weisenden Teil des Profils ist ein weniger wärmedurchlässiger Kunststoffsteg eingebaut, der den Wärmefluss von innen nach außen verringert. Aluminiumprofile werden nicht nur in „natur“, sondern auch eloxiert oder in RAL-Farben pulverbeschichtet angeboten. Aluminium ohne besondere Behandlung wird unter Witterungseinflüssen rau und verfärbt sich zu einem stumpfen Grau. Das Eloxalverfahren (Elektrolytische Oxidation des Aluminiums) verstärkt und verbessert den Oberflächenschutz, wobei die Oxidschicht häufig gleichzeitig eingefärbt wird. Eloxierte Aluminiumteile behalten ihre glatte, glänzende Oberfläche. Bei der Pulverbeschichtung werden farbige Kunststoffpulver auf das Metall aufgebracht und durch Wärmeeinwirkung aufgeschmolzen.
Beim Vergleich der Angebote verschiedener Gewächshausfirmen sollten außer den Materialien auch die Verarbeitung, Materialstärken, Herstellergarantien und Ähnliches berücksichtigt werden.
Kunststoff bietet keine Kältebrücke. Für hochwertige Gewächshäuser gibt es UV-beständige Kunststoffprofile mit einem innenliegenden Stahlkern.
1thermisch getrenntes Profil
2Firstprofil
3Pfostenprofil mit Glasklemmhalterung (links: 2-Scheiben-Verglasung, rechts: Isolierverglasung)
4Pfostenprofil mit Einfachverglasung
Die Eindeckung
Die Eindeckung stellt die trennende „Haut“ zwischen Gewächshausinnerem und Umgebung dar. Sie soll einerseits Licht hindurchlassen und andererseits vor Wärmeverlusten schützen. Die verschiedenen Eindeckungsmaterialien sind unterschiedlich durchlässig für Licht und für die UV-Strahlung. Eine Maßzahl für den Wärmedurchgang eines Materials ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient, früher k-Wert). Je größer der U-Wert, desto schlechter ist das Wärmedämmvermögen. Der U-Wert ist wichtig für die Berechnung der Heizung.
Darüber hinaus wird von der Eindeckung eine gewisse mechanische Festigkeit verlangt, d. h., sie soll einen Ballwurf oder einen Hagelschauer möglichst unbeschadet überstehen. Ein weiteres Auswahlkriterium ist außerdem die Beständigkeit des Materials. Hier sind beim Vergleich auch die Herstellergarantien zu berücksichtigen.
Für die Eindeckung von Kleingewächshäusern kommen vor allem Glas, Kunststoffplatten (Stegplatten / Hohlkammerplatten) sowie Folien infrage. Sie werden einzeln oder kombiniert verwendet.
Glas
Glas ist das klassische Eindeckungsmaterial für Gewächshäuser. Es ist bis zu 93 % lichtdurchlässig und hat bei einer Dicke von 3 mm einen U-Wert von etwa 6. Glas für Gewächshäuser wird als Gartenblankglas (Flachglas, Fensterglas) oder als Gartenklarglas (Gussglas, einseitig genörpelt) in verschiedenen Stärken angeboten. Gartenklarglas lässt durch die Nörpelung ein diffuses, weicheres Licht in das Gewächshaus einfallen, was ein „Verbrennen“ des Pflanzengewebes bei starker Sonneneinstrahlung verhindert. Die Nörpelung wird immer nach innen verlegt. Wer die Vorteile beider Glassorten ausnützen möchte, deckt die Dachflächen mit dem genörpelten Gartenklarglas und die Seiten- und Giebelwände mit Gartenblankglas ein.
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ist ein besonders behandeltes Glas und besitzt eine höhere Schlag- und Stoßfestigkeit. Falls es zu Bruch geht, zerfällt es in Glaskrümel. Es wird für die Gewächshausverglasung zum Beispiel in 4 mm Stärke angeboten (30 % UV-Durchlässigkeit, 89 % Lichtdurchlässigkeitf, U-Wert 5,9 W/m2K).
Wesentlich energiesparender als eine Einfachverglasung ist die Doppelverglasung. Noch besser als die „normale“ Doppelverglasung ist die Isolierverglasung: Zwei oder mehr Glasscheiben werden rundum so verschweißt oder verklebt, dass ein Zwischenraum entsteht, der mit Luft oder einem Gas gefüllt wird. Isolierglas gibt es in vielen verschiedenen Variationen. Eine davon ist Wärmeschutzglas, welches einen besonders kleinen U-Wert hat.
Ein Nachteil von Glas ist sein hohes Gewicht, was stabilere und teurere Konstruktionen erforderlich macht. Insbesondere bei Doppelverglasungen und Isolierverglasungen ist dies von Bedeutung, da die Flächenlast sich in diesem Fall gegenüber der Einfachverglasung noch einmal verdoppelt.
Hartkunststoff
Gewächshäuser mit einer Eindeckung aus Hartkunststoff sind im Hobbygarten inzwischen sehr verbreitet. Meist sind es Hohlkammerplatten (Stegplatten) aus Polycarbonat (Macrolon, Lexan) oder Acrylglas (Plexiglas).
Acrylglas wird im Kleingewächshausbau vor allem als Plexiglas Alltop (91 % Lichtdurchlässigkeit, UV-durchlässig) oder Plexiglas Resist (86 % Lichtdurchlässigkeit, nicht UV-durchlässig) verwendet. Die UV-Durchlässigkeit von Plexiglas Alltop ermöglicht Wachstumsbedingungen ähnlich wie im Freiland: Der Wuchs ist natürlicher, die Farbentwicklung der Blüten und der Geschmack der Früchte intensiver.
Der Vorteil von Hartkunststoff-Eindeckungen liegt in ihrem guten Wärmedämmverhalten und dem geringen Materialgewicht bei hoher Eigenfestigkeit. Die Schlagzähigkeit dieser Materialien, speziell des Polycarbonats, macht sie hagelsicherer. Selbst große Hagelkörner durchschlagen fast nie beide Schichten der Stegdoppelplatten. Nach dem Hagelschlag müssen zwar die Scheiben ausgewechselt bzw. repariert werden, aber die Pflanzen im Gewächshaus bleiben unversehrt. Hartkunststoffplatten sind heutzutage weitgehend UV-beständig, spezielle Beschichtungen verhindern das „Altern“. Diese vom Hersteller in der Regel mit einer Garantie versehenen Produkte sind meist mit dem Zusatz „LONGLIFE“ gekennzeichnet. Die sogenannte „NO DROP-Beschichtung“ verhindert die Tropfenbildung durch Schwitzwasser auf der nach innen gerichteten Seite der Eindeckung. Das Wasser fließt als dünner Film an der Oberfläche der Kunststoffplatten ab und tropft nicht auf die Pflanzen, was ansonsten bei starker Sonneneinstrahlung zu Verbrennungen führen könnte.
Leider sind viele Stegplatten durch ihren Aufbau weniger durchsichtig als Glas, man wird also, wo es auf freie Durchsicht ankommt, auf Isoliergläser oder Stegdoppelplatten mit großem Stegabstand aus Polyacryl (Plexiglas Alltop) zurückgreifen müssen. Es ist auch eine kombinierte Eindeckung aus Glas (z. B. für die Stehwände) und Kunststoffplatten (z. B. für die Bedachung) möglich.
Der Preis von Hohlkammerplatten liegt in der Regel deutlich über dem von Gartenblank- und Gartenklarglas, aber unter dem von Isolierglas. Hohlkammerplatten und Isolierglas sind besonders für beheizte Gewächshäuser zu empfehlen, wo sie Energie einsparen helfen und dadurch die Heizkosten senken.
U-Werte in W/m2K verschiedener Eindeckungsmaterialien(Beispiele)
Luftpolsterfolie H 30
8 mm
3,0
Einfaches Blankglas
3 mm
6
ESG
4 mm
5,9
Beschichtetes Glas (Hortiplus oder K-Glas)
4 mm
3,7
Beschichtetes ESG (HortiplusN oder ESG-K-Glas)
4 mm
3,7
Doppel-Blankglas
16 mm
3
Isolierglas
14 mm
2
Wärmeschutzglas
24 mm
1,1
Polycarbonat, Stegdoppelplatte
6 mm
3,5
Polycarbonat, Stegdoppelplatte
8 mm
3,3
Polycarbonat, Stegdreifachplatte
10 mm
2,8
Polycarbonat, Stegdreifachplatte
16 mm
2,3
Polycarbonat, Stegfünffachplatte
16 mm
1,9
Acrylglas (Plexiglas Alltop), Stegdoppelplatte
16 mm
2,4
Acrylglas (Plexiglas Resist), Stegvierfachplatte
32 mm
1,6
Die in der Tabelle angegebenen Werte sind den Katalogen verschiedener Gewächshausanbieter entnommen (Liste im Serviceteil).
Die Luftfeuchte ist in Gewächshäusern mit Hohlkammerplatten- und Isolierglas-Eindeckung höher als in einfach eingedeckten Häusern, da bei letzteren der Wasserdampf der Luft an der kalten Außenwand kondensiert und als Wasser nach unten abläuft. Bei mehrwandigen Eindeckungsmaterialien dagegen ist die innere Wand vergleichsweise warm, und es kommt weniger zur Kondensation, der Wasserdampf bleibt in der Luft.
Kunststofffolien
Einfache Kunststofffolien werden für unbeheizte Gewächshäuser verwendet, da sie einen hohen Wärmedurchgang haben. Die im Handel befindlichen Folien sind meist aus Polyethylen (PE) oder aus Polyvinylchlorid (PVC) und zwischen 0,1 und 0,2 mm dick. PE-Folien haben gegenüber den PVC-Folien den Vorteil, dass sie sich umweltfreundlicher entsorgen lassen. Die sogenannte Lichtkorrosion (Verspröden und Eintrüben der Folien durch Sonnenlicht) spielt bei den UV-stabilisierten Gartenbaufolien eine geringere Rolle. In der Praxis wird die von den Herstellern garantierte Haltbarkeit von 3 bis 4 Jahren um 2 und mehr Jahre ohne größere Qualitätseinbußen überdauert. Gitterverstärkte Folien besitzen eine höhere mechanische Festigkeit, reduzieren aber den Lichteinfall. Fachmännisch verwendet widerstehen Gartenbaufolien auch extremen Witterungen. Sie stellen bei einer Lichtdurchlässigkeit von 92 bis 94 % eine kostengünstige Alternative zu Glas dar.
Im Erwerbsgartenbau hat inzwischen die Doppelfolien-Eindeckung Einzug gehalten. Vor allem die Doppelfolien-Eindeckung mit F-Clean (eine spezielle Ethylen-Tetrafluorethylen-Folie, die von Asahi Glass Company entwickelt wurde), zeigt gute Ergebnisse in der Erprobung (siehe Kapitel „Die Temperierung“), was an ihrer hohen Licht- und UV-Durchlässigkeit liegt.
Luftpolsterfolien (z. B. dreilagig und UV-stabilisiert) haben sich vor allem als zusätzliche Isolierung während der Wintermonate bewährt. Dabei kann die Luftpolsterfolie innen oder außen, beispielsweise mit speziellen Folienhaltern, angebracht werden. In Gewächshäusern mit Luftpolsterfolien-Eindeckungen liegt die Luftfeuchtigkeit höher als bei Glas- oder Einfachfolien-Eindeckung.
Ungeeignet zur Eindeckung von Gewächshäusern sind Folien aus dem Baustoffhandel, die als Verpackungs- oder Abdeckmaterialien angeboten werden, da man nicht davon ausgehen kann, dass sie die nötige Lichtdurchlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Pflanzenverträglichkeit und andere Anforderungen erfüllen. Unabhängig von der Wahl des Materials ist auf eine winddichte Verbindung zwischen Eindeckung und Konstruktionsteilen zu achten.
Türen
Gewächshaustüren sind in der Regel Flügel- oder Schiebetüren. Foliengewächshäuser werden teilweise statt mit Türen mit Reißverschlüssen, Klettverschlüssen oder Ähnlichem angeboten. Schiebetüren sind Platz sparend, aber in der Ausführung nicht immer zufrieden stellend. Eine dauerhaft funktionierende Schiebetür muss über eine stabile, vor Beschädigungen und Verschmutzungen geschützte Lauf- und Führungsschiene sowie über leichtgängige, korrosionsbeständige Laufrollen verfügen. Die Tür selbst sollte verwindungssteif sein, damit sie nicht klemmt, und außerdem winddicht abschließen. Eine qualitativ hochwertige Schiebetür schlägt sich zwar auch im Preis eines Gewächshauses nieder, erspart dafür aber späteren Ärger.
Flügeltüren brauchen mehr Platz, sind aber weniger störanfällig als Schiebetüren. Eine langjährige Funktionsfähigkeit setzt auch bei Flügeltüren eine ausreichende Stabilität und eine einwandfreie Verarbeitung voraus. Ein Verziehen des Türrahmens oder des Türblattes hätte zur Folge, dass die Tür schlecht schließt und nicht mehr winddicht ist, was im Winter zu beträchtlichen Wärmeverlusten führt. Neben den klassischen Flügeltüren werden auch solche angeboten, bei denen man die obere Hälfte öffnen kann, während die untere Hälfte geschlossen bleibt (Halbtür).
Die Gewächshaustür sollte über 70 cm breit sein, um auch mit einer Schubkarre noch mühelos hindurchzukommen. Türen von höherwertigen Gewächshäusern sollten mit einem leichtgängigen, funktionsfähigen Schloss ausgerüstet und sicher verschließbar sein.
Fenster und Lüftungen
Auch die Fenster müssen verwindungssteif und stabil sein sowie dicht schließen. Sie werden nach Möglichkeit an der Ost- und Nordseite angebracht, da sie hier Stürmen weniger ausgesetzt sind. Sie sollten auch im geöffneten Zustand einem plötzlich einsetzenden Sturm wenigstens einige Zeit standhalten können.
Der Belüftung und Entlüftung des Gewächshauses kommt eine große Bedeutung zu. Da die Temperatur auch an heißen Sommertagen möglichst 30 °C oder zumindest die Außenlufttemperatur nicht übersteigen soll, ist auf genügend Lüftungsflächen in den Seitenwänden und im Dach zu achten. Warme Luft ist leichter als kalte und steigt nach oben, daher sollten die Dachflächenfenster, in der Regel Klappfenster, ihren Drehpunkt am höchsten Punkt des Gewächshauses, dem First, haben und zwischen 10 und 15° über die Horizontale zu öffnen sein. Ein optimaler Luftaustausch wird erzielt, wenn die Fenster in den Seitenwänden möglichst weit unten angebracht sind. Da es von der Gewächshauskonstruktion her einfacher ist, den Drehpunkt der Seitenfenster an die Traufe zu legen, wird diese Lösung, abgesehen von einigen Ausnahmen, bevorzugt angeboten. Höher angebrachte Seitenfenster haben zudem den Vorteil, dass sie das Eindringen von Kleintieren verhindern oder zumindest erschweren.
Bei Kleingewächshäusern wird die Tür in das Lüftungssystem miteinbezogen. Die über die natürliche Lüftung erreichbare Abkühlung ist vom stündlichen Luftwechsel, d. h., wie oft das gesamte Luftvolumen des Gewächshauses pro Stunde ausgetauscht wird, abhängig und wird über die Luftwechselzahl angegeben. Eine Luftwechselzahl von 10 besagt beispielsweise, dass genügend Öffnungen vorhanden sind, um die Luft im Gewächshaus pro Stunde 10-mal auszutauschen. Anzustreben ist ein 20- bis 50-facher Luftwechsel pro Stunde. Als Richtwert gilt, dass an einem heißen Sommertag die Haustemperatur bei 20-fachem Luftwechsel etwa 5 °C höher liegt als die Außentemperatur. Die Erfahrung zeigt, dass besonders bei den preisgünstigen Gewächshäusern die serienmäßigen Lüftungsflächen nicht ausreichen. Zusätzliche Fenster werden gegen Aufpreis angeboten. In der Regel lohnt sich diese Investition und erspart die spätere Anschaffung von Ventilatoren zur Zwangsent- und -belüftung. Der Luftwechsel in einem Gewächshaus hängt vom freien Querschnitt der Öffnungen ab, daher kann die Temperatur über ein mehr oder weniger weites Öffnen der Fenster beeinflusst werden. Die Fensterstellung wird im einfachsten Fall von Hand mittels einer Arretiervorrichtung vorgenommen. Fast alle Gewächshausfirmen bieten jedoch passend zu ihren Lüftungsfenstern automatische Fensteröffner an, bei einigen gehören sie sogar zur serienmäßigen Ausstattung.
Die Temperierung
Heizen, Schattieren und Lüften sind die wichtigsten Maßnahmen zur Beeinflussung der Temperatur im Gewächshaus. Aber Heizen ist teuer und belastet zudem noch Umwelt und Klima, wenn die Energie aus nicht regenerierbaren Energiequellen stammt. Am einfachsten ist das Energiesparen, wenn man schon beim Kauf oder Bau eines Gewächshauses die spätere Nutzung und Temperierung im Auge hat. Wer sein Gewächshaus im Winter ebenfalls warm haben möchte, sollte beispielsweise auf entsprechend gut isolierende Eindeckungsmaterialen achten. Aber auch für bereits in Betrieb genommene Gewächshäuser, gibt es Möglichkeiten, Energie einzusparen. Wenn beispielsweise nicht im gesamten Gewächshaus das gleiche Klima benötigt wird, kann man Kabinen einrichten, die unterschiedlich temperiert werden. Auch das Vermehrungsbeet im Gewächshaus ist ein wärmerer „Raum im Raum“, der für die Anzucht und Vermehrung von Pflanzen genutzt werden kann.
Energiesparende Gewächshäuser
Die staatlich geförderte Zukunftsinitiatve „Niedrigenergiegewächshaus“ (ZINEG) untersuchte von 2009 bis 2014 technische und kulturtechnische Möglichkeiten, mit denen das Heizen mit fossilen Brennstoffen bei der Pflanzenproduktion im Gewächshaus reduziert werden kann. Bei allen Maßnahmen wurden zusätzlich die Auswirkungen auf die Pflanzen geprüft, denn was nutzt das energiesparendste Gewächshaus, wenn es nicht für die Pflanzen, die man anbauen will, geeignet ist. Auch wenn die Untersuchungen eigentlich für den Erwerbsgartenbau durchgeführt wurden, lassen sich manche Erkenntnisse beim Hobbygewächshaus anwenden.
In einem ZINEG-Projekt in Hannover mit Topfpflanzen wollte man feststellen, wie viel Energie mit Isoliermaßnahmen eingespart werden kann. Dafür brachte man ein bis drei Energieschirme in Gewächshäusern mit 20 mm dicker Isolierglas-Eindeckung (antireflexbeschichtet und mit Argonfüllung) an. Energieschirme sind spezielle, mehr oder weniger lichtdurchlässige Gewebe, die in etwas Abstand zur Außenhülle und mit etwas Abstand voneinander unter das Gewächshausdachdach gespannt werden. Es gibt Energieschirme, die hauptsächlich tagsüber als Schattierung eingesetzt werden (Tagesschirm), und solche, die eher für den Winter geeignet sind und dann nachts aufgespannt werden, damit weniger Wärme nach außen verloren geht. Für Letzteres kann man auch Verdunklungsgewebe (eigentlich zur Tageslängenverkürzung) nutzen.
Im Zierpflanzenbau werden Gewächshäuser oft mit zwei, manchmal sogar mit drei Energieschirmen ausgerüstet. Sie kann man je nach Bedarf tagsüber oder nachts, einzeln oder in Kombination einsetzen. In eisigen Nächten werden alle Energieschirme zugezogen. Die Messungen im ZINEG-Projekt ergaben bei Isolierglas mit drei Energieschirmen (Tagesschirm mit 20 % Schattierung als äußerer Schirm, Energieschirm mit 50 % Schattierung in der Mitte und Verdunkelung mit 100 % Schattierung als innerer Schirm) eine Einsparung nachts von 84 % gegenüber einem mit Einfachverglasung ausgestatteten Gewächshaus! Bei Einfachglas kann man schon mit nur einem Energieschirm nachts 40 % Wärmeenergie einsparen. Bei Isolierglas konnte alleine mit dem Tagesschirm, wenn er nachts aufgespannt war, eine nächtliche Energieeinsparung von fast 30 %gemessen werden. Die Anbringung von Energieschirmen (egal, ob Tagesschirm, Energieschirm oder komplette Verdunkelungsgewebe) sind wirkungsvolle Möglichkeiten der Energieeinsparung.
In einem anderen ZINEG-Projekt (München und Neustadt a. d. Weinstraße) wurden gemüsebaulich genutzte Doppelfolien-Gewächshäuser