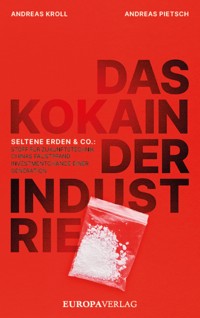
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Seltene Erden und Technologiemetalle sind der Stoff, aus dem wir die Zukunft bauen. Wir brauchen sie nicht nur für Chips und Computer: Kein leistungsstarkes Windrad würde sich ohne sie drehen, keine moderne Solaranlage die Energie der Sonne ernten, kein modernes Flugzeug fliegen. Quantencomputer blieben eine Utopie und (fast) kostenloser grüner Strom durch Kernfusion und dessen Speicherung durch Wasserstofftechnologie ein Traum. Sie sind teuer und nicht immer ohne Weiteres verfügbar, aber unsere moderne Industrie ist abhängig davon. Das Problem: China agiert dominant auf diesem Markt, die Rolle der USA wird zunehmend unberechenbar, weshalb wir in eine ähnliche Abhängigkeitsfalle geraten könnten wie seinerzeit beim russischen Gas. Die europäische Industrie ist in Panik, sie fürchtet eine Mangellage. Die Rohstoffhändler Andreas Kroll und Andreas Pietsch agieren weltweit, um mehr Unabhängigkeit zu erlangen, und fordern mehr staatliche Investitionen in diesen kritischen Bereich, der von erheblicher strategischer Bedeutung ist. Für solvente Privatanleger interessant: Sie können diese Metalle inzwischen kaufen und besitzen wie Gold und Silber. Sie können dabei gleichzeitig Geld verdienen und als Teil der Lieferkette Versorgungssicherheit für die deutsche Industrie schaffen. Dieses Buch heißt Das Kokain der Industrie, weil ... ... unsere Industrie von Seltenen Erden & Co. abhängig ist. ... uns noch geringe Mengen genügen, aber unser Verlangen danach wächst. ... unser aller Wohlstand davon abhängt, dass wir pünktlich beliefert werden. ... wir bereit sind, dafür einen hohen Preis zu bezahlen, den der Dealer bestimmt. ... wir von diesen Stoffen nicht loskommen und den Dealern ausgeliefert sind. ... die Stoffe nicht offen gehandelt werden und der Abbau teilweise illegal ist. ... wir verwundbar sind, wenn unsere Dealer nicht mehr zuverlässig liefern. ... erste Drohungen im Raum stehen, die uns zutiefst besorgen. ... die Industrie Wege aus ihrer Ohnmacht sucht und ... es diese Wege gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANDREAS KROLL | ANDREAS PIETSCH
DAS KOKAINDER INDUSTRIE
SELTENE ERDEN & CO.:STOFF FÜR ZUKUNFTSTECHNIKCHINAS FAUSTPFANDINVESTMENTCHANCE EINER GENERATION
INHALT
VORWORT
1. SELTENE ERDEN UND TECHNOLOGIEMETALLE
WORUM ES GEHT? – ES GEHT UM UNSERE ZUKUNFT!
Unsere Reise in die Zukunft
Wohin unsere Reise uns in Zukunft führen wird
Was uns auf der Reise in die Zukunft bremsen könnte
Reisen Sie mit uns! Auch Privatanleger können in die Zukunft investieren
2. MEGATRENDS
WIE WIR UNS DIE ZUKUNFT VORSTELLEN
DIE ENERGIEWENDE IST AUCH EINE ROHSTOFFWENDE
Windräder: Wer will eigentlich Atomkraftwerke?
Elektroautos: Der Verbrenner hat keine Zukunft
Human Robotics: Die nächste Welle
Seltene Erden und Technologiemetalle: Wir brauchen immer mehr
3. SELTENE ERDEN UND TECHNOLOGIEMETALLE
DIE KÖNNEN WAS
SELTENERD-ELEMENTE
Neodym
Scandium
Dysprosium
Terbium
Gadolinium
TECHNOLOGIEMETALLE
Indium
Hafnium
Rhenium
Gallium
Germanium
Iridium
4. USA UND CHINA IM HANDELSKRIEG
UND WAS SELTENE ERDEN DAMIT ZU TUN HABEN
Handelspolitik ist immer auch Sicherheitspolitik
Kritische Infrastruktur: Europa wird wachsamer
DER DEALER: CHINAS MONOPOL UND UNSERE ABHÄNGIGKEIT
Kritische Rohstoffe: Wie China sein Monopol aufbaute
Beispiel Gallium: Wie China sein Monopol ausnutzt
Seltene Erden: China bereit zu strategischer Angebotsverknappung
Dunkle Wolken voraus: Wie groß ist die Gefahr durch China?
DIE PRODUKTION: LEIDEN FÜR MENSCH UND UMWELT
Kriminelle Geschäfte: Selbst China verlagert Produktion ins Ausland
Die Luchse und das liebe Vieh: Wenn Naturschutz den Klimaschutz bremst
5. SELBST MACHEN
WIE WIR UNS AUS DEN FESSELN BEFREIEN
DER WESTEN BRAUCHT EIGENE LAGERSTÄTTEN UND RAFFINERIEN
Wege aus der Abhängigkeit: Diversifizierung der Lieferketten
Raffinerien: Wir müssen unsere Ressourcen selbst veredeln
VORWÄRTS IN DIE VERGANGENHEIT: STILLGELEGTE MINEN AUSSCHÖPFEN
Noch eine Quelle: „Mining dump and tailings“
Vorräte anlegen: Wir brauchen Rohstofflager im eigenen Land
DIE FABELHAFTE WELT DES RECYCLINGS: WIE WIR AUS SCHROTT GOLD SPINNEN
Kreative Forschung: Mit Phytomining und Bakterien Rohstoffe fangen
DIE ZUKUNFT WIRD GRÜN: WIE WIR UMWELTFREUNDLICH SELTENE ERDEN BEKOMMEN
Wegweiser ins Grüne: Das Lieferkettengesetz
6. SELTENE ERDEN & CO.
ALTRUISTISCHES INVESTMENT MIT GROSSER RENDITECHANCE
Knappe Güter, Inflation: Was uns Corona und Russlands Ukrainekrieg lehren
GENERALI-Versicherung: Rohstoffe schützen vor Inflation
Gutes tun: Warum auch Privatpersonen Industriemetalle kaufen sollten
Investment in Seltene Erden & Co.: Risiken und wie man sie verhindert
DER ROHSTOFFZYKLUS: PREISE WERDEN NOCH GUT 15 JAHRE STEIGEN
Nikolai Kondratjew: Die Wirtschaft verläuft in Wellen
Ewiges Auf und Ab: Was der Schweinezyklus mit Rohstoffen zu tun hat
PHYSISCHE ROHSTOFFE: MEGAMARKT FÜR INVESTOREN
Seltene Erden AG: Metalle gehören an die Börse
DAS ANGEBOT SERIÖSER HÄNDLER: LAGER, BLOCKCHAIN, MITTELVERWENDUNGSKONTROLLE
Fakes vs. Finomet: Sicherheit bietet nur noch die Blockchain
Eigentum und Transparenz: Woran man einen seriösen Metallhändler erkennt
7. EINE FRAGE DER NATIONALEN SICHERHEIT
ROHSTOFFE SICHERN
Politische Verantwortung: Weshalb der Staat in der Pflicht ist
Der Rohstofffonds: Ein Tropfen auf dem heißen Stein
Versorgungssicherheit der Industrie: Unternehmen brauchen eine Strategie
Rohstoffe sichern: Jedes Gramm zählt
NACHWORT
DANKSAGUNG
QUELLENVERZEICHNIS
ABBAUGEBIETE UND RAFFINERIEN
VORWORT
Seltene Erden und Technologiemetalle sind essenzielle Rohstoffe, die als Grundlage für nahezu jede technologische Innovation dienen – von Quantencomputern über erneuerbare Energien bis hin zu Human Robotics. Doch obwohl sie unverzichtbar für Fortschritt und Innovation sind, werden diese Elemente nicht an Börsen gehandelt, sodass bisher nur wenige Marktteilnehmer das Geschehen bestimmen. Diese seltenen Metalle sind bereits Teil eines Rohstoffkrieges, der bisher zwischen China und den USA geführt wird.
Denn die Mächtigen wissen: Wir befinden uns am Beginn eines entscheidenden Wendepunktes, eines „Rohstoffzyklus“, der sich mit einem technologischen Superzyklus bedingt und verstärkt – Zeit, darüber ein Buch zu schreiben.
Zwei globale Trends treffen jetzt aufeinander:
EIN BEVORSTEHENDER TECHNOLOGIESUPERZYKLUS …
Die Digitalisierung, künstliche Intelligenz (KI), Motorik und Sensorik im Bereich der Human Robotics sowie die Technologie des Quantencomputers entfachen eine nie da gewesene Nachfrage nach knappen Hightechmetallen. Hinzu kommt der Umstieg auf erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge. Währenddessen explodiert auch die Nachfrage in rüstungsrelevanten Industrien. Der neue Technologiesuperzyklus könnte Grundlage für ein enormes Produktivitätswachstum sein – zumindest aber Grundlage für einen Nachfrageschub bei Seltenen Erden und Technologiemetallen.
… KOLLIDIERT MIT EINEM STAGNIERENDEN ANGEBOT
Die vergangenen Jahre haben eines deutlich gezeigt: Es wurde zu wenig in Minen, Raffinerien und die Rohstoffgewinnung investiert. Experten schätzen, dass wir mindestens 300 Milliarden Dollar und 15 bis 18 Jahre benötigen werden, um die Produktionskapazitäten auf die steigende Nachfrage vorzubereiten. Dabei dominieren Rohstoffe aus China den globalen Markt – eine Abhängigkeit, die immer stärker zu spüren ist, da Exportkontrollen und geopolitische Spannungen zusätzliche Unsicherheiten schaffen.
DEUTSCHLAND UND EUROPA – AUFBRUCH ODER ABSTIEG?
Zur Fertigstellung dieses Buches im Dezember 2024 liegt das Produktivitätswachstum in Europa, vor allem aber in Deutschland am Boden. Unser Wohlstand ist in Gefahr. Nationen, die technologische Spitzenpositionen einnehmen, werden ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihren Wohlstand erhalten – allen voran die USA, die, bezogen auf KI, alle weltweit relevanten Unternehmen innerhalb ihrer Landesgrenzen ansiedeln. Deutschland steht vor der Herausforderung, Anschluss zu finden. Es fehlt nicht nur an konkreten Plänen, sondern auch an leichten Zugängen zu Risikokapital, an Cluster-Strukturen, zum Beispiel bei Universitäten, und insgesamt an schnelleren Entscheidungswegen. Kaum vorhanden ist darüber hinaus auch der gesicherte Zugang zu Primärrohstoffen. Hier sind im ersten Schritt die Unternehmen, angesichts der schieren Größe der Herausforderung aber letztlich auch die Staaten gefragt.
WARUM ROHSTOFFINVESTITIONEN JETZT SINNVOLL SIND
Für Investoren ergeben sich aus der Verbindung von Superzyklus und stagnierendem Angebot einmalige Gelegenheiten. Rohstoffinvestments, insbesondere in Seltene Erden und Technologiemetalle, bieten außergewöhnliche Stabilität und langfristige Berechenbarkeit. Im Durchschnitt verlaufen diese Zyklen über 18 Jahre – ein Zeitraum, der weitaus kalkulierbarer ist als jener für viele andere Assetklassen.
Ein zusätzliches Argument für Rohstoffinvestitionen ist ihre Diversifizierungsfunktion. Sie verbessern nicht nur die Renditemöglichkeiten innerhalb eines Portfolios, sondern erhöhen auch dessen Sicherheit. Der Weg zur Unabhängigkeit von China und den USA sowie die Stabilisierung globaler Lieferketten erfordern sowohl ein Zusammenspiel aus staatlichem und unternehmerischem Engagement als auch den Einsatz von Finanzinvestoren. Als Nebeneffekt wächst mit zunehmender Liquidität auch die Gesamtattraktivität des Marktes und erleichtert Minen- und Raffineriefinanzierungen.
EINE WIN-WIN-SITUATION FÜR ALLE
Mit diesem Buch möchten wir nicht nur über die Risiken und Herausforderungen aufklären, sondern vor allem die Chancen hervorheben, die der Rohstoffmarkt in Verbindung mit dem technologischen Wandel bietet. Wir stehen an einem Wendepunkt, an dem Investoren nicht nur Teil einer Lösung werden können, sondern gleichzeitig von einer fundamentalen Veränderung des globalen Wirtschaftsmarktes profitieren.
Denn am Ende gilt immer noch eines: Alles, was erdacht wird, braucht Rohstoffe. Lassen Sie uns gemeinsam die Voraussetzungen schaffen – für einen liquiden, attraktiven und sicheren Markt!
Wir wünschen Ihnen viel Freude und wertvolle Erkenntnisse beim Lesen dieses Buches.
Andreas Kroll und Andreas Pietsch
1. SELTENE ERDEN UND TECHNOLOGIEMETALLE
WORUM ES GEHT? – ES GEHT UM UNSERE ZUKUNFT!
Dass unsere Bosse – die Chief Executive Officers und Topmanager in Großkonzernen und Familienunternehmen – nur an schnellen Profit, maximale Rendite und hohe Dividenden für ihre Stakeholder denken, behaupten nur noch radikale Kritiker, die mit einem Buch von Karl Marx unter dem Arm herumlaufen. Die Zeiten sind längst vorüber, zu denen ein Mann wie Milton Friedman Nobelpreisträger werden konnte, dessen Botschaft lautete: „Die soziale Verantwortung von Unternehmen ist es, den Gewinn zu steigern.“ Längst wollen die Chefs und die Belegschaften auch einen übergeordneten Zweck erfüllen, einen Sinn in ihrer Arbeit erkennen – einen Purpose. Was tun wir da eigentlich den ganzen Tag? Für wen produzieren wir? Wozu? Besonders intensiv arbeiten Tüftler und Denkerinnen, Investorinnen und Visionäre an technischen Lösungen für das größte menschengemachte Problem unserer Zeit: den Klimawandel. Manchen mag es nicht schnell genug gehen, aber die „Kapitalisten“ leisten ihren Beitrag. Um die Welt vor dem „Untergang“ zu retten, folgen sie dem Ruf der Politik nach Veränderung mit Elektroautos statt Verbrennern, mit Windrädern statt Kohlekraftwerken, kurz: mit Technologien, die weniger CO2 ausstoßen. Unternehmen erweisen sich als vernünftig: mehr Gemeinsinn statt Eigensinn; sie sind grüner geworden, wollen nachhaltiger werden, gar die Welt zu einem besseren Ort machen – Zuversicht vermitteln auf eine bessere Zukunft. Und das sind beileibe nicht nur Marketingbekenntnisse, Etikettenschwindel und Greenwashing.
Aber dort, in den Zentralen unserer fortschrittlichen Konzerne und großen Familienunternehmen, erkennen wir auch Sorgen, Unruhe, Angst, Ratlosigkeit. Weil die Mission Zukunft Rohstoffe braucht, die wir nicht besitzen und die schwer zu produzieren sind: die Elemente der Seltenen Erden (SEE) wie Praseodym und Neodym, Terbium und Dysprosium sowie Technologiemetalle (TM) wie Germanium und Gallium, Indium und Hafnium. Sie sind teuer und nicht immer ohne Weiteres verfügbar. Wir brauchen sie so dringend wie ein Trinker seine Flasche, wie ein Junkie seinen Stoff, und wir brauchen sie immer wieder und immer mehr davon. Unsere Hightechindustrie ist abhängig von diesen Metallen, wenn wir eine gute Zukunft für uns und das Klima nicht nur erträumen oder herbeifantasieren wollen. SEE und TM helfen uns tatsächlich, Technologien zu entwickeln, mit denen wir das CO2-Zeitalter überwinden und das Schlimmste noch verhindern können; sie sind der Stoff, aus dem die Träume für eine bessere, lebenswertere Welt sind. Wir sind abhängig und wollen das auch gar nicht ändern, zu gut sind die Aussichten mit diesem Stoff. Nur hätten wir gern weitere Lieferanten, um freier zu handeln und um weniger erpressbar zu sein. Aber nach neuen Lieferanten sucht die ganze Welt.
Seltene Erden und Technologiemetalle
Die Elemente der Seltenen Erden (SEE) werden häufig zu den Technologiemetallen gezählt. Wir betrachten sie allerdings als eigene Gruppe. Sie sind im Periodensystem Nachbarn, die sich durch ähnliche Eigenschaften und Anwendungsbereiche wie bspw. Magnete auszeichnen. Das Wort ‚Technologiemetalle‘ (TM) verwenden wir als Sammelbegriff für die übrigen in der Spitzentechnologie stark nachgefragten knappen und besonderen Metalle. Sie liegen im Periodensystem nicht unbedingt nebeneinander und können sich hinsichtlich ihrer Funktion stark voneinander unterscheiden.
Wir haben diesem Buch den Titel „Das Kokain der Industrie“ gegeben. „Kokain“, weil unsere Industrie von Seltenen Erden & Co. abhängig ist,
weil uns noch geringe Mengen genügen, aber unser Verlangen danach wächst,
weil unser aller Wohlstand, unser Glücksgefühl, davon abhängt, dass wir pünktlich beliefert werden,
weil wir bereit sind, dafür einen hohen Preis zu bezahlen, den der Dealer bestimmt,
weil wir von diesen Stoffen nicht loskommen und den Dealern ausgeliefert sind,
weil die Stoffe nicht offen gehandelt werden und der Abbau teilweise illegal ist,
weil wir verwundbar sind, wenn unsere Dealer nicht mehr zuverlässig liefern,
weil erste Drohungen im Raum stehen, die uns zutiefst besorgen,
weil die Industrie Wege aus ihrer Ohnmacht sucht und
weil es diese Wege gibt.
Beim Kauf des Stoffs, aus dem sie Zukunft machen sollen, müssen die Unternehmen meistens Deals mit einem mächtigen Staat vereinbaren, der schon angedeutet hat, dass er dieses Faustpfand zu nutzen bereit ist, um politische und wirtschaftliche Ziele durchzusetzen. Unser größter Rohstoffdealer ist China. China ist das Kolumbien der SEE. Unsere Industrie hängt von Xi Jinpings verlässlichem Nachschub ab. Was, wenn er in Peking beschließt, nicht mehr zu liefern? Wenn die Regierung ihre De-facto-Monopolmacht ausnutzt? Dann kommt die große Depression. Dann wird das Exportland Deutschland eines der ersten Opfer der noch jungen Deglobalisierungswelle und des erwachenden Nationalismus.
Daran sind wir selbst schuld. Der Abbau dieser Rohstoffe ist bisher eine schmutzige Angelegenheit für Mensch und Natur, weshalb wir dieses Geschäft gern anderen überlassen haben. China hat die Chance erkannt und genutzt. Das Land produziert den größten Teil dieser begehrten Rohstoffe. In Zeiten eines anschwellenden Handelskriegs fürchtet die westliche Welt, dass die Führung in Peking ihre Marktmacht ausnutzen könnte, um politische Ziele durchzusetzen. Das allerdings könnte ihnen niemand ernsthaft übelnehmen, weil Chinas größter Gegenspieler, die USA, es seinerseits versteht, die Instrumente des verschärften Wettbewerbs sehr virtuos zu bedienen: zum Beispiel Zölle. Donald Trump hat diese Option zuerst gezogen, Joe Biden hat das fortgesetzt, und alle Welt fürchtet derzeit, dass sich diese Praxis mit der Regierung Trump II verschärfen könnte. Unsere Meinung: Zölle, nur erhoben, um eine weniger produktive Industrie vor einer mit höherer Produktivität zu schützen, verhindern Innovationen und sind schlichtweg schädlich.
China war bisher ein sehr zuverlässiger Geschäfts- und Handelspartner, auch für uns. Bisher ist die Gefahr eine theoretische. Noch funktionieren die Lieferketten in Richtung Europa. Wir hoffen, dass ein friedlicher Welthandel das auch in Zukunft weiter gewährleistet. Aber die Zeichen stehen auf Sturm. Die einst friedliche, wohlstandsfördernde, globalisierte Welt liegt in Trümmern. Wladimir Putin hat das Vertrauen in die bisherige Weltarchitektur zerstört. Aber nicht nur er. Donald Trump hat „America first!“ zu seinem Markenkern erklärt. Und China? – Peking versucht im Kreis der BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien und Südafrika, ein Gegengewicht zum sogenannten Westen aufzubauen. Und innerhalb Europas sprießen die Egoismen wie Pilze im Herbst; zu beobachten war das nicht nur beim Brexit, sondern auch bei den Corona-Impfstoffen und beim Gas nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Der Trend läuft in Richtung Entsolidarisierung, Deglobalisierung. Was, wenn die Lieferketten zerstört werden? Bei den Zukunftsmetallen stehen wir dann nackt da, ohne eigene Produktion; was, wenn die Besitzer den Habenichtsen nichts abgeben wollen? Wenn uns die SEE für die Energiewende fehlen und die TM für die Hightechprodukte, die uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen? In einem Interview mit dem Handelsblatt gaben wir im August 2023 die Antwort: „Panik ist eine angemessene Reaktion.“1
Die Panik ist inzwischen real bei den Unternehmen. Die Angst vor Engpässen an diesen Elementen ist besser: spürbar, zumal wir in naher Zukunft noch viel mehr davon brauchen werden, viel, viel mehr. Das nächste Segment, das auf Seltene Erden & Co. angewiesen ist, wächst bereits. Dieser Markt wird größer sein als der für E-Autos und Windmühlen. Der nächste Treiber der Nachfrage nach den Technologieboostern heißt: Human Robotics. Es wird keine Generation dauern, bis sich zu den acht Milliarden Menschen Milliarden von Robotern gesellt haben werden. Und in Kriegen, die wir hoffentlich vermeiden können, werden auch KI-gesteuerte Roboter kämpfen. Auf die Frage, wie viele Roboter es wohl um 2040 geben wird, antwortete Elon Musk: So viele, wie es Menschen auf der Welt geben wird.
Wir haben die für solche Technologien notwendigen Elemente eingekauft und verkauft. Dabei ist die Überzeugung entstanden und gewachsen, dass es nicht genügt, Händler zu sein: dass wir verantwortungsbewusste Händler sein wollen, dass wir mehr machen müssen, als zu kaufen und zu verkaufen, dass wir Geschäfte nicht mit Waren machen dürfen, deren Produktion Menschen oder die Umwelt geschädigt hat. Und dass wir, weil uns die Abhängigkeit von China bewusst ist, nach einem Ausweg suchen sollten. Aber wie? Wo? Mit wem?
Diese Fragen beschäftigen uns seit zehn Jahren. Und dann, 2022, fanden wir sie, die Option. Wir griffen sofort zum Telefon. Dieser Anruf sollte der Anfang von etwas werden, das wir uns nicht hätten erträumen können. Was wir nicht geplant hatten: Wir bekamen durch diesen Anruf und das, was danach geschah, die Chance, mehr zu sein als Rohstoffhändler. Wir wollten diese Chance nutzen. Seither gehören wir zu denen, die das Problem grundsätzlich lösen wollen. Unsere Lösung liegt in Südafrika, zumindest ein Teil davon.
UNSERE REISE IN DIE ZUKUNFT
Wir haben bereits mehr als 300 Kilometer Highway hinter uns, als das Navigationssystem uns mitten im Nichts auf eine Schotterpiste lotst. Die Sonne steht am wolkenlosen Zenit; trotz der stetigen Brise zeigt das Thermometer 30 °C an, und unser Jeep, in dessen Kofferraum Wasser und Nahrungsmittel für eine viertägige Expedition ins Unbekannte mitfahren, zieht nun eine Sandfahne hinter sich her. Im südafrikanischen Frühling im August und September soll sich am nördlichen Westkap von Langebaan bis zur namibischen Grenze ein Blütenmeer breitmachen, ein Spektakel der Farben. Jetzt, am 14. Februar 2023, ist alles rötlich-braun.
Noch einmal biegen wir ab, diesmal links. Im Wagen singt Annie Lennox: „There must be an angel playing with my heart.“ Auch wenn die Eurythmics bei „No one on earth could feel like this, I′m thrown and overblown with bliss“ nicht an ein Bergwerk dachten – in uns macht sich ein überwältigendes Glücksgefühl breit. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt, aber wir können es kaum erwarten.
Wenige Minuten später – halb 11, Punktlandung – stehen wir vor einem Maschendrahttor und klopfen uns den Sand aus den Klamotten. Hier also ist es. Ein Wachmann hat uns schon erwartet, öffnet das Tor, bedeutet uns, wir sollten auf dem Besucherparkplatz parken, lotst uns in ein karg ausgestattetes Häuschen und reicht jedem von uns ein Röhrchen. Er bittet unsere ganze vierköpfige Delegation zum Alkoholtest.
Nachdem wir bestanden haben, geleitet er uns zu einer Gruppe von Containern, einen betreten wir. Eine Klimaanlage schnurrt, wir frösteln. Die Einweisung dauert eine Dreiviertelstunde. Sicherheitsmaßnahmen. Schließlich wollen wir unter Tage, immerhin hundert Meter tief. Sie erklären uns, wohin wir laufen müssten, falls Steine von der Decke fallen sollten. Wir blicken uns mit großen Augen an. Von dort geht’s nach draußen und wieder schön mollig zur nächsten Box. Noch eine Einweisung. Wir bekommen weiße Schutzkleidung und einen Helm. Wieder raus und rauf auf einen Jeep. Kurze Fahrt zu einem stählernen Förderturm, von dem Gleise in einen Schacht hinabführen. Dort unten also ist es, was wir suchen. Dafür sind wir vier Stunden gefahren, den N7-Highway hinauf, vorbei an den Zederbergen, und nun stehen wir fast 400 Kilometer von Kapstadt und 40 Kilometer östlich von Bitterfontein am Eingang der stillgelegten Monazitmine von Steenkampskraal. Dort wollen wir rein.
Wir müssen zu Fuß gehen. Kein Fahrstuhl. Sie geben uns 45 Minuten, nicht mehr. Zwei Ingenieure der Mine mit Dosimetern begleiten uns. Auf unseren Köpfen der Helm mit Grubenlampe, an unserem Gurt ein Beatmungsgerät, eine Gasmaske für den Fall der Fälle. Es ist stockdunkel. Aber für Beklemmungen ist jetzt keine Zeit. Ungeduldig stürmen wir eine Treppe hinab, für die der TÜV keine Plakette ausgestellt hätte, immer entlang der Gleise, auf denen früher ein Motor die Loren an Seilen nach oben gekurbelt hatte. Etwas drückt auf die Ohren. Je tiefer wir kommen, desto mehr kapitulieren die Ohrstöpsel, desto lauter tost der Lärm. Unten angekommen, sehen wir die Ursache: Ventilatoren. Gebaut vor mehr als 70 Jahren. An der Wettertür brüllt unser Begleiter: „Da müssen wir noch durch, dann wird’s leiser.“ Schnell rein also. Drinnen fliegen uns stattliche Fledermäuse um die Köpfe, in der Luft liegt der Duft von deren Kot und Urin; und auf den Gleisen stehen noch mit Erz gefüllte Loren, die darauf zu warten scheinen, endlich nach oben gezogen zu werden, ans Licht. An den Wänden lehnen Hacken und Schaufeln, zurückgelassen von den Bergarbeitern, nachdem die Briten die Suche nach Thorium von heute auf morgen beendet und ihren Leuten den Broterwerb entzogen hatten. „It’s over!“
Ein halbes Jahr zuvor hatten wir die Mine gefunden und sofort gefragt, ob wir vorbeikommen dürften, wenn wir zur Messe Mining Indaba nach Kapstadt reisen. Man akzeptierte sofort. Bald wissen wir: Diese Mine verließen die Briten 1962 überraschend, nachdem sie zwar gefunden hatten, was sie suchten, damit jedoch nichts anzufangen wussten. Was sie gefunden hatten, war Thorium, benannt nach Thor, dem germanischen Gott. Es gelang ihnen nicht, das schwach radioaktive Schwermetall so anzureichern, dass es für eine Bombe gereicht hätte, eine Atombombe für das schon während des Kriegs gegründete Atomwaffenprogramm der Briten.
Woher wussten sie, wo sie nach Thorium suchen mussten, mitten in der Wüste? Sie wussten es, weil die Indigenen, die Khoisan, mit extrem harten Pfeilspitzen zur Jagd gegangen waren und den Ort kannten, an dem sie das dazu nötige Material finden konnten. Ahnenwissen, das Geologen während der Burenkriege um 1900 herum anzapften. Was damals noch niemand wusste: Neben dem im Licht unserer Helmlampen blau schimmernden Kupfersulfat auf Level 1 sind rötliche Stellen im grauen Granit zu erkennen: Es ist eine Ader aus Monaziterz, die sich wie ein kolossaler Wurm von 1 200 Metern Länge und einer Dicke bis zu zehn Metern durch das Gestein windet. Darin sind insgesamt in einer Konzentration von gut 14 Prozent 15 Rohstoffe gebunden, darunter mehr als 15 000 Tonnen Neodym, 4 500 Tonnen Praseodym, an die 900 Tonnen Dysprosium und 200 Tonnen Terbium, die für die Technologieentwicklung mindestens so wichtig sind wie Kupfer und eines Tages so wertvoll sein könnten wie Gold.
Die Autoren besuchten im Februar 2023 die Mine Steenkampskraal in Südafrika.Fotos: Kroll/Pietsch
Nach einer Dreiviertelstunde müssen wir wieder nach oben, wegen der Strahlung. Rückzug. Wir haben es eilig, wegzukommen. Jetzt erst bemerken wir die Hitze, die Kleidung klebt an unserer Haut. 500 Stufen nach oben, zum Tageslicht. Kurze Atemzüge, die nicht genügen. Die Atemschutzmaske schnürt uns die Luft ab. Anstrengende, kleine Schritte sind das für uns, doch ein großer für die europäische Industrie, könnte man sagen, aber ohne Sauerstoff zu scherzen ist schwer. Oben angekommen, plumpsen wir auf die Erde; manch einer hustet. Erst fünfzehn Minuten später entsteigen unsere Begleiter der Grube und schütteln den Kopf. „Stupid Germans“, sagen sie, weil wir wie bei einem Towerrunning nach oben geeilt sind. „Stupid Germans“, sagten sie auch, als sie unseren Proviant im Jeep sahen, genug, um eine Woche ohne Zivilisation in der Wüste zu überleben.
Wieso tun wir das alles? Wieso fliegen wir nach Südafrika, um eine stillgelegte Mine zu besichtigen? – Wir tun das, weil die Welt sich verändert und das benötigt, was in der Monaziterzader zu finden ist. Weil wir nicht am Bahnsteig stehen bleiben wollen, wenn die Menschheit sich in den Zug begibt, der in ein neues Zeitalter fährt. Weil wir unsere Erde nicht denen überlassen wollen, die sie rücksichtslos ausbeuten. Weil wir beim Entstehen der Zukunft des Planeten nicht nur zusehen wollen, sondern an unserem Platz die Welt von morgen mitgestalten.
WOHIN UNSERE REISE UNS IN ZUKUNFT FÜHREN WIRD
Schauen wir zurück ans Ende des vorigen Jahrhunderts: Im Film ‚Terminator 2‘ sorgte ein menschenfeindlicher Roboter namens T-1000 für Schrecken. Er konnte Mauern und Gitter überwinden, indem er sich verflüssigte und auf der anderen Seite wieder auferstand. 1991 glich diese Filmanimation einem Albtraum für die Menschen. 32 Jahre später hat ein chinesisches Forschungsteam ein kleines silbernes Etwas vorgestellt, das zu einer Pfütze schmilzt, durch eine Art aufrecht gestellten Gullydeckel fließt und sich auf der anderen Seite wieder verfestigt. Ein solches Etwas könnte in Zukunft dem Wohl der Menschheit dienen, zum Beispiel bei der Montage und Reparatur von Maschinen an schwer zugänglichen Stellen im Inneren. Oder in der Medizin. Dieses Etwas könnte Medikamente in menschliche Körper transportieren oder Fremdkörper aus dem Magen entfernen.
Was aber sorgt dafür, dass dieser Miniroboter seinen Aggregatzustand verändern kann? Er besteht aus Gallium, einem Technologiemetall, das bei weniger als 30 °C schmilzt. Seine Form „merkt“ sich der Flüssigmetallroboter durch kleine magnetische Mikropartikel aus Neodymoxid, einem der SEE, die in dem rötlichen Wurm in Steenkampskraal schlummern. Diese dienen ihm als internes Gerüst, das die Struktur stabilisiert und ihm erlaubt, sich zu bewegen. Um nach dem Schmelzen wieder seine alte Gestalt anzunehmen, braucht „T-1000“ allerdings noch ein von außen angelegtes Gerüst. Trotzdem können wir wortwörtlich sehen, wie die Zukunft Gestalt annimmt.
Neodym ist auch der wichtigste Bestandteil der derzeit stärksten Dauermagnete, wie wir sie in Elektromotoren und Windkraftanlagen finden. Es ist eines von 17 sehr potenten Elementen, die auf Namen getauft sind, die kein Geburtenregister kennt. Bald wird man mehr von ihnen hören, von den SEE, den leichten namens Cer, Europium, Lanthan, Neodym und Praseodym, Promethium, Samarium und (schon etwas „schwerer“) Scandium sowie den schweren, die Dysprosium, Erbium, Gadolinium, Holmium, Lutetium, Terbium, Thulium, Ytterbium und Yttrium heißen. Einige dieser Elemente (15 Lanthanoide sowie Yttrium und Scandium) sind wirklich schwer und wirklich selten.
„Shape-shiftig metal creates a self-powered motor“, New Scientist Video ansehen
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ErCOTdIruoc
Manche dieser metallischen Rohstoffe sind nur wenige Minuten nach dem Urknall entstanden, andere erst später bei Supernovae, gigantischen Sternenexplosionen, denen wir schwere Elemente wie Gold, Silber, Titan und Uran verdanken. Durch mächtige kosmische Prozesse entstanden damals SEE und TM mit ihren besonderen Eigenschaften: Kein Computer liefe ohne sie, weil sie halbleiterfähig sind, sprich: Strom unter bestimmten Bedingungen leiten oder eben nicht, 1 oder 0. Ohne korrosionsbeständige und hitzeresistente Halbleiter könnten wir keine Computer bauen, kein leistungsstarkes Windrad drehte sich ohne sie, kein modernes Flugzeug und keine Rakete flöge.
Und welche Chancen für die Menschheit liegen in diesen Hightechmetallen! Welchen Nutzen werden sie dem Klimaschutz bringen? Wäre es nicht schön, Strom nicht nur ohne Öl, Gas oder Kohle zu produzieren, sondern mittels einer Technologie, die Energie fast kostenlos liefert? All das wird kein Traum bleiben. Das jedenfalls verspricht eine Technologie, bei der eine Anlage mit riesigen Magneten Wasserstoff-Plasma erhitzt – auf höheren Temperaturen als im Inneren der Sonne, mehr als 100 Millionen Grad Celsius: die Kernfusion. Das Plasma wird der Idee nach genutzt, um (fast) kostenlosen Strom zu erzeugen, als Abfallprodukt entsteht, anders als bei konventionellen Atomkraftwerken, kein hochradioaktiver Müll. Die in den Anlagen eingesetzten Magnete könnten ihre Aufgaben ohne TM wie Hafnium und SEE wie Dysprosium und Terbium nicht verlässlich erfüllen. Der Traum vom billigen Strom wird wahr, sobald bei der Kernfusion dauerhaft viel mehr Energie erzeugt als bei seiner Gewinnung verbraucht wird. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, versprechen uns Wissenschaftler – vielleicht nur noch etwa 30 Jahre. Aber es gibt auch die Auguren, die an dieser Technologie zweifeln. Bis es so weit ist, können wir die Sonne mittels Photovoltaikanlagen direkt nutzen – und dieser Boom hat gerade erst begonnen.
Auch in der künstlichen Intelligenz (KI) steckt jede Menge Zukunft – und eine Menge dieser besonderen Metalle. Wir haben Anlass, auf umwälzende Technologie und eine bessere, lebenswertere Welt zu hoffen.
Die Zeitenwende ist nicht nur eine geopolitische, seit Russland den Krieg nach Europa zurückgebracht hat und China sowie zahlreiche Staaten im sogenannten globalen Süden die Suprematie der USA und die vom sogenannten Westen durchgesetzten Regeln nicht mehr akzeptieren möchten. Auch technologisch stehen buchstäblich Quantensprünge an. Die Welt ist auf dem Weg, sich von fossilen Energieträgern zu verabschieden und sie durch Windkraft und Sonnenenergie und andere Quellen zu ersetzen – manche wollen auch Atomkraft nutzen. Die 17 Elemente dienen uns bereits bei all den Veränderungen; sie und eine Reihe von Technologiemetallen scheinen auf die Welt gekommen zu sein, um unsere Zukunftsprobleme zu lösen: bei der Stromversorgung und beim Klima, beim technologischen Fortschritt, in der Medizin und auch im Militärischen.
SEE und TM verfügen über Eigenschaften, deren Nutzen wir noch gar nicht vollständig abzusehen vermögen. Mit ihnen wird die Welt sich verändern, hoffentlich auch verbessern. Wir sind optimistisch. Schon heute werden in Solarzellen Indium, Gallium und Germanium verbaut. In den Generatoren von Windkraftwerken stecken starke Permanentmagnete, deren hohe Leistungsfähigkeit auf Neodymoxid, Dysprosiumoxid und Terbiumoxid basiert. Grüner Wasserstoff, in dem die aus Solar- und Windkraft gewonnene Energie gespeichert wird, entsteht mithilfe von Iridium und Ruthenium und großen Mengen von SEE. Die Kernfusion setzt je nach Reaktortyp auf starke Magneten oder neueste Neodymlaser. Für beides braucht man SEE. Germanium senkt den Stromverbrauch von Mikroprozessoren und ist für Glasfaseranschlüsse, Nachtsichtgeräte sowie Wärmebildkameras unverzichtbar. Quantencomputer benötigen sehr leistungsfähige Halbleiter und Isolatoren. Und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz (ChatGPT ist erst der Anfang) hängt nur noch von der Leistungsfähigkeit der Computertechnologie ab, die sich ebenfalls mitten in einem Technologiespurt befindet. Die Materialwissenschaft ermöglicht diese Entwicklung durch besondere, beispielsweise aus Indium bestehende Quantenmaterialien. SEE und TM sind an allen diesen Entwicklungen beteiligt. Welche davon am Ende das Rennen macht und so einen neuen Kondratjew-Zyklus (eine Technologie, die den Zeitgeist einer ganzen Epoche bestimmt; siehe Kapitel 6) einläutet, lässt sich schwer vorhersagen. Vielleicht ist es eine Kombination gleich mehrerer aufstrebender Spitzentechnologien.
Auch die Medizin können diese Materialien revolutionieren: Dank des Halbleitermetalls Germanium könnte ein kleines Gerät bald das Coronavirus diagnostizieren, Prostatakrebs dank Gallium besser therapiert werden; Hafnium ermöglicht eine effektivere Strahlentherapie bei Krebserkrankungen, weil durch das Metall die halbe Strahlendosis ausreicht. Eine Therapie mit Rheniumfolie ermöglicht bereits eine wirksame Behandlung von Hautkrebs, eine mit Gallium misst unsere Körperwerte, und Kleidungsstücke mit Germanium fördern unsere Durchblutung.
Indium hilft, sauberes Trinkwasser zu erzeugen. Glasfaserkabel mit Germanium lassen Milliarden von Menschen an allen Ecken der Welt miteinander kommunizieren. SEE sind in Permanentmagneten und Katalysatoren eingesetzt, in Polituren und Metalllegierungen, in Batterien und Gläsern. Eine Prise des Technologiemetalls Germanium sorgt dafür, dass sich Supermarkttüren öffnen, eine Spur Gallium lässt LED-Lampen leuchten, und ein wenig Indium erlaubt es, unsere(n) Traumpartner(in) auf dem Handy nach rechts zu swipen.
Vor allem der Energiesektor sorgt für eine explodierende Nachfrage nach SEE und TM. Damit ist die Energiewende auch eine Rohstoffwende: Statt fossiler Brennstoffe sind jetzt Unmengen dieser Metalle nötig. Die Regierungen fast aller Länder haben in die Erforschung weiterer Alternativen mächtig investiert – in die Welt von morgen. Man muss diese Zeichen richtig lesen, denn: Wo das Geld hingeht, da ist die Zukunft.
Bei der Mobilität setzen Wirtschaft und Politik auf Elektroautos. Sie verbrauchen weniger Energie (kumulierter Energieaufwand) als solche mit Verbrennungsmotoren. Bis zu 1,5 Milliarden Tonnen Rohöl können durch den Austausch bis 2050 eingespart werden, hat Agora Verkehrswende im Auftrag des Öko-Instituts errechnet.2 Allerdings benötigen Elektrofahrzeuge für Motor, Batterie oder Brennstoffzelle mehr SEE sowie Lithium, Platin, Naturgrafit, Synthesegrafit und Kobalt. Durch den Zuwachs an E-Autos und anderen Elektrogeräten wird der Vorrat knapp; der Bedarf könnte in etlichen Segmenten die Produktionskapazitäten übersteigen. Auf jeden Fall werden die Preise steigen, „weil nicht garantiert werden kann, dass alle neu zu erschließenden Förderstätten rechtzeitig fertig gestellt (sic) werden oder dass der Export aus den Förderländern zu jeder Zeit in ausreichenden Mengen garantiert werden kann“.
Weltweit werden bereits mehr als 350 000 Tonnen Seltenerdoxid produziert, jährlich3. Technologien der Zukunft wie autonomes Fahren, magnetische Kühlsysteme, Drohnen und zivile Luftfahrzeuge für den Güter- und Personenverkehr werden den Bedarf steigern. In einem Elektroauto stecken bis zu fünf Kilogramm SEE, in den mächtigsten Windrädern mehr als eine Tonne. Es ist unübersehbar: Die Nachfrage wird steigen.
WAS UNS AUF DER REISE IN DIE ZUKUNFT BREMSEN KÖNNTE
Unglücklicherweise können Elemente der Seltenen Erden (SEE) nur durch einen aufwendigen Prozess gewonnen werden. Wirtschaftlich werden sie aus Mineralien wie Bastnäsit erschlossen, aus dem vier Fünftel der weltweiten SEE-Produktion stammen, aber auch aus Monazit, Xenotim und anderen. Solche Mineralien enthalten meist alle SEE, die sehr ähnliche physikalische und chemische Eigenschaften zeigen und deshalb aufwendig voneinander getrennt werden müssen. Durchschnittlich sind 100 Tonnen Gestein zu bewegen, um eine, zwei oder bis zu sechs Tonnen SEE zu bekommen, im Fall von Indium 20 000 Tonnen für eine Tonne; aus 200 Kilogramm Roherz bleibt ein Kilogramm Neodym zurück. Wie ergiebig die Erde ist, hängt davon ab, ob der Rohstoff sich in einem Gesteinsgemisch in homöopathischen Dosen oder wie ein Gewinnerlos in der Jahrmarktslotterie versteckt oder in Adern hochkonzentriert gebunden ist, wie in der Monazitader „unserer“ Mine. Extreme Knappheit kann zu extremen Preisen führen, was den Ausbau der Windkraft verschleppen und den Fortschritt in der Automobilindustrie bremsen kann – und die Bundeswehr wäre auch nur bedingt abwehrbereit.
Der größte Teil der auf dem Markt angebotenen SEE stammt aus China. Deutschland bezieht zwei Drittel seines Bedarfs von dort, ebenso erhebliche Mengen TM. China hat deren strategische Bedeutung längst erkannt. Für zwei kritische Technologiemetalle – Gallium und Germanium (unentbehrlich für Solarmodule und das Militär) – hat Peking im Sommer 2023 Exportkontrollen eingeführt, woraufhin die Handelsvolumen in den ersten Monaten deutlich abnahmen. Seit 3. Dezember 2024 liefert China beide Metalle nicht mehr in die USA – angeblich aus Sicherheitsgründen, doch ziemlich sicher ist es eine Retourkutsche für die am Vortag von den USA verhängten Restriktionen im Bereich Chiptechnologie. Wie auch immer, die Eskalationsspirale dreht sich weiter und weiter – wir sind längst mittendrin in einem Handelskrieg.
Der brutale Überfall Russlands auf die Ukraine und der durch die Sanktionen entstandene Gasmangel haben uns gezeigt, wie leicht andere Länder unsere Abhängigkeit ausnutzen könnten. Was kürzlich noch Russlands Gas war, nämlich potenziell ein politisches Druckmittel, könnten bald SEE und TM sein. Diese Erkenntnis verlangt Lösungen: Wenn die arbeitsteilige Welt zerfällt, müssen wir uns von dieser Abhängigkeit befreien. Dazu müssen wir eigene Vorkommen erschließen. Gleichzeitig haben wir die Chance, dafür zu sorgen, dass ihre Produktion weniger Nebenwirkungen hat, viel weniger als die Technologien, die wir damit überwinden können, zuallererst solche, die auf fossilen Energieträgern basieren.
Wer über SEE verfügt und sie kontrolliert, wer sie zu nutzen versteht, dem gehört die Zukunft. Staaten, die das jetzt erkennen, sind bald eine Weltmacht auf vielen Gebieten; sie setzen Maßstäbe bei der Energiegewinnung und beim Klimaschutz zugleich, in der Wirtschaft und nicht zuletzt beim Militär. Inzwischen sucht die EU deshalb nach alternativen Lieferländern und fördert auch die Eigenproduktion. Alle Welt ist inzwischen auf der Suche nach Ressourcen. China agiert offensiv und setzt sehr viel Geld ein. Autokratische Systeme sind bei diesem Rennen im Vorteil, da sie viel schneller und entschlossener handeln, mitunter auch gegen die Interessen der betreffenden Bevölkerung.
Rohstoffe waren schon immer politisch. Sie waren und sind Ursache für Kriege. Mit der Zusicherung an die USA, Zugriff auf Rohstoffe zu bekommen, versucht Ukraines Präsident Selenskyj, sich vom Joch des Krieges zu befreien. Kaum etwas ist machtvoller als der Besitz von Rohstoffen. Heute müsste kein Bundespräsident mehr zurücktreten, der wie Horst Köhler sagte, „dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen – negativ durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen“.
Was ist nun zu tun? Erster Lösungsansatz: Reserven anlegen. Jedermann kann dabei schon helfen – indem er oder sie Kapital so anlegt, dass es nützlich für die Gemeinschaft ist. Wer in diese kritischen und strategischen Rohstoffe investiert, baut mit an der Zukunft und hilft, Abhängigkeiten zu mindern. Das sehen wir als einen Auftrag. Es geht darum, diese Materialien nach Europa zu holen, sie dort einzulagern. Warum sollten wir uns nicht eine Reserve halten wie bei Getreide, Erbsen, Reis und Linsen? Volle Lager machen allerdings nur kurzfristig den Unterschied zwischen Macht und Ohnmacht. Daher braucht es weitere Lösungsansätze.
Wir benötigen dringend ein geschärftes Bewusstsein für unsere Abhängigkeit von Lieferketten und Rohstofflieferungen. Unser Unwissen und unsere Sorglosigkeit bezüglich der Bedeutung von SEE und TM gefährden Europas Zukunft, weil wir ohne sie in Technologie und bei der Wehrhaftigkeit zurückfallen. China und auch Indien brauchen keine Atombombe, um uns zu erpressen; Indien muss uns nur die (Rohstoffe für die) Antibiotika vorenthalten, China die Rohstoffe für die Industrie. Letzterem zu begegnen, sehen wir als unsere große Aufgabe.
REISEN SIE MIT UNS! AUCH PRIVATANLEGER KÖNNEN IN DIE ZUKUNFT INVESTIEREN
Dieser Auftrag birgt große Chancen – für Investoren und Unternehmen, für Deutschland und alle europäischen Industrienationen. Auch Privatleute können sich inzwischen daran beteiligen, uns aus der Rohstoff-Gefangenschaft zu befreien. Sie können mit SEE & Co. (viel) Geld verdienen – und dabei Nützliches tun. Auch Privatinvestoren können mittlerweile bei mehreren Anbietern diesem Markt beitreten. Wir möchten sie zu einem Investment in diese produktionskritischen Rohstoffe ermutigen. Sie sind ein sehr simples Investment, viel unkomplizierter als Aktien, Fonds oder Bitcoin. Sie versprechen mehr Sicherheit, denn die Investitionen in SEE und TM sind ein reines Warengeschäft. Sie kaufen bei einem Händler mit angeschlossenem Zollfreilager ein und erwerben echte physische Metalle, die in Ihren Besitz übergehen, anstatt beim Händler zu verbleiben und im Fall seiner Insolvenz verloren zu gehen. Bei einem Engagement in SEE und TM wirken sich Managementfehler nicht auf den Wert Ihrer Anlage aus, weil Sie nicht in Firmen und deren manchmal volatile Führung investieren. Sie können Ihr Eigentum verkaufen und im besten Fall beträchtliche Wertzuwächse erzielen. Selbst bei Inflation und Verschuldungskrisen kann man davon ausgehen, dass ihr Wert stabil bleibt, und gerade in Zeiten von Krieg und Zerstörung könnten Sie sogar besonders profitieren. Rohstoffe als langfristiges Investment (länger als 12, maximal 20 Jahre) sind die ideale Ergänzung in einem Mix zur Absicherung der Rentenlücke.
Für Anleger ist Sicherheit ein wichtiges Argument. Wenn die Welt nach Krieg riecht, dann stinkt es an den Weltbörsen: Goldpreis hoch, Ölpreis hoch, Aktien runter. In unsicheren Zeiten fließt das Geld zum Gold, wie im Jahr 2024 geschehen. Gold ist jedoch das egoistischste Investment; es geht nur um den eigenen Schutz. Gold hat keinen Zweck, es verschwindet zum großen Teil in Tresoren. SEE und TM dagegen gehen zu 99 Prozent in die Industrie. Wer trotzdem Gold erwirbt, sollte wenigstens prüfen, woher es kommt. Mit Gold finanziert Putin auch seinen Krieg. Aber es gibt eine Anlageform, die mehr kann als Gold – mit der Sie neben Ihrer eigenen Sicherheit etwas für unser aller Sicherheit tun können. Auch darüber werden wir sprechen – in Kapitel 6.
In unserer Welt, in der Katastrophenmeldungen die Nachrichten bestimmen, gehen positive Entwicklungen unter. Darauf hat der schwedische Statistiker und Mediziner Hans Rosling in seinem Buch „Factfulness“ hingewiesen. Die Bildungsrate steigt weltweit, auch die Lebenserwartung – in Afrika in den vergangenen 15 Jahren um zehn Jahre auf 61. Und weltweit sinkt die Zahl der Armen. Den Menschen geht es heute so gut wie nie zuvor. Es besteht Grund zur Hoffnung.





























