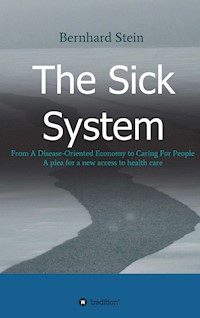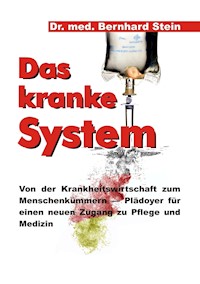
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Gesundheitssystem ist krank, aber noch zu heilen. Seine Ökonomisierung hat nicht nur den Beruf des Arztes zu einem ›Geschäftsmodell‹ auf einem ›Medizinmarkt‹ gemacht, sondern riskiert, zu einem ›unlogischen‹, inhumanen und ungerechten Versorgungssystem zu führen, ohne seine ökonomischen Ziele zu erreichen. Dr. Bernhard Stein zeigt die Schwachstellen unseres Gesundheitsversorgungssystems auf, das in seinem aktuellen Zustand nicht dazu geeignet ist, die gesellschaftlichen Anforderungen zukünftig noch zu bewältigen. Die medizinische Versorgung der Bevölkerung kann nicht an Wachstums- und Rationalisierungsmaßstäben allein ausgerichtet werden. Der Autor plädiert dafür, die Krise als Chance für eine grundlegende Neuausrichtung zu verstehen und stellt ein Konzept vor, in dessen Zentrum die Metamorphose des Akut-Krankenhauses alter Schule in eine schlanke, modulare und regional vernetzte Struktur steht - unter dem Leitmotiv ›ambulant vor stationär‹ und ›Synergie statt Konkurrenz‹. Das stellt die Menschen wieder in den Mittelpunkt und führt angesichts der ausufernden Kosten des Geschäftsmodells › Gesundheit‹ von der industriell-keynesianischen Herangehensweise weg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Dr. med. Bernhard Stein
Das kranke System
Von der Krankheitswirtschaft zum Menschenkümmern Plädoyer für einen neuen Zugang zu Pflege und Medizin
Copyright: © 2014 Bernhard Stein
Lektorat, Umschlag & Satz: Erik Kinting / www.buchlektorat.net
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Zum Autor:
Dr. med. Bernhard Stein, geboren 1956 in Braunschweig, ist Facharzt für Anästhesie, Intensivmedizin sowie Notfallmedizin und seit 1992 in leitender Funktion in Luxemburg tätig, nach Ausbildungsjahren in Klinik und Forschung in Deutschland und Frankreich.
Parallel zur klinischen Tätigkeit beschäftigt er sich, nach Zusatzstudien der Gesundheitsökonomie an der European Business School und Qualitätsmanagement an der Universität Kaiserslautern mit Fragen der Organisation des Krankenhauses und des Gesundheitssystems.
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Absturz oder Neustart
Analyse des Existierenden – Spiralen in den Abgrund
a. Was ist passiert?
b. Philosophische und ethische Fragen
c. Gesellschaft, Demokratie und Ökonomie
d. Unlogischer und überteuerter Aufbau der Krankheitsversorgung
e. Organisation und Vermarktung der Krankheit
f. Wissenschaft und Lehre: Publish or perish
g. Verrechtlichung der Medizin
Change – vom Kopf auf die Füße
a. Wo könnte die Reise hingehen
b. Rolle der Wissenschaft und des medizinischen Mainstreams
c. Nachhaltigkeit, Subsidiarität und Suffizienz in der Medizin
d. Rolle der Menschen / Patienten
e. Ein neues Konzept der Gesundheitsversorgung
I. Prävention und Gesundheitsinformation
II. Exzellenzzentren und Universitätskliniken
III. Regionalversorgung
Fazit
Eine Vision – Epilog
Bibliographie
Prolog: Absturz oder Neustart
Die Diskussion über das Gesundheitssystem ist ein delikates Unterfangen, ein Killer-Thema für politische Karrieren. Wegen seiner Komplexität und politischen Sprengwirkung gilt wohl statt too big to fail eher too big to be optimized.1
Dieses Buch versteht sich als ein Manifest, geboren aus der kritischen Reflexion und dem Gefühl, dass wir in eine falsche Richtung laufen.
Ausgangspunkt ist eine kritische, aber belegbare Analyse des Istzustandes, die unser wohlgeformtes Bild und unsere scheinbaren Wahrheiten infrage stellen, um daraus Alternativen für einen anderen Weg in der Pflege und Medizin aufzeigen.
Die Subjektivität besteht in der Interpretation der Fakten und der formulierten Thesen, durchaus auch provokant, aber belegbar und erfahrbar. Was wir daraus für Konsequenzen ziehen, hängt vom Reifegrad unserer Gesellschaft und dem Wunsch nach Veränderung ab.
Wir haben es hier mit einem komplexen System zu tun, das Opfer seines eigenen Erfolges zu werden droht. Seine ökonomische und politische Durchdringung beeinflusst und korrumpiert sowohl seine Protagonisten als auch viele normale Menschen.
Kritische Fragen ergeben sich, wenn wir uns in der Folge mit drei in der Gesundheitsversorgung weitgehend unbekannten Schlüsselbegriffen beschäftigen, die bislang nur aus anderen Bereichen bekannt sind bzw. in den letzten trente glorieuses2 verschollen sind:
Der Begriff der Nachhaltigkeit im Sinne der drei Säulen ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit ergänzt durch die inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit. Unser aktueller Ansatz der Krankheitswirtschaft ist nicht nachhaltig.
Die Subsidiarität als ein Prinzip, welches die Entfaltung der individuellen Fähigkeiten, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung anstrebt. Aufgaben, Handlungen und Problemlösungen sollten vom Einzelnen, von der kleinsten Gruppe oder der untersten Ebene einer Organisationsform erledigt werden. Nur bei unlösbaren Hürden sollen höhere Instanzen die Aufgaben unterstützen und übernehmen. Also, in der Gesundheitspolitik ein Bottum-up-Ansatz, vom Einfachen zum Komplexen oder auch von innen nach außen. Die Eigenverantwortung verkümmert unter dem Siegel von monopolisiertem Expertentum und Qualitäts- und Kostenmanagement. (ILLICH, 1995)
Die Suffizienz, der schonende Umgang mit Ressourcen – Finanzmittel, Menschen, Energie, Arbeitszeit und Transportwege etc. Der derzeitige Ressourcenverschleiß fördert ein unkontrolliertes und ungerechtes Wachstum. (SACHS, 1993).
Jede Krise bietet die Chance, aus der Not eine Tugend zu machen und neue Wege der Gesundheitsversorgung mit Vorbildcharakter, deren Kern ein Menschenkümmern ist, zu schaffen. In deren Mittelpunkt sollte eine soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit stehen, ein Zurückführen der eigenen Souveränität für Gesundheit, Krankheit und Tod und eine Pflege, die den Menschen nahe ist – und nicht zuletzt ein Umdenken hin zu einer Selbstbeschränkung auf das für die Menschen Sinnvolle und Gewünschte.
Damit wäre der Ausgangspunkt für einen Neustart geschaffen.
1.
These:
Das Verhältnis der Menschen zu Leiden und Krankheit sowie deren Behandlung hat in wenigen Generationen zu einem Zustand geführt, der langfristig weder ökonomisch zu tragen ist noch die Menschen nachhaltig befriedigt. Ein ganzheitlicher Ansatz und die Hilfe zur Selbsthilfe sind verdrängt worden durch eine Ökonomie- und von Technik getriebene Krankheitswirtschaft, die droht, sich zu verselbstständigen. Ihre vordergründigen Erfolge in Lebensverlängerung, Wirtschaftsleistung und Fortschrittsdenken vernebeln den Blick auf die andere Seite der Medaille: die Entmündigung der Menschen und die Entwicklung eines Gesundheitssystems, das mehr seinen Protagonisten dient als den Menschen.
2.
These:
Wenden wir ernsthaft die Begriffe Nachhaltigkeit, Subsidiarität und Suffizienz auf die Pflege und Medizin an, und geben wir uns wieder die Hoheit für Gesundheit, Krankheit und Tod, kann ein Neustart für eine andere Form der Gesundheitsversorgung entstehen.
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:
Geborenwerden hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit; Pflanzen hat seine Zeit, Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; Töten hat seine Zeit, Heilen hat seine Zeit; Abbrechen hat seine Zeit, Bauen hat seine Zeit;
Altes Testament
Der Prediger Salomo, Kapitel 3, die Verse 1-3
1Zu groß zum Scheitern gilt für systemtragende Institutionen und Banken, vor allem während der Sub-prime-Krise 2008 als Begriff verwendet, während die Gesundheit wohl ein zu großer Brocken ist, um reformiert zu werden.
2Trente glorieuses bedeutet die glorreichen 30 Jahre der Nachkriegszeit (1945 — 1973) bis zur Ölkrise, kann aber ebenso auf die letzten 30 Jahre seit 1984 übertragen werden.
Analyse des Existierenden – Spiralen in den Abgrund
a.
Was ist passiert?
Die heutige Medizin stellt, unter dem Impuls einer starken Ökonomisierung und Angleichung an industrielles Management, die akute Erkrankung und deren rasche, technisch und ökonomisch aufwendige Behandlung in den Mittelpunkt. Mehr noch, die gesamte Lebens- und Krankheitsgeschichte eines Menschen wird wie eine Aufeinanderfolge akuter Erkrankungen gesehen, wobei die soziale, psychologische und individuelle Dimension in den Hintergrund gerät.
Der Beruf des Arztes und des Pflegers, der auf einer menschlichen Zuwendung zum Patienten basiert und Vertrauen und Anteilnahme erfordert, wird zu einem Geschäftsmodell des marktwirtschaftlichen Tauschgeschäftes von Dienstleistungen (MAIO). Er wird entwertet und entkernt durch pseudoevidente Handlungsanweisungen, die die Arbeit mithilfe eines aus der Industrie entnommenen Arsenals von Prozessschritten und Therapiemodulen zu kosteneffizienten und erfolgsorientierten Konsumgütern werden lässt. (MAIO)
Die Medizin hat sich seit 100 Jahren immer wertfrei und wissenschaftlich gegeben, aber letztendlich mehr die Karte des bedingungslosen technischen und pharmakologischen Fortschritts, und weniger der sozialen oder gesellschaftlichen, gar globalen Weiterentwicklung gespielt.
Die rein quantitativen Probleme durch medizinischen Fortschritt und demografische Entwicklung, wie Zunahme alter und chronisch kranker Menschen, führen in eine Spirale, aus der eine dreifach brisante Problematik entsteht:
Die zunehmende Diskrepanz zwischen dem Anspruch einer gleichen und bezahlbaren Medizin trotz sozialer und regionaler Diskrepanzen und der Realität. Wenn wir bislang glauben, das gilt nur für Süd- und Osteuropa sowie die Dritte Welt, die ja so weit weg sind, werden wir rasch feststellen, dass der Riss sich innerhalb unserer Länder, Frankreich, Deutschland, befindet – regional und auch sozial
Diese Entwicklung geschieht zulasten chronischer und Alterserkrankungen, die medizinisch und ökonomisch in der Logik von akuten Erkrankungen über- oder fehltherapiert werden und weder von einer konsequenten Prävention noch alternativen und weniger invasiven Pflegekonzepten profitieren.
Begleitet und verstärkt wird dieses durch eine Entwicklung in Wissenschaft und Medizin, die weite Teile des medizinischen Mainstreams beeinflusst, im Sinne eines ständig wachsenden Medizinmarktes. Mit teuren Scheininnovationen in der Medikamentenbehandlung und neuen Befindlichkeitsstörungen, denen Krankheitswert suggeriert wird.
Folgen sind:
Fehlanreize und vor allem Fehlinvestitionen in einen weiterhin überdimensionierten, teuren Akut-Krankenhausbereich, der sich nicht adäquat an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen kann,
die Entwicklung einer weitgehend privat finanzierten, aber lukrativen Lifestyle Medizin,
die Vernachlässigung und unzureichende Entwicklung bei Pflege und Behandlung chronischer und Alterserkrankungen sowie des ambulanten Sektors,
die Monopolisierung der Medizin und Pflege durch ein Expertentum, seit 20 Jahren ergänzt und zunehmend dominiert durch Geschwader von spezialisierten Managern, Ökonomen und Qualitätsmanagern, mit dem Ergebnis einer durchaus effizienten Spitzenmedizin, aber der Schaffung einer Mehr-Klassen-Medizin und der zunehmenden Entmündigung der Nicht-Experten und Patienten.
Während sich Politik, Öffentlichkeit, aber auch Berufsverbände oft auf die Spitzenmedizin und den medizinischen Fortschritt konzentrieren, wird vergessen, dass sich ca. 90 Prozent der medizinischen Versorgung der Bevölkerung in ihrer Region, vor ihrer Haustür und außerhalb von Universitätszentren abspielt.
Gerade die Region ist der erste Leidtragende von Defiziten in der Versorgungskette, gleichzeitig aber auch von besonderer Bedeutung bei der Prävention und Behandlung chronischer Krankheiten und des Alters. Sie stellt ein Schlüsselelement unseres Gesundheitssystems für die Zukunft dar.
Will die Gesellschaft ein Abwenden von der Krankheitswirtschaft hin zu einem tragfähigen und innovativen
Konzept der Gesundheitsversorgung anstreben, so funktioniert dieses nur unter der Voraussetzung einer Gesamtphilosophie und eines Gesamtkonzeptes, welches die Herzen, Köpfe und Brieftaschen der Menschen, der Experten und Entscheider erreichen kann.
3.
These:
Unter dem Eindruck spektakulärer Erfolge der Akut-Medizin monopolisiert eine bestimmte Sicht der Medizin unser Leben. Leiden, Leben und Krankheit werden unter dem Blickwinkel der akuten Störung und deren technologisch-pharmakologischen Behandlung mit maximalem finanziellem und technischem Einsatz gesehen. Auf der Strecke bleibt eine sozial ausgewogene, regionale Versorgung, die den Menschen bewusst in seinem Lebenskontext und seiner individuellen Verantwortung belässt.
b.
Philosophische und ethische Fragen
In der Rückschau hatten sowohl Naturvölker, alte Kulturen als auch die Menschen bis zum Mittelalter eines gemeinsam: Krankheit, Tod und Heilung gehörten in einen höheren Rahmen, ein allgemeines Weltbild, und waren Ausdruck eines Ungleichgewichts in diesem System. Heilung hatte daher den Charakter der Versöhnung mit einer höheren Macht. (SCHIPPERGES)
Im Mittelalter war sowohl in der christlichen als auch der arabischen Welt Heilung mit dem ewigen Heil und Krankenfürsorge mit Seelsorge verbunden. Die Pflege folgte den Grundsätzen der menschlichen Fürsorge, die Medizin war sozusagen ein Begleit- und Rahmenprogramm, zu dem im Grunde vorbestimmten Schicksal. Der Mensch selbst war in diesem System einerseits stark verantwortlich für sein Leben und sein Heil, sein Ansprechpartner war die höhere Macht, die sein Glaubens- und Lebenssystem bestimmte. Gleichzeitig lastete auf ihm nicht allein die Verantwortung für sein Schicksal und seine körperliche und seelische Gesundheit.
Die Aufklärung und Entwicklung der Naturwissenschaften verhalfen der Medizin zu ungeahnten Erkenntnissen und Erfolgen sowie zu einer komplett veränderten Sichtweise des Lebens. Alle Lebens- und Denkprozesse wurden in biologische und biochemische Vorgänge zerlegt, die sich einerseits verstehen und beeinflussen lassen, begleitet von der technologischen Revolution der Kommunikationsmedien und einer scheinbaren Verfügbarkeit von Information und Wissen für jedermann.
Die Säkularisierung der Gesellschaften geht einher mit diesen Entwicklungen und gibt dem modernen Menschen nun die Verantwortung für das Große und Ganze auf, in Vertretung einer höheren Macht. Mit dem Effekt für den Einzelnen, dass er nun ganz für sein Leben, seine Gesundheit, Krankheit und seinen Tod verantwortlich ist, dieses aber zunehmend an Experten delegiert. Angesichts der naturwissenschaftlichen Komplexität und der Rasanz der Wissenschaften verliert der Mensch rasch die Bodenhaftung zu seinem Körper und versucht dieses Manko mit drei Gegenmaßnahmen zu kompensieren, die uns die neue Welt geschenkt hat:
Die Wissens- oder besser Halbwissens-Revolution durch die moderne Kommunikation, die den Menschen suggeriert, sie könnten den Dingen nun in Echtzeit folgen und alle Prozesse auch als Nicht-Fachmann durchschauen.
Die Verrechtlichung des gesamten Lebens, die zur Folge hat, dass die Jurisprudenz als Gegengewicht zu einer höheren Macht hier auf Erden für Gerechtigkeit zu sorgen hat.
Die Ökonomisierung von Krankheit, Medizin und Pflege ist die letzte und wohl die am tiefsten greifende Veränderung in dieser Entwicklung. Analog zu allen anderen Lebensbereichen kommt hier ein Prozess mit einer Präzision und Durchschlagskraft, beflügelt durch die technologische Entwicklung und die Globalisierung, der wie ein gigantisches Hochwasser alle Zonen des Lebens und des Handelns erfasst. (LAFONTAINE, 2014) (MAIO)
Die Entwicklung auf unserem Planeten folgt einer Philosophie des unbedingten Wachstums als Motor für sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt, welche die ökologischen und sozialen Ressourcen ohne reelle Folgenabschätzung nutzt und verbraucht. Dieses wird im Rahmen der Globalisierung und kommunikativen Vernetzung in jeden Winkel der Erde getragen, ist aber oft begleitet von einer intellektuellen Verflachung und Herrschaft der Mittelmäßigkeit, die die Entwicklung unserer Gesellschaft als alternativlos darstellt.
So unerbittlich und präzise diese Maschinerie arbeitet und alle Lebensbereiche erfasst, so wenig ist dahinter ein Masterplan zu erkennen (WELZER, 2013) (KEMPF, 2013). Die oben angeführten Begriffe der Nachhaltigkeit, Subsidiarität und Suffizienz fehlen in diesem Szenario ebenso, wie intergenerationelle Gerechtigkeit und Ausgleich (SIDELSKY & SKIDELSKY, 2013). So sind wir zwar in der Lage, die Erde mit dieser Philosophie effizient zu durchdringen, nicht aber deren Folgen auf das soziale, ökologische und ökonomische Gleichgewicht zu erfassen oder gar zu beherrschen.
Ein weiterer, neu-diskutierter bzw. wiederentdeckter Faktor liegt in der Soziologie moderner Institutionen und Unternehmen, die als Stupidity based theory of Organization (ALVESSON M.) (CIPOLLA) (CANTO), sozusagen als Herrschaft und Hegemonie der Mittelmäßigkeit, beschrieben werden kann.
Entgegen dem nach außen erklärten Ziel, die Talente und exzellenten Fähigkeiten der Mitarbeiter einer Organisation in deren Vielfalt zu fördern, um den Erfolg zu garantieren, findet eine entgegengesetzte Entwicklung statt; hin zu einer pseudoharmonischen Organisation mit einem manipulierten positiven Selbstbild, von Alvesson und Spicer als