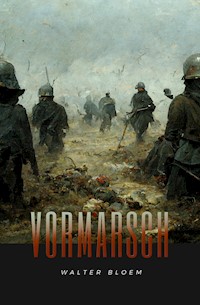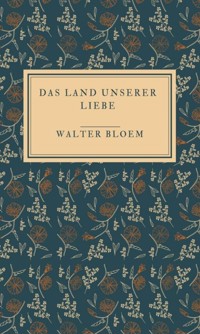
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Um die kahlen, von harzigen Knospen geschwellten Ulmenriesen des Harvestehuder Weges brandete der Märzsturm. Auf den breit anschwellenden Rasenflächen der Villa Freimann taute letzter Schnee. Der Generaldirektor kam schleppenden Schrittes die breite Freitreppe herunter. Fröstelnd zog er den Nerzpelz um seine Schultern zusammen. Der legt mächtig ein! dachte der Chauffeur. Und im tiefsten Herzen des altbewährten Bediensteten regte sich doch fast unbewußt etwas wie eine geheime Genugtuung des Kleinen, des Knechtes, über den unverhehlbaren Verfall des Mächtigen, des Hochmögenden ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Land unserer Liebe
von
Walter Bloem
1
Um die kahlen, von harzigen Knospen geschwellten Ulmenriesen des Harvestehuder Weges brandete der Märzsturm. Auf den breit anschwellenden Rasenflächen der Villa Freimann taute letzter Schnee. Der Generaldirektor kam schleppenden Schrittes die breite Freitreppe herunter. Fröstelnd zog er den Nerzpelz um seine Schultern zusammen.
Der legt mächtig ein! dachte der Chauffeur. Und im tiefsten Herzen des altbewährten Bediensteten regte sich doch fast unbewußt etwas wie eine geheime Genugtuung des Kleinen, des Knechtes, über den unverhehlbaren Verfall des Mächtigen, des Hochmögenden ... Dies Gefühl war den Tönen jenes Liedes verwandt, dessen verwehte Klänge durch den trüben Vorlenzmorgen von der Lombardsbrücke herüberflatterten:
»Was hoch und stolz, das fällt
im Sturm der neuen Zeit —
jetzt bringen wir der Welt
die rote Seligkeit!«
Auch der Generaldirektor horchte auf. Eine neue Falte querte sich senkrecht durch die tiefen Furchen seiner schmal gewordenen Stirn.
Der Chauffeur gewahrte dies Lauschen, dies Stutzen.
»Meinen Herr Präsident nicht, daß es besser wäre, heute nicht —«
»— nicht zu fahren, Hansen? Das souveräne Volk von Hamburg nicht zu reizen? Es ist alles eins ... Haben Sie übrigens eine Ahnung, was los ist?«
»Sie sind mal wieder sehr unruhig da drinnen ... Seit gestern kommen immerfort Züge mit heimkehrenden Kriegsgefangenen aus Rußland an«, berichtete der Chauffeur. »Die haben uns grad noch gefehlt. Alles die reinsten Bolschewisten, Herr Präsident!«
Der Generaldirektor zuckte die Achseln. Aber dann schauderte er in seinem schweren Pelz doch sekundlich zusammen. Ihn schüttelte der Ekel ... Diese Zeit — dieses Volk ...
Er straffte sich auf. »Los, Hansen!«
Das Auto sauste über die Lombardsbrücke. Einen Augenblick überflog der Generaldirektor mit einem kaum bewußten Gefühl von liebeschwerer Verbundenheit das vertraute Bild: zur Rechten das Quadrat der Binnenalster mit den hufeisenförmig darumgestellten drei Fronten der majestätischen Handelspaläste — zur Linken die im Nebel verschwimmenden Ufersäume des fernhin sich dehnenden Außenbeckens. Aber leer, wie ausgestorben die ehemals froh belebte Fläche ... Kein flugfrohes Segel, kein munter flitzendes Dampferchen ... Da fauchte der Wagen an einem Zuge von Heimkehrern vorüber. Eine rote Fahne wehte voran. Der sie flattern ließ, trug nicht Feldgrau — seine kalmückische Gestalt stak im schwarzen Anzug der russischen Kriegsgefangenen ... Und hinter dem Steppensohne trotteten in Gruppenkolonnen, wie sie's einst auf dem Kasernenhof gelernt, vier Jahre lang im Felde geübt, die Entronnenen der kaukasischen Bergwerke — in verschlissenen Soldatenmänteln, die hageren Gesichter bartumstarrt, rote Fetzen irgendwo auf die Monturen genäht, rote Kokarden auf den schiefgestülpten Feldmützen ...
»— jetzt bringen wir der Welt die rote Seligkeit —«
Stockung — Schreie — geballte Fäuste — — aber schon war's vorüber — ein Stück verschimmelten Brotes flog gegen Freimanns Nacken.
Der Generaldirektor hatte unwillkürlich den schmerzenden Kopf tief in den Pelzkragen gedrückt. Als er den Blick hob, traf eine neue Qual seine gemarterte Seele. Vor ihm zur Linken stieg der vielfenstrige Würfel des Atlantic-Hotels aus dem Nebel. Auf dem First der fremdenleeren Riesenkarawanserei, die einstens die Sendlinge des Erdballs beherbergt hatte, wehten die Banner der Entente und gaben Kunde, daß drinnen die Kommission des Feindbundes zur Beaufsichtigung der Auslieferung der deutschen Handelsflotte ihr Standquartier aufgeschlagen hatte. »— die rote Seligkeit — —«
Hatte es Sinn zu arbeiten, — — mit zusammengebissenen Zähnen zu kämpfen für ein rettungslos Verlorenes?!
Georg Freimann fühlte, wie die Verzweiflung über ihm zusammenschlug.
Im stolz hingelagerten Verwaltungsgebäude der Hansa-Transatlantik-Linie schleppte der Arbeitstag sich gähnend und zwecklos hin — angefüllt mit dumpfen Ängsten und Ahnungen. Man arbeitete nicht mehr — man wurde beschäftigt ... Die gigantische Maschine lief leer.
Aus dem satten Braun des eichengetäfelten Prunkbureaus trat dem Generaldirektor eine schlanke Mädchengestalt in schlichter Bluse aus grauer Kunstseide entgegen. Ein flüchtiges Lächeln überflog die gelben Züge des Chefs. Wie täglich empfand er halb unbewußt die Wohltat dieses klaren, in sich gefestigten Gesichts.
»Herr Präsident,« sagte Antje Tietgens, »die Entente-Kommission hat soeben aus dem Atlantic-Hotel angerufen: der amerikanische Sachverständige sei gestern angekommen und habe heute die Revision des ›Altreichskanzlers‹ vorgenommen — das Schiff solle heut nachmittag um drei Uhr in See gehen und könne nach Prüfung des Ganges auf der Höhe von Cuxhaven übernommen werden.« In der Stimme der Sekretärin schwang leise die tiefe Trauer, das grenzenlose Mitgefühl einer Wissenden.
Der »Altreichskanzler«! Georg Freimann mußte sich auf die Stuhllehne stützen. Längst fällige Botschaft — dennoch — unfaßbar — unerträglich!
Das letzte Schiff der H. T. L. — das schönste — und das letzte!
Der »Altreichskanzler« war zwei Jahre vor Kriegsausbruch vom Stapel gelaufen — die vollkommenste Schöpfung der Hammonia-Werft — am ersten August zum Glück im Heimathafen — dann, in ein Kriegsschiff verwandelt, vier Jahre lang als Hilfskreuzer in der Ostsee, Mitkämpfer der ruhmvollen Tage von Ösel und Dagö — nun gemäß den Waffenstillstandsbedingungen in den stolzesten Passagierdampfer der Welt zurückverwandelt — um als letzter Besitz der einstmals erdumspannenden deutschen Großreederei dem Feindbund ausgeliefert zu werden.
Fräulein Tietgens blieb noch einen Augenblick stehen. Sah es nicht aus, als würde der gewaltige Mann, dessen Werk die Linie war, auf der Trümmerstätte seiner Schöpfung zusammenbrechen? Ihr Herz ward weit vor Mitleid — und sie zürnte sich selber, daß in den Tiefen ihrer Seele sekundenlang die geheime Genugtuung der Tochter der Niederung über den Sturz des Hochmögenden hatte triumphieren wollen ...
Schäm' dich, Antje! —
Ihre weibliche Hilfsbereitschaft brauchte nicht in Wirksamkeit zu treten: der Chef hielt sich. Aber er schien keine weiteren Befehle zu haben. Geräuschlos verließ die Sekretärin den Raum.
Georg Freimann war allein. Eine Sekunde lang zuckte wie ein tiefer, erlösender Traum die Vorstellung durch sein todwundes Hirn, daß daheim im Schubfach seines Arbeitstisches nun seit dem Tage des Waffenstillstandes der geladene Browning des Augenblicks harrte, da die Wucht des Schicksals unerträglich geworden sein würde ... War es so weit? Konnte es noch tiefer in den Abgrund gehen?
Mein Lebenswerk! ächzte seine Seele. Mein Lebenswerk!
Ja — es ging zu Ende. Diesen Tag würde Georg Freimann nicht überleben können.
Horch! und draußen schon wieder das Lied von der roten Seligkeit! Wahnsinnige, diese einstigen Helden von Gorlice und Tarnopol — diese — — Deutschen ... Sahen sie denn nicht, daß sie und ihresgleichen die Heimat in den Ozean der Schande, sich selber und all ihre Welt ins Elend gestürzt hatten?!
Abermals straffte sich der Generaldirektor. Der Instinkt des Handelnmüssens, der Verantwortung, des Führertums überwand noch einmal die tödliche Erschlaffung. Und schon lag der Telephonhörer in seiner mageren Hand, schon flogen seine Befehle in entfernte Räume des vielzelligen Arbeitsklosters. Sie stellten aus Ingenieuren und kaufmännischen Oberbeamten die Kommission zusammen, welche als Vertreterin der Linie die Probefahrt des »Altreichskanzlers« mitzumachen und die Übergabeverhandlungen mit den Mitgliedern der feindlichen Abordnungen zu tätigen haben würde. Aber die sonst so klare Herrscherstimme des Chefs klang an das Ohr seiner Mitarbeiter wie geborsten ...
Er überhörte ein bescheidenes Klopfen an der Flurtür und fuhr erst herum, als eine linde Hand sich auf den Arm legte, der die Schalthebel des Fernsprechers regierte.
»Ah — Johanna?!« Des Gatten Auge staunte. »Du strahlst ja — — etwa gar Nachrichten von Heinz —?!« So lächelt eine Mutter nur, wenn sie Gutes von ihrem Kinde zu melden hat ...
Wortlos leuchtend reichte Frau Johanna ein Telegramm. Georg las:
»Aus Bremerhaven — Endlich in Freiheit, eintreffe, sobald Zeitläufte gestatten. Heinz.«
Nun war der Jubel auch in des Vaters Stimme und Auge gekommen. Einen Augenblick schlugen die Herzen der beiden wesensfremden Menschen im gleichen Takt. Und über Georg Freimann, der sonst, eiskalter Rechner, einsam den Weg seines Aufstiegs gegangen war, kam in dieser Sekunde etwas wie Dankbarkeit gegen die Mutter seines Sohnes ... Ein Verbündeter, ein Kampfgenoß im Anmarsch ... Er zog die feine, kühle Hand an seine Lippen. Und vor beider Gatten Augen stand das Bild ihres Einzigen, wie sie ihn zum letzten Male gesehen — für wenige Tage von der flandrischen U-Bootbasis in Brügge her auf Urlaub eingetroffen — noch dampfend von ungeheuren Spannungen heroischer Gefechte, Gebieter einer Nußschale von Kampfschiff, eines stählernen Haifisches, dessen Kiefer Tod und Verderben durch die Seewüste zu den Riesen der feindlichen Handelsflotte hinübergespien ... Ein Held, um so heldenhafter, je weniger sein überzarter Körper, seine überzarte Seele zu solchem Reckentum der Meerestiefe geschaffen schienen. Und an seiner Seite die Braut, selig und bangend, in ihrer stolzen, altererbten Vornehmheit dem Wesen dieser Frau verwandt, die einstmals die althamburgische Gediegenheit ihrer Gesinnung dem zähen Auftrieb des Emporsteigenden verbunden — und dem heißen Wollerblute des Ringers jenen Schuß verträumter Weichheit beigesellt, die den Vater an seinem Sprößling oft gestört, befremdet, enttäuscht hatte ...
Die Gatten sahen sich in die Augen. Waren sie einander fremd im Nebeneinander des Alltags — wenn's um Heinz ging, so verstanden sie einer des andern Gedanken.
Wie wird er wiederkommen? Wie wird er, der die Fremde, die Gefangenschaft so schwer ertrug — wie wird er die Heimkehr — — die Heimat ertragen?!
»Gottlob, daß er seine Ilse hat ...« sprach Mutter Johanna die Antwort auf die stumme Frage der beiden Elternherzen.
»Weiß sie's schon?« fragte Georg.
»Einstweilen bist du noch der nächste dazu — als Vater ...«
Die beiden alternden Menschen sahen sich abermals an — der zähe Emporkömmling und die Frau aus altem Bürgerblut. Und sie erlebten im Flug einer Sekunde noch einmal den Augenblick, da ihrer beider Wesen zusammengeronnen war, um diesen Menschen zu bilden, der als Ganzes eben darum ihnen beiden so unähnlich war ... Und abermals neigte des Generaldirektors schmaler Usurpatorenkopf sich auf die zarte, mädchenhafte Hand der Frau, die seinem Aufstieg das Relief gegeben hatte.
»Nun, dann wird's aber höchste Zeit!« lächelte Freimann und bestellte eine Verbindung mit der Hammonia-Werft.
Inzwischen berichtete er seiner Frau, daß heute nachmittag der »Altreichskanzler« in See gehe.
Frau Johanna kannte die tragische Bedeutung dieser Nachricht. Ihrer Vorstellung von althamburgischer Kaufmannssolidität war die rasende Aufwärtsentwicklung der Linie immer unheimlich gewesen, unsympathisch die dämonische Betriebsamkeit ihres Ehegefährten, in der sich Kraft und Anpassung, steifer Nacken und — gelegentlich! — krummer Buckel so seltsam vermischt hatten ... Immerhin: es war doch eine stolze Höhe, auf die er sich selbst und sie mit hinaufgehoben — und um so zäher, vernichtender nun der Sturz. Sie fühlte, daß er litt bis zur Unerträglichkeit — fühlte sich seinen Leiden näher als ehedem seinem unersättlichen Auftrieb. Was sie in Jahren, vielleicht seit einem Jahrzehnt nicht mehr getan — sie legte ganz leise den Arm um des Gatten Haupt und wollte es an sich ziehen.
Aber schon entwand er sich — er verstand es nicht, sich bemitleiden zu lassen. Zum Glück schnarrte eben der Apparat.
»Hier Hammonia-Werft!« klang die vertraute Stimme der heimlichen Verlobten seines Sohnes.
»Guten Morgen, Ilseken!« Und in Georg Freimanns starrem Erobererherzen tat eine zweite Geheimkammer sich auf. »Mama ist bei mir — sie hat eine Nachricht für dich, die sie dir selber sagen muß!«
Frau Johannas Augen wurden feucht, als sie der künftigen Schwiegertochter die befreiende Kunde zurief. Ach, daß man sich nicht sah in diesem Augenblick der Erlösung von jahrelangem Bangen ...
Seltsame Härte des modernen Lebens ... Die Mutter und die Verlobte des Heimgekehrten hörten eine der anderen Stimme — den Jubel, der durch die verhaltene Kühle schwang — und sahen einander nicht ...
»Na, nun gib mal her, Johanna — ich muß den alten Carstensen noch sprechen!«
Zauberei! Der kleine schwarze Trichter in des Reeders Hand sprach nun plötzlich mit der müden, verhaltenen Greisenstimme des ehemaligen Senators Carstensen — des Eigentümers und Leiters der Werft. Sie zitterte, als Georg Freimann die grausame Kunde vom bevorstehenden Ende der Linie hindurchgegeben.
»Entsetzlich ... wie tragen Sie's?«
Georg Freimann biß die Zähne zusammen.
»Wir sind nachgerade abgehärtet — wir unglückseligen Deutschen ...«
»Das weiß der Himmel — aber grausam ist's doch ... Ein Glück, daß Ihr Junge kommt — da bekommen Sie Hilfe ... Sein Beruf ist überflüssig geworden in Deutschland. Wohl ihm und Ihnen, daß in seines Vaters Riesenbetrieb ein Kontorstuhl für ihn freisteht ... Nur — ob er mögen wird —?!«
Des Vaters Lippen wurden schmal und streng. »Er muß.« Ein Befehlsblick schoß zur Mutter hinüber, die unter diesem Ton, diesem Blick leise zusammenzuckte — wie unzählige Male zuvor in einem langen Gemeinschaftsleben.
»Nun, wir sehen uns ja wohl heut abend,« klang die Stimme des alten Carstensen. »Ich wenigstens will zur ›Alten Liebe‹ fahren — von ferne noch einmal das stolzeste Kind meiner Werft grüßen ... Ach, Freimann — unser Werk — unser zertretenes Land ...«
»Auch ich muß hin —« knirschte Georg Freimann, »auch ich ... Man muß das sehen, man muß ... Und wenn's einen vollends umschmeißt ... Also Schluß, lieber Freund — heut abend um fünf an der ›Alten Liebe‹ —«
»Einen Augenblick, Freimann,« klang Carstensens Stimme. »Timmermanns möchte Sie noch sprechen ...«
Und abermals eine Wandlung. Aus dem kleinen geheimnisvollen Abgrund in des Präsidenten Hand, der eben noch des alten Herrn vibrierende Stimme ausgeströmt, dröhnte nun der urweltliche Baß eines Titanen. Bob Timmermanns — gleich Freimann ein siegreicher Kämpfer — die rechte Hand seines alternden Chefs, das technische Genie der Werft und Oberleiter des gewaltigen Apparats der Konstruktionsbureaus, aus dem die Pläne all der umwälzenden Neuerungen hervorgegangen waren, die dann Gestalt gewonnen hatten.
»Hier Timmermanns ...«
»Hier Freimann ... Haben Sie gehört, Timmermanns — der ›Altreichskanzler‹ —?!«
Ein zorniges Knurren klang aus dem Apparat. »Hab's gehört ... mache mit ... Die Kerle, die mein bestes Schiff einstecken wie'n gestohlenes Portemonnaie — die muß ich mir doch mal aus der Nähe besehen ...«
»Tun Sie's nicht, Timmermanns — Sie springen den Burschen ins Gesicht ... hat ja keinen Zweck ... wir liegen unten.«
»Weiß, weiß ...« keuchte es zurück. »Hab' als Kaiserlicher Marineingenieur auf der in Watte gewickelten Hochseeflotte vier Jahre den Maulkorb getragen ... So viel Selbstbeherrschung werd' ich schon noch aufbringen, daß ich den Anblick der Messieurs und Gentlemen und Signori aushalt', ohne einen davon in die Elbe zu schmeißen ... Aber einen Schwur werd' ich schwören bei ihrem Anblick — einen Schwur, den der Himmel erhören soll ... oder die Hölle — je nachdem —!«
2
Der Berlin-Hamburger D-Zug schnob durch die kahlen Marschen von Billwärder, auf deren Feldern die Frühsaat saftgrün in Halme schoß. Seinem regelmäßigen Bestand an Durchgangswagen waren vier Waggons dritter Klasse angehängt — für einen Trupp heimkehrender Kriegsgefangener, die aus Hamburg, Harburg, Altona stammten.
Sie hatten ein abenteuerliches Schicksal hinter sich. Aus den kaukasischen Bergwerken hatten sie sich nach Ausbruch der russischen Revolution im Fußmarsch bis Moskau durchgeschlagen. Hier waren sie einem »Arbeiter- und Soldatenrat« der deutschen Kriegsgefangenen in die Hände gefallen, der von der Sowjetregierung beauftragt war, die in der Hauptstadt eintreffenden Kameraden zu empfangen, zu versorgen — und nebenbei nach Kräften zu bolschewisieren. Die Mitglieder dieses edlen Rates, eine Gesellschaft übelster Sorte, hatten die ihnen überwiesenen Leidensgefährten, statt sie unverzüglich nach Deutschland weiterzubefördern, mit kaum verhüllter Gewalt zurückgehalten. Nur ab und an fertigten sie, um den Schein zu wahren, einen Transport nach Deutschland ab. Für den aber suchten sie nach Möglichkeit nur solche Heimkehrer heraus, welche sich ihre bolschewistische Theorie und Praxis gründlich zu eigen gemacht hatten. Von dieser Sorte waren die anderthalb hundert ehemaligen Werft- und Hafenarbeiter aus dem Hamburger Bezirk, die der Berliner Zug heute morgen ihrer Heimat entgegentrug. In ihren verworrenen Seelen tobte ein wilder Tanz der Gefühle: Heimkehrbangen, Wiedersehensfreude, Sehnsucht nach der lang entwöhnten Berufsarbeit — das alles wirkte und wühlte wohl im innersten Herzensbezirk. Aber nach außen trugen sie ein ganz anderes Wesen zur Schau. Waren sie nicht die Träger und berufenen Verkünder der großen Heilslehre aus dem Osten? Schon beim Halten in Spandau waren sie aus den ihnen angewiesenen Wagen herausgeströmt und hatten sich durch den ganzen Zug verbreitet. Sie lümmelten sich auf den mit roter Kriegsleinwand bespannten Polstern der ersten Klasse, setzten im Speisewagen die Unterstützungsgelder der Hilfskomitees in Schnaps und Sekt um und entsetzten die verschüchterten Fahrgäste durch greuliche Reden von Zukunftsstaat, Ausrottung der Bourgeoisie und Diktatur des Proletariats.
In einem Abteil der ersten Klasse lagen, langhingestreckt auf den roten Bänken, von denen die berechtigten Fahrgäste mit Entsetzen in die Korridore entwichen waren, zwei ungleiche Kameraden in abgewetzten, verdreckten, verlausten Feldmänteln. Sie qualmten Zigarette um Zigarette. Und Tedje Tietgens, einst Nieter auf der Hammonia-Werft, dann schwerer Artillerist und seit der Brussilowoffensive Kriegsgefangener im fernen Osten des Zarenreiches, entwickelte dem Genossen seines Handwerks und seiner Gefangenschaft seine Zukunftspläne.
»Deerns, Clos, junge Deerns möt ick nu irst mol hebben ... Ick bün, as wör ick rein dull un uthungert op Deerns ... Öber nich son'n smuddlige Mietjes ut de Fabriken. Uns' russ'sche Kam'roden, wat dei sünd, weißt du, Clos, de hebben sick den'n Zoren sien Döchter halt ... Ick hal mi de Fienste von de Fienen ut'n Harvestehuder Weg ... un denn möt dei danzen, as ick fleit ... Junge, Junge, dat möt ick erleben ... Nu sünd wi de Herren, nu warden dei Wiewer requirert, as Volkseigentum erklärt und denn sozialisert ...«
Und der ungeschlachte Geselle dehnte und rekelte den stämmigen Leib, dem zwei Jahre harter Fronarbeit unter der Knute russischer Aufseher von seiner Urkraft so wenig hatten nehmen können wie einst die minder schwere, doch ungleich gefahrvollere Arbeit des Nietens, hoch droben am werdenden Eisenleibe gigantischer Schiffsrümpfe.
Sein Gefährte, untersetzt, kräftigen Leibes wie er, doch neben dem klobigen Gesellen fast schmächtig anzuschauen, lag ganz still und behaglich hingestreckt und schaute den Kringeln seiner Zigarette nach, die am Gepäcknetz verstiebten.
»Achtstündigen Arbeitsdag!« träumte er mit verschleierter Stimme vor sich hin. »Klock veer is Sluß op dei Werft! Un denn nah Huus, un in mien Quartier heff ick'n Pianino ... un denn späl ick'n ganzen Obend ... ganz wunnerscheune Soken späl ick denn, Schumann un Brahms ... nich ümmer blot taun Danz as vör Tieden ... Ja ... wenn man blot mien Finger nich ümmer so stief wören von dei swore Arbeit op dei Werft ... denn spälte Clos Mönkebüll bi de groten Konzerten.«
»Du büst'n groten Quasselkopp un Spintisierer, Clos!« knarrte Tedje. »Nu kannst du fiene Dam's kriegen, so väl as du wullt — un brukst jem nich erst wat optauspälen, dat du sei dull makst nah di ... Nu brukst du blot mol kommanderen: Runter mit die Lappen! — denn hest du s' all, as sei wussen sünd ...«
Eine Unruhe entstand im Zug. Aus allen Abteilen drängten die schweißdunstigen, bartumstarrten Gestalten der Heimkehrer in die Gänge.
»Hamborg! Kiekt blot, Jungs, nu kümmt Hamborg!«
Straßenzeilen drängten sich an den Zug heran, hochragende Speichergebäude, alles grau und geschwärzt im fahlen Lichte des nebelverhangenen Vorlenztages ... Und nun:
»Kiekt, Jungs — de Hoben ... Ober wo leddig ... Dunnerslag noch mol — wo leddig; grod as weer hei utstorben ...«
Die Männer hatten seit ihrer Rückkehr aus Feindesland schon viel von ihres Vaterlandes Schicksal geschaut. In fremder Städte Bannkreise waren sie sich der grauenvollen Veränderung nicht voll bewußt geworden — hatte der begeisterte Empfang, den die Genossen ihnen bereitet, das trunkenmachende Bewußtsein des inneren Sieges ihrer Klasse ihnen die Erkenntnis der vernichtenden Folgen der äußeren Niederlage bis zu dieser Stunde noch verschleiert. Nun tat sich ihre Heimat, ihre Arbeitsstätte vor ihnen auf — nun fröstelte jählings in ihren Seelen die entsetzliche Ahnung, daß die Hand des Feindes nicht dem verhaßten Kapitalismus allein, nein, jedem einzelnen von ihnen die Wurzeln des Daseins abgrub.
Schon lief der Zug in die rußige Halle des Hauptbahnhofs, und bald strudelten die Heimkehrer die Treppen zur Durchgangshalle hinan, quollen als mißfarbiger Schwall auf den fast ausgestorbenen Glockengießerwall hinaus. Und wieder nun, wie bisher auf allen Stationen, wehte ihnen das geliebte, mit fanatischer Inbrunst verehrte Rot entgegen. Empfangskomitee, Kaffee, Wurststullen, Begrüßungsreden:
»Willkommen, Brüder, Genossen, Proletarier im befreiten, verjüngten Vaterlande!«
Die bis zum Überfluß vernommenen Phrasen zündeten nicht mehr so hitzig wie in Breslau und Berlin ... Auf den gefurchten Stirnen, unter den früh ergrauten Scheiteln der Familienväter hockte plötzlich die Sorge um Arbeit und Brot ... Man würde ja nicht hungern müssen, o nein, der neue Staat sorgte für die arbeitslosen Verteidiger des alten ... Aber man war nicht heimgekehrt, um stempeln zu gehen — man sehnte sich nach dem altvertrauten Schaffen ... nur kürzer müßte es sein, nicht den ganzen Tag mit Beschlag belegen, nicht Leib und Seele ausdörren ... Und der Hafen so leer ... Woher sollte da — —
Die Organisatoren des Empfanges kannten solche Stimmungen. Die sollten jedenfalls nicht gleich zu Anfang aufkommen. Noch schaltete ja über Hamburg der Arbeiter- und Soldatenrat ...
Musik zur Stelle — es ordnete sich ein Zug. Und es war wie eine Selbstverständlichkeit, daß der lauteste, selbstbewußteste, klassenbewußteste der Schar, der stämmige Tedje Tietgens, das bereitgehaltene rote Panier ergriff und hart hinter der Musik dem Zug der Kameraden vorantrug. Die Trompeten, die einstmals den Ersatz der Sechsundsiebziger zur Ausfahrt ins Feld begleitet hatten, schmetterten nun der Heimkehr der bolschewisierten Trümmer der wehrhaften Mannschaft Hamburgs voran. Taktfester Gesang aus zweihundert Kehlen brandete an den Mauern der Geschäftshäuser des Glockengießerwalls empor, zum Alsterbecken hinüber:
»Wir bluteten vier Jahr
in Schlamm und Glut und Graus
für Krone, Thron, Altar —
nun ist die Knechtschaft aus!
Was hoch und stolz, das fällt
im Sturm der neuen Zeit —
nun bringen wir der Welt
die rote Seligkeit!«
Wenige Minuten später als der Berliner Zug war von Harburg her der Bremer in die Halle gelaufen. Ihm entstieg unter dem tagesüblichen Gewimmel jener Geschäftsleute, die sich im revolutionären Deutschland einzurichten gewußt hatten, ein junger Marineoffizier in stark strapazierter Uniform, das Eiserne Kreuz Erster Klasse und eine breite Ordensschnalle auf der Brust. Er war ja nun wieder frei ... Aber auch in seinen Zügen stand noch das dumpfe Entsetzen des ersten Wiedersehens mit dem Hafen, dem Lebenszentrum seiner Vaterstadt. Auf Urlaub, während des großen Ringens, hatte man diesen Zustand als natürliche Kriegsfolge empfunden — sein Fortbestehen nach dem Waffenstillstande durchschauerte die Seele mit bitteren Beklemmungen ... Die überschatteten die ernsten, feinen Züge des Seemanns, den seine Ehrenzeichen als Bewährten erkennen ließen — und nur ein tiefes Aufatmen der schmalen Brust, ein verstohlenes Glimmen in den stillen, nach innen schauenden Augen verriet, daß in diesem Jüngling-Mann auch Hoffnungen und Sehnsüchte der Heimat entgegenjubelten — aller tiefsten Trauer um den Jammer des Vaterlandes, der Vaterstadt zum Trotz.
Von so widerspruchsvollen Gedanken durchstürmt trat der Kapitänleutnant Heinz Freimann aus der Pforte des Hauptbahnhofs auf den Glockengießerwall hinaus. Heimat ... Vaterstadt ... Wie anders als einst ... Wohin der brandende Schwall des Reiseverkehrs der Handelsmetropole? Und in den Lüften alles wie still ... Es fehlte etwas — jener Klang, der einstens dem Ankommenden den Gruß der Schiffahrt entboten hatte — das vieldutzendstimmige Heulen der Sirenen aus- und einfahrender Dampfer ... Also Hamburgs Hafen immer noch in todgleicher Erstarrung ... Und wo war die endlose Reihe der Autos, die sonst vor dem Bahnhofseingang der Reisenden geharrt hatte? Nirgends ein Gefährt zu erspähen ... Freilich: das war auch während der Kriegsjahre so gewesen. Aber — war denn jetzt nicht Friede? Nur wogende Menschenmassen — alles vom Proletariertyp, in jedem Knopfloch, an jedem Frauenmantel die blutrote Rosette ... Und in der Ferne, nach der Lombardsbrücke zu, wälzte sich ein Zug von hinnen — schmetterte marschfeste Musik, brandete das blutaufpeitschende Lied von der »roten Seligkeit« ...
Jetzt erst gewahrte Heinz Freimann, daß neben dem Bahnhofseingang vor einem blutrot lackierten Schilderhaus ein Posten stand — ein Matrose, die Flinte am Riemen umgehängt, die Mündung, jedem infanteristischen Gefühl zum Trotz, nach unten gekehrt. Der Mann stand nicht etwa stramm, als des Offiziers Auge ihn traf — den erstaunten Blick des Vorgesetzten beantwortete er mit einem tückisch-herausfordernden Grinsen ...
Ach so ...
Vor dem Heimgekehrten stand plötzlich ein sechzehnjähriger Lümmel mit frechem, verwüstetem Gesicht:
»Na, wat's dit? Sei hebbt woll de niege Tied verslopen?! Wüllt Sei mol fix den'n ganzen Plünn'nkrom von Achselstücken un Kron' un Ordens un Kokarr runnernehmen? Öber 'n bäten fix, segg ick ... wat?!«
Der Offizier sah eine Sekunde lang verständnislos auf den unverschämten Bengel herab — ihm zuckte die Hand, den Buben abzustrafen — aber schon wandten sich ringsum die Köpfe, stockten Schritte, schob sich's heran, glotzten herausfordernde Blicke, gellten Schreie, Flüche, Pfiffe.
»So'n utverschamten Reaxionär! Messers rut! Riet em de Plünn'n von'n Liew!«
Heinz Freimann starrte entsetzt in den Klumpen Gier und Haß, der sich sekundlich dichter um seine Heimkehr zusammenballte. Und schon war's geschehen. Derbe, arbeitsrissige Männertatzen, behandschuhte, parfümierte Dirnenhände, schmutzige Knabenfinger griffen nach ihm, rissen ihm die Waffe von der Seite — die Krone vom Ärmel, die Achselstücke von den Schultern — vom Rock die Ehrenzeichen, in vielen Dutzenden todumdräuter, abenteuertoller Seegefechte verdient — Püffe regneten ihm wider Brust und Bauch, seine Mütze, der Kokarde beraubt, wurde ihm roh von hinten wieder aufgestülpt, daß ihm der Schirm über die Augen fiel ...
Da stand er, taumelnd, gebrochen — ein Blutrinnsel tropfte ihm übers Gesicht, auf dem die dicken Beulen aufquollen ... um ihn johlte Triumphgeheul, Hunderte von haß- und hohngrinsenden Augenpaaren starrten ihn an ...
Wenn sie mich doch nur ganz zusammengetrampelt hätten — das war der erste halbbewußte Gedanke des Geschändeten. ... Der zweite: fort — fort — sich verkriechen ...
Wankenden Schrittes tappte Heinz von dannen, der Lombardsbrücke zu. Da hinten irgendwo gehörte er ja hin ... Dorthin, wo nun jenseits der Kunsthalle, des Schillerdenkmals der weitgeschwungene Bogen des Alsterufers auftauchte, Harvestehudes kühl-unnahbare Vornehmheit ... Der Pöbelhaufe begleitete ihn, johlend, pfeifend —
Und stob plötzlich auseinander — spritzte nach rechts und links, gab einem Auto den Weg frei, dem das gellende Hupensignal Bahn riß ... Auf dem Motorgehäuse flatterte ein winziges Sternenbanner. Nur der Kapitänleutnant hatte den Warnruf nicht vernommen — taumelte verblödet seinen Weg ... und ward plötzlich umgerissen ... Der Chauffeur des Kraftwagens hatte im letzten Augenblick scharf gebremst und das Steuerrad herumgerissen, sonst hätte er den Betäubten vollends überfahren.
Seltsam! Dieselben Menschen, die eben noch den Offizier entwaffnet, beschimpft, mißhandelt hatten, wandten sich nun mit verschärfter Wut und Empörung gegen den Fahrer und den Insassen des Wagens mit der feindlichen Flagge.
Der hagere, bartlose Herr, der bisher mit verächtlichem, unbeteiligtem Gesichtsausdruck im Lederpolster gelegen hatte, sah sich nun bemüßigt, sich des uniformierten Mannes anzunehmen, den sein Gefährt, achtlos durch die Massen des besiegten Volkes dahinrasend, zur Strecke gebracht hatte. Er machte eine lässig beschwichtigende Handbewegung gegen die Menge, die sein Gefährt mit geballten Fäusten und drohenden Mienen umdrängte, stieg federnden Schrittes aus, rief seinem Chauffeur einen Befehl zu und hob mit dessen Unterstützung den sich mühsam aufrichtenden Offizier in seinen Wagen. Und ehe die Herandrängenden recht zum Bewußtsein gekommen waren, flog das Gefährt mit dem flatternden Sternenbanner über die Lombardsbrücke.
»Beg your pardon, Sir —« sagte der Herr des Wagens zu seinem Opfer und Schützling und fuhr in leidlich verständlichem Deutsch fort: »Ich bin sehr unangenehm habend Sie beschädigt ... wohin muß ich bringen Sie?«
Heinz Freimanns Sinne fanden sich langsam wieder zueinander. Er richtete sich auf und sagte eisig ablehnend:
»Lassen Sie halten. Ich wünsche auszusteigen.«
Sehr höflich bat da der Amerikaner wiederholt um Verzeihung und um Erlaubnis, das Versehen seines Chauffeurs dadurch wieder gutmachen zu dürfen, daß er den captain nach Hause fahre.
»Ich meine zu sehen, Sie haben gehabt eine collision mit Ihre countrymen ...«
»Ich bitte wiederholt, mich sofort aussteigen zu lassen ...«
Je schärfer des Deutschen Stimme klang, desto liebenswürdiger wurde der Amerikaner. Er ging ins Englische über:
»Mein Name ist Elias Patterson ... ich bitte wiederholt um die Vergünstigung, Sie heimfahren zu dürfen ...«
Heinz Freimann, im Bann einer unbesieglichen Müdigkeit, gab sich gefangen. »Harvestehuder Weg 327, Villa Freimann, bitte rechtsum am Wasser entlang ...«
Der Fremde wurde ein wenig verlegen und verdoppelte seine Verbindlichkeit. »O — Villa Freimann ... Ich kenne Villa Freimann ...«
»Ich bin der Sohn des Herrn Freimann«, sagte Heinz auf Deutsch.
»Oh — ich bin glücklich zu hören, daß Sie mich verstehen in Englisch« — und weiter in der heimatlichen Sprache: »Ich bin untröstlich, daß meine erste Wiederbegegnung mit dem Hause meines alten Freundes Freimann ein wenig gewaltsam war ... Ich kenne Ihren Vater sehr gut aus den schönen Tagen des Morgan-Trusts ... Wir haben sehr gut zusammen gearbeitet zum Wohle der amerikanischen und der deutschen Schiffahrt — damals — in glücklicheren Zeiten. Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, wie ich nach Hamburg komme. Die Regierung der Vereinigten Staaten ist gebeten worden, einen Sachverständigen zu senden, welcher der Entente-Kommission bei Übernahme des letzten Schiffes der Hansa-Transatlantik-Linie als Berater zur Seite stehen soll. Ich habe den Auftrag des Weißen Hauses um so lieber angenommen, als ich als Chefbesitzer des Patterson-Großreederei-Konzerns in sehr angenehmen Beziehungen zur H. T. L. und ihrem ausgezeichneten und hochverdienten Leiter, Ihrem Vater, gestanden habe ...«
In Heinz Freimanns dröhnendem Schädel hatten sich inzwischen die Gedanken ein wenig geordnet. Allerhand Assoziationen schossen an: Patterson-Konzern — natürlich, eine der führenden amerikanischen Dampfschiffahrtsvertrustungen ... Ja, Heinz meinte sich sogar zu entsinnen, daß er einmal auf Urlaub in seinem Vaterhause dem Leiter dieser riesigen Zusammenballung amerikanischer Seeinteressen begegnet sein müsse ... Aber dazwischen lagen die vier Jahre — die hatten von der Tafel des Gedächtnisses unzählige Erinnerungen und Bilder spurlos ausgelöscht ...
»Mein Vater wird erfreut sein, von Ihnen zu hören«, sagte er in Haltung.
»Ich weiß nicht genau« — wieder lächelte Patterson diplomatisch. »Ich werde ihn darauf vorzubereiten haben, daß meine Sendung nicht ganz uninteressiert ist ... Aber wie ich Ihren Vater kenne, wird er es ahnen, wenn er nur meinen Namen hört ... Sagen Sie ihm, er soll nicht böse sein — Elias Patterson wird ihn besuchen, wenn das amtliche Geschäft vorüber ist — vielleicht machen wir dann noch ein privates ...«
Das Auto hielt inmitten der Doppelreihe der Baumkolosse des Harvestehuder Weges. Über den schneegesprenkelten Rasenflächen, den braunen Bosketts stieg in ablehnendem Weiß Villa Freimann auf. Ihr Stil verriet, daß der Präsident der H. T. L. sich bei der Gestaltung seiner Lebenshaltung statt von dem eigenen Geschmack von dem unfehlbaren Takt seiner Gattin beraten ließ.
Heinz Freimann zwängte einen formelhaften Dank über die Lippen.
»Auf Wiedersehen, Herr Freimann ... grüßen Sie Herrn und Frau Freimann ... und lassen Sie sich die Heimat so gut schmecken, daß Sie den abscheulichen Empfang vergessen!«
Der Seemann hastete den knirschenden Kiesweg hinan. Nur nicht gesehen werden so — nur schnell verschwinden und vom Leibe reißen das besudelte Ehrenkleid ...
Ein Schillervers aus Primanertagen zuckte auf:
»O schöner Tag, wenn endlich der Soldat
ins Leben heimkehrt, in die Menschlichkeit —«
Aufschreien hätte er mögen — aufschreien ...
Und da war er doch gesehen worden ... Ein Willkommen scholl vom Altan, eine helle, festlich gekleidete Mädchengestalt stieg die Treppe hinunter in jener vollendeten Haltung, welche die Hamburgerin aus erster Familie so peinlich wahrt, wenn sie sich in die Sphäre der Beobachtungsmöglichkeit begibt ... Aber als die Braut die fahlen, leidensgefurchten Züge des geliebten Mannes enträtselte, da war es doch um ihre Fassung geschehen. Zwei junge Menschenkinder flogen sich entgegen, umschlangen sich in Harm und Seligkeit, schluchzten einander all ihr Trennungsleid und ihren Jammer ums zertretene, geschändete Vaterland entgegen.
Ilse Carstensen hatte das Fehlen der Achselstücke, der Krone, der Ehrenzeichen bemerkt und — in diesem instinktiven Wissen um das Grausen der Zeit ganz richtig verstanden ... Sie würde seinen Eltern alles erklären, niemand sollte ihn fragen dürfen.
»Mein Junge du — mein Junge ... Still — bist bei mir — nun wird alles gut ...«
Und da — da stand Frau Johanna. Durch Tränenschleier strahlte ihr Mutterauge doppelt hell ... Auch sie hatte sofort gesehen ... und begriffen. Man wußte ja aus Zeitungen, wie der deutsche Pöbel seine Kämpfer empfangen hatte ... Sie winkte dem alten Charlie, der auf der Terrasse stand, bescheiden im Hintergrunde, doch im Blick den ganzen tiefen Anteil des vasallentreuen Greises.
»Charlie — sofort mit Herrn Kapitänleutnant auf sein Zimmer — Bad, frische Wäsche, Zivil ...«
Dann erst schloß sie ihren Einzigen in die Arme. Es war ja alles, alles gleichgültig — er war da, war frei — lebte — es hatte ihn nicht behalten, das brüllende Meer, der brüllende Krieg ... O doch, es wachte droben ein gnädiger Hüter ...
Und dann stand Heinz vor dem Vater, der ihn um eines Hauptes Länge überragte.
»Willkommen, mein Sohn, in dem, was übrig ist von unserm armen Vaterland ...«
»Still, still, Georg —« flüsterte Frau Johanna. »Ein Festtag ist's, ein hoher Festtag! Nein, nein, Heinz, jetzt nicht fragen, nicht erzählen ... Laß ihn, Georg, er kommt von langer Reise, ist müd' und angegriffen, wie kann's denn anders sein? Komm, mein Junge, deine Zimmer warten, und Charlie läßt das Bad einlaufen. Das brauchst du jetzt am nötigsten ... bist ja daheim, mein Junge, bist ja daheim!«
Gott, diese Wonne, sich ganz stumm und einsam in die warme Flut versenken — und dämmern — schweigen — leben — —
Wortlos räumte der brave Charlie das verstümmelte Soldatenkleid hinweg — grimmige Flüche im Herzen auf das Pack ohne Distanzgefühl — und doch ein beglücktes Lächeln auf den schmalen, umfalteten Lippen — breitete mit Behagen den hechtgrauen Zivilanzug aus, die seidene Wäsche — warf ganz bescheiden seinem jungen Herrn einen Blick zu, der sich verklärte, als er dankbar lächelnd erwidert wurde ...
Und drunten rüsteten die Frauen den Eßtisch, besetzten ihn mit seltenen, lang aufgesparten Köstlichkeiten ... und zwischendrein sahen sie einander in die Augen — die feuchteten sich, es zuckten die Lippen ... und plötzlich fielen die zwei einander in die Arme ...
»Mut, liebste Mama —« sagte Ilse und löste ihr blondes Haupt von der zuckenden Schulter der Mutter ihres Geliebten — »Mut! Wir werden arbeiten — Heinz an seines Vaters Seite — wir kommen wieder hoch — wir kommen hoch!«
Eine trotzige Falte grub sich in Ilse Carstensens Stirn — das Erbteil eines alten Geschlechtes von Schiffbauern ... es konnte seinen Ursprung bis in die Tage zurückverfolgen, da ein Timm Carstensen der Stadt Hamburg jene stolzen Koggen baute, die dann den Dänenkönig Waldemar Atterdag das Fürchten lehrten.
Georg aber war in sein Arbeitszimmer getreten. An diesem Schreibtisch hatte er nach Geschäftsschluß all jene ehrgeizigen Pläne ausgesonnen und aufgezeichnet, welche die H. T. L. zur ersten Dampfschiffahrtsgesellschaft der Welt gemacht hatten. Wie manchen Brief des Kaisers hatte er hier beantwortet in seinem schwungvollen Stil, der den Geschmack des weiland Schirmherrn deutscher Handels- und Schiffahrtsgröße so meisterhaft zu treffen gewußt hatte ...
Nun sann er nicht mehr. Dumpf und ausgebrannt war sein Hirn, sein unverwüstlicher Wille gelähmt. Er fühlte: der schluchzende, unter ungeahnter Schande zusammengebrochene Jüngling, der seines Blutes einziger Erbe war, der war nicht aus dem Holz, aus dem die großen Kommodoren geschnitzt werden. Er wußte: er war allein. Und heute abend dampfte der »Altreichskanzler« unter der Flagge der vereinigten Weltmächte in den Ozean hinaus.
Freimann öffnete ein Geheimfach und starrte auf den braunen Lauf des letzten Trösters ...
3
Wie alltäglich, seit die Revolution dem arbeitenden Volke den Achtstundentag beschert hatte, verstummte auch heute auf den Werften das gellende Ticktack der von Menschenfaust geschwungenen Niethämmer, das unablässige Schwirren um vier Uhr nachmittags. Vater Tietgens verschloß sorgfältig den Verschlag des riesigen Laufkrans, den er seit acht Jahren führte, droben auf der schwindelnden Höhe des weit gedehnten Krangerüstes, das sich über die ganze Breite der fünf vorderen Helgen der Hammonia-Werft hinzog. Freilich, von diesen fünf Schiffsbaustellen war jetzt nur eine belegt: ein Zehntausendtonnen-Passagier- und Frachtdampfer entstand dort. Den hatte eine neutrale Macht bestellt. Ja, ja, die Spanier — und die Holländer — die kennen uns ... die wissen: sie kommen ja doch wieder hoch ... die Deutschen ... werden wieder leistungsfähig wie vor dem großen Unglück ... Aber die anderen vier Helgen standen leer ... Wann würden sie sich wieder beleben?
Der Vadder Tietgens da oben in seinem Laufkran — der hatte Augen im Kopf. Wenn's nicht bald wieder Bestellungen gab — wenn keine Schiffe mehr auf Helgen gelegt werden konnten — dann ging's allen an den Kragen — den Kapitalisten natürlich — den Eigentümern, den Aktionären der Werften ... aber den Handarbeitern erst recht ... den Hunderttausenden, die ihr Brot fanden da unten, wo am Südufer der Norderelbe Werft an Werft sich reckte. Und drüben die endlosen Arbeiterviertel in Hamburg, Altona, Ottensen! Da hausten sie in unzähligen Straßen und Häuserblocks, vom Erdgeschoß bis unters Dach der Mietkasernen — die Kollegen, die — Genossen! — mit Weib und Kind und Schlafburschen ... Und all das lebte — vom Hafen ... Hatte während des Krieges alle Hände voll Arbeit gehabt, die Taschen voll Geld. ... Aber nun —?! Was würde nun?! Die Kanonen waren verstummt ... der Hafen verödet ... die Werften so gut wie beschäftigungslos ... Himmel — wenn das so bliebe — was dann?!
Oh — Vadder Tietgens sah klar. Hier oben bekam man helle Augen — hellere als drunten im Brodem der Schiffsbauhallen und Eisengießereien — oder im Bauch der langsam sich aufwölbenden Schiffsrümpfe — wo man ja wohl vorm Getöse der Arbeit sein eigen Wort nicht hören konnte — geschweige denn nachdenken. Natürlich — man war seit Jahrzehnten ein anerkannter Führer der Hamburger Sozialdemokratie. Marx! Oho! — jedes Wort ein Evangelium — aber — man hatte auch auf der Werft eine Vertrauensstellung. Man wußte, wie so ein Ding entstand — so ein Riesenungeheuer, so ein modernes Seeschiff. Dazu gehörte vor allem ein Kopf — viele Köpfe — und nicht bloß ein paar hundert oder tausend stramme Fäuste. Kopf und Hand — nur zusammen konnten sie es schaffen. Brauchte denn nicht auch er selber, der Kranführer, fast mehr seinen ruhigen klaren Hirnkasten — und die sicheren Augen darin als die nicht minder verläßliche Hand?
Freilich — man war ein Vorkämpfer seiner Klasse, der Klassenkampf — der mußte sein. Der Geldsack und der Kopf — die hielten zusammen wie Pech und Schwefel — da mußten auch die Fäuste zusammenhalten, sonst rückten Kopf und Geldsack nichts heraus, — als was das »eherne Lohngesetz« ihnen abpreßte. Und schließlich — leben will doch auch der Mann der harten Faust, nicht wahr? Und ein bißchen besser als das Vieh ... man ist ja schließlich ein Mensch und kein Triebrad, kein Zapfen bloß im Riesengetriebe ... man will sein bißchen Behagen, sein Stück Fleisch und einen sauberen Rock für den Feiertag ... und abends ein paar Ruhestunden, in denen man aufatmen kann, sich selber gehören und seinen Lieben. Das ist doch nicht zuviel verlangt, he? Und nicht einmal das wollen sie sich abzwacken lassen, die zwei harten Verbündeten, Kopf und Geldsack ... also zielbewußter Klassenkampf, zielstrebige Organisation —! Aber: der Irrsinnsschrei aus dem Osten — Ausrottung der Bourgeoisie, Diktatur des Proletariats, »die rote Seligkeit«?! Nein, davon mochte er nichts hören, der alte Kranführer droben auf seiner blickweiten Höhe.
Er warf noch einen Blick voll unbewußter Zärtlichkeit auf das vertraute Bild zu seinen Füßen. Das weite Werftgelände lag tief unter ihm wie ein sauber aufgestelltes Riesenspielzeug — bis an den breit hinfließenden Elbstrom. Seine gelblich opalisierenden Gewässer stießen in unzähligen schmalen und breiten Streifen tief hinein in das Gewirr der Schuppen, Bauhallen, Wohnhausgruppen hüben, der turmüberzackten Häusermassen der gigantischen Doppelstadt da drüben. Das war seine Welt ... Und kaum geahntes Bewußtsein der Zusammengehörigkeit schlich durch die Seele des alten Arbeiters ... etwas wie ein traumhafter Stolz. Das alles war sein ... sein Hamburg ... die Welthandelsstadt ... über deren Brausen und Brodeln er täglich schwebte und schaltete seit Jahrzehnten ... Er verwahrte den Schlüssel zu seinem luftigen Reiche sorgfältig in der Tasche und stapfte über den schmalen Eisensteg zum Fahrstuhl. Der trug ihn zur Erde hinab — und die zahlreichen Maler, die auf dem Labyrinth des Krangerüstes dauernd mit Instandhaltung des Farbanstrichs der Eisenkolosse beschäftigt waren. Die Gespräche der Genossen, die ihn umschwirrten, drehten sich wie immer um den einen Punkt: Lohnerhöhung ... Das war so gewesen, solange Timm Tietgens denken konnte. Aber der Krieg hatte den Beginn der großen Teuerung gebracht, der Umsturz ihr Anschwellen lawinenhaft beschleunigt. Die Lohnbewegung kam nicht einen Augenblick zur Ruhe, gärte alle paar Wochen zu neuen Krisen auf. Schon war es zu schrecklichen Ausbrüchen der Empörung gekommen: Sturm auf das Verwaltungsgebäude, schimpfliche Bedrohung und rohe Mißhandlung der Direktoren waren ihre wildesten Gipfelungen gewesen. Und seit die Heimkehrer aus den östlichen Teilen Rußlands die Gemüter mit entflammenden Schilderungen der russischen Proletarierherrschaft immer aufs neue aufpeitschten, schienen neue wilde Dinge sich vorzubereiten.
Timm Tietgens verfolgte wie die Mehrzahl der älteren Kollegen diese Entwicklung mit tiefer Besorgnis. Er für seine Person hatte sich abgefunden. Man war als eines von zehn Kindern in einer Proletariermietskaserne der menschenwimmelnden Vorstädte oder in einem der uralten Ziegelhäuser der Altstadt-Twieten zur Welt gekommen, hatte in der Volksschule das Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt und war mit vierzehn Jahren auf die Werft oder in die Fabrik gekommen — tjä, da hatte man wenig Aussicht, in einem Villenpalast am Harvestehuder Weg zu sterben ... Immerhin, auch das war schon vorgekommen ... Aber dann mußte man einen Kopf haben etwa wie jener Bob Timmermanns ... der hatte sich aus einem Werkmeisterhäuschen bis an die Spitze der vielverzweigten Konstruktionsabteilung der Werft emporgekämpft ... Und dessen Bruder Armin, der Stadtsekretär vom Rathaus, hatte es ja wohl gar im Kriege bis zum Leutnant gebracht ... damals, als man für den Offiziernachwuchs auf die Subalternbeamten als auf ein wertvolles Material von guter Schule und zuverlässiger Gesinnung zurückgegriffen hatte ... Timm Tietgens persönlicher Ehrgeiz kannte nur noch eine letzte Staffel des Aufstiegs: er hätte Werkmeister werden mögen, einer ganzen Unterabteilung des Riesenbetriebes als Arbeitsaufseher vorgesetzt — und eine Dienstwohnung in einem der schmucken Gebäude beziehen, welche die Werft für ihre sichersten Vertrauensleute unter den Angestellten im Bannkreis des Werkgeländes errichtet hatte ... Dann würde man sich fünf Minuten nach Arbeitsschluß zu Mutters Kaffeetisch heimfinden. Statt dessen mußte man Jahr für Jahr und Tag für Tag die Heimfahrt über den Elbstrom tun — in der vollgepramsten Dampffähre — und dann die halbe Stunde tippeln bis zum Neuen Steinweg. Dort versteckte sich in einem Seitenhofe das winklige, barackenmäßige Häuschen, in dessen oberem Stock der Kranführer Timm Tietgens mit seiner frühergrauten Lebensgefährtin eine Wohnung von immerhin drei Kämmerchen innehatte. Sie war einmal recht enge gewesen, diese Behausung — damals, als in ihr drei stramme Buben und ein hageres Mädelchen heranwuchsen. Zwei von jenen lagen in Frankreich verscharrt — einer arbeitete in den kaukasischen Bergwerken. Und das Töchterlein teilte auch nicht mehr die Wohnung der Eltern. Dennoch strahlte Timm Tietgens, wenn er seiner Antje gedachte. Sie hielt treulich zu den Eltern, obwohl sie eine Feine geworden war, eine »Bürgerliche« sozusagen ... Sie war auf die Handelsschule gegangen, hatte Stenographie gelernt und auf einem der zahllosen Bureaus der Werft ihre Lehrjahre verbracht. Dann war sie von der befreundeten Hansa-Transatlantik-Linie am Alsterdamm übernommen worden und hatte es dort so hoch gebracht, wie sie es in ihrem Beruf überhaupt bringen konnte. Sie war persönliche Sekretärin des allmächtigen Generaldirektors geworden, des großen Georg Freimann. Da schickte es sich denn nicht mehr, daß sie im Seitenhof des Neuen Steinwegs hauste. Sie wohnte in einer Pension im vierten Stock des Wolkenkratzers am Binnenhafen, wo sie bis zum Kriege Gelegenheit gehabt hatte, ihre Sprachkenntnisse im Englischen, Französischen, ja im Spanischen zu vervollkommnen. Aber jeden Sonntag, ja manchen Wochenabend verbrachte sie bei Vadder und Mudder — und hatte immer ein paar Mark übrig, um den Eltern eine unerwartete Freude zu machen.
Ja, Antje —! Ihr Lebensgang bewies, gleich dem der Werkmeisterjungen Bob und Armin Timmermanns: der Aufstieg in die beneidete und gehaßte Sphäre der Bürgerlichkeit war den Söhnen und Töchtern des arbeitenden Volkes nicht so unbedingt verschlossen, wie die Hetzer der Volksversammlungen es den Genossen vorschwindelten ... Und der stramme Tedje, der nun wohl endlich einmal den Heimweg aus dem Kaukasus gefunden haben müßte —? Ja, wenn der nur ein bißchen von dem zähen Ehrgeiz, dem sauberen Pflichteifer seiner Schwester Antje gehabt hätte ... Aber dem waren der Schnaps und die Mädels immer wichtiger gewesen als die Fortbildungsschule. Der würde ja wohl hoch droben in der Schwindelhöhe der Laufstege ewig seine Niete setzen, bis Alter und Gicht ihn zu einer noch anspruchsloseren Hantierung in der Schiffsbauhalle zwingen würden ... Der würde ewig ein unzufriedener, hetzerisch gestimmter Lohnsklave bleiben — und es nicht einmal zum Kranführer bringen — oder gar in die Werkmeisterswohnung aufsteigen, wie Vater Timm es für sich und seine Mine auf ihre alten Tage erstrebte ...
So übersann Timm Tietgens sein Schicksal und das seiner zwei von sieben Geburten übriggebliebenen Sprößlinge. Das tat er täglich, wenn er, dem Gewimmel der Dampffähre entronnen, seinen Weg durch die Wallanlagen der »Neustadt« zulenkte, deren Name längst ein Hohn auf die winklige, altersgeschwärzte Verkommenheit des größten Teiles ihres Innern geworden war. Und immer mündete solches Grübeln in einem stillen, glückseligen Lächeln:
Ja, meine Antje —!
Als er die klapprige Holzstiege zu seiner Behausung emporklomm, vernahm er droben den polternden Klang einer Männerstimme, die ihm eine Sekunde lang fremd vorkam. Und dann stand ihm das Vaterherz einen Schlag lang still: Das war — Tedje —!
Er sprang die letzten Stufen hinan — riß die Tür auf und — hal mi de Düwel — dei Jung —!
Da saß er neben Mutter ... die streichelte, mit blinkenden Tränen auf den welken Wangen, des Heimgekehrten muskelgeschwellten Arm ...
Vater und Sohn schüttelten einander die kräftigen Tatzen, daß sie knackten.
»Junge, wo sühst du ut — as 'n Russ' — mit 'n groten Bort ...«
»Bün ick ok!« grinste Tedje. »Ja, Vadder — ick bring dei grote Heilslehre ut'n Osten mit — Moskau heißt die Parole! Nu späln wi ok Bolschewismus!« Und mit rauher, offenbar schnapsbefeuchteter Stimme sang er den Trutzgesang des Radikalismus:
»Jetzt bringen wir der Welt die rote Seligkeit!«
Vater Timm mochte sich die Freudenstimmung über des Sohnes Heimkehr nicht durch einen politischen Disput verkümmern lassen. Er langte zur Kaffeekanne, um seinem Letzten, seinem Einzigen, einzuschenken. Da klang aus der guten Stube ein ungewohnter Ton: Klavierspiel ...
»Na nu? Wat's dit —?!«
Mutter Mining hatte dereinst um wenige Zwanzigmarkstücke ein altersschwaches Pianino eingehandelt, damit ihr Liebling auch Musik machen lernte ... Seit Antje die elterliche Wohnung verlassen hatte, war es verstummt. Nun klang es auf einmal wieder, und zwar anders als unter Antjes stümpernden Kinderhänden. Seltsame Weisen, den Schlichten kaum verständlich, doch geheimnisvoll erhebend und tröstend zugleich ... Eine Andacht schwebte heran, vor der selbst Tedjes trunkener Sinn sich neigen mußte ...
»Dat's mien Kam'rod, Vadder, mien Fründ ut'n Kaukasus — Clos Mönkebüll heit hei ... un Schippbuer is hei as ick ok op uns' Werft — öber freuher hebbt wi uns nich kennt ...«
Clas sei Nieter wie er, erklärte er flüsternd den Eltern. Er stamme aus Holstein und habe die ersten beiden Kriegsjahre als Reklamierter auf der Hammonia-Werft gearbeitet. Dann aber sei er »ausgekämmt« und in Rußland gefangen genommen worden. Sie beide hätten im Bergwerk gute Kameradschaft gehalten und beschlossen, sich auch in Zukunft nicht zu trennen. Sie würden ja beide ihre Arbeitsplätze auf der Werft wiederfinden und dort als Nieter zusammenarbeiten in jener zwillingshaften Gemeinschaft, die immer zwei Nieter beim Schaffen — und in der Regel auch im Leben zusammenhält.
Inzwischen entquollen dem verstimmten Pianino immer neue Weisen, fremd und seltsam, und dennoch bezwingend für die kunstfernen Hörer ... Sie weckten wunderlich wechselnd Wehmut und Seligkeit, Gram und Verzückung, Lebensangst und Vernichtungsschauer ... Immer stiller saßen die drei Tietgens, Eltern und Sohn, und allen ward die Brust zu eng im Lauschen ... das ungelenke Spiel des Genossen da drinnen rührte mit unbegriffener Magie an die unerweckten Seelen.
Und keiner von ihnen hörte es, daß sich hinter ihnen leise die Tür geöffnet hatte. Ein Mädchen schob sich in die Stube, auch sie sofort zur Andacht entrückt. Ihr Wesen, ihre Kleidung wirkten in dieser Umgebung geradezu vornehm ... Antje sah den Bruder sitzen — ihr schlug das Herz in zärtlicher Liebe und doch in jähem Erschrecken zugleich. Er war immer ein rauher Gesell gewesen, und niemand, der die Geschwister beisammen gesehen hätte, wäre auf den Gedanken gekommen, sie für Vögel aus dem gleichen Neste zu halten. Aber nun — war es möglich, dieser struppige, abgerissene Steppensohn, das war ihr Bruder?! Doch die Töne, die von drinnen quollen, von den Tasten, die sie selber einst mit kindlichen Fingern mißhandelt hatte — war's nicht noch ein viel größeres Wunder als des Bruders unheimliche Verwandlung? Aber ein beglückendes, ein tröstlich zaubervolles ...? Antje versäumte kein Konzert in der Musikhalle, sie kannte, erkannte sofort die schmerzlich-süße Weise: den ersten Satz der Mondscheinsonate. Es entging ihr nicht, wie verstimmt das Instrument war, wie holprig, übungsentwöhnt und hart das Spiel — es strömte dennoch von da drinnen eine Weihe aus, der auch sie, die an edelste Kunstübung gewöhnt, sich nicht entziehen konnte.
In dunkelster Schwermut verklang das Spiel. Noch eine Sekunde lang waren die Lauscher im Bann — dann schloß Antje dem Bruder von hinten mit ihren schlanken, sorgsam gepflegten Händen die Augen.
Der Bursch machte sich frei, fuhr auf, stutzte sekundenlang vor der damenmäßigen Erscheinung der Schwester — dann glühte in seinem Blick etwas mühsam Verhohlenes auf, etwas tierisch Wildes:
»Gottverdammi — Antje — Deern, wo hest du di rutmokt ...« Sie fühlte seine glühenden Finger an ihren Armen, es fröstelte sie — aufatmend machte sie sich frei, umfing den Heimgekehrten und küßte ihn rasch und scheu.
»Willkamen, Tedje — endlich! Scheun, Mudder, scheun, dat wi em wedder hebben!«
Aber da staunte ja noch ein anderes Augenpaar sie an — doch ehrfürchtig wie eines Kindes Blick, das in die Weihnachtslichter starrt. Clas Mönkebüll, in zerlumptem Feldgrau, bartumzottelt wie sein Kamerad — aber in seinem Blick flatterten nicht wilde Dränge — eine kaum bewußte Sehnsucht leuchtete drinnen — und die Rechte, die er schüchtern in die dargebotene Hand der Schwester des Kameraden legte, diese derbe Werkmanns- und Soldatenfaust, die dennoch zu Beethovens Höhe zu langen trachtete, sie zitterte leise, als berühre sie ein Heiligtum.