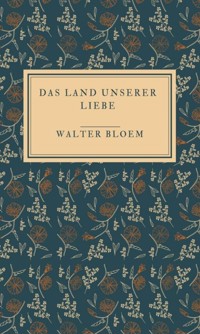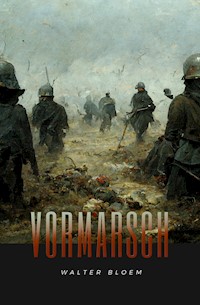
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir überschritten die letzten Höhen, die uns vom Marnetale trennten. Mal wieder ein toller Tag. Vierzig Kilometer bergauf, bergab, bergauf, bergab . . . Glühender Sonnenbrand. Zur Linken Bülows Kanonen: aha, die langersehnte Fühlung — nun wird sie bald kommen. Viel traurige Bilder: die Massen der Flüchtlinge, die vor unserm Anmarsch in kopfloser Flucht gen Süden geströmt, waren allgemach ins Stocken gekommen, hatten nicht mehr weiter gekonnt. Immer wiederkehrendes Schauspiel: ein Leiterwagen, hoch mit Habseligkeiten bepackt, die Mähre zusammengebrochen, verendend, daneben ein von Hitzschlag getroffener Alter oder ein verschmachtendes Mütterchen, die Familie, Mann, Weib und Kinder, halb verhungert, schlotternd vor Mattigkeit und Todesangst. O ihr journalistischen Hetzer und Verleumder in Brüssel, Lille, St. Ouentin, Paris — ahnt ihr, wie viele eurer Landsleute ihr durch euer gewissenloses Lügengewäsch um Hab' und Heimat, Gesundheit und Leben betrogen habt?!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VORMARSCH
Walter Bloem
______
Erstmals erschienen im
Grethlein & Co. Nachf. Leipzig, 1916
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung
© 2021 Klarwelt-Verlag
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Einleitung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Einleitung
Der Mitkämpfer des großen Krieges, dem die Gabe des Erzählens beschieden ist, hat die Verpflichtung, sein Erlebnis für Mit- und Nachwelt aufzuzeichnen.
Seine Beisteuer wird umso wertvoller sein, je gewissenhafter er sich bemüht, nicht Kriegsgeschichte zu schreiben, sondern nur das Selbsterlebte festzuhalten.
Bedeutet das ein unberechtigtes Vordrängen der eigenen Persönlichkeit?
Die Möglichkeit eines solchen Missverständnisses darf uns nicht schrecken.
Da ist nicht einer unter uns gewesen, der nicht genau wüsste: auch der Beste hat nicht mehr und nichts Besseres geleistet als neben ihm viele Hunderttausende.
Unsere Pflicht getan zu haben — das ist unser aller berechtigter Stolz, dem jede Überhebung fernliegt.
Aber eben darum: weil das Erlebnis des einzelnen das von Hunderttausenden ist — darum soll, wer es kann, es bildhaft gestalten — nicht sich selber zur Ehre, sondern zum Gedächtnis seiner Millionen unbekannter Mitkämpfer, die, jeder auf seine Art und unter Einsatz seines besten soldatischen Könnens, seiner höchsten sittlichen Kraft das gleiche geleistet haben.
Wenn einer der Leser meiner beiden ersten Kriegstagebücher mir sagte — und das ist oft genug geschehen — er habe in meinem Erlebnis das eigene wiedergefunden — dann habe ich ihm froh antworten können:
Das, lieber Kamerad, das habe ich ja gerade gewollt.
W. B.
1.
Meine drei Romane aus dem Kriege von 1870 und 71 habe ich begonnen im Frühjahr 1909 und beendet im Sommer 1913. Von meinem vierzigsten bis zu meinem fünfundvierzigsten Lebensjahr haben sie all mein Sinnen und Trachten ausgefüllt. Dennoch war es mir nicht vergönnt, ihnen allein zu leben. Vom Frühjahr 1911 an war ich gleichzeitig als Dramaturg und Regisseur am Stuttgarter Hoftheater tätig bis kurz vor Ausbruch des Krieges. „Volk wider Volk“ und „Schmiede der Zukunft“ sind neben dieser Tätigkeit entstanden.
Als die Kriegsromane vollendet waren, setzte ich mir neue Ziele. Die elsass-lothringische Frage wuchs ganz von selbst in meinen Gesichtskreis und drängte zur schaffenden Mitarbeit. Einen Urlaub meiner Intendanz benutzte ich zu einer längeren Studienreise ins Elsass im Frühjahr 1914. Während ich im Klosterfrieden von Sankt Odilien meine Eindrücke sichtete und die ersten Kapitel des „Verlorenen Vaterlandes“ niederschrieb, wurde es mir klar, dass ich mir künftig die Überbelastung des Doppelberufs nicht mehr zumuten dürfe.
Ich löste alle meine Stuttgarter Verpflichtungen und beschloss, mich vom 1. September ab nur noch der eigenen schöpferischen Arbeit zu widmen.
Eine Pflicht nur war zuvor noch abzutragen.
Das Regiment, dessen Reserve ich als Hauptmann angehörte, durfte erwarten, dass ich einmal wieder durch Ableistung einer militärischen Übung mir die Ehre verdiente, seine Uniform zu tragen. So reiste ich am 15. Juni nach Frankfurt an der Oder, um vier Wochen lang im geliebten Waffendienste mich zu tummeln.
So trug ich des Königs Rock an dem 20. Juni, an dem ich mein 46. Lebensjahr vollendete. Das Alter der gesetzlichen Wehrpflicht hatte ich bereits um ein Jahr überschritten. Aber noch immer gehörte ich dem Heere an, da ich mich körperlich und geistig noch spannkräftig und den Obliegenheiten meines Dienstgrades für Frieden und Krieg gewachsen fühlte.
In die Zeit meiner Übung fiel — Sarajewo. Es wetterleuchtete ein paar Tage ganz beängstigend am politischen Himmel — doch das Wetter schien sich zu verziehen. Wir Offiziere redeten ein paar Tage von nichts als vom nahen Kriege. Und dann verzog sich’s wieder und vergrollte. Und als ich am 14. Juli von den Kameraden Abschied nahm — da ist nicht einem von uns der Gedanke gekommen, geschweige denn dass einer ihn ausgesprochen hätte: wer weiß, ob wir uns nicht in ein paar Tagen schon hier auf dem Kasernenhofe wiedersehen! —
2.
„Haben Ich war so versunken in meine Arbeit während der nächsten Tage nach der Heimkehr, dass ich des Weltlaufs nicht recht achthatte — die dumpfen Stöße nicht empfand, die an den Grundfesten der Menschenerde rüttelten.
Aber eines Tages gab es doch ein unwilliges, erstauntes, ungläubiges Erwachen. Wir lebten so abgeschlossen von aller Welt, dass von dem Ungeheuren, das draußen wurde, nichts in unsere Stille drang, als die Nachrichten der Zeitungen.
„Wär’s möglich?“ fragte meine Frau dann wohl im Frieden der Bibliothek, die uns vier allabendlich bei der Lampe versammelte — „wär‘s möglich?! diesmal doch?!“
Aber sie tröstete sich dann immer selber hastig über ihre Beklemmungen hinweg. „Ach Unsinn — das haben wir nun doch schon so oft erlebt — und immer war es nichts — es wird auch diesmal nichts werden.“
Andern Morgens lasen wir die Zeitungen mit geweiteten Augen. Nun plötzlich fühlten wir den Boden unter unsern Füßen wanken. Ein Büchlein wurde hastig beschafft, das eine Zusammenstellung des Kriegsbedarfs für den berittenen Offizier enthielt, eine Liste von hundert Gegenständen ausgezogen. Morgens arbeitete ich mit fieberhafter Anspannung an meinem Roman. Fehlten doch nur noch wenige Kapitel bis zur Vollendung . . .
Nach Tisch eilten wir in die Stadt und kauften zwei Stunden lang ein. Und wenn auch die Schwabenhauptstadt noch nicht merklich aus ihrer sesshaften Ruhe aufgeschreckt schien: wir begegneten in allen Läden einkaufenden Herren in Uniform und Zivil, sahen sie mit Zetteln in der Hand auf der Straße haften.
Abends packten wir lang, bedachtsam und sorgfältig.
Meine Offizierkoffer, der Wäschesack und jedes Paketchen trugen in der Handschrift eines meiner Lieben die Angabe des Inhalts. Und dann saßen wir stumm und beklommen unter der Lampe im Frieden der Bibliothek.
Wär’s möglich — —?!
So lang und bitter war unser Lebenskampf gewesen.
So nahe, zum Greifen nahe winkte uns der ersehnte Lohn. Zwei Reisejahre im Süden . . . und dann: die eigene Scholle. Und nun —?!
Wenn ich unserer Zukunftsträume gedachte, wie sie, der Erfüllung nahe, noch in dieser Abendstunde vor uns standen und doch schon verblassten und seltsam geisterhaft zurückwichen — dann war mir weh. Aber wenn ich dann meines Dichterloses gedachte, fühlte ich mich geführt und vorwärtsgewiesen von einer wunderstarken Lenkerhand.
Nie so stark zuvor empfundenes Vertrauen erfüllte mich, ein Vorklang jener unerhört herrlichen Offenbarungen, die ich in den heißen Kämpfen der Zukunft erleben sollte.
So in tiefer, erschütternder und doch schon jetzt geheimnisvoll erhebender und beseligender Gefühlsverwirrung saß ich in meiner Lieben Mitte an jenem Vorabend des Weltkrieges.
Wohl war der Kriegszustand in Deutschland erklärt, hatte Russland mobil gemacht. Doch immer zirpte irgendwo im Herzenswinkel ein Hoffnungsheimchen: Es ist schon manchmal so gewesen — und immer wieder hat das Unwetter sich verzogen.
So begaben wir uns zur Ruhe und suchten den Schlummer. Draußen in der großen Welt wirkte inzwischen das Weltgeschick. —
Der Morgen des Sonnabends fand mich wieder am Arbeitspult. Ach schrieb wie ein Verrückter — und staunte oft über mich selbst, dass ich das konnte. Bis mich um Mittag die Kraft verließ. Noch wenige Seiten, und ich hätte den Meinen als letzte Gabe, als letzte Stütze für ihre dunkle Zukunft noch ein fertiges Werk hinterlassen können.
Aber es ging nicht mehr. Es war aus mit dem Dichten. Die Stunde der Tat hatte geschlagen.
Nach Tische gingen wir vier wiederum einkaufen. Selbst in der gelassenen Schwabenhauptstadt war bereits eine tiefe Veränderung des gewohnten Bildes wahrnehmbar. Überall sah man jene Herren mit den weißen Zetteln in der Hand, mit den erregten Frauen am Arme hin und wider hasten.
Und dann war auf einmal ein weißes Blatt in aller Händen, und auch in unsern knisterte es: da stand es hart und unverwischbar:
„Mobil!“
Vom Schloss her kam ein Zug junger Leute über die Planie — sie mochten beim König schon gewesen sein, nun zogen sie zum Herzogsschloss.
Vom Balkon herab sprach der junge Herzog Albrecht: militärisch knapp und kraftvoll. Das Hoch auf Kaiser und Reich brauste daher: ja . . . nun würde es Wahrheit werden, das Unausdenkbare. Es gab noch viel zu tun. Mein Entschluss war gleich gefasst: obschon ich erst am dritten Mobilmachungstage im Standort meines Regiments einzutreffen hatte, wollte ich doch schon morgen, Sonntag früh, reisen. Ich musste zur Truppe.
Fieberhaft wurde gepackt, ein Wagen besorgt, die zwei Kisten mit der Ausrüstung für zwei Pferde vom Speicher heruntergeholt und samt dem Offizierkoffer und dem braunen Wäschesack verladen. Tiefaufatmend sah ich zu, wie am Gepäckschalter auf alle vier Stücke der rote Zettel geklebt wurde:
„Kriegsgepäck. Bevorzugt zu befördern.“
Und dann saßen wir alle vier beisammen unter der friedlichen Lampe in der Bibliothek. Zum letzten Mal.
Vater, Mutter, Kinder. Zum letzten Mal beisammen. Und morgen geht’s in den Krieg.
Hand will Hand, Auge will Auge nicht lassen. Und mit einem Male wird’s dem Herzen ganz deutlich und zum ersten Mal im Tiefsten bewusst: wie glücklich man gewesen. Wie reich. Wie begnadet.
Steht auf, meine Lieben: es gilt dem Manne, dem ich einst im Fahneneid die Treue gelobt hab“ — die ich nun besiegeln will in Tat und Opfer, wie es Gott gefallen mag.
Unser Kaiser hoch! und hoch unser herrliches, reiches, lichtes, wundervolles Vaterland! Sie stürmen heran aus Ost und West und wollen’s uns rauben — sie sollen nicht — sie werden nicht! — Die Gläser klingen zusammen: Auge will Auge, Hand will Hand nicht lassen. Ist es zu glauben? Wir werden froh, als ging’s morgen auf gemeinsame Fahrt ins Sonnenland — und nicht — —
So sitzen sie nun beisammen in vielen, vielen hunderttausend und Millionen Heimstätten — und feiern Abschied! Nein, es muss noch einen Ausweg geben. Gewiss, die Großen, die Schicksalslenker, sind im letzten Augenblick doch noch erschrocken vor dem Übermaß des Leids, das sie heraufbeschworen haben, und sinnen auf eine Lösung. Es kann nicht anders sein . . .
Sei’s, wie’s sei: diese Stunde noch ist unser.
3.
Der Morgen kam. Der Sonntagmorgen. Der Morgen des 2. August — des ersten Mobilmachungstages.
Die Pforten des Heimathauses hatten sich hinter mir geschlossen. Da oben an meinem Schreibtisch war „Volk wider Volk“ entstanden. Hier hatte ich zuerst den Sieg geschaut. Und nun . . . nun ging’s zu einem neuen — zum schwersten Kampf. Mit sechsundvierzig Jahren, graue Fäden im Haar. Ins Ungewisse, ins Ungeheure, ins Bodenlose.
Mein Weib am rechten Arm die Kinder abwechselnd am linken. Im feldgrauen Kriegsgewand, an der Feldbinde das Glas, die Pistole. Der Bub trug den Helm mit dem grauen Bezug.
Die Sonntagsglocken klangen. In dichten Scharen hasteten die Menschen den Pforten der Gotteshäuser zu.
Wir hatten uns Zeit genommen. Die letzte Stunde des Beisammenseins sollte ausgekostet werden in ihrer ganzen wehen Süße. Wir schritten durch den Park, Stuttgarts köstliches Prunkstück.
Eng gesellt, doch fast stumm. Nur der Junge schwärmte, schwatzte seine erregte Begeisterung ins dunkle Sommergrün hinaus. Wir Eltern sprachen noch diese und jene häusliche Angelegenheit durch. Und jedes kannte des andern geheimste Gedanken:
Es wird ja doch nicht . . . es geht ja doch noch alles gut. . . Mobilmachung ist noch kein Krieg.
Eine nur war ganz, ganz stumm. Töchterlein. Sie war immer eine kleine Schweigerin gewesen, die ihr Tiefstes und Bestes wortlos in sich verschloss. Und auf einmal fiel ihr braunes Köpfchen an meine Schulter, und fassungslos weinte sie, weinte, weinte. Herzenskind . . . diese Tränen vergess ich dir nie. Dies stumme, köstliche Liebesgeständnis. Mein Kind . . . mein Kind.
Nun stehen wir an der Ecke, wo die Schlossstraße in die Königstraße mündet. Ein rotes Plakat, von Menschen umdrängt:
„Libau wird von unserer Flotte bombardiert. Heftige Zusammenstöße zwischen deutscher und russischer Kavallerie.“
Das — ist keine Mobilmachung mehr. Das ist der Krieg. Feindesblut ist geflossen und deutsches Blut. Kein Zurück mehr. Es ist entschieden.
Und tief senkten sich meines Weibes Blicke sekundenlang in die meinen. Sie hatte verstanden. Und sie schenkte mich dem Vaterlande. Mich und all ihr Glück. Das große Opfern hatte begonnen.
Am Bahnhof ein ungeheurer Wirrwarr. Noch fast gar keine Uniformen. Der zweite Mobilmachungstag ist erst der eigentliche Reisetag für die Offiziere des Beurlaubtenstandes.
Dennoch Menschenfluten, Riesenhaufen von Gepäck, fieberisches Rennen und Stoßen. In die friedliche Sommerreisezeit, die Ferienzeit, ist das Grauen hineingeplatzt. Alles hastet heimwärts, verstört, zerfahren, rücksichtslos nur auf die eigene Sicherung bedacht.
Züge rennen aus und ein. Der Berliner Schnellzug wird dreiviertel Stunde Verspätung haben.
Welch ein Volk! Fotogr. Scherl
Reserve rückt ein! Fotogr. Scherl
Im Schwall der heimwärts Hastenden entdecke ich zwei liebe, verehrte Freundesangesichter. Max Grube ist’s und seine prachtvolle Kameradin Marie. Ein glücklich Vorzeichen. Dieser Mann hat mich einst mir selbst entdeckt. Er hat mein Schauspiel „Caub“, das ich als ahnungsloser, welt- und bühnenfremder kleiner Barmer Rechtsanwalt vor vielen Jahren hingestammelt, für das Königliche Schauspielhaus in Berlin angenommen und aufgeführt. Meine Verehrung und Dankbarkeit für Max Grube ist unauslöschlich. Wir werden zusammen reisen. Gutes Vorzeichen.
Man geht wartend auf und ab. Man plaudert. Man sieht sich ins Auge. Alles unbewusst, willenlos, im Halbtraum.
Und auf einmal ist der Zug da. Man nimmt die letzten Küsse. Man klettert hinein. Man stürmt ans Fenster. Da unten stehen sie — die drei Geliebtesten. Sie stehen und weinen.
O ihr —! Wär’s möglich — — Nein, nein, nein — es darf nicht sein! Weib, Kinder — auf Wiedersehen — auf — Wiedersehen . . .
Man sitzt in einem Abteil voll Menschen, die alle vor Erregung fiebern. Auf dem Wagenflur drängt sich allerlei Volk. Zwei Mädchen darunter, auf ihren Koffern kauernd: stumm und tränenlos ins Nichts starrend. Zwei Bräute fahren nach Berlin, sich kriegstrauen zu lassen.
Der Zug rollt durch die sommerprangenden Berggelände. An jeder Brücke, jedem Tunnel hält eine kräftige Männergestalt Wache, in Zivil, aber das Gewehr 88 stolz im Arme. Sie trugen schwarzrote Binden, solange wir noch auf württembergischem Gebiete waren — nun gelbrote, seit wir auf badischem Boden hinrollen. An allen Bahnhöfen haben sie ihre Wachtstuben eingerichtet, da schäumt das Bier. Der Landsturm. Natürlich alles Freiwillige. Denn einberufen ist er selbstverständlich nicht. Damals schien er uns eben gut genug, im Inlande Wachtdienst zu tun — wer ahnte, welch ungeheure vaterländische Not unsere Vierzigjährigen alsbald in die vorderste Linie reißen würde, in Wunden, Leiden, Tod, Schulter an Schulter mit der Jugend, Väter und Söhne Leib an Leib . . .
So ging’s quer durch Deutschland. Überall gab es zu sehen, zu staunen. Schon war das Land im Innersten aufgewühlt.
Die Gesellschaft der Freunde Max und Marie Grube war mir eine wahre Herzstärkung. Das wirre Streben und Ringen von siebzehn Jahren stand mir wieder klar vor der Seele, als ich Erinnerungen austauschte mit dem Manne, der meinen Anfängen der einzige Helfer gewesen, mich nach unendlich vielen bittren Enttäuschungen aufgerichtet hatte: „Sie machen „Ihren Weg!“
Nun hatte ich ihn gemacht . . . und plötzlich vor mir gähnte statt des Ziels ein Abgrund.
4.
Um neun Uhr abends hatten wir in Berlin sein sollen: sechs Uhr früh ist’s geworden.
Nach einem schrecklichen Kampf um Gepäck, Droschke, Dienstleute, Bahnbeförderung komme ich nachmittags um vier in Frankfurt an.
Hochbepackt rumpelt die Kalesche durch die vertrauten Straßen. Hält endlich vor dem Kasernentor.
Leutnant Maron kommt mir entgegen, der junge, schlanke, prächtige, liebe Gesell.
„Herr Hauptmann — wer hätte das vor vierzehn Tagen gedacht!“
„Ja, mein lieber Maron — jetzt wird’s ernst!“
„Jawoll! die zweite Kompagnie wartet drinnen bereits mit Schmerzen auf Herrn Hauptmann!“
„Die zweite! — und ihr Chef — Hauptmann Gebhard?“
„Kommt zum Reserveregiment.“
„Und Sie?“
„Ordonnanzoffizier beim Regimentsstab.“
„Gratuliere! Na, wird’ ich mal gleich meinen Feldwebel aufsuchen. Wiedersehen!“
„Wiedersehen, Herr Hauptmann!“
Ich suche das Geschäftszimmer des ersten Bataillons auf. Treffe Leutnant Stumpff, den jungen, rosigen Adjutanten — der sich noch vorm Ausrücken mit der Schwester unseres Kameraden Grapow kriegstrauen lassen wird. Melde mich bei Major von Kleist. Überall die gleiche herzliche Aufnahme, der gleiche fröhliche, gesammelte Ernst.
„Sie werden in den nächsten Tagen alle Hände voll zu tun bekommen“, sagt der Kommandeur. „Ihre beiden Offiziere, Leutnant von der Osten und Leutnant der Reserve Grabert, sind auf Kommando, holen Reservistentransporte. Die ganze Mobilmachung müssen Sie allein mit dem Feldwebel machen. Aber Ahlert ist ja tüchtig, wie Sie wissen.“
Und bald steh’ ich in der Schreibstube „meiner“ Kompagnie, „meinem“ Feldwebel gegenüber. Kompagnievater und Kompagniemutter. Ein noch junger, kräftiger Mann mit blitzenden Soldatenaugen im runden Braungesicht, dessen Oberlippe ein weiches Schnurrbärtchen antuscht. Wir schütteln uns kräftig die Hand — versprechen uns gute Kameradschaft und vertrauenvolles Zusammenarbeiten. Wir haben’s gehalten.
„Wollen Herr Hauptmann die Kompagnie gleich mal sprechen? Es sind schon etwa fünfzig Mann Reserve eingetroffen.“
Ich will. Ahlert lässt antreten. Ich schlendre auf die sich ausrichtende Front meiner künftigen Waffengefährten zu.
In mir singt ein wildes Jubellied.
„Stillgestanden! Richt’ euch!“
Mit der gemessenen Lebhaftigkeit des altgedienten Unteroffiziers geht Ahlert auf den rechten Flügel, nimmt sich ein paar Sekunden Zeit, die Richtung zu verbessern.
„Augen gerade — aus! Augen — rechts!
Nun steht er kerzengerade vor mir, Aug’ in Auge:
„Kompagnie zur Stelle mit vierzehn Unteroffizieren, hundertzweiundsechzig Mann!“
Aller Augen sind auf mich gerichtet, neugierig, prüfend, durchdringend. Und mein Herz gelobt euch stumm die Treue, ihr fremden Hundertsechsundsiebzig.
„’Tag, zweite Kompagnie!“
„’Tag, Herr Hauptmann!“
Ein Schrei ist das, wie ein Schlachtruf: die vier Wände der Kaserne geben Echo.
„Zum Kreise rechts und links schwenkt — marsch!“
Ich stehe inmitten „meiner“ Kompagnie. Ich halte ihr eine Rede — die erste von vielen. Noch nie in meinem Leben, so etwa wird’ ich gesagt haben, hab’ ich einen stolzeren Augenblick erlebt als diesen, da es mir vergönnt ist, mich an die Spitze der zweiten Kompagnie unseres altberühmten, herrlichen zwölften Grenadierregiments zu stellen. Und ich weiß: euch allen geht’s nicht anders. Von Ost und West dräut der Feind heran, unser liebes Vaterland zu zerschmettern. Und uns ist es vergönnt, des deutschen Mannes höchste, heiligste Ehrenpflicht zu erfüllen: für Heimat, Weib und Kind die Waffen zu erheben. Euch allen hat der Krieg als erstes Erlebnis eine schwere Enttäuschung gebracht. Jeder von euch hat gehofft, ins Feld ziehen zu dürfen unter der Führung seines alten Kompagniechefs, des Hauptmanns Gebhard, der seit Jahren die Kompagnie geführt und zu dem gemacht hat, was sie ist. Und nun hat der Befehl des Königs ihm die schwerere Aufgabe zugedacht: eine neue Kompagnie beim Reserveregiment aufzustellen und zu führen. Ihr aber seht an eurer Spitze einen Reserveoffizier, den keiner von euch kennt. Ich habe heute noch kein Recht, Vertrauen von euch zu erwarten. Aber ich verspreche euch, nicht zu rasten und zu ruhen, bis ich mir’s verdient habe. Mehr brauche ich euch nicht zu sagen: märkische Grenadiere wissen, was ihre Pflicht ist, wenn ihr König sie zu den Waffen ruft. An den nächsten Tagen werden wir uns noch über mancherlei verständigen. Heute sage ich nur das eine: lasst uns gute Kameradschaft halten in frohen und schlimmen Tagen! Das sei unser Gelöbnis, und wir bekräftigen es mit dem Rufe:
„Seine Majestät, unser allergnädigster Kaiser, König und oberste: Kriegsherr — hurra! hurra! hurra!“
— Zurück zur Kompagniestube und dort mit Ahlert das Arbeitsprogramm für die nächsten Tage durchgesprochen. Drei Tage nur werden wir voraussichtlich noch zur Verfügung haben: vom siebenten Abends an ist das Regiment marschbereit! Und was muss in den drei Tagen alles noch geschehen! Aber ein Blick in des Feldwebels ruhig — feste Augen sagt mir: der schafft’s. Und ich will’s an nichts fehlen lassen.
Mein Bursche meldet sich bei mir: der Grenadier Weise. Ein Landwirtssohn mit guten, verlässlichen Augen. Er verstaut meine Pferdekisten im Kompagniezimmer, wird mein Gepäck in mein Quartier besorgen. Ich werde in einem Privathause einquartiert, bei Oberregierungsrat K.
Die Villa liegt abseits, in einem köstlich stillen Garten. Der Hausherr heißt mich willkommen, einer seiner Söhne steht bereits als Kriegsfreiwilliger bei den Fürstenwalder Ulanen, der andre kommt vom Dienst nach Hause, Rekrut bei unserm achtzehnten Feldartillerieregiment. Alles fiebert, jedes Wort, jeder Gedanke heißt: Krieg.
Abendtafel wie in einem Manöverquartier. Jeder sucht die tiefe Erregung des Innern durch heitere Ruhe zu übertünchen. Vergebens. Der Oberregierungsrat erzählt, die Stadt Frankfurt habe Anweisung bekommen, für dreißigtausend Flüchtlinge aus Ostpreußen Quartier bereitzustellen. Die Abendzeitungen melden, dass unsere Truppen die belgische Grenze überschritten haben, der belgischen Neutralität nicht achtend. Wie wird England sich stellen? Die letzten Telegramme erzählen von der wundervollen Reichstagssitzung des heutigen Morgens. Von des Kaisers Wort: keine Parteien mehr, nur noch Deutsche. Die Sozialdemokraten haben die Kriegskredite bewilligt. Wir sind ein einzig Volk von Brüdern.
In der Nacht, im fremden Bette, wird’ ich wach. Irgendwo in der Ferne hallt der Schritt marschierender Scharen. Dazu klingt Gesang:
„Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
wie Schwertgeklirr und Wogenprall:
Lieb Vaterland, magst ruhig sein,
fest steht und treu die Wacht am Rhein!“
Tausendmal hat man diese Weise gesungen im Frieden . . . Und in meinen Dichterträumen hab’ ich sie noch anders vernommen: durchschüttert vom Erzklang kriegerischer Wirklichkeit. So hab’ ich versucht, sie in meine Dichtung von Siebzig hineinzuweben. So klingt sie nun in mein Erwachen hinein: in feierlicher Wirklichkeit.
5.
Die Welt ist verwandelt. Sie scheint nur mehr Männer zu tragen — und Rosse.
Männer. Wohin das Auge blickt, branden sie heran. Im Gewand ihres Alltags. In unübersehbaren Fluten durchstrudeln sie die Straßen, in hartem Kolonnentritt, zu dröhnendem Gesang. Neben der Bluse der Bratenrock, neben dem Försterflausch der Bauernkittel. Die Kasernentore schlucken sie ein.
Drinnen verwandeln sie sich. Sie streifen das Werkeltagskleid ab und hüllen die festen Knochen in die eine, die gleiche Farbe: das stumpfe, herbe Grau des neuen Krieges. Komische, zwerchfellkitzelnde Bilder des Übergangs. Reservistenbäuche, zu denen kein Koppel passen will. Quadratschädel, auf denen die viel zu enge Feldmütze hockt wie ein Studentenzerevis. Der Regimentskommandeur reitet über den Hof. Oberst von Reuter. Ich melde mich „ganz gehorsamst gemäß Mobilmachungsbefehl beim Regiment eingetroffen und mit Führung der zweiten Kompagnie beauftragt“. Er begrüßt mich in seiner ernsten, fast finstern Art. „Darf ich meinen ganz gehorsamsten Glückwunsch aussprechen, dass Herr Oberst nun die Ehre haben werden, das gleiche stolze Regiment an den Feind zu führen, an dessen Spitze der Vater von Herrn Oberst bei Spichern gefallen ist!“
Ein ekstatisches Leuchten geht über die bronzenen Züge. Ich fühle, dass er sich nichts Stolzeres wünscht und hofft, als den gleichen köstlichen Soldatentod. Ich verehre ihn um dieses Leuchtens willen.
Männer. Jeder neue Schwall, der in die Pforte der Grenadierkaserne droben an der Freienwalder Landstraße hineindrängt, spaltet auch einen Zufluss für meine Schar ab. Es werden immer mehr, immer mehr. Vizefeldwebel Döring, mein Kammerunteroffizier, kommt aus seinem von Kampfer und altem Schweiß durchdunsteten Bau nicht mehr heraus. Unter seinen Händen verwandeln sich die alten Reservisten wieder in junge Grenadiere.
Dazwischen: Begrüßung, Willkommen, leuchtende Augen, erregt schnarrende Stimmen, rasselnde Säbel, braune Handschuhe zum Mützensaum emporfahrend und gleich darauf zu heftigem Händedruck einander sich entgegenstreckend. Kameraden — bald in Wahrheit Waffengefährten. Am engsten schließen sich sofort die Bataillonskameraden zusammen. Die vier Kompagnieführer. Spiegel, alter Ostafrikaner, schon vom Aufstand 1905/6 her das schwarzweiße Band im Knopfloch: ein ausgekochter Kriegsgesell, um seiner Felderfahrung willen unser aller beneidetes Vorbild — wortkarg, überlegen, bestimmt: der Kompagniechef der Ersten. Graf Reventlow, ruhig, heiter, freundlich, sarkastisch, unpathetisch und doch voll inneren Schwunges: seit Jahren Häuptling der Dritten. Der Führer der Vierten gleich mir dem Beurlaubtenstande angehörig.
— Rosse. Auf allen Straßen schnauben sie, Hadern sie, stampfen sie daher. Stämmige Bauerngäule, reckenhafte Spediteurpferde, schlanke Traber aus Herrschaftsställen, tänzelnde Vollblüter, der Hindernisbahn kundig. Eine Flut von Braunen und Rappen und Füchsen und Isabellen. Das ungewohnte Beisammensein in solchen Riesenmassen, der Eisenbahntransport, das ganze seltsam fremde Geschehen macht die Nachdenklichen, Regelgewohnten wirr und erregt. Es gibt Ausbrecher, Starrköpfe, die nicht weitermögen. Mürrisches, verstörtes, verschrecktes Gewieher und Geschniefe. Peitschenklatschen, rauer Zuruf, Zaumzerren, Schweiß und Zank.
Rosse — was ihr uns geworden seid im Kriege — wer könnte das zu Ende singen und sagen? In euch wie in uns ist eine Kriegerseele. Ihr versteht, fühlt, leidet und triumphiert mit uns. Es gibt brave Durchschnittskämpfer unter euch und erlesene Helden. Freunde, Kameraden seid ihr uns alle.
Noch wälzen sie sich als formloser Strom wellenliniger Rücken, schaumbeflockter Flanken, mähnenumbuschter nickender Hälse an mir vorüber, ein Bild unerschöpflicher, heißaufwogender Urkraft.
Nach den Rossen wieder Männer. Wenn du zu Fuß zur Kaserne gehst, bekommst du die Hand nicht vom Mützenschirm. Jeder grüßt. Auch die noch in bürgerlicher Kleidung sind. Alle sind sie ja willens, sich einzugliedern in den Riesenorganismus, der sich zusammenschließt mit Rätselkraft. Unzählige Male wird man angesprochen.
„Herr Hauptmann, können Sie mir wohl sagen, wie ich’s anfangen kann, das; Ihr Regiment mich als Freiwilligen annimmt? Meine Frau ist tot, meine beiden Jung’s sind eingezogen, mein Schwiegersohn auch! Ich bin schon bei drei Regimentern gewesen, keins will mich haben, ich wär’ zu alt! Sechsundfünfzig, und zu alt! Wollen Sie mal meine Muskeln fühlen, Herr Hauptmann?“
„Nicht nötig, Kamerad. Ich brauch’ Ihnen nur ins Auge zu sehen: gehen Sie auf den Kasernenhof und warten Sie auf mich, will sehen, dass Sie wenigstens vorgemerkt werden.“
Ein Jungchen, kaum der Schulbank entronnen, tritt mir keck in den Weg, haut die Hacken zusammen wie ’n Alter. „Herr Offizier, ick will mit.“
„Du? und der Vater, Schlingel, was sagt der?“
„Ick darf. Ick habe ’t schriftlich.“ Er hält mir einen Brief unter die Nase. „Vom Ollen.“
Es ist zum Lachen und zum Weinen.
Ein junger Kamerad, Leutnant Egon von Münch, spricht ein hübsches Wort.
„Herr Hauptmann!“ sagt er blitzenden Auges, „nun haben wir so viele Jahre lang Regimentsgeschichte instruiert: jetzt woll’n wir mal selber welche machen!“
— Heut ist Pferdeverteilung. Da gilt’s sich dazuzuhalten. Pferde sind Schicksale.
In drei Reihen sind sie aufgebaut — die Pferde für’s erste Bataillon. Der Oberst, der Regimentsadjutant, der schmucke Oberleutnant Tronje Hagen; der Bataillonskommandeur und sein Adjutant, die Kompagnieführer, die Feldwebel, alles gespannt, gewinnsüchtig. Jeder findet, für ihn sei das Beste gerade gut genug.
Nun werden sie vorgeführt — die Schicksale. Sie haben die Bahnfahrt noch in den Knochen — sind rein des Deibels.
Ich denke, ich werde gut abgeschnitten haben. Einen Braunen bekomm’ ich, der an Kruppe und Flanken ein paar abgewetzte Stellen zeigt: ein Wagenpferd, aber ein erstklassiges. Er soll Alfred heißen, nach dem jungen Freiwilligen in der Trilogie. Und einen höchstens vierjährigen Falben, ein bissel klein für mich, noch ungeritten, sogar unbeschlagen. Wird Arbeit geben. Ich taufe ihn Werner, nach dem „krassen Fuchs“.
„Weise, verpassen Sie zunächst mal für den Braunen Sattel- und Zaumzeug.“
Inzwischen hat sich eine Zeremonie vollzogen, der ich leider nicht habe beiwohnen können, so fest ich mir’s vorgenommen: das Säbelschleifen. Seit Frühjahr 1892 hab’ ich die Waffe getragen, wann immer es dem Vizefeldwebel der Reserve, dem Sommerleutnant geziemte. Auf Übung wochenlang. Durch fünf Manöver. Zu Kaiser-Geburtstag-Feiern und Denkmalenthüllungen. Beim Kaiserbesuch. Zu zahllosen Ehrenrats-Sitzungen. Immer mit dem Gedanken: ob du wohl noch mal geschliffen wirst?
Nun ist sie geschliffen — die blanke Klinge, haarscharf. Die Blutrinnen funkeln gierig. Ob sie Blut zu trinken bekommen werden? Mit seltsamen Gefühlen häng’ ich sie an die Seite. Abends wieder bei Oberregierungsrats am gastlichen Tische. Manöverbild. Aber keine Manöverstimmung. Der Hausherr hat Zeitungen mitgebracht. Seltsame Nachrichten: Sir Edward Grey hat in der Sitzung des Unterhauses vom 3. August wunderliche Reden geführt: Wenn eine fremde Flotte Frankreichs ungeschützte Küste angreifen würde, könne England nicht ruhig zusehen. Wenn England mit seiner mächtigen Flotte an dem Kriege teilnehme, werde es wenig mehr zu leiden haben, als wenn es ihm untätig zusähe . . .
Das bedeutet also . . . Herrgott! noch ein Feind . . .
Andern morgens früh heraus. Auf dem Kasernenhof das immer gleiche rastlose Treiben. Mitten zwischen dem Gewühl der einströmenden, im Einkleidungsgeschäft begriffenen Mannschaften tummelt Willy Weise kräftig den „Werner“.
„Na, wie geht er?“
„Ganz roh, Herr Hauptmann“ Pferd und Reiter triefen. Wird Mühe kosten.
Auf dem Hofe stehen meine Kompagniewagen aufgebaut. Funkelnagelneu, blitzsauber lackiert. Patronenwagen, Gepäckwagen, Lebensmittelwagen. Und die Bagagepferde werden verteilt, die Trainsoldaten, die Feldküchen. Nach unsäglicher Mühe ist alles bewusst, die Bagage des ganzen Bataillons rollt zur Fahrübung aus dem Kasernentor. Nach ein paar Minuten kommt ein wildes Vorwärtspreschen in die Kolonne. Wie die höllische Jagd braust der rasselnde Tross von dannen. Wenn das man gut geht.
Meine Männer sind nun vollzählig beisammen, stehen zum Appell angetreten. Mit stolzverlegenem Schmunzeln meldet mir Ahlert: „Es sind vierzig Mann zu viel.“
Vierzig Mann zu viel!
„Wie ist das möglich, Ahlert?“
„Es sind eine ganze Menge ehemaliger Leute von der Kompagnie unter den Reservisten, die Einberufung nach Cottbus zum Reserveregiment haben. Aber sie sagen: sie blieben hier. Sie gehörten zur zweiten Kompagnie — und Herr Hauptmann müssten sie mitnehmen.“
Ich trete heran. Am linken Flügel sind, noch ganz in Zivil, die „Ungebetenen“.
„Kinder, das ist mir ’ne schöne Geschichte! Ihr gehört ganz woanders hin — und ich soll euch mitnehmen?“
„Jawoll, Herr Hauptmann — wir jehören mang de Zweete.“
„Seht mal, euren alten Hauptmann, den findet ihr doch nicht. Der ist beim Reserveregiment. Und mich kennt ihr nicht.“
„Ja ejal, Herr Hauptmann. Wir jehören mang de Zweete. Und Herr Hauptmann wird det schonst machen. Wir bleiben bei de Zweete!“ Irgendetwas Warmes, Auflösendes steigt in mir auf und drängt mein Herz diesen fremden Männern entgegen. „Seht mal, Jungens, wenn ich euch auch mitnehmen wollte — ich kann nicht. Ich hab ja gar keine Sachen für euch.“
„Det macht nischt, Herr Hauptmann. Wir jehn eenfach vorläufig in Siffiel mit. Et werden schonst bald welche zu liegen kommen. Den’ ihre Sachen gibt Herr Hauptmann uns dann.“
Herrgott . . . keinen von euch möcht’ ich missen — keinen.
Ich trete mit Ahlert zur Seite. Wir beraten. Vielleicht könnte man wenigstens einigen helfen. Da sind noch etliche zwanzig, die zwar zum Regiment einberufen, aber aus andern Regimentern hervorgegangen sind. Wenn man die — mit Genehmigung des Kommandeurs — austauschte?
Es ist gemacht worden. Unter den zwei-, dreiundzwanzig alten Kerls von der Zweiten sind ein paar meiner Besten gewesen.
Ein Zug junger, blutjunger Bürschchen in Drillich trudelt über den Hof, von einem grauschnurrbärtigen Feldwebel geführt. Noch ist keine Form drin — kein Zusammenschluss. Nur: die feinen Köpfe überm groben Leinen! die blanken, verlangenden Augen! Die knisternde Begeisterung unterm Kittel! Unsere Freiwilligen. Alle Geschäftszimmer sind von ihnen überlaufen.
Welch ein Volk! welch ein Volk!
Am Nachmittag stell’ ich, was eingekleidet ist von der Kompagnie, zum ersten Male zum Exerzieren zusammen. Mit siedendem Stolz in der Seele reit’ ich auf „Alfred“ vor die Mitte der Kompagnie, zieh’ den Säbel — gebe das erste Kommando:
„Stillgestanden! Das Gewehr — über!“
Auf einmal bin ich — ganz woanders. Alfred, der nie zuvor Soldat war, hat einen fürchterlichen Satz gemacht und rast mit mir von dannen. Der ganze Kasernenhof kommt in Aufruhr — alles grinst. Ich fühle, wie mir die Glut in die Stirn quillt.
Ins Feld! Fotogr. Scherl
Vorwärts ohne Rast! Fotogr. Scherl
Mit Müh und Not zwing’ ich den zitternden, schäumenden Gaul. Aber er ist nicht wieder an die silberschillernde Linie der Gewehrläufe heranzubringen.
„Feldwebel, setzen Sie die Kompagnie nach dem Exerzierplatz in Marsch!“
Mit ein paar festen Sporenhieben such’ ich den Gaul zur Vernunft zu bringen. Endlich hab’ ich ihn wieder in der Hand, bringe den ängstlich Schielenden zum Kasernentor hinaus, an der Marschkolonne vorüber, setze mich an ihre Spitze. Alfred trieft — ich auch.
Wir sind auf dem „Nuhnen“. Auf mein Kommando schwenkt die Kompagnie zur Linie ein — steht regungslos.
„Gewehr — ab!“
Rrrtt —
Wie hätt’ ich mich über den Griff gefreut — wenn ich ihn noch gesehen hätte. Aber ich bin schon weit, weit weg. Alfred rast von dannen, wie mit glühenden Ketten gepeitscht.
Kein Halten. Wir überqueren in tollster Peese den weiten Platz, fegen in mächtigem Satz über einen Graben, eine Chaussee, noch einen Graben — ein Stacheldrahtzaun gebietet endlich Halt.
Ich sitze ab — versuche den Gaul am Zaum auf den Platz zurückzubringen, nachdem alle Versuche, ihm vom Sattel aus die Nase ’rumzudrehen, kläglich gescheitert sind. Er mag das Entsetzliche nicht mal von weitem sehen.
„Pferdehalter her!“ schrei“ ich über einen Kilometer.
Ein Soldat löst sich aus dem Klumpen, schnauft heran. Ein älterer Reservist: ein brauner Kerl mit einem ungeheuren schwarzen Schnurrbart, Augen wie Kohle. Hinter furchterregender Maske ohne ich unsägliche Gutmütigkeit.
„Wie heißen Sie?“
„Reservist Müssigbrodt.“
„Verstehen Sie was von Pferden?“
Er grinst vertrauenerweckend. „Jawoll, Herr Hauptmann.“
Er nimmt die dargereichten Zügel, klopft dem Pferde den weißbeflockten Hals, lacht mich an.
„Det Ferd is jut, Herr Hauptmann. Det is man det Unjewohnte.“
Ich lache auch. Eine Kameradschaft ist geschlossen. Sie hat gehalten.
Zu Fuß leite ich das Exerzieren: freue mich, wie die Reservisten mit den Rekruten um die Wette im Einzelmarsch die eingerosteten Knochen strecken. Dämmerung goldet um die Strampelwiese, als ich Einrücken befehle.
Müssigbrodt bringt mir das Pferd: aber kaum sitz’ ich oben, da rast der Gaul wieder von dannen, von den grässlichen Soldaten weg. Und in ganz, ganz weitem Umweg nur hab’ ich ihn um den verhassten Platz herumbringen können. In den Kasernenhof geht er hinein, obwohl schaudernd. Drinnen wittert er ja den Stall.
Graf Reventlow begegnet mir auf dem Kasernenhof. Ich erzähle mein Pech. Mit seiner prachtvoll beruhigenden tiefen Stimme tröstet er mich:
„Lassen Sie den mal drei Tage mit der Nase auf ein Kochgeschirr unterwegs sein: dann bringen Sie ihn von den Soldaten gar nicht mehr weg.“
— Und noch ein Tag. Die Stammrollen werden aufgenommen: an langen Tischen schwitzt ein halb Dutzend Schreiber. Ich muss zweihundertfünfzigmal meinen Namen schreiben.
Und heute kommt der erste Brief von Hause — von ihr — von den Kindern. So gut, so stolz, so deutsch . . .
Am Nachmittag meldet sich bei mir der erste meiner Zugführer: Vizefeldwebel Schüler, ein schlankes, feines Jungchen, seines bürgerlichen Zeichens Beamter der Deutschen Bank in Berlin; auf dem Achselstück trägt er die Kriegstressen des Offizierstellvertreters. Ich habe für den Spätnachmittag einen großen Übungsmarsch der nunmehr zusammengestellten Kompagnie angesetzt. Dann gab’s noch massenhafte Büroarbeit. Spät in der Nacht kam ich in meinem Quartier an, völlig zerschlagen, konnte nur mit Mühe dem Bericht des Oberregierungsrats über die Entwicklung der Ereignisse da draußen lauschen. Der umfasste furchtbar ernste Dinge, aber ich konnte sie nicht mehr so richtig im Schädel unterbringen. Nur eins rumorte mir in allen Nerven und Knochen, als ich ins weiche Bett fiel — zum letzten Mal, ohne dass ich’s ahnte — dies eine:
England hat uns den Krieg erklärt.
6.
Dies ist das große Glück des Soldaten in solcher ungeheuren Zeit:
Er lebt in seinem engsten Kreise. Den füllt er aus, und dazu bedarf es des Einsatzes seiner letzten Kraft. Er hat nicht Zeit, aufs Ganze zu denken, das Ganze zu suchen — dies riesenmäßige, ungreifbare Millionenschicksal, auf das er ja doch nicht wirken kann. Er hat seine engumgrenzte Pflicht: die leistet er, und dann kann und darf er mit sich zufrieden sein. Was darüber hinaus liegt, das stellt er in die Hand — nun, in wessen Hand? In die Hand einer Macht, für die das Weltkind bislang keinen Namen hatte — nach der es nun, zum ersten Mal im Leben, ein nebelhaftes, banges, herzumschnürendes Sehnen empfindet. Es muss — es muss irgend so etwas geben . . . irgendwohin muss die Seele sich flüchten können aus dem Grauen, das sich ringsum zusammenballt, irgendwo muss sie niederlegen können Erinnerung und Hoffnung, Glück und Qual, Stolz und Scham, Jauchzen und Bangen. Irgendwo — ach, wo?!
Durch die Jagd der nach Stunden und Minuten genau eingeteilten Arbeit, durch den wilden Vorüberzug der Bilder eines neuen, ungeheuren Lebens, das unmittelbare, drängende, atemraubende Nähe ist, dringt nur matt und dumpf das Getös des fernen, unermesslich gewaltigen Weltgeschehens.
Befehl: von heute Abend sechs Uhr an ist das Regiment marschbereit. Verladung wahrscheinlich morgen früh. Wohin? nach Osten? nach Westen? Unbekannt . . .
Ein letztes fieberhaftes Arbeiten rumort in den staubdurchwirbelten Kasernengängen. Das Landwehrregiment soll unser Quartier wie ein Schmuckkästchen vorfinden.
Meine Offiziere sind endlich von ihren Kommandos zurückgekommen: der aktive Leutnant von der Osten, mir von den Übungen her bekannt, ein schlanker, fester, korrekter, straffer Berufssoldat, und Leutnant der Reserve Grabert, seines bürgerlichen Zeichens Geometer und Mitglied der kartographischen Abteilung des Großen Generalstabes, untersetzt, stramm, trocken, humoristisch, etwas derb in seinen Formen. Die Herren melden sich.
„Na, Sie haben’s gut gehabt, haben in der Welt herumsausen dürfen, während ich mit dem Feldwebel die ganze Mobilmachung allein schaffen musste . . .“
— „Wir haben auch nichts zu lachen gehabt, Herr Hauptmann“
Und sie berichten von mancherlei komischen und ärgerlichen Erlebnissen.
„Wie ist die Stimmung im Lande?“
„Über jedes Lob erhaben. Nicht die leisesten Schwierigkeiten mit den Reservisten. Das Kaiserwort: Ich kenne nur noch Deutsche, die Stellungnahme der Sozialdemokratie — uns kann nichts geschehen.“
„Ich merke, die Herren haben auf ihren Fahrten zum Zeitunglesen Muse gehabt“
Aus den knappen Erzählungen der Kameraden steigt etwas herzaufschwellend Herrliches empor: das Bild eines Volkes, das sich aufreckt, riesenhaft, urgewaltig, in nie erhörter Vollendung der Idee seiner selbst.
Für den Mittag hatte ich noch einen Übungsmarsch angesetzt.
Am Nachmittag führte ich meine Kompagnie zum Abendmahl in die alte, ehrwürdige, halbdunkle Garnisonkirche, die ein Stück preußischer Geschichte verkörpert.
Der Divisionspfarrer Jäckel sprach. Schlicht, mannhaft, soldatenhaft.
Und wie nun in langen Reihen meine Grenadiere niederknieten, kniend das heilige Mahl empfingen — wie die hochgeschwellte Seele das Bild in sich aufnahm dieses dämmrigen Gotteshauses mit dem mattschimmernden sparsamen Gold des Altars, dem fahlen Grau der Waffenröcke, den rührenden, kurz geschorenen Köpfen meiner Jungens in allen Abschattungen von Braun und Blond und Schwarz, dahinter der schwarze Talar des Pfarrers, sein ernstes, ehrenfestes Antlitz, von schwarzem Haar und Bart umrahmt, alles in Haltung, Gebärde und Wort von einer geraden, herben, evangelischen, preußischen, fritzischen Nüchternheit — da empfand ich ein inniges Begreifen und Umfassen der Schönheit unserer Zeit. Ja, es ist Preußengeist, Brandenburgergeist, der über dieser Stunde liegt. Scheinlos, farblos, wortlos. Tatgeist. Kantgeist.
— Nun muss ich noch einmal zu meinen lieben Quartierwirten, um Abschied zu nehmen. In einer Stunde, um sechs Uhr, ist Regimentsappell auf dem Platz am Proviantamt. Ein Beisammensein der Offiziere wird sich anschließen. Es dürfte spät werden. Die wenigen Nachtstunden bis zum Aufbruch find’ ich wohl auf einem überzähligen Kasernenbett ein erstes Kriegslager.
Ja — und nun wären die Koffer unterwegs zum Bahnhof, kriegsmarschmäßig hab’ ich mich angetan, losgelöst von dem letzten Zusammenhang mit der Welt von gestern. Mit einem seltsam befreiten Abenteurergefühl schlendre ich der Kaserne zu, den vertrauten Weg. Ein Gefühl von trunkener Daseinsfülle, froh aufjauchzender Daseinslust. Als singe nun das Leben erst so recht an, das zu sein, was es hatte werden wollen . . .
Das ist es: sich erfüllen. Was du sangest, sollst du schauen und schaffen helfen.
Marschbereit steht das Regiment, die Bataillone in Hufeisenform aufgestellt. Es knarrt das nagelneue Lederzeug, über dem stumpfen Grau der Waffenröcke flammen die Zwölfen an den Helmbezügen in grellem Rot. Ein verhaltenes Fieber liegt über den Dreitausend. Wie oft standen wir so in Parade. Damals war’s Spiel, wenn auch ein ernsthaftes, bedeutungsvolles. Nun winkt uns des Spieles tieferer Sinn. Morgen geht’s ins Feld.
Du bist wach, so wach wie je im Leben. Und doch: dies alles ist mehr Traum als Wachen. Mehr Gedicht als Erlebnis.
Musik von der Landstraße her! Vor der Fahnenkompagnie der Regimentskommandeur mit seinem Stabe. Auf des Obersten bronzenem Gesichte wetterleuchtet feierliche Erregung. Umbraust von herben Marschrhythmen, schweben die Fahnen heran. Nicht die zerfetzten, blutgeweihten aus alten Kriegen. Ein Neues hebt an.
Die erste Kompagnie schließt das Viereck. In der Mitte hält Oberst von Reuter. Er spricht.
Was hat er gesagt? Ich weiß es heute nicht mehr — habe es vielleicht nie gewusst. Es ist ein großes Brausen in meiner Seele. Weltensturm. Gottessturm. Es ist ja nicht ein einzelner, der da spricht. Wir alle reden. Deutschland redet. Es redet das Vaterland.
Jetzt das Hurra — das dreifache Hurra des Grenadierregiments Zwölf für den Obersten Kriegsherrn. Dies ist ein Hurra, wie wir’s nur dies eine, dies einzige Mal gerufen haben. Einst wird das Regiment am gleichen Platze stehen und den gleichen Jubelruf in die Lüfte jauchzen. Das Regiment. Aber wer von uns wird dann noch dabei sein? Viele von uns werden fehlen. Das Regiment wird leben, wie Preußen, wie Deutschland leben wird. Wir alle sind sterblich. Diese drei sind unsterblich: Deutschland, Preußen, das zwölfte Regiment.
Die Bataillone rückten ab, der Kommandeur versammelte uns im Vortragsraum des Kasinos.
Er hielt eine erste Offizierbesprechung ab, versprach und erbat treue Kameradschaft, vor allem auch gegenüber Mannschaften und Unteroffizieren. Dann lud er zu einem „Satteltrunk“ — einem letzten Liebesmahl in dem vertrauten großen Kasinosaal. Wie viele haben ihn nicht wiedergesehen.