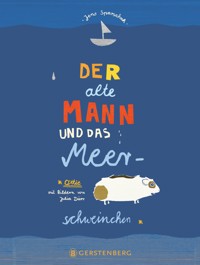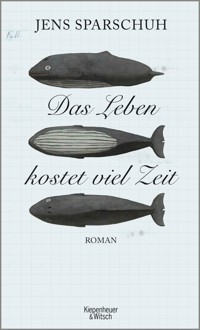
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jedes Leben ist ein Roman. Stimmt. Und der Verfasser ist unbekannt. Jens Sparschuh, Autor des Wendeklassikers »Der Zimmerspringbrunnen«, erzählt in seinem neuen Roman »Das Leben kostet viel Zeit« hinreißend komisch und leichtfüßig philosophisch von einer ganz besonderen Freundschaft und der Suche nach der eigenen Geschichte. Vor Jahren führte Titus Brose ein beinahe aufregendes Leben als Chefredakteur des Spandauer Boten. Heute schreibt er Memoiren im Auftrag der Firma LebensLauf. Seine Klienten findet er im Alten Fährhaus, einer Seniorenresidenz am Rande von Berlin. Auch Dr. Einhorn lernt er dort kennen, der sein Interesse auf Adelbert von Chamisso und Eduard Hitzig lenkt. Letzterer schrieb nicht nur posthum Chamissos Biografie, er sorgte gleich selbst für einige der spannendsten Episoden in dessen Leben. Fasziniert von dieser Beziehung begibt sich Brose auf eine Recherchereise. Sie führt ihn in seine eigene Vergangenheit im geteilten Berlin und ins Leipziger Stadtarchiv. Und während er in rätselhaften historischen Dokumenten stöbert und im Alten Fährhaus an kollektiven Gedächtnistrainings teilnimmt, merkt er: Es ist nicht das Leben, das all diese komischen und traurigen Geschichten schreibt ... Dieser Roman ist ein so philosophisches wie herrlich humorvolles Nachdenken über die Entstehung von Lebenserzählungen und eine Hommage an eine ganz besondere Freundschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jens Sparschuh
Das Leben kostet viel Zeit
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jens Sparschuh
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jens Sparschuh
Jens Sparschuh, geboren 1955 in Karl-Marx-Stadt, studierte von 1973–1978 Philosophie und Logik in Leningrad. 1983 promovierte er in Berlin, seitdem arbeitet er freiberuflich. Er veröffentlichte eine Vielzahl von Hörspielen und Kinderbüchern. 2009 erschien »Putz- und Flickstunde« (zusammen mit Sten Nadolny). 1989 erhielt er den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Bei Kiepenheuer & Witsch sind erschienen: »Der Schneemensch« (1993), »Der Zimmerspringbrunnen« (1995), »Der große Coup« (1996), »Ich dachte, sie finden uns nicht« (1997), »Lavaters Maske« (1999), »Eins zu eins« (2003), »Silberblick« (2004), »Ich glaube, sie haben uns nicht gesucht« (2005), »Schwarze Dame« (2007), »Im Kasten« (2012), »Ende der Sommerzeit« (2014).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Vor Jahren führte Titus Brose ein beinahe aufregendes Leben als Chefredakteur des Spandauer Boten. Heute schreibt er Memoiren im Auftrag der Firma LebensLauf. Seine Klienten findet er im Alten Fährhaus, einer Seniorenresidenz am Rande von Berlin. Auch Dr. Einhorn lernt er dort kennen, der sein Interesse auf Adelbert von Chamisso und Eduard Hitzig lenkt. Letzterer schrieb nicht nur posthum Chamissos Biografie, er sorgte gleich selbst für einige der spannendsten Episoden in dessen Leben. Fasziniert von dieser Beziehung begibt sich Brose auf eine Recherchereise. Sie führt ihn in seine eigene Vergangenheit im geteilten Berlin und ins Leipziger Stadtarchiv. Und während er in rätselhaften historischen Dokumenten stöbert und im Alten Fährhaus an kollektiven Gedächtnistrainings teilnimmt, merkt er: Es ist nicht das Leben, das all diese komischen und traurigen Geschichten schreibt …
Dieser Roman ist ein so philosophisches wie herrlich humorvolles Nachdenken über die Entstehung von Lebenserzählungen und eine Hommage an eine ganz besondere Freundschaft.
Inhaltsverzeichnis
Dienstag, 23. Mai
Mittwoch, 24. Mai
Dienstag, 30. Mai
Dienstag, 13. Juni
Mittwoch, 21. Juni
Montag, 26. Juni
Dienstag, 27. Juni
Dienstag, 4. Juli
Dienstag, 11. Juli
Freitag, 14. Juli
Montag, 17. Juli
Freitag, 21. Juli
Montag, 14. August
Dienstag, 15. August
Ein Tag im August
Danksagung
Dienstag, 23. Mai
»Stimmt was nicht?«
»Ja«, sagte Wanda.
Lange schaute sie Brose an. Und dann sagte sie leise, fast entschuldigend: »Eigentlich – – – alles.«
Ein Lächeln hing verrutscht in ihrem Gesicht; jederzeit, so schien es, konnte es herunterfallen und in tausend Stücke zerspringen.
Dabei, an diesem Dienstag hatte alles so perfekt begonnen. Ein richtig guter Vormittag hätte es werden können. Luftig zogen ein paar Wolken über den beinahe schon sommerlichen Frühlingstag hinweg. Als weißflockiges Kontrastprogramm zum himmlischen Blau ließen sie das Firmament noch höher erscheinen, noch intensiver leuchten, flirren.
Die beigefarbene LebensLauf-Mappe locker unter den Arm geklemmt, war Titus Brose um halb zehn vom Parkplatz gekommen, durch das Foyer geschritten, selbstbewusst am Fahrstuhl vorbei, den er wie stets stolz ignoriert hatte, um dann, immer zwei Stufen auf einmal, zu ihr in den zweiten Stock zu eilen. Nachdem er kurz angeklopft hatte, war er in Wandas Zimmer getreten. Was heißt »getreten«? Hineingeweht war er, wie ein Frühlingswind. Auf demonstrative Weise wurde er in diesem Seniorenheim jedes Mal unglaublich leichtfüßig; das war unfair, er wusste es. Es war eine widerrechtlich angemaßte Jugendlichkeit, die sich nur angesichts des allgemeinen Siechens und Kriechens rundum behaupten konnte; abstellen ließ sich es trotzdem nicht.
Sogar an Blumen für Wanda hatte er noch gedacht, Tulpen von Shell, gelbe und rote.
Unterm Strich waren es exakt die zweihundertvierzig Seiten geworden, die sie vereinbart hatten; darüber war Brose sehr froh. Der Fototeil musste noch eingearbeitet werden, kein Problem. Auf ein Namensregister verzichteten sie natürlich. Mehrkosten waren keine angefallen.
Sie mussten sich abschließend noch über einen Titel für Wandas Lebenslauf verständigen. »Wanda im Wandel«, wie es Brose einmal, als ihm ihre Erzählung zu sehr mäanderte, spaßeshalber vorgeschlagen hatte, war natürlich Unsinn, aber etwas in dieser Richtung hätte es seines Erachtens schon sein können.
Wanda hatte sich extra für diesen Anlass schick gemacht, es schien ihr also wichtig zu sein. Schließlich, es war das erste Mal, dass sie schwarz auf weiß zu lesen bekam, was »dieser junge Mann« – und damit war tatsächlich er, Brose, gemeint – aus den Mitschnitten ihrer mehrtägigen Sitzungen herausgefiltert, in eine chronologische Ordnung und am Ende zu Papier gebracht hatte.
Diese kupferfarben schimmernde Seidenbluse beispielsweise, die sie an diesem Tag trug, kannte er noch gar nicht. Ebensowenig die Kette mit den kullerigen Bernsteinen, die ihn an Honigbonbons erinnerten.
Sie hatte wohl auch versucht, sich zu schminken. Die schrägen schwarzen Striche anstelle ihrer Augenbrauen wirkten clownesk, wie von einer frechen Kinderhand gemalt.
Er hatte Wanda übrigens von Anfang an sehr gemocht.
Sie setzte die Brille auf und während sie schon zu lesen begann, wurde ihm wie von Geisterhand – aber es war nur Wandas runzelige Hand – die Teetasse zugeschoben.
Bevor Wanda die Seiten umblätterte, leckte sie stets die rechte Zeigefingerspitze an. Brose kannte das schon, das war ein Reflex bei ihr. Als sie vor ein paar Wochen die beiden Schuhkartons mit ihren alten Briefen und den Zeugnisheften durchgesehen hatten, hatte sie das auch immer so gemacht, Blatt für Blatt.
Einmal, für einen winzigen Moment, blieb ihr gekrümmter Finger vor dem nächsten Umblättern nachdenklich an der trockenen, rissigen Unterlippe hängen und gab den Blick auf ihren Unterkiefer frei. Das mürbe, hellrosa Zahnfleisch hatte sich schon weit zurückgezogen und bedeckte kaum noch die langen Zahnhälse, deren Konturen sich bereits deutlich darunter abzeichneten.
Wie bei einem Totenschädel, dachte Brose verwirrt und gerührt, er war nahe daran, tröstend die Hand auf ihren altersfleckigen, spillerigen Haut-und-Knochen-Unterarm zu legen. Wanda schaute auf.
Energisch, als wollte sie einen lästigen Gedanken abschütteln, schüttelte sie den Kopf.
»Sie müssen einfach mehr trinken, Wanda.«
Wanda nickte, beachtete ihn aber nicht weiter. Gerade hatte sie sich wieder ein neues Blatt vorgenommen. Aus ihrem Gesicht hatte Brose bisher noch nichts ablesen können, weder Zustimmung noch Ablehnung.
Er lehnte sich vorsichtig, weil der Polsterstuhl etwas wackelig war und bedenklich unter ihm knarrte, zurück, schlug die Beine übereinander und tat so, obwohl es ganz profane Jeans waren, als würde er sich die Hose glattstreichen. Eine Verlegenheitsgeste, die alles entscheidende Frage war jetzt: Was würde Wanda zu den Aufzeichnungen sagen?
Bewegungslos betrachtete sie das Blatt, das sie in ihren Händen hielt. Auf einmal war sich Brose nicht mehr sicher, ob sie überhaupt noch las.
Ihr Blick war nach unten, auf das Papier gerichtet, so dass er nur ihre faltigen, feingeäderten Augenlider sehen konnte. Vielleicht langweilte sie das alles ja auch, und sie war über der Lektüre längst eingeschlafen?
Er hörte, wie sie ruhig und gleichmäßig atmete.
Mein Gott, auf einmal war Brose hellwach: War sie jetzt wirklich eingenickt? Er überlegte, ob er sie nicht probehalber ansprechen, leise etwas zu ihr sagen sollte – Hallo? Wanda … –, da bemerkte er unter ihren dünnen Lidern die rasche Bewegung der Augäpfel, wie sie hin und her rollten.
Gut, sie las also doch.
Sie musste nur an einer Stelle innegehalten haben, durch irgend etwas, einen kleinen Fehler vielleicht oder eine Ungenauigkeit, aufgehalten worden sein, wer weiß. Leider hatte er nicht erkennen können, auf welcher Seite das gewesen war, das musste er sie nachher unbedingt fragen.
Brose konnte jetzt nur noch abwarten und – – – er trank einen Schluck Tee, der war inzwischen aber schon kalt geworden, er schmeckte bitter.
Sein Blick wanderte aus dem Fenster in den Park hinaus, wobei »Park« eine Übertreibung war. Eigentlich waren es, halbrund eingerahmt von einem blickdichten Tannenwald, nur ein paar Eichen, die das Seniorenpflegeheim Altes Fährhaus stämmig umstanden. Dazwischen ein Plattenweg für die immergleichen Rundgänge. Da es sich in den meisten Fällen aber nur noch um Rundfahrten mit dem Rollator oder im Rollstuhl handelte, wurde der Weg von Insassen wie Pflegekräften auch die »Rollbahn« genannt.
Weit kam sein Blick nicht. Die Äste und Zweige der Eiche vor Wandas Fenster streiften beinahe die Scheiben und versperrten die Aussicht. Auch wenn die Sonne schien, befand sich Wandas Zimmer dauerhaft in einem Dämmerzustand.
Deswegen hatten sie einen Großteil der Aufnahmen auch unten im verglasten Speisesaal gemacht, wo man seine Gedanken frei schweifen lassen konnte.
Von dort aus hatte man einen weiten Blick – über den Kanal, auf dem die Spiegelbilder der Wolken schwammen, die aussahen wie verirrte Ausflugsdampfer der Weißen Flotte, über die gerupfte Koppel hinweg, wo manchmal ein paar dicke graue und braune Pferde mit gesenkten Köpfen herumstanden, bis hin zu einem störrisch aus dem platten Land aufragenden, windzerzausten Waldstück, das das Bild, weit hinten, begrenzte.
Auch wenn Brose in Wandas Zimmer immer extrem schnell müde wurde, diesmal musste er wach sein, musste aufmerksam registrieren, wie Wanda den Text aufnahm. Schließlich handelte es sich bei diesen zweihundertvierzig Seiten um nichts anderes als ihr Leben, beziehungsweise um das, was er davon aufgeschrieben hatte. War alles in Ordnung, das war laut Vertrag die »Abnahme«, konnten die Papiere vervielfältigt, gebunden und schließlich ein paar Tage später an den Auftraggeber überreicht werden. Damit war dann auch die zweite und letzte Rate fällig.
Laut raschelte es. Ein Lebenszeichen?
Erstaunt, fast erschrocken, sah Brose, wie Wanda die Seiten immer schneller, immer ungeduldiger umblätterte und dann einen ganzen Stapel Papier ungelesen ablegte.
Er stand auf und goss ihr Mineralwasser nach, medium, aus der grünen Flasche.
»Stimmt was nicht?«, fragte er vorsichtig.
»Ja«, sagte Wanda leise.
Sie schauten sich an.
»Eigentlich … alles.«
»Wie jetzt!« Brose musste laut, beinahe hektisch auflachen. »Wanda, Sie haben mir das doch alles so ins Aufnahmegerät gesprochen, was, bitte schön, soll denn daran nicht stimmen?«
Sie sagte nichts.
»Sicher«, gab er zu, »sicher, manchmal, da musste ich noch an den Formulierungen herumfeilen, glätten, damit es sich besser liest. Und Wiederholungen, klar, die gibt es zwangsläufig beim Reden, die musste ich natürlich auch streichen, aber sonst …«
Sie schüttelte nur störrisch ihren grau-lila gelockten Kopf.
»Ich verstehe es einfach nicht.« Wanda hatte die Papiere weit von sich geschoben. Sie lagen jetzt zwischen ihnen auf dem Tisch.
»Aber was verstehen Sie denn nicht?«
»Na, zum Beispiel, woher Sie mein richtiges Alter wissen?«
Brose starrte sie an.
»Ja, ich habe mich doch immer um drei Jahre jünger gemacht. Das habe ich Ihnen, junger Mann, aber garantiert nie erzählt! Warum sollte ich denn? Und hier steht es auf einmal richtig. Das ist falsch.«
Das verstand Brose auch nicht.
»Darf ich mal bitte sehen?«, fragte er leise, er nahm unschlüssig den Stapel zur Hand.
»Aber das ist längst noch nicht alles«, sagte sie, halb verärgert, halb resigniert. »Gehen Sie doch bitte mal auf den Anfang von Teil zwei.«
»Welche Stelle meinen Sie da?«, fragte er.
»Na die, wo ich mit meinen Eltern die große Freitreppe heruntergelaufen komme!« Es war nicht mehr zu überhören, wie ungeduldig sie inzwischen geworden war. »Meine Einschulung, Herr Brose.«
Er blätterte, betont ruhig jetzt, zurück; sicher ein Missverständnis, das leicht aufzuklären war, und begann still für sich die Seite zu lesen. Stimmt, hier ging es um die Einschulung – aber komisch, von einer Freitreppe stand da kein Wort.
»Sehen Sie?«, rief sie triumphierend.
Brose sah nichts.
»Damals, das weiß ich noch ganz genau, hatte ich einen Plisseerock an, ja, einen blauen, einen dunkelblauen Plisseerock. Und das habe ich Ihnen auch so gesagt.«
Mit einem raschen Griff hatte sie die Papiere wieder an sich genommen und starrte sie ärgerlich an.
Brose hörte es ticken.
Das war aber kein Zeitzünder, der an dieser Stelle gut zur explosiven Stimmung gepasst hätte, es war lediglich der alte Regulator mit den römischen Ziffern, der bei Wanda auf der Kommode stand und stoisch, mit enervierender Gleichgültigkeit, die Zeit in ihre Einzelteile zerlegte.
Nach kurzem Suchen tippte Wanda mit dem gekrümmten Zeigefinger auf eine Stelle im Text und las laut vor: … Es war ein wunderschönes, von meiner Großmutter genähtes rosarotes Kleid mit Rüschen und Schleifen.«
Ihre Augen funkelten Brose an.
»Das ist doch …«, und dann sagte sie ein Wort, das Brose schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört hatte und das wie aus einem fernen, versunkenen Zeitalter zu ihm herüberklang, … ungezogen! Sie können das doch nicht einfach alles ändern.«
Sie blätterte weiter. »Und das ist längst noch nicht alles, junger Mann, längst noch nicht alles.«
Beim raschen Umblättern hatte Wanda nicht aufgepasst und Broses Teetasse umgestoßen, sie war scheppernd von der Untertasse gerutscht und vom Tisch gefallen. Brose konnte die hauchzarte Porzellantasse nicht mehr auffangen, er glaubte schon, ihr feines Klirren zu hören. Doch der dicke Teppich dämpfte ihren Aufprall, begierig sog er den letzten Schluck kalten Tee auf.
Nichts passiert, zum Glück, dachte Brose erleichtert, er hob die leere Tasse auf und stellte sie wieder an ihren Platz. Mit einem kurzen, tadelnden Seitenblick registrierte Wanda diesen Vorfall – es sah tatsächlich so aus, als würde sie gnädig über eine Unachtsamkeit Broses, die ihr aber nicht so wichtig war, hinwegsehen; sie blätterte die Seite um.
»Hier!«, sagte sie auf einmal. »Ich bin auch nie in Halle zur Schule gegangen, niemals. Wie kommen Sie denn bloß auf Halle?«
Halle, das hatte sie so anklagend hervorgestoßen, dass es laut und lange in Brose nachhallte: … Halle? Halt, irgend etwas schien hier wirklich nicht zu stimmen, das wurde auch ihm allmählich klar.
»Moment, in Halle? Kann ich doch noch mal bitte die Papiere …«, fragte er vorsichtig.
Wanda hielt sie fest umklammert, wie ein wichtiges Beweismaterial, das sie unter keinen Umständen leichtfertig aus der Hand geben durfte.
»Und dann: Ich habe auch nie eine Lehre als – was steht da? –, als ›Hutverkäuferin‹ gemacht. Wie kommen Sie denn darauf, Herr Brose? Sicher, nicht uninteressant … und ich habe mich früher auch immer sehr für Mode interessiert, ja, aber ich habe studiert. Das war zu dieser Zeit sogar ziemlich außergewöhnlich. Das können Sie doch nicht einfach weglassen!«
Nein, natürlich nicht.
»Und mein Mann übrigens, der hieß auch nicht Waldemar. Das wüsste ich.«
»… nicht Waldemar«, wiederholte Brose kleinlaut. »Kein Problem, das lässt sich ja alles noch ändern.«
Ungläubig, fast feindselig, starrte sie ihn an.
»Nein, nicht das mit Waldemar natürlich«, sagte er leise, »also dass der ihr Mann war, meine ich, aber …« Oh Gott! Eine dunkle Ahnung stieg in ihm auf, so dunkel, dass sie ihm jede Sicht nahm, ihm wurde schwarz vor Augen.
»Wanda …«
»Ja?«
»Das ist mir jetzt un– – –glaub– – –lich peinlich.«
Sie nickte zufrieden.
Verdammt, endlich kapierte er, was los war: Vorhin, auf dem Parkplatz, musste er doch tatsächlich beim raschen Griff in die Hängeregistratur seiner Ablagebox, in der lauter Mitschriften, Vertragsunterlagen, fertige und halbfertige Lebensläufe steckten, die beiden Mappen verwechselt haben: Wanda hatte die ganze Zeit, Seite für Seite, die Lebenserinnerungen von Frau Emma Paczensky (Erdgeschoss, Zimmer 12) gelesen, ebenfalls im beigefarbenen Einband.
Als er sich kurz geräuspert und ihr schließlich seinen Fehler gestanden hatte, sagte sie nur: »Ach so. Na, sehen Sie, hatte ich also doch recht.« Beruhigt lehnte sie sich zurück.
»Aber, Wanda, ich verstehe nicht, das … das muss Ihnen doch gleich aufgefallen sein, warum haben Sie denn nicht sofort etwas gesagt und immer weitergelesen?«
»Ich weiß nicht. Wie ich das so gelesen habe, kam es mir, abgesehen von den Fehlern natürlich, sonst hätte ich mich ja auch nicht so darüber aufgeregt, kam es mir alles sehr …«
»… fremd«, versuchte er ihr behutsam zu soufflieren, er wusste, dass sie manchmal Wortfindungsprobleme hatte.
»Nein, gar nicht«, widersprach sie, »im Gegenteil. Es kam mir alles sehr … sehr plausibel vor. Sagt man doch so, oder?«
»Plausibel?«
»Ja, ich konnte es mir eigentlich ganz gut vorstellen alles, es hat mir gefallen.« Sie sah ihn streng an: »Bis auf die Fehler eben.«
»Aber Wanda! Das ist doch im Grunde, also … ein komplett anderer Lebenslauf, eine völlig fremde Biografie.«
»Na ja, wahrscheinlich hat es mir deswegen so gut gefallen. Erst dachte ich, vielleicht habe ich das eine oder andere bloß vergessen. Aber wenn das so schwarz auf weiß dasteht, vor einem steht, meine ich, ist man sich plötzlich auch nicht mehr so ganz sicher. Es war jedenfalls interessant, das zu lesen, mir das alles so vorzustellen, wie es … Ich konnte Ihnen das nur vorhin nicht so schnell … Ich habe manchmal, na, mit den Worten eben …«
»Wortfindungsprobleme.«
»Ja, richtig. Sie sagen es.«
Lange dachte sie nach.
»Aber jetzt will ich Ihnen auch mal was sagen, Herr … Wer keine, hm … wie nennen Sie das?«
»Wortfindungsprobleme«, wiederholte er leise.
»Richtig. Wer das … das da nicht hat, ja – – – der hat als Schriftsteller völlig versagt, der hat seinen Beruf verfehlt.«
»Wanda, ich bin kein Schriftsteller.«
»Ich weiß.«
»Das habe ich Ihnen doch nun schon so oft erklärt. Ich bin Journalist. Oder ich war es zumindest. Und ich sitze heute hier mit Ihnen zusammen, weil ich Ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben habe, das ist ja unsere Arbeit bei LebensLauf. Sie haben mir alles erzählt. Ich habe das mit meinem Rekorder aufgenommen, dann abgetippt und …«
»Ach! Interessant.«
»Wanda!«
»Ja?«
»Kann es jetzt weitergehen?«
»Ein Schriftsteller, der sucht dauernd nach Worten, nach den richtigen Worten. So ist das nämlich.«
»Soll ich jetzt vielleicht doch mal die richtige Mappe holen? Die liegt unten im Auto. Ich bin …«
»Ja, ich bin auch müde. Wollen wir nicht eine kleine Pause machen?«
Brose griff in die Jackentasche, er spürte die Zigarettenschachtel. »Natürlich. Gerne.« Manchmal wusste er nicht, ob Wanda nicht einfach nur mit ihm spielte.
Als er vor ihrer Zimmertür stand, rief sie etwas.
Brose verstand es nicht genau, er drehte sich um, starrte den staubigen Trockenblumenkranz an, der dort in Augenhöhe angebracht war, wie auf einem Friedhof, dachte er, dann öffnete er noch einmal die Tür: »Wanda?«
»Egon«, wiederholte sie voller Andacht und schloss dankbar die Augen, ihr Gesicht strahlte von innen.
»Was, wie bitte?«
»Mein Mann. Der hieß Egon. So ist das nämlich.«
Die weiße Frau stand am Aschenbecher neben dem Haupteingang des Alten Fährhauses, sie hielt sich an ihrer Zigarette fest. Als sie Brose kommen sah, nickte sie ihm zu, schnipste die Asche ab und trat ein Stück zur Seite. Er stellte sich zu ihr. Schweigend schauten sie hinüber zum Kanal.
Dass er sie kennen würde, wäre zu viel gesagt. Brose wusste nicht einmal, wie sie hieß, nur, dass eine »Simone« ihre Tochter oder ihre Enkeltochter war.
Wegen ihrer schlohweißen Haare war sie für Brose einfach nur »die weiße Frau« – und als solche ein fester Bestandteil des Heims, fast so etwas wie ein Inventarstück; eines, von dem ständig in kleinen Wölkchen Rauchzeichen aufstiegen. Manchmal gab sie auch orakelhafte Sätze von sich.
Es zeugte von der Vertrautheit zwischen den beiden, dass sie einfach so, rauchend, nebeneinander stehen und miteinander schweigen konnten.
Sonst unterhielt sich Brose auch ganz gerne mit ihr. Die beiden großen, zentralen Themen, die üblicherweise alle Heimgespräche vom Morgen bis zum Abend dominierten, das Essen und das Wetter, spielten für die weiße Frau absolut keine Rolle.
Wetter? Sommers und winters, egal, ob die Sonne brannte oder Schnee feinkörnig über den asphaltierten Vorplatz wehte, stand sie am Haupteingang. Von allen Heimbewohnern schien sie deshalb mit Abstand die fitteste zu sein, weil sie dauernd an der frischen Luft war, um zu rauchen.
Und während sich die anderen meistens schon um halb zwölf vor dem Speisesaal einfanden und dort grummelnd eine lange, ungeduldige Schlange bildeten, kam sie oft zu spät zum Essen. Löffelten die anderen noch ihre Kompottschälchen aus, verschwand sie bereits wieder nach draußen. Die Zigarette danach, so hatte sie es Brose einmal flüsternd anvertraut, sei doch schon immer das Beste gewesen, nachdenklich hatte sie dabei ein kleines Rauchwölkchen ausgestoßen.
Im Moment aber beschäftigte ihn die Sache mit Wanda viel zu sehr, als dass er sich hätte mit ihr unterhalten können. Er zog an seiner Zigarette. Biografie: ein Spiel? Wer weiß.
Dass man die Mappen verwechseln konnte – kein Kunststück. Schon so oft hatte er mit Iris darüber gesprochen: Das LebensLauf-Zeichen mit dem Schriftzug Sie haben viel erlebt – wir schreiben Ihre Geschichte auf! beanspruchte seines Erachtens viel zu viel Platz auf dem Deckblatt, so dass der jeweils eingesetzte Name und der Titel dagegen kaum ins Gewicht fielen, man konnte sie leicht übersehen, noch dazu, wenn es, wie bei Wanda, noch gar keinen Titel gab.
Und auch die zweifellos kostengünstige Reduktion auf ausschließlich zwei Farbvarianten bei den Einbänden, Beige und Hellgrün, war ein Problem. Das konnte leicht, so wie vorhin, zu folgenschweren Verwechslungen führen.
Doch das war nur die Oberfläche, waren Äußerlichkeiten.
Viel problematischer war doch, dass Wanda bis zu der Stelle, wo ihr richtiges Alter genannt wurde, seitenlang in der Emma-Paczensky-Biografie gelesen hatte, ohne auch nur einmal zu protestieren oder zumindest kurz aufzumerken, das war kein gutes Zeichen. Das konnte nicht nur an Wanda gelegen haben, obwohl die manchmal ihre Aussetzer hatte und dann vieles durcheinanderbrachte oder ewig ergebnislos nach einem bestimmten Wort suchte und darüber alles andere vergaß.
Oder hatte er bei Emma Paczenskys Erinnerungen vielleicht doch zu ausgiebig mit Versatzstücken gearbeitet, so dass Wanda ganz zwangsläufig durcheinanderkommen musste?
Sein Kollege Schulze, der weitaus mehr Routine hatte, schwor ja darauf, passgenau Fertigteile zu verwenden, bestimmte, in allen Biografien wiederkehrende Grundbausteine wie Einschulung, Abschlussball, erste Liebe, Hochzeit und so weiter. Das erhöhe den Wiedererkennungswert. Er meinte, man müsse einen Lebenslauf, damit der für andere überhaupt lesbar werde, erst einmal aus dem Wust des rein Privaten befreien, ihn entschlacken oder »entpersönlichen«, und ihm so eine allgemeinverständliche Form geben, sonst sei es wie früher beim Dia-Abend mit Bier und Salzstangen, wo nur Eingeweihte, also allernächste Familienmitglieder, verstanden hätten, worum es überhaupt ging, und der Rest habe im Finsteren gesessen – nein, große Linien, durchaus auch an historische Ereignisse geknüpft, alles andere ergebe sich dann schon fast von selbst.
Bei Gelegenheit musste Brose wahrscheinlich doch noch mal ernsthaft mit Schulze darüber sprechen, obwohl er wenig Lust dazu verspürte. Er hielt Schulze, der zwar langjährige Erfahrungen hatte, sprich: auf einige Regalmeter LebensLauf-Biografien zurückschauen konnte und sich selbst gerne als den »alten Hasen« der Berliner Memoirenschreiber-Szene bezeichnete, für einen intellektuell ziemlich übersichtlich ausgestatteten Kollegen.
»Na, Sie sehen heute aber nicht so zufrieden aus«, unterbrach die weiße Frau seine dunklen Gedanken.
»Stimmt«, sagte Brose, er lächelte müde, »könnte besser gehen. Das ist heute, glaube ich, nicht so mein Tag. Ich …« Er verstummte – zeitgleich, wie auf ein geheimes Kommando, gingen ihre Blicke um etwa 45° zur Seite.
Mit dem Rücken zuerst schob sich neben ihnen ein Mann zur Eingangstür heraus. Sein schmaler Hintern hatte vorsichtig die Tür aufgestoßen, nach einer halben Drehung um die eigene Achse und kurzem Schwanken hatte der Alte beide Armkrücken wieder fest im Griff, nun stand er aufrecht vor ihnen.
Seine dicken Brillengläser funkelten im Sonnenlicht.
Aufmerksam nickte er der weißen Frau und dann, flüchtig, auch Brose zu. Sein kritisch-prüfender Rundumblick war an einer Bank im Halbschatten haften geblieben. Die steuerte er jetzt in wackeliger, zugleich entschlossener Gangart an.
Ein Tier auf vier Beinen, dachte Brose ihm hinterher: zwei Krücken plus zwei Beine. Allerdings, das sah er jetzt, der Mann zog ein Bein nach, berührte mit ihm kaum den Boden. Dreieinhalb, korrigierte Brose sich.
Der Mann trug ein dunkelblaues Jackett mit abgeschabtem Wildlederbesatz an den Ärmeln. Ein dickes Buch schaute aus der ausgebeulten Jackentasche hervor.
»Unser Herr Doktor«, verkündete die weiße Frau feierlich.
Skeptisch sah Brose dem Mann hinterher.
»Ja«, wiederholte sie.
Doch als er nachfragte, stellte sich heraus, Dr. Einhorn war gar kein Arzt, sondern, wie die weiße Frau sagte, »auch bloß ein Insasse«, der ebenfalls lebenslänglich habe, »so wie wir alle hier«.
Der Doktor hatte sich umständlich auf der Bank niedergelassen und seine Krücken so neben sich abgelegt, dass sich niemand zu ihm setzen konnte.
»Er braucht seine Ruhe. Er erforscht nämlich etwas«, flüsterte die weiße Frau, versonnen blies sie Rauch aus in Richtung der Bank.
»Ach, interessant – und was?«
»Das«, sagte sie, »ist unbekannt.«
Und als sie Broses erstaunten Blick bemerkte, erklärte sie ihm: »Wäre es bekannt, müsste er es ja nicht erforschen, nicht wahr?« Brose grinste: wieder eines von ihren Orakeln.
Er sah hinüber. Der Mann auf der Bank hatte sich jetzt in seine Lektüre vertieft – so tief, dass er nicht einmal den Spatz bemerkte, der direkt vor seinen Füßen gelandet war und in Erwartung einiger Brot- oder Kekskrümel gebannt zu ihm aufblickte. Konzentriert rückte er sich die Brille zurecht, dann blätterte er ein paar Seiten zurück.
Die weiße Frau schaute in ihre Zigarettenschachtel, bemerkte, dass die leer war, und zerdrückte sie mit der linken Hand. Dann nahm sie die Zigarette aus dem Mund und kam ein Stück näher an Broses Ohr heran, unwillkürlich wich der zurück. Sie sah sich nach allen Seiten um. »Kommt Simone heute noch?«, wollte sie plötzlich von ihm wissen, sie hatte das geflüstert und guckte ihn groß und fragend an.
»Ich … weiß es nicht«, sagte Brose leise, so als schämte er sich dafür, dass er das nicht wusste.
Sie nickte mitleidig, eine andere Antwort hatte sie ihm wahrscheinlich auch gar nicht zugetraut. Gründlich drückte sie die Zigarette aus und betrachtete nachdenklich die Asche.
»Na dann«, sagte sie zu ihm, und auf einmal war sie wieder so munter wie vorher und verschwand leichtfüßig durch die Glastür ins Foyer: »Bis Baldrian!«
Die weiße Frau hatte die leere, sorgfältig zerknüllte Zigarettenschachtel auf dem Fenstersims liegengelassen. Brose entzifferte den zerknitterten Aufdruck, dort stand es schwarz auf weiß: »Rauchen kann tödlich sein.«
Stimmt, dachte Brose, und Leben ist tödlich.
»Guck mal, und hier, hier steht ja sogar ein richtiger Vogelkäfig! Das gibt es doch gar nicht. Ist der nicht wunder-, wunderschön? Da wirst du richtig aufleben, Mutti. Nachmittags, nicht wahr, da kannst du dann immer hier unten sitzen und die Vögel beobachten. Und hockst nicht mehr so mutterseelenallein herum wie … na, als du noch zu Hause … also, als du noch in deiner alten, finsteren Wohnung warst, meine ich. Die ist doch inzwischen sowieso viel zu groß für dich. Für wen willst du denn da noch den ganzen Tag lang Staub wischen, nicht wahr. Und hier, hier lernst du bestimmt auch jede Menge Leute kennen und du lebst dich sicher ganz, ganz schnell ein.«
Die Frau, Anfang fünfzig vielleicht, steckte prall in einem energischen lila Hosenanzug, sie trug eine überdimensionale Sonnenbrille, die sie jetzt im Foyer entschlossen hochgeschoben hatte. Ohne Pause redete sie auf ihre Mutter ein. Die hatte gar keine Chance, etwas zu sagen oder, vielleicht sogar, zu widersprechen. Mit gesenktem Kopf trabte sie widerstrebend hinter ihrer Tochter her und beschränkte sich auf ein Nicken, das man auch für ein Kopfschütteln oder einfach nur für ein nervöses Zittern halten konnte. Einmal wurde sie von ihrer Tochter ungeduldig an die Hand genommen und weitergezogen, zum Wochenspeiseplan: »Schau doch mal, was es hier nicht alles gibt. Lecker!«
Aus dem Hinterkopf der Alten spross ein zarter, graubrauner, vom vielen Liegen zerdrückter Babyflaum, der schon beim leisesten Lüftchen, wenn die Glastür geöffnet wurde und es leicht durch den Eingangsbereich zog, erzitterte.
Offenbar ein Neuzugang. Die Alte sah aus wie ein Kind, das von seiner Mutter zur Schule oder zum Kindergarten angemeldet werden soll, im Augenblick aber nur eines will: weg, bloß weg hier.
Ganz im Unterschied zu ihrer Tochter. Die schien restlos vom Heim überzeugt zu sein, fast hörte sie sich in ihrer Begeisterung so an, als würde sie am liebsten gleich selbst ins Seniorenpflegeheim einziehen wollen. Lediglich der Autoschlüssel in ihrer Hand, mit dem sie herumspielte, deutete an, dass es für sie noch ein Zurück gab, in eine andere Welt, in ein anderes Leben.
Sie waren in Begleitung von Frau Schwartze, der Chefin, die den beiden voranging, beziehungsweise, wenn sie irgendwo anhielten, um sie herumstöckelte, und ihnen alles zeigte, was hier im unteren Bereich vorzeigbar war.
Brose, der wie im RTL-Dschungelcamp inmitten immergrüner Topfpflanzen mit seiner Mappe in der Hand auf einem Sofa in der Wartezone des Foyers saß – hinter ihm stürzte ein norwegischer Wasserfall auf einer Fotomotivtapete in die Tiefe –, war im Rahmen dieser Besichtigungstour wohl eher als ein Fremdkörper zu betrachten, über dem ein unsichtbares Fragezeichen schwebte.
Trotzdem, als Frau Schwartze ihn hier herumsitzen sah, fragte sie ihn forsch im Vorbeigehen, ohne allerdings seine Antwort abzuwarten, denn da steuerten sie gerade die offene Tür zum Speiseraum an, wo noch vom Kaffeetrinken ein paar verlorene, verwitterte Gestalten herumsaßen, die schon wieder auf das Abendessen warteten: »Na, geht es gut bei Ihnen, geht es voran?«
Er nickte ihr neutral hinterher.
Eigentlich, dachte er, ist das hier wie im Hotel: Man hat ein Zimmer. Am Eingang gibt es eine Rezeption, dazu diese ewige Hotelfahrstuhlmusik in der Lobby. Man müsste der alten Dame einfach erklären, dass sie nur vorübergehend hier sein würde. Mit hochgezogenen Augenbrauen betrachtete er die Rückenansicht der lila Hosenanzugfrau – da schob sich von links ein elektrischer Rollstuhl ins Bild.
Schon ein paarmal war der hier im Eingangsbereich unauffällig herumgekurvt: auf Patrouillenfahrt, wie es schien. Sein Fahrer, ein dicker Mann, der den Rollstuhl vollständig ausfüllte und der trotz des beinahe sommerlichen Wetters eine graue Wollmütze trug, beobachtete genau, was im Foyer vorging. Als Frau Schwartze ihm vorhin »Hallo, Herr Krampe« zugerufen hatte, hatte der Mann wissend genickt, war dann abgedreht, Richtung Essenssaal, und für eine Weile von der Bildfläche verschwunden.
Jetzt parkte er in unmittelbarer Nähe des Empfangstresens, der um diese Zeit nicht besetzt war. Er hatte Brose genau im Blick. Unablässig starrte er herüber, was Brose schließlich, als er das partout nicht mehr ignorieren konnte, zur Andeutung eines Nickens veranlasste. Der Mann schüttelte unmerklich den Kopf, er schien enttäuscht zu sein, dann rollte er davon.
Doch Brose konnte sich beim besten Willen nicht um den Wollmützenmann kümmern.
Nachdem er Wanda kurz vor 12 den richtigen Text aufs Zimmer gebracht hatte, den sie nun erst einmal ganz allein lesen wollte, war er nach draußen gegangen.
Er war an einer Bank vorbeigekommen, deren Besatzung – zwei Frauen und ein Mann – hatte im Halbschatten vor sich hingedöst, ohne Notiz von ihm zu nehmen. Er hatte schon überlegt, ob er sie nicht ansprechen sollte, damit sie nicht das Mittagessen verpassten, doch dann hatte er es vorgezogen, das friedliche Bild nicht zu zerstören, und war weitergegangen.
Die Mittagspause hatte er am Kanal verbracht – als stiller Teilhaber der Natur, nur in Gesellschaft einiger Enten und eines Schwanenpaars, mit denen er dann sein mitgebrachtes Baguette geteilt hatte.
Jetzt, wieder zurück, versuchte er, sich auf das nächste Gespräch zu konzentrieren. Ihm blieben noch ein paar Minuten. Heute durfte es keinen weiteren Fehler mehr geben.
Er schaute noch einmal nach: Richtig, Termin war um 16 Uhr, Frau Förster, Erdgeschoss, Zimmer 19, am Ende des Gangs. Hier stand Brose, im Unterschied zu Wanda, allerdings noch ganz am Anfang. Zunächst galt es, zu sichten und zu sammeln.
Als er kurz darauf ihr Zimmer betrat, sah er, dass Frau Förster bereits alles, was ihr in Bezug auf ihr Leben wichtig zu sein schien, auf dem runden Tisch unterm Fenster ausgelegt hatte. Die Sonne des Spätnachmittags brach durchs Glas und brachte spärliches Licht ins Dunkel: Schräg, in dürren Strahlen fiel es auf braune und grüne Pappmappen sowie diverse Briefbündel. Blassrote Einweckgummis hielten sie, nach Jahrgängen sortiert, zusammen. Es roch einschläfernd nach vollendeter Vergangenheit.
Erwartungsvoll schaute Frau Förster Titus Brose an, was der jetzt wohl mit dem Material anfangen würde. Ihre Augen, die sich zwischen Blau und Grau nicht genau entscheiden konnten, standen halb unter Wasser. Auf den ersten Blick sah es so aus, als hätten sie gerade ausgiebig geweint.
Doch Brose fing ganz anders an, er ließ die ausgebreiteten Erinnerungsstücke zunächst unbeachtet und versuchte, sich mit Frau Förster erst einmal grundsätzlich über den Sinn des Ganzen zu verständigen.
Anders ging es hier auch gar nicht.
Während einige Bewohner, als Iris vor ein paar Monaten im Speisesaal vor versammelter Heimbelegschaft das Biografieprojekt von LebensLauf vorgestellt hatte, sich sofort darauf eingelassen und im Vertragsformular das entsprechende Feldchen angekreuzt hatten, dass sie selbst zu hundert Prozent die Finanzierung übernehmen würden, waren es bei Frau Förster die Kinder gewesen, die ihre Mutter dazu gedrängt hatten, ihre Erlebnisse zu Papier bringen zu lassen. Sie hatten ein paar Tage später bei Iris im Büro angerufen.
Wanda hingegen wollte selbst ihre Erinnerungen aufbewahren. Und zwar, wie sie betonte, für ihre Enkel. Hörte man sie reden, konnte man den Eindruck gewinnen, sie hätte überhaupt nie im Leben Kinder gehabt, sondern ausschließlich Enkel.
Bei einem ersten Vorgespräch vor ein paar Wochen hatte Brose dann auch Frau Försters Tochter und ihren Schwiegersohn kennengelernt. Die beiden waren extra aus Braunschweig angereist. Nette Leute, mehr fiel Brose beim besten Willen zu ihnen nicht ein. Ihn irritierte nur, dass sie Frau Förster auch in deren Beisein immer nur als »unsere Oma«, beziehungsweise (der Schwiegersohn) sogar als »die gute Omi Hilde« bezeichneten.
Als er danach bei Frau Schwartze im Büro vorbeigeschaut hatte, um mit ihr die Terminplanung für die nächsten Wochen durchzusprechen, und er sie beiläufig danach gefragt hatte, hatte sie sofort genickt.
»Ja, das machen viele hier so, ein kleiner, ziemlich hilfloser Trick. Würde man von ›Mutter‹ oder ›Vater‹ sprechen, wäre klar, dass man als Nächstes selbst an der Reihe ist. ›Oma‹, das stellt gewissermaßen einen Sicherheitsabstand her.«
»Aber immerhin«, meinte Brose, »die geben doch für ihre … «, er stockte kurz, »also für ihre Mutter, da geben die doch ordentlich viel Geld aus, damit ihre Erinnerungen schwarz auf weiß erhalten bleiben.« Fast hätte er gesagt: für die Nachwelt erhalten bleiben, doch das war hier wohl definitiv zu hoch gegriffen.
»Schön, dass Sie das so sehen, Herr Brose – ich sage meinen Leuten ja auch immer: Eine positive Grundeinstellung bei unserer Arbeit ist das A und O.«
Sie lehnte sich in ihrem Bürostuhl zurück und wippte leicht: »Was jetzt speziell die Frau Förster betrifft, da bin ich, offen gesagt, nicht so im Bilde.« Sie stellte das Wippen ein und hielt sich mit ihren schlanken, weißen Fingern an den grauen Kunststoffarmlehnen fest: »Aber es gibt auch Angehörige, die kaufen sich mit diesem LebensLauf-Angebot praktisch frei. Von Besuchen, zum Beispiel. Oder eben von der Verpflichtung, sich immer und ewig dieselben Geschichten anhören zu müssen. Ich meine, das kann man ja auch von niemandem verlangen, der noch berufstätig ist und den Kopf frei haben muss, oder? Aber es ist natürlich etwas anderes, wenn Sie das nun alles ein für alle Mal aufschreiben: wirklich, ein perfekter Service. Das kommt dann in ein Buch, das man sich zu Hause ins Regal stellen kann. Und damit hat es sich dann. Fertig. Sehen Sie, so ein Buch, das kann man zuklappen und wegstellen. Und gelegentlich auch mal den Staub darauf abwischen. Man kann sogar, wenn man das wirklich möchte, darin lesen, warum nicht. Die Augen kann man schließen. Aber die Ohren, die kann man ja nicht einfach so zuklappen, falls uns jemand immer und immer wieder dasselbe erzählt.«
Sie beugte sich über den Schreibtisch nach vorn: »Kommen Sie doch ruhig mal vorbei in unserer Biografiegruppe, alle vierzehn Tage, mittwochs.« Sie schaute kurz auf ihren Wochenplan. »Ah ja: Der nächste Termin ist ja schon morgen, von 16 bis 17:30 Uhr. Da bekommen Sie einiges, einiges zu hören, Herr Brose.«
Er nickte zwar und machte sich anstandshalber eine flüchtige, unleserliche Notiz im Kalender, doch er dachte natürlich im Traum nicht daran: Das ganz normale Pensum genügte ihm schon völlig.
»Jedenfalls – was die Frau Förster betrifft, sie ist ein bisschen … na ja. Sie werden schon sehen. Aber sonst: sehr nett. Viel Glück mit ihr!«
Glück, ja, das konnte Brose hier in Zimmer 19 tatsächlich gebrauchen. Sie kamen einfach nicht voran. Mal starrte Frau Förster nur apathisch mit wässrigen Augen aus dem Fenster. Dann wieder riss sie ungeduldig ein Briefbündel auf, weil sie dringend etwas suchte und es nicht fand. Lange hielten es die Gedanken nicht aus bei ihr im Kopf. Brose fragte sich, wie viele versunkene Word-Dateien, die niemand mehr öffnen konnte, am Grunde ihres Gehirns liegen mochten.
Auf der Suche nach Anhaltspunkten, die ihm eventuell nützlich sein und weiterhelfen könnten, blätterte Brose sogar ihre alten Terminkalender durch, die sie in einer leeren Dresdner-Christstollen-Dose aufbewahrte. Während er die verschiedenen Einträge überflog, betrachtete Frau Förster Canalettos Ölgemälde mit der bekannten Dresden-Ansicht auf dem Deckel. Um es besser sehen zu können, wischte sie die Dose mit einem ihrer vielen Taschentücher blank.
In den abgegriffenen schwarzen und blauen Kalendern tat sich ein merkwürdiges Koordinatensystem auf: Die Wochentage, genau durchstrukturiert nach den Eckpunkten von unaufschiebbaren Arzt- oder Friseurterminen, Urlaubsreisen, Familienfeiern und Geburtstagen (bei denen jeweils die betreffende Zahl eingetragen und dick unterstrichen war: Annemarie – – – 75!), hatten sich inzwischen zu verblassten, längst vergessenen 365 Kalendertagen eines für immer abgelaufenen Jahres verwandelt.
Brose hob seinen Blick von den Seiten.
»Sagen Sie mal, wer ist denn eigentlich dieser … ja, hier, schon wieder … dieser Herr Halske?«, fragte er Frau Förster. Die sah ihn groß an, klappte den Mund weit auf, dann sofort wieder zu, sie zuckte die Schultern und drehte störrisch den Kopf weg.
Ihm war aufgefallen, dass es in Frau Försters alten Terminkalendern regelmäßig Perioden gab, in denen mehrmals hintereinander eingetragen war: Herrn Halske anrufen,Morgen H. anrufen!, manchmal auch nur Halske!!! Dahinter stand eine achtstellige Berliner Telefonnummer.
Vielleicht konnte dieser Herr Halske ja Auskunft über die letzten Jahre »draußen« geben, als die Kinder von Frau Förster schon in Braunschweig gewohnt hatten, Frau Förster ganz allein ihre Zeit in der Tempelhofer Zweizimmerwohnung abgesessen hatte und der Kontakt zwischen ihnen fast abgerissen war. Ihre Kinder wussten kaum etwas aus dieser Zeit, und auch für Brose lag sie noch völlig im Dunkeln.
Gut, den könnte man ja mal anrufen und nachfragen.
»Moment, bitte«, sagte er zu Frau Förster und tippte rasch die Nummer ein; er kam sich sehr professionell dabei vor.
»Halske!«, schnarrte es im nächsten Moment forsch aus dem Mobiltelefon.
Brose war derart davon überrascht, ja: überrumpelt, dass ihm vor Schreck nicht einfiel, was er sagen sollte. Er konnte doch jetzt nicht einfach fragen, obwohl es genau das war, was er wissen wollte: Herr Halske, wer sind Sie? Außerdem war es unfair, jemanden vor solch ein unlösbares Rätsel zu stellen.
Es schwieg aus dem Mobiltelefon, Stille in der Luftleitung.
Brose fiel ein, dass er seit ein paar Wochen seine Nummer unterdrückte. Für diesen Halske war er also nicht einfach nur ein unbekannter Anrufer, sondern sogar einer, der sich nicht zu erkennen geben wollte. Verdammt, daran hätte er vorher denken sollen. Wirklich, absolut schlechte Karten für einen derartigen Spontananruf.
Die Halske-Stimme fragte dementsprechend ungeduldig und jetzt auch eindeutig abschließend gemeint »Hallo!?« ins Leere, und damit wurde die Verbindung dann auch beendet.
Brose steckte sein Mobiltelefon unverrichteter Dinge wieder ein. Kein so guter Einfall.
»Wenn das so wichtig für Sie ist: Ich kann ja mal meine Tochter fragen, wer dieser Halske ist«, schlug Frau Förster vor, sie griff nach dem kleinen grauen Apparat, der neben ihr auf dem Beistelltisch lag, flink tippte sie eine Nummer ein, die sie offenbar auswendig kannte, und hielt ihn sich ans Ohr.
»Sie ist noch nicht zu Hause«, verkündete sie nach einer Weile. Brose nickte, vorsichtig nahm er ihr die Fernbedienung aus der Hand und legte sie wieder auf dem kleinen Tisch ab.
Sicher war es ohnehin besser, er versuchte, so schwierig das auch war, direkt mit Frau Förster ins Gespräch zu kommen, ganz egal, wer nun dieser Halske war, und einen Gesprächsfaden mit ihr zu knüpfen, langsam Vertrauen aufzubauen. Inzwischen hatte die sich jedoch dem kleinen Bücherbord zugewandt, das neben dem Fenster stand. Ihr feuchtschimmernder Blick ruhte teilnahmslos auf den bunten Buchrücken.
»Sehen Sie nur mal, diese ganzen vielen Bücher hier«, sagte sie in einem leicht vibrierenden Tonfall, so dass es wie ein leises Jammern klang, »die hab ich alle mal gelesen.«
Brose horchte auf, aufmunternd nickte er ihr zu: Eventuell ließe sich ja über gemeinsame Lektüreerlebnisse ein geeigneter Gesprächseinstieg finden.
»Wissen Sie, das da, das bedeutet mir alles überhaupt nichts mehr. Ich schlage ein Buch auf, ja, dann halte ich es in den Händen, so wie früher, ich sehe zwar noch die Buchstaben, auch die einzelnen Wörter, aber ich bekomme das alles einfach nicht mehr richtig zusammen, verstehen Sie. Da wird nichts draus, das einen Sinn ergibt. Nein. Das war einmal.«
Ihr Blick ging zum Fenster hinaus.
»Oder man hat sich das alles nur eingebildet. Kann ja sein, vielleicht hatte das alles ja auch nie richtig einen Sinn.«
Broses Blick streifte die bunte Berg- und Talbahn der glänzenden Pappbücherrücken: Serienweise standen hier Bergdoktoren-, Liebes- und Heideromane. Verständnisvoll nickte er Frau Förster zu. Nein, einen Sinn hatte das alles wohl nie gehabt. Vergeblich hatte er übrigens nach historischen Romanen Ausschau gehalten, aus denen man wenigstens noch etwas hätte lernen können.
»Am ehesten noch«, setzte Frau Förster unvermittelt neu an, »die Natur! Also, ich meine, wenn von den Bäumen Regen tropft und eine Amsel singt, morgens, ganz früh, wenn es noch nebelig ist und man sich gar nicht wünscht, dass es sich lichtet. Ja, na ja, das werden Sie sicher irgendwann verstehen.«
Noch ehe Brose ihrem kühnen Gedankensprung hinaus ins Freie, in die grüne Natur, hatte folgen können, war Frau Förster abrupt aufgestanden. »Heute ist doch Dienstag, nicht wahr?«
Er nickte.
»Da muss ich jetzt los. Dienstags gibt es abends manchmal Hühnersuppe. Hühnersuppe ist gut für mich, sagt meine Tochter. Sie ruft nachher bestimmt wieder an. Das macht sie jeden Abend. Gehe ich also lieber schon mal und stelle mich an.«
Brose musste sich nun ebenfalls beeilen und hastig seine Siebensachen zusammenpacken (genaugenommen waren es nur drei: Olympus-Voicerekorder, Notizblock, Stift), um nicht allein im Zimmer von Frau Förster sitzenzubleiben, die schon in der offenen Tür stand und das kleine Seidentäschchen fest umklammert hielt, in dem sie ihre Ausgehutensilien – Brille, Taschentücher und Geheimfachschlüssel – verwahrte.
Mittwoch, 24. Mai
Spontan, nach einem kurzen, aber brunnentiefen Mittagsschlaf, den er wie immer auf dem Sofa im Wohnzimmer erledigt hatte, der diesmal jedoch zum Ende hin erstaunlicherweise von riesigen Giftspinnen bevölkert gewesen war, die ihn mit langen, klebrigen Fäden eingewickelt und schließlich aufgescheucht hatten, war Brose am Mittwochnachmittag um halb drei ins Auto gestiegen und hinaus Richtung Altes Fährhaus gefahren.
Die graue Ablagebox mit den Lebensläufen auf dem Rücksitz, war er mit seinem uralten Toyota zügig in die Zufahrt zur Bundesstraße eingebogen – seinen stummen Begleiter, der friedlich hinten stand, ihm zugleich aber gewaltig im Nacken saß, hielt er im Rückspiegel fest im Blick. Natürlich hatte Brose die Plastikbox mit einem Sicherheitsgurt angeschnallt, das machte er immer so, damit die sich nicht selbstständig machen konnte und ihm alles noch mehr durcheinandergeriet.
Vor die Wahl gestellt, ob er diesen sonnigen Nachmittag bei sich zu Hause, im dämmrigen Arbeitszimmer unter Kopfhörern am Schreibtisch zubringen sollte, um weiter an der längst überfälligen und äußerst langwierigen Verschriftung der vielstündigen Tonaufnahmen vom Ehepaar Lommatsch zu arbeiten, das unter dem Dach des Alten Fährhauses eine Doppelzimmer-Wohnung mit Blick zum Kanal bewohnte, oder nicht doch lieber Frau Schwartzes Einladung zum Treffen der Biografie-Gruppe folgen sollte, hatte er sich sofort, ohne lange zu überlegen, für Letzteres entschieden.
Der Fauxpas mit Wanda gestern lenkte ihn ab, er konnte sich nur schlecht konzentrieren. Den ganzen Vormittag über hatte er nichts Richtiges machen können, wahrscheinlich fühlte er sich deswegen so ausgelaugt, so völlig überarbeitet.
Die gut sortierten und vollständig, geradezu liebevoll dokumentierten Erinnerungen von Herrn und Frau Lommatsch ließen ihm keinerlei Gestaltungsspielraum. Während er sie aufgenommen hatte, hatten sie ihn schon derart genervt, dass ihm einmal sogar ein schlimmer Anfängerfehler passiert war: Nach einer kurzen telefonbedingten Unterbrechung war ihm gar nicht aufgefallen, dass die beiden schon längst wieder flott losgelegt hatten mit ihrem einstudierten, äußerst munteren, auf Dauer so unendlich einschläfernden Altes-Ehepaar-Duett, er aber seinen Rekorder noch gar nicht wieder auf Aufnahme gestellt hatte, was er dann mit einem unauffälligen Tastendruck auf REC nachholte; Lommatschs hatten es im Eifer ihrer Erzählung zum Glück gar nicht bemerkt.
Für diese Fehlstelle im Leben der Lommatschs, es waren circa acht bis zehn Minuten aus den 1980er-Jahren, umgerechnet also sicher ein paar Jährchen, die unter Umständen vielleicht sogar ziemlich wichtig für sie gewesen waren, musste er sich bei Gelegenheit etwas einfallen lassen, eventuell sogar eine kunstvolle Überbrückung bauen oder, wie Schulze das nannte, ein bisschen »zaubern«.
Wirklich, eine gute Entscheidung, fand er, als er in seine altbekannte Route zum Alten Fährhaus eingebogen war, stadtauswärts rollte und das durchgestrichene gelbe Berlin-Schild hinter sich ließ.
Passenderweise lief im Autoradio gerade Willie Nelsons guter alter Klassiker On the road again. Brose drehte lauter und pfiff leise mit. Da er aber bis auf die Titelzeile, in der es darum ging, dass da gerade wieder jemand auf der Straße war, den Text nicht verstand, konnte er, obwohl er es gerne getan hätte, leider nicht laut mitsingen.
Anfangs hatte er diesen Oldie-Privatsender nur mal so, probehalber, eingestellt, um sich mental auf die Atmosphäre im Alten Fährhaus vorzubereiten. Inzwischen war er, sehr zu Claudias Befremden, dabei hängengeblieben. Zumindest unterwegs gehörten die Oldies nun zum Standardprogramm für ihn, obwohl der flotte Jingle vor Nachrichten und Werbeblock ihm höllisch auf den Geist ging – und auch das Studioteam, das sich anhörte, als würde es permanent unter Drogen stehen; vor allem dieser ölige Gunnar, der heute wieder Dienst schob: »Ein munteres Hallöchen all euch Jungen und, vor allem, euch Junggebliebenen dort draußen! Wie heißt es so schön bei unserm guten Blacky alias Fuchsberger? Na klar, ihr wisst es: ›Altwerden ist nichts für Feiglinge.‹ Und ihr, ganz egal, wo ihr mir gerade zuhört, könnt sicher das eine oder andere Lied davon singen. Okay, tolle Überleitung war das jetzt zum nächsten Lied oder, neudeutsch: ›Song‹ …«
Mit einem Knopfdruck brachte er Gunnar zum Schweigen.
Er war fast allein auf der Straße. Alles auf Grün. Über Nacht hatte die Chaussee sich in eine frühsommerlich blühende Allee verwandelt, die direkt an die Ostsee zu führen schien: In seinen Ohren rauschte es. Aber das konnte auch der Fahrtwind sein, er hatte die Scheibe der Fahrertür heruntergelassen, um keinen einzigen Atemzug Frühling zu verpassen.
Noch immer konnte er das genießen: einfach so, ohne Grenzkontrolle, ohne Schlagbaum, ohne überhaupt ein Ziel nennen zu müssen, die Stadt zu verlassen und hinaus ins Umland, in die Mark Brandenburg, zu fahren. Sollte er selbst einmal seine Erinnerungen aufschreiben (woran er natürlich nicht im Mindesten dachte): Das Gefühl dieser neuen Reisefreiheit war ’89 ein wichtiger Zugewinn in seinem Leben gewesen, den man, obwohl er mit den Jahren zu einer Selbstverständlichkeit geworden war, keinesfalls vergessen durfte.
Herr und Frau Lommatsch behaupteten immer wieder von sich, in Ostberlin eingesperrt gewesen zu sein.
Das war, seines Erachtens, so nicht ganz korrekt: Eingesperrt war er, Titus Brose, gewesen: in Westberlin. Die ganze Zeit über. Die Lommatschs im Osten hatte man vielleicht ausgesperrt, das kann gut sein, aber das war schon ein Unterschied. Außerdem, und das stand in gewissem Kontrast zu ihrer Aussage: Beim Blättern in ihrem Familienfotoalbum war ihm aufgefallen, dass die Schwarz-Weiß-Menschen in Zeiten der Diktatur (vor ’45 und danach im Osten) immer sehr zufrieden ausgesehen hatten, wahrscheinlich war ihnen auch gar nichts anderes übriggeblieben.
Bei diesem Thema musste er, das war fast unausweichlich, an diesen seltsamen Kay-Uwe denken, seine, wie er ihn intern immer bezeichnete, »größte menschliche Enttäuschung in der Wendezeit«. Das war jetzt fast dreißig Jahre her. Dieser Kay-Uwe musste inzwischen tatsächlich schon fünfzig sein. Unvorstellbar bei so jemandem. Brose jedenfalls konnte es sich nicht vorstellen.
Er selbst kam sich übrigens nicht annähernd so alt vor, wie er in Wirklichkeit war. Regelmäßig erschrak er deshalb, wenn ihm ohne Vorwarnung ein zerknittertes, spitzes Wolfsgesicht unter stahlgrauen Haaren finster und fremd aus einem Schaufensterspiegel oder aus der Untiefe einer schwarzen U-Bahn-Fensterscheibe entgegenblickte – das sich dann, beim zweiten Hinsehen, als sein eigenes herausstellte. Natürlich ahnte, nein: wusste er, dass – im Unterschied zu seinem Selbstbild – das Spiegelbild das richtige war, das, mit dem er auf offener Straße herumlief und das alle anderen zu sehen bekamen.
Inzwischen sah er so aus wie auf den Negativen seiner Jugendfotos, auf denen der blasse Jüngling Titus mit dem dunklen Haarschopf sich afrikanisch dunkelhäutig präsentierte, unter grauen, fast weißen Haaren.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: