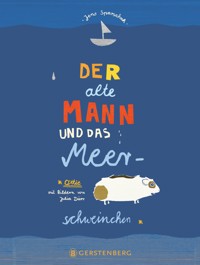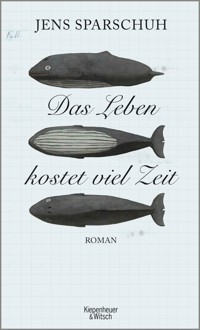16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Liebes- und einige andere Erklärungen. In diesem außergewöhnlichen Logbuch unternimmt Jens Sparschuh einen höchst vergnüglichen Streifzug durch die Welt der schönen Künste, begleitet von Kolleginnen und Kollegen, die sie auf unverwechselbare Weise geprägt haben. Er führt telepathisch ein Ferngespräch mit Irmtraud Morgner, spaziert mit Uwe Timm um den Wannsee bis nach Ikarien, inspiziert in den virtuellen Katakomben des ZVAB den Zustand alter Ausgaben von Karl Mickel, erkundet an der Seite Volker Brauns eine verwüstete Landschaft, strandet mit Leonard Cohen auf der griechischen Insel Hydra, untersucht historisches Treibgut, das Reinhard Minkewitz aufgelesen hat, streift mit Irina Liebmann auf zielvollen Umwegen durch die Große Hamburger, an deren Ende sie staunend vor einem Rätsel stehen, unter einem von Johannes Nawrath täuschend echt darüber hingepinselten Himmel macht er kurz blau und überlässt die Navigation sogar für einen hochriskanten Moment dem eigensinnigen Vladimir Nabokov, bevor er mit Thomas Mann den Zauberberg besteigt. Die in diesem Band versammelten Texte beweisen aufs Schönste, dass Jens Sparschuh nicht nur ein großer Erzähler und ein ebenso kluger wie gewitzter Beobachter unserer Gegenwart ist, sondern auch ein wahrer Meister der kurzen Form.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jens Sparschuh
Die Matrosen der Schweiz
Ein Logbuch
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jens Sparschuh
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jens Sparschuh
Jens Sparschuh, geboren 1955 in Chemnitz (Karl-Marx-Stadt), studierte von 1973–1978 Philosophie und Logik in Leningrad. 1983 promovierte er in Berlin, seitdem arbeitet er freiberuflich. Sein Werk erscheint bei Kiepenheuer & Witsch. Er veröffentlichte außerdem eine Vielzahl von Hörspielen, Features und Kinderbüchern. 1989 erhielt er den Hörspielpreis der Kriegsblinden, 2018 den Prix Chronos und 2019 den Günter-Grass-Preis.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die in diesem Band versammelten Texte beweisen aufs Schönste, dass Jens Sparschuh nicht nur ein großer Erzähler und ein ebenso kluger wie gewitzter Beobachter unserer Gegenwart ist, sondern auch ein wahrer Meister der kurzen Form.
Er führt telepathisch ein Ferngespräch mit Irmtraud Morgner, spaziert mit Uwe Timm um den Wannsee bis nach Ikarien, inspiziert in den virtuellen Katakomben des ZVAB den Zustand alter Ausgaben von Karl Mickel, erkundet an der Seite Volker Brauns eine verwüstete Landschaft, strandet mit Leonard Cohen auf der griechischen Insel Hydra, untersucht historisches Treibgut, das Reinhard Minkewitz aufgelesen hat, streift mit Irina Liebmann auf zielvollen Umwegen durch die Große Hamburger, an deren Ende sie staunend vor einem Rätsel stehen, unter einem von Johannes Nawrath täuschend echt darüber hingepinselten Himmel macht er kurz blau und überlässt die Navigation sogar für einen hochriskanten Moment dem eigensinnigen Vladimir Nabokov, bevor er mit Thomas Mann den Zauberberg besteigt.
Inhaltsverzeichnis
Die Matrosen der Schweiz
Geistergespräch mit Amanda
Wer Ohren hat zu sehen der wird schmecken
In den Fallen des Sprachstellers
Winnetou schnürt heimlich durch Dresden!
Uff, uff, uff!!!
Unterwegs nach Ikarien
Wie Uwe Timm mich zum Schweigen brachte
Ein Gespräch im Hause der Akademie über den abwesenden Geist des Theaters
Neues aus Butzmanns Notizbüchern
Treibgut. Reprisen
Unheimliche Nachbarschaft
Unendliche Geschichte
Die Vergnügungen des Ausdrucks
Lektionen eines Hochstaplers
Fabelhafte Aussicht von hier oben
Show Me The Place
Dostojewski, einfach dreifach
Durch den Schnee
Eine Botschafterin aus dem alten Prag
Jahresringe
Die Kunst des Augenblicks
Der Schöpfer aus Gera
Briefgeheimnisse
Die Vorstellung. Ein Albtraum
Quellen
Zitierte Literatur
Die Matrosen der Schweiz
träumen vom Meer.
Meer: Das stellen sie sich vor wie den Vierwaldstätter See, nur eben sehr, sehr viel größer. Größer als das Meer ist in ihren tiefblauen Augen nichts. Nichts wünschen sie sich daher so sehr, als eines Tages ihr bisheriges, zufälliges Leben kopfschüttelnd abzuwerfen, es einfach hinter sich zu lassen, ihren olivgrünen Seesack rasch mit dem Allernötigsten zu packen, eher: zu stopfen, Rasierzeug, Zwieback, Socken, Ersatzbatterien und was sonst noch dazugehört, rundum Adieu oder Ahoi zu sagen, die enge Treppe unter der splitternackten Glühbirne hinabzupoltern, die flirrende, laute Bahnhofsstraße entlangzulaufen, die sie so oft in ihrem verkappten Leben schon vergeblich entlanggelaufen sind, und in den nächstbesten pünktlichen Zug der Schweizer Bundesbahn zu steigen.
Steigen dann abends über der Stadt, über ihrem Dunst und ihren klirrenden Drähten, über den Schornsteinen mit ihren verwehenden Säulen aus Rauch in schrägen, schwarzen Strichen die flüchtigen Vögel auf – fliegende Fische in den Augen der Matrosen, die sich in den Netzhäuten verfangen und die dennoch leichthin, zwischen Luftschiffen und Flugzeugen, davonzusegeln vermögen –, folgen die Blicke der Matrosen ihnen bis an den Horizont: Dort hinten, sagen sie leise, dort, irgendwo, ist es …
Es ist wirklich nicht leicht mit ihnen! Ihnen, obwohl sie doch fest im Leben stehen oder, wie man wohl besser sagen müsste, fest darin verankert sind (zumindest scheint es so auf den ersten Blick), wäre es tatsächlich recht, führe dieser Zug ohne Halt, ohne ein Besinnen immer weiter, immer nur weiter, so weit, bis er an eine ferne, steile, steinige Küste gelangte, wo ein Prellbock auf den Schienen ihm den Weg verstellte, und es nicht mehr weiter ginge. Ginge es nach ihnen, sie wären bereit, ja, diese große Fahrt könnte schon morgen, nein: heute, nein: gleich, jetzt, hier, auf der Stelle, sofort beginnen.
Beginnen aber müssen wir diesen Bericht ganz am Anfang.
Am Anfang ist von den Matrosen der Schweiz noch nicht viel zu sehen, drei oder vier von ihnen, käme es darauf an, würden bequem in einen Seesack mittlerer Größe passen; sie sind also noch winzig klein. Klein, zahnlos und haarlos liegen diese Leichtmatrosen in ihren Kojen, die zu diesem Zeitpunkt noch »Kinderbetten« heißen, ihre Kajüte ist das Kinderzimmer, und ein knisternder Mond aus Papier lacht von oben auf sie herab; sie warten, sie wachsen, und obwohl sie, erschrocken über ihr heimliches, unaufhörliches Wachstum, oft voller Verzweiflung lauthals schreien oder, ganz plötzlich, verstummen und dann still und ergeben daliegen, ahnen sie noch nichts von der großen Obsession, die sie später einmal umtreiben soll.
Soll man es in einem kurzen Satz sagen: Da sind die Matrosen noch gar nicht sie selbst!
Selbst wenn man sie im Photoatelier am Marktplatz ablichtet, wie sie bäuchlings mit angewinkelten dicken Babyärmchen nackt auf einem Eisbärenfell liegen und gebannt auf das Vögelchen starren, das aus dem Apparat flattert, oder sie später, mit der Schultüte im Arm, sogar in einem richtig schmucken Matrosenanzug (!) knipst; sie sind es noch nicht, sie bereiten sich erst vor. Vor allem darauf, dass sie zeitlebens ihr wahres Wesen, ihr zweites Gesicht, verbergen müssen.
Müssen die Matrosen der Schweiz dann – so wie alle anderen gelegentlich auch – ihren Lebenslauf schreiben, füllen sie sorgfältig den Pelikan-Füller mit blauer Tinte und zählen akribisch alle von ihnen durchlaufenen Stationen auf, keine einzige vergessen sie, nicht den Kindergarten, nicht die Schule, nicht die Lehre, sie legen auch sämtliche Zeugnisse amtlich beglaubigt bei – doch das Entscheidende, das alles Entscheidende, umschiffen sie, sie sparen es aus. Aus ihrem Lebenslauf kann also niemand ersehen, wie es in ihnen aussieht und was wirklich wichtig ist für sie.
Sie wählen, wenn sie groß geworden sind, aus Gründen der Tarnung meist einen ganz normalen Beruf, Berufe gibt es schließlich wie Sand am … Am besten man spricht nicht mit ihnen darüber, wirklich!; denn dieser Beruf, mit dem sie später ihr Geld verdienen (manchmal sogar erstaunlich viel), raubt ihnen so unendlich viel kostbare Zeit, dass sie darüber beinahe vergessen, wozu sie eigentlich auf der Welt sind.
Sind dann Jahre oder sogar Jahrzehnte vergangen, sitzen sie in ihrem Büro fest wie Gestrandete, schiffbrüchig auf einer einsamen Insel, der Ventilator dreht schlapp seine Blätter über ihnen, sie schauen auf den Kalender, von dem die Zeit abfällt, starren einen halben Tag lang einfach so vor sich hin … Hin und wieder merkt man es ihnen – trotz aller Tarnung, trotz Maskerade und Mimikry – also doch sehr deutlich an. An solchen Tagen wirken sie abwesend, wie gar nicht da. Da lässt man sie besser in Ruhe, es ist die Ruhe vor dem Sturm, dem Sturm im Herzen oder dem im Wasserglas, schwer zu sagen: schwere See jedenfalls bei Windstärke zwölf.
Zwölf Uhr mittags jedoch, und das ist das Verrückte, völlig Verdrehte an ihnen, besteigen sie, so als wäre nichts geschehen, den Paternoster, fahren hinunter in die Kantine, stellen sich an und wählen Essen 2, jawohl: die Nr. 2, so wie immer. Immer dasselbe mit ihnen: Dass sie an manchen Tagen unversehens aus dem Tritt geraten, keinen Sinn in allem mehr sehen – und dann? Dann löffeln sie trotzdem ergeben, stumm und stur ihre Suppe aus, sitzen einfach nur da. Da fragen wir uns manchmal: Sind das überhaupt noch die Matrosen der Schweiz oder nicht doch eher ganz normale Leute, wie es sie schließlich überall gibt – solche wie du oder ich?
Ich kann hier mit Bestimmtheit nur festhalten: Sie leben unter uns. Unter uns gesagt, es ist also keineswegs ausgemacht, dass die Matrosen der Schweiz unbedingt in der Schweiz leben müssen. Müssen sie nicht; darauf kommt es bei ihnen nicht an. An ihrer jeweiligen Staatsbürgerschaft liegt ihnen herzlich wenig, weil sie im Grunde – am tiefen, stummen Grund ihrer unauslotbaren Herzen – ohnehin nur auf den Meeren zu Hause sind, dort draußen, wo der Himmel auf Erden ist und blau auf den schäumenden Wellen treibt.
Treibt es sie dann endlich einmal im Jahr (meist im August) hinaus in die Welt, in die glückliche Aus-Zeit Urlaub, diese sonnige Zäsur, da vergessen sie alles. Alles ist lange und sorgfältig von ihnen im Voraus bedacht, geplant und vorbereitet worden: Sicher, es wäre kein Problem für sie, sie könnten ohne Weiteres auch an die See, nach Zandvoort oder Ostende fahren. Fahren aber stattdessen, so wie jedes Jahr, ins Gebirge, um dort mit spitzem Geröll unterm Schuh zwischen Kühen, die gemächlich den Abend einläuten, und steil aufragenden Felswänden herumzusteigen, denn sie wissen: Zandvoort, Ostende und so weiter, das ist es nicht.
Nicht, dass Zandvoort oder Ostende nicht am Meer lägen, das tun sie laut Schulatlas, den die Matrosen stets griffbereit zur Hand haben, sehr wohl; nur haben Strandpavillons, eingecremte Badende, Rettungsschwimmer, knatternde Flaggen und ein aufgezogener Sturmball, kurz: all das, was man an derlei Orten zu gewärtigen hat, nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, was ihnen so blau, so überdeutlich und dennoch in schimmernder Ferne so verschwommen verheißungsvoll: so lapalomahaft vorschwebt, wenn sie ans Meer denken.
Denken wir uns nun, um ein genaueres Bild zu bekommen, folgende Situation: Einer der Matrosen, nennen wir ihn der Einfachheit halber Enrico, vielleicht heißt er auch wirklich so, aber das soll uns hier nicht weiter kümmern, dieser sogenannte Enrico also, den wir jetzt schärfer heranzoomen wollen, sitzt eines Nachmittags bei sich in der Küche, er schaut auf die Uhr, er nickt, dann nimmt er seufzend den eingewickelten Blumenstrauß aus dem Eimer (es sind Astern, ein Sonderangebot aus dem Blumenladen, unten, an der Ecke, wo er schon ewig die Verkäuferin kennt) und verlässt pünktlich das Haus.
Das Haus, vor dem er einige Straßen weiter, einige Minuten später steht, ist wild von Efeu überwuchert, es gehört seiner Tante oder seinem Onkel, das ist ganz egal: »Da bist du ja endlich!«, rufen die beiden im Chor, sie freuen sich und machen ihm die Tür auf.
Auf Familienfeiern (»Schau nur, alle sind schon da!«) stehen die Matrosen der Schweiz immer ein wenig im Abseits, sie sehen verlassen aus. Aus diesem Grunde schätzen sie derlei Zusammenkünfte nicht besonders. Besonders fatal ist es ihnen, stellt sich jemand mit einem Weinglas zu ihnen und stellt ihnen Fragen, fragt sie, zum Beispiel, nach ihrer Arbeit, da können sie nicht viel, eigentlich gar nichts erzählen. Erzählen hingegen die anderen, die lange schon ungeduldig auf diesen Moment, ihren Einsatz, gewartet haben, ist ihnen das recht, sie hören zu, sagen »Ach ja« beziehungsweise »Ach nein« und stehen nur staunend da.
Da nützt es auch nichts, fasst oder hakt man sie später am Abend, wenn es schon ungezwungener und richtig krakeelig wird, unter: In schunkelnden Runden (»So ein Tag, so wunderschön wie heute …«) schließen sie entsetzt die Augen, sie werden schnell seekrank, es schlingert und rollt hin und her, die Dielen des Bodens schwanken unter ihnen.
Unter ihnen, das dürfen wir an dieser Stelle nicht verschweigen, gibt es aber auch ganz andere als diesen Enrico, gewissermaßen Anti-Enricos, nicht gerade Hallodris, aber doch unerklärliche Frohnaturen: Reicht man denen, zum Beispiel, ein Akkordeon, spielen die wie die Verrückten, quetschen diese wimmernde, quietschende Kommode sehnsüchtig an ihr krankes Spieler-Herz, tasten ergriffen die Tasten ab, spielen darauf, bis es spät wird und alle Gäste, der Reihe nach, den Saal verlassen.
Verlassen sitzen sie dann auf der dunklen Bühne und spielen weiter, nur für sich, ihnen fällt immer noch was ein.
Ein zentrales Thema ist nun unverzüglich anzusprechen – reden wir endlich von den Wasserbetten!
Von den Wasserbetten haben die Matrosen der Schweiz nämlich eine ganz schlechte Meinung, das ist für sie lediglich modischer Schnickschnack, absolut verzichtbar, so wie auch eine klassische Seebestattung mit allem Pipapo für sie niemals infrage käme, da bekommt man am Ende nur nasse Füße, einen Schnupfen oder wer weiß was noch.
Noch mehr allerdings als Wasserbett und Seebestattung verabscheuen sie Tätowierungen, wie man sie neuerdings, ohne ein Patent vorweisen zu müssen, ja: ohne überhaupt jemals zur See gefahren zu sein, überall, an jeder Ecke, in einem beliebigen Tattoo-Studio anfertigen lassen kann; nein, davon halten sie überhaupt nichts. Nichts läge ihnen ferner, als ihr Innerstes derart obszön auszustellen, sodass alle Welt aus den krakeligen Schriftzügen, den verwaschenen Bildern ihrer Körperbemalung (diesen Blaupausen exotischer Seemannsgräber unter Möwen und Palmen) herauslesen könnte, wie es um sie bestellt ist. Ist das klar?
Klar, ist es.
Ist es Spätherbst oder auch März, Anfang April vielleicht, gibt es Tage, da sitzen sie an einem See, über dem so viel Nebel liegt, dass man das andere Ufer nicht sieht, und sie denken schon: Endlich, wir sind da … Da lichtet der Nebel sich unversehens, Einzelheiten (Schilf, ein Steg, Bootshäuser, ein Dorf, eine ferne Kirchturmspitze) fallen nacheinander und äußerst unwillkommen ins schöne Bild ein, das sie sich gerade gemacht haben – und nun?
Nun schießt es haltlos aus ihren blauen Augen, die grau und undurchsichtig werden vor lauter Wasser, sie schmecken das Salz auf den Lippen und schütteln ungläubig den Kopf. Den Kopf immer oben behalten, lautet daher ihre Devise, sie putzen sich heftig (fast schon trompetend) die Nase, dann stecken sie das nasse Taschentuch wieder weg und gehen mit eingezogenen Köpfen nach Hause oder wohin auch immer.
Immer, wenn ihnen so etwas passiert, sagen sie sich: Wir dürfen nicht ungeduldig sein, wir müssen nur abwarten, der Tag kommt schon noch. Noch ist es ja nicht zu spät.
Spät am Abend, wenn alle schlafen, stehen die Matrosen der Schweiz lange auf dem Balkon, sie rauchen, hören auf die Rufe des Kuckucks und zählen jeden einzelnen an ihren Fingern mit, sie starren in die Dunkelheit. In die Dunkelheit, die sie nachts im Bett umgibt, versuchen sie mit den Taschenlampen ihrer funzelnden Träume hineinzuleuchten, doch gelingt ihnen das selten, nur manchmal.
Manchmal genügt auch ein einziges, zufälliges Wort – Hotel Maritim etwa –, das sie mitten am Tage, irgendwo im Stadtzentrum, rasch im Augenwinkel streift und das sie dann nicht loswerden, das ihnen folgt und bis spät in die Nacht als fixe Idee im Kopf bleibt.
Bleibt noch hinzuzufügen, dass sie am nächsten Morgen wieder einen erstaunlich klaren Kopf haben (auch die Haare dort oben lichten sich ja schon) und unter dem Schwall der Dusche plötzlich rufen: »Jetzt!« Jetzt hören wir sie endlich auch einmal singen, immer dasselbe Lied, es sind die alten Matrosenlieder von Leonard Cohen: »Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied«oder: »Jesus was a sailor …«;Cohen ist zwar keiner von ihnen, doch er bedeutet ihnen sehr viel.
Sehr viel wäre hier noch zu berichten über ihre merkwürdigen Morgenrituale, diese täglichen Rückrufaktionen ins Leben, etwa, dass es ihnen neuerdings gefällt, ein bläulich-prickelndes Duschbad der Marke Meeresbrise zu benutzen, sie stehen inmitten chemisch schäumender Wogen (wogen sie früher sechzig, vielleicht siebzig Kilo, sind es heute fast anderthalb mal so viel!), ihr Rumpf ist der gewaltige graue Rumpf eines Containerschiffes, das behäbig unter dem Kreuz des Südens seine Spur in den Ozean zieht.
Zieht sie am Ende womöglich nichts anderes als die blaue Ferne an, wenn sie, nachdem sie sich gründlich, Bahn für Bahn, rasiert haben, ein äußerst verwegenes Rasierwasser mit der flachen Hand in ihr brennendes Gesicht schlagen, ein Rasierwasser, das Karibik heißt und das ihnen wohl helfen soll, ihre Tage auch ohne Karibik (auch ohne Meeresbrise) zu bestehen?
Bestehen ihre Tage, müssen wir uns hier schließlich besorgt fragen, denn wirklich nur noch aus Arbeit und aus nichts anderem mehr?
Mehr oder weniger schon, das ist nun mal so.
So wichtig ihnen auch für den flüchtigen Moment ihre kleinen Ablenkungen, Abschweifungen und Zerstreuungen sind, mit denen sie erstaunlich viel Zeit verbringen, um nicht zu sagen: vertrödeln, nichts täuscht darüber hinweg, dass dies nur Ausflüchte sind, dass ihre gedankenlos auf der Schreibtischplatte trommelnden Fingerspitzen pausenlos SOS morsen, dass da immer noch ein kleiner Rest bleibt – bleibt zu vermuten, dass das der Rest ihres alten Traumes ist: die Kette, die sie umschlingt, zu zerreißen, nicht ewig dort wieder beginnen zu müssen, wo sie am Vortage, im Vorjahr (oder auch nur im vorigen Satz!) aufgehört haben, um mit dem nächsten Atemzug neu anzufangen. Anzufangen ist mit solch einer vagen, eher windigen Vorstellung natürlich nicht viel. Viel wichtiger wäre es, jetzt endlich nach oben in den schwankenden Mastkorb die bange Frage zu stellen: Kein Land in Sicht?
In Sicht ist jetzt noch, nachdem die im Büro verbrachten Jahre unwiderruflich um und ihre letzten Tage im Amt gezählt sind, die feierliche Verabschiedung: Sie gehen, wie es der Chef halb feierlich, halb spaßeshalber verkündet, »von Bord«.
»Von Bord also«, wiederholen sie leise, ratlos halten sie den Abschiedsblumenstrauß in den Händen und, wirklich, dann gehen sie, und dann stehen sie draußen.
Draußen, aus allen Wolken, die sich über der Stadt aufgehäuft haben, fällt Regen. Regen sie sich darüber noch auf? Auf gar keinen Fall, ach wo. Wo sie doch nun schon so weit gekommen sind. Sind sie dann endlich (für immer) zu Hause, wundern sie sich, wie schnell ihnen das Leben vergangen ist.
Ist dieser Lebensabschnitt erreicht, lungern sie tagsüber oft in den Parks herum, stehen auf Brücken, beugen sich über die rostige Reling des Eisengeländers, füttern Enten, oder sie sitzen auf einer Bank und fragen sich erstaunt, weshalb die Vögel in den Mastbäumen über ihnen plötzlich alle verstummt sind; sie hören jetzt fast gar nichts mehr.
Mehr und mehr ist ihnen aber auch das egal. Egal, was jetzt noch kommt, es betrifft sie nur noch am Rande.
Am Rande sei hier vermerkt, dass sie jetzt nicht nur Hörgeräte brauchen, sondern auch Brillen mit starken, runden Gläsern (dick wie Bullaugen), sonst müssten sie das Kreuzworträtsel (so wie all die anderen Rätsel in ihrem Leben) ungelöst liegen lassen.
Lassen ihre Kräfte auch nach, täglich machen sie noch ihren kleinen, tapferen Spaziergang, merken aber, wie sie vom ewigen Schwindelgefühl – als gingen sie bei hohem Seegang über die glitschigen Planken des Decks – bei jedem Schritt wanken und schwanken, überall müssen sie sich festhalten, sie werden ganz langsam. Langsam müssen sie nun daran denken, ihre Siebensachen zu packen, die große Reise beginnt bald.
Bald verstehen sie uns (bald wir sie) nur noch zur Hälfte, dann schon gar nicht mehr, verzagt halten sie ihre gekrümmte, vom Alter stockfleckige Hand an das Ohr, das Ohr ist eine rosa Muschel, in der hören sie in der Ferne die Brandung, und wie es rauscht …
Es rauscht – eines Tages, eines Nachts, ganz egal, einmal kommt dieser Moment – jäh alles an ihnen vorüber, wie von einer gewaltigen Strömung, einem unheimlichen Sog gezogen, treibt es sie plötzlich als Treibgut dahin und davon, von Strudeln hinabgerissen in abgrundtiefe grüne Wasserschächte staunen sie mit weit aufgerissenen Mündern – sie müssen schlucken, und sie verschlucken sich daran –, was alles sie in ihrem provisorischen Leben auf dem Trockenen gewesen sein sollen: Kind, Briefmarkensammler, Großonkel, Kleindarsteller, Abteilungsleiter, Pilzsammler, Karteileiche, Lottospieler und -verlierer, Liebhaber, Volltrottel; vor ihren Augen verschwimmt es – es hört nicht mehr auf.
Auf einmal sehen sie klar: Das Meer, die ganze Zeit, ohne dass sie es geahnt hätten, rauschte es ja nirgendwo anders als in ihnen.
Ihnen ist nun so, als lägen sie, angespült, auf einer Insel unter Palmen, die Kompassnadel sticht mitten in ihr Herz, eine Möwe schießt über sie hinweg, flatternder Herzschlag, ihre Lippen sind trocken, Sand rinnt durch die Uhr, rinnt durch die Hand, durch die Finger. Finger, die alles loslassen wollen, doch dann verkrampfen sie sich: So greifbar nah, so unendlich fern ist es bis zum … Bis zum letzten fiebrigen Windstoß ihres Atems, der immer flacher, immer rascher, immer heißer weht, träumen sie.
Sie träumen vom Meer.
Geistergespräch mit Amanda
Neulich, vor ein paar Jahren, spätabends, als ich mal wieder spirituellen Kontakt mit Irmtraud Morgner hatte, erzählte ich ihr von der bevorstehenden Geburtstagsparty zu ihrem Fünfundsiebzigsten, ausgerichtet von der Lila Villa in Chemnitz.