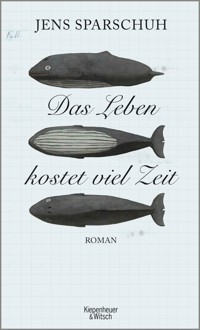16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ordnung und spätes Leid – Jens Sparschuhs tragischer Held kommt völlig durcheinander Hannes Felix ist seine Frau los: Monika kann sein sprödes Verhalten nicht mehr ertragen und packt ihren Koffer – leider völlig falsch. Sein Versuch, Ordnung in den wüsten Kofferinhalt zu bringen, gibt ihr den Rest und ihm die Gelegenheit, seine Vision von der optimalen Ordnung des Lebens künftig ganz ungestört umzusetzen. Jens Sparschuh erzählt von einem obsessiven Charakter und einem kollektiven Phänomen mit hohem Wiedererkennungseffekt: der Beschäftigung mit Strategien, das Leben und die Dinge effizient zu ordnen. Bei NOAH ist sein Held an der richtigen Adresse. Die unausgelastete Firma für Neue Optimierte Auslagerungs- und Haushaltsordnungssysteme hat ihn mit großen Hoffnungen eingestellt, aber seine Ideen zur Ankurbelung des Geschäfts nehmen immer groteskere und komischere Züge an. Rückblenden in Felix' Kindheit und seine beruflichen Anfänge liefern Einblicke in die subtilen Mechanismen, die diese komplexe Psyche formten. Und das Vorhaben, die Geschäftsinteressen von IKEA mit denen von NOAH zu verknüpfen, den Firmensitz von der städtischen Peripherie ins Zentrum zu verlegen und dafür endlich den Neubau des Berliner Stadtschlosses zu stoppen, entwickelt eine unheimliche Sogwirkung.Die große Kunst von Jens Sparschuh liegt darin, mit Sprachwitz und Feingefühl einen sympathischen und hochneurotischen Don Quichotte von heute zu entwerfen, dem der Leser bei seiner Suche nach einer neuen, perfekten Ordnung mit banger Hoffnung und großem Vergnügen bis zum bitteren Ende folgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
CoverTitelMemento MoniEin komischer KundeInterne BetrachtungenKeinerlei EinerleiSirenen, ich höre euch nicht!Messie und MessiasEr und sie und 1000 FragenStaub zu StaubIch sehe was, was du nicht siehstZu den AktenSchnee von gesternAuf der SiegerstraßeWie alles begannHaus des VolkesEin Schloß im Mond?Die KrönungBuchAutorImpressum[Menü]
Memento Moni
Seit etwa Mitte Januar leben Monika und ich in einer Art Fernbeziehung, zwar immer noch in derselben Drei-Zimmer-Wohnung, aber doch deutlich auf Abstand. Wenn man die vereinbarten Spielregeln einhält und sich zu gewissen Zeiten, morgens und abends im Bad, aus dem Weg geht, geht das.
Wir müssen einfach nur einen gewissen Sicherheitsabstand beachten. Ist man lange genug verheiratet, kommt man sich näher, als einem unter Umständen lieb ist. Das kann zu Problemen führen, auch zu ernsthaften Störungen. Das muß ja nicht sein.
Warum es dennoch zum Streit zwischen uns gekommen ist?
Weiß ich nicht.
Sucht man lange genug, findet sich immer ein Grund beziehungsweise finden sich sogar mehrere, und man verliert den ursprünglichen Anlaß dabei aus den Augen. Am Ende weiß man gar nicht mehr, weshalb man eigentlich so erbittert streitet oder tagelang pausenlos aufeinander einschweigt.
Also, es hat überhaupt keinen Zweck, nachzuforschen.
Ratlos habe ich heute nachmittag – nur fürs Protokoll: heute ist Freitag, der letzte im Januar – in der Küche vor einem Häufchen Scherben gestanden. Diese Glücksbringer zu meinen Füßen sind die blauen Zwiebelmusterfrühstückstassen gewesen, die wir bis vor kurzem noch alle im Schrank gehabt haben. Schließlich hockte ich mich hin und kehrte die traurigen Reste zusammen. Zumindest nach dem alten Kalender (falls der überhaupt noch gültig ist) bin ich heute mit Küchendienst dran.
Nicht mein Herz übrigens ist es, das blutet, sondern mein rechter Zeigefinger. Gut, daß ich immer darauf achte, daß die Hausapotheke (in der Küche, neben dem Boiler, rechts) rund um die Uhr einsatzbereit ist.
Ich selbst, muß ich dazusagen, bin gar nicht streitsüchtig und verzichte lieber. Ich merke es immer erst dann, wenn ein schwelender Konflikt offen ausgebrochen ist. Dann wundere ich mich allerdings.
»Meinetwegen«, hatte Monika zu mir gesagt, »du siehst die Sache so, wie du sie siehst. Ich sehe sie so, wie sie ist.«
Doch bevor ich mich dazu hinreißen lasse, in solch einem Streitfall derart irrige Meinungen von mir zu geben, die mir normalerweise nicht im Traum eingefallen wären – wann hätte denn schon einmal jemand die Dinge so gesehen, wie sie sind? –, und ich solche abwegigen Ansichten dann sogar, weil es kein Zurück und keinen Ausweg mehr gäbe, immer starrsinniger vertreten würde, ja sie geradezu auf Teufel komm raus verfochten hätte, gehe ich der Sache lieber weiträumig aus dem Weg, stelle mich ans Fenster, Hände in den Hosentaschen, beobachte den Straßenverkehr unten und warte, warte, bis sich die Lage insgesamt wieder beruhigt hat.
Ein schwarzer Audi Cabrio will abbiegen, er blinkt rechts und, nachdem er auf Radfahrer und Fußgänger geachtet hat, biegt er auch richtig ab. Die Tram zieht stur und eisern ihre vorgeschriebene Bahn. Sie hat ihre Nummer genau im Kopf, trägt sie sogar gut sichtbar auf der Stirn; ihren Weg kennt sie auswendig und weicht nie auch nur ein Zentimeterchen davon ab. Fußgänger stehen an der Ampel, momentan sehen sie rot.
Will Monika mir beibringen, daß ich schuld daran bin, daß … (hier kann man Beliebiges einsetzen), behauptet sie zunächst erst einmal das Gegenteil: »Natürlich«, sagt sie, »natürlich, ich, ich bin an allem schuld!«
Das heißt: Sie blinkt rechts, will aber eigentlich nach links! Eine gefährliche Situation für alle Verkehrsteilnehmer entsteht. Allgemeine Orientierungslosigkeit.
Die – wie sie meint – offenkundige Lächerlichkeit ihrer Behauptung soll nun wohl per indirekten Beweis meine Alleinschuld aufdecken. Da sie natürlich nicht schuld sein kann, muß also, weil niemand sonst weit und breit übrigbleibt, ich es sein.
Zu kompliziert? Ja, viel zu kompliziert.
Wie tröstlich dagegen der ruhig und reibungslos unter meinen Augen abrollende Verkehr.
Vom Wohnzimmerfenster aus im vierten Stock stelle ich mir vor, wie ich von hier oben mit weit ausgebreiteten beziehungsweise angewinkelten oder erhobenen Armen stumm die Autos dirigiere, den dichter werdenden Feierabendverkehr regele.
Nein, nicht ganz stumm: Da rennt tatsächlich jemand bei Rot, die weißen Linien mißachtend, schräg über die mehrspurige Fahrbahn zur Straßenbahnhaltestelle. Daumen und Zeigefinger zwischen den Lippen, will ich diesen Verkehrssünder laut trillernd zurückpfeifen, da ist er aber schon über das Absperrgeländer geklettert und in der Bahn verschwunden. – Pech gehabt.
Eine junge Mutter, selbst gerade noch Schulkind, zieht ihren Drei- oder Vierjährigen hinter sich her. Sie hat ihn offenbar vom Kindergarten abgeholt. Der Junge trägt eine bunte Blechbrille. Mit seinem kurzen gelben Plastikschwert kämpft er fuchtelnd gegen Dämonen, die unsichtbar hinter den beiden her sind.
Der Werbemann, ein fester Bestandteil unseres Straßenbildes, mit seinem ärmellosen Anorak, dem Kugelkopf und dem schmalkrempigen Hütchen obendrauf, der seinen zweiräderigen blauen Wagen durch die Gegend karrt, vor jedem Hauseingang haltmacht, um sämtliche verfügbaren Briefkästen zu verstopfen. Wir haben zwar seit langem ein Schild »Keine Werbung« am Kasten, aber wahrscheinlich kann er nicht lesen. Er verteilt ja auch nur bunten Bilderkram.
Unsichtbar den schwarz-weiß gestreiften Verkehrsstab steil in die Höhe gestreckt: Achtung! Halbe Drehung auf dem Hacken, die Arme breit: Stop!
Zuvor, damit die Kreuzung zügig wieder frei wird, noch schnell mit links einen Abbieger durchwinken und dann lässig den Zeigefinger, der mit Heftpflaster zugeklebt ist, an den Tschako tippen lassen.
Einmal – das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich mit dem Rücken zur Tür stehe – muß Monika kurz zu mir hereingeschaut haben. Sie hat aber kein Wort zu mir gesagt. Ich hörte dann nur, wie sie – die Tür klappte – wieder verschwand.
Meine Arme sinken herab. Unten kommt der Verkehr zum Erliegen. Auf einmal ist es stockfinster. Beide Augen habe ich fest verschlossen.
Dafür kann ich nun akustisch von meinem Standort aus wahrnehmen, daß Monika sich in unserem gemeinsamen Schlafzimmer zu schaffen macht.
Was sie da macht?
Das sehe ich, als ich Momente später in der offenen Tür stehe: Sie hat unseren blauen Koffer, mit dem wir schon oft schön verreist sind, zuletzt im August nach Heringsdorf, »Haus Schwalbennest« (Halbpension), aufs Bett geschmissen und damit begonnen, wahllos Sachen hineinzustopfen.
Will sie mich damit beleidigen?
Nachdem ich mir ihr Treiben einige Sekunden lang – lange genug! – von der Tür aus angeschaut habe, sage ich leise »Nein« und trete auf sie zu.
»Nein, so geht das nicht, Monika. So wird das nie etwas!« Ich mußte an dieser Stelle einschreiten! Und ich denke, sie weiß das auch. »Da findest du doch nie, was du brauchst.«
Skeptisch betrachte ich das Chaos im Kofferinnern.
»Warte mal«, sage ich halblaut und schiebe Monika sachte am Oberarm beiseite. Konzentriert kneife ich die Augen zusammen. Eigentlich sollte sie das doch aus dem Effeff beherrschen, wie man Sachen richtig zusammenlegt.
Sprachlos steht sie neben mir, als ich ihr mit wenigen Handgriffen zeige, wie einfach das geht, wieviel Platz man im Kofferinnenraum gewinnen kann, wenn man nur durchdacht genug beim Packen vorgeht.
»Im Grunde«, sage ich, »brauchst du ein Kofferverzeichnis.«
Sie starrt fassungslos in den Koffer.
»Ja, damit fängt es schon mal an.«
Natürlich weiß ich: Solche elementaren Dinge haben ihr noch nie im Leben etwas bedeutet.
»Also, zum Beispiel, ich sehe hier: vier paar Unterhosen, weiß …«
Tief über den offenen Koffer gebeugt, werfe ich ihr, so wie man ihn aus der Fahrschule kennt, den Schulterblick zu.
Auch Monika ist jetzt weiß – im Gesicht.
»… wie lange willst du eigentlich bleiben?«
Keine Antwort.
Gut, vertiefe ich mich also weiter in den Koffer, hier gibt es mehr als genug für mich zu tun.
Stumm, abgesehen von ihren wirkungsvoll gesetzten Absatzschritten – klack-klack, klack-klack –, verläßt sie unser gemeinsames Schlafzimmer. Nun fällt auch diese Tür, die ich vorhin so behutsam geöffnet hatte, ins Schloß.
Ich richte mich kurz auf. Aus dem ovalen Spiegel der Frisierkommode blickt mich ein fremder Mann an, dem die Haare verrutscht sind. Wir nicken uns kurz, einverständig zu. Ich streiche ihm die Haare glatt. Dann beginne ich noch einmal ganz von vorn, lege ordentlich Blusen, Röcke, Hosen und so weiter zusammen, um sie dann häufchenweise in den Koffer zu betten.
Als ich damit fertig bin und auch überprüft habe, ob die Kofferklappe jetzt noch zugeht (ja, es geht: sie klappt), öffne ich geräuschlos die Tür und lausche in den Flur.
Aus dem Küchenbereich höre ich, daß Monika Spiegeleier brät. Ich kenne ihre Angewohnheit, auf die magische Kraft von Eiern zu setzen: Eierkuren, Soleier, Ei im Glas und so weiter.
Na, nun ist ja alles wieder in Butter, denke ich, als ich es so vertraut in der Teflonpfanne brutzeln höre, und gehe zu ihr.
»Darf ich?« frage ich.
Da sie nicht nein sagt, verstehe ich das als stumme Aufforderung, mich zu ihr zu setzen und ihr Gesellschaft zu leisten.
Ich setze mich also an die Stirnseite des Tischs, lege mitfühlend meine Hände übereinander und sehe ihr zu, wie sie, fast ohne zu kauen, die Bissen von der Gabel herunterschlingt.
Ihre Augen sind rot. Die Nase auch. Aber sie ißt mit gutem Appetit. Die Krise scheint im Abklingen zu sein.
Die Zentralheizung gluckert nachdenklich, ich schweige.
Ich hatte dann nur kurz die Wohnung Richtung Keller verlassen, weil ich dort dringend benötigtes Material für die nächste Woche vermutete. Ich muß Norbert unbedingt, am besten gleich Montag vormittag, abpassen, um noch einmal zu versuchen, ihm den Felix-Koeffizienten nahezubringen, oder zumindest: ein Stück näher. Bisher, so scheint mir, hat er noch gar nicht begriffen, welche Tragweite diese von mir entwickelte Umrechnungszahl für die Zukunft unserer Firma haben könnte. In diesem Koeffizienten bündeln sich nicht nur die reichen Erfahrungen, die ich nach inzwischen dreijähriger Tätigkeit bei NOAH im Bereich optimierter Einlagerungs- und Ordnungssysteme habe sammeln können, nein, es geht – weit darüber hinaus – hierbei auch um ganz grundsätzliche Fragen des vernünftigen menschlichen Zusammenlebens.
Als ich aus dem Keller zurückkomme – die Mappe hatte ich übrigens nicht gefunden, die liegt wahrscheinlich schon im Büro, auf dem Stapel »Akutes« –, ist sie weg: Monika ist weg.
»Moni?!«
Ich suche die ganze Wohnung nach ihr ab – nichts.
Monika hatte meine kurzzeitige Abwesenheit also für ihre offenbar von langer Hand geplante Flucht genutzt.
Den Koffer hat sie, wie ich im Schlafzimmer feststellen mußte, nicht mitgenommen. Der liegt noch immer mit staunend aufgerissener Klappe, aber ordentlich gepackt auf dem Bett. Ich lege mich daneben.
Die Augen habe ich geschlossen. Ich schlafe nicht, ich wache nicht, ich … ich weiß nicht. Als blinder Passagier reise ich zurück, rase mit allen Sinnen, die mir noch verblieben sind, zurück in die Vergangenheit: Wie ist es nur so weit gekommen mit uns?
[Menü]
Ein komischer Kunde
»Iyi günler, Herr Arslan. Hava düzeldi!«
Unverständliches, was Norbert da leise murmelnd von sich gab. Wie bei einem Staatsempfang hatte er am Eingang des Bürogebäudes Aufstellung genommen, um auf unseren Besuch zu warten, die Hände probehalber mal im Schrittbereich übereinandergelegt, dann wieder geheimnisvoll hinter dem Rücken versteckt. Er konnte sich schlecht für eine dieser beiden Varianten entscheiden, so kam gelegentlich noch als Variante Nummer drei hinzu, daß er rasch eine Hand zum Kopf führte, sich kratzte oder, zu allem entschlossen, die Brille zurechtrückte.
Auf und ab war er geschritten, sorgenvoll hatte er dabei abwechselnd auf die Uhr und in die Ferne geschaut.
Ich sehe, auch ohne mir die Brille zurechtzurücken, diese Szene noch ganz deutlich vor mir, obwohl sie in weiter Ferne liegt. Drei Jahre ist das inzwischen her. Es war an meinem ersten Arbeitstag bei NOAH.
Für neun Uhr war Firma Arslan zu einem Besichtigungstermin angemeldet, ein türkisches Teppichgroßhandelsunternehmen aus Neukölln. Soweit ich mitbekommen hatte, war das der erste potentielle Großkunde überhaupt.
Auch ich sah kurz auf die Uhr.
Je länger dieser Herr Arslan uns warten ließ, desto mehr übertrug sich Norberts gespannte Erwartung auf mich. Kein Wunder, an meinem ersten offiziellen Arbeitstag, der im Dunst dieses fahlen Herbstmontags begann, wollte ich nichts falsch machen, für mich war damals alles noch neu und exotisch – und gleich zu Beginn so hoher Besuch.
Nach all den Wunderdingen, die Norbert mir am Morgen über Arslans schillerndes Im-und-Export-Imperium erzählt hatte, war ich zwar nicht direkt davon ausgegangen, daß Herr Arslan, sicher ein kleiner, bärtiger Mann mit Kappe, eigens auf einem fliegenden Teppich seiner Firma anreisen würde, aber zumindest hätte ich doch mit einer märchenhaften Autokolonne gerechnet.
Statt dessen fuhr zwanzig nach neun ein bejahrter, reichlich verchromter, schon etwas angegrauter Mercedes auf das Gelände. Das Innere des Wagenfonds lag hinter getönten Scheiben.
Verabredungsgemäß sollte ich – meine erste Aufgabe an diesem Tag – als Programmpunkt 1 an den Wagen herantreten, die Tür hinten rechts öffnen, damit unser Gast würdig aussteigen und Norbert ihn begrüßen konnte.
Fest hatte ich also den verchromten Türgriff im Blick, fixierte ihn scharf, trat einen Schritt nach vorn … Norbert zog mich, sachte den Kopf schüttelnd, unauffällig am Ärmel zurück.
Ausdrücklich muß ich hier Norberts Geistesgegenwart loben. Wäre es nämlich weiter genau nach Plan gelaufen, hätte es befremdlich nach Zoll- oder Drogenfahndung ausgesehen: Ich reiße hinten die Wagentür auf, worauf Herr Arslan, der arglos vorn am Steuer sitzt, zusammenzuckt und zu Tode erschrocken herumfährt.
Wahrscheinlich lag es an den getönten Scheiben oder am religiösen Flitterkram, der vom Innenrückspiegel herabhing und mich einen Moment lang abgelenkt hatte – jedenfalls: Entschieden zu spät hatte ich bemerkt, daß hinten überhaupt niemand saß. Programmpunkt 1 entfiel.
Und vorne? Auch das war mir entgangen, weil ich mich einzig und allein auf die hintere Hälfte des Wagens konzentriert hatte. Statt des erwarteten Teppichgroßhändlers aus Tausendundeiner Nacht stieg eine Frau aus dem Wagen, Frau Kaya, wie wir gleich erfahren sollten.
Sie sah sich um und, nachdem Norbert endlich seinen türkischen Begrüßungsspruch aufgesagt hatte, den er mir, fast simultan, ins Ohr übersetzte (»Guten Tag, Herr … äh, Frau Arslan. Das Wetter ist besser geworden!«), sagte sie auf deutsch: »Guten Tag, ich bin Frau Kaya von der Firma Arslan.«
Ihr Blick war dabei skeptisch zum Himmel hinaufgegangen, der tief und ziemlich undurchsichtig über uns hing. Sie hatte kurz ihre dunkelrot geschminkten Lippen verzogen, die außen mit einem dünnen, fast schwarzen Strich umrandet waren.
Vielleicht kannte Norbert, der einige Male mit seiner Ex Urlaub am Bosporus gemacht hatte, nicht den türkischen Ausdruck für bedeckten Himmel, oder er wollte einfach nur »gutes Wetter« für die Verhandlungen machen. Ganz bestimmt aber wußte diese Frau Kaya, die allem Anschein nach schon länger in Deutschland lebte, daß besseres Wetter – selbst hier – anders aussah.
Nun war es auch bei Norbert angekommen, daß unser Besuch diesen spontanen muttersprachlichen Überfall nicht zu schätzen gewußt, wahrscheinlich sogar als unerlaubten Eingriff in die Privatsphäre empfunden hatte. Also keinen Rückfall mehr ins Türkisch für Anfänger – dafür: »Hatten Sie eine gute Fahrt?«
Und genau damit hatte Norbert gleich zu Beginn einen wunden Punkt berührt, den man sich sicher besser für später und für das Kleingedruckte aufheben sollte.
Nein, Frau Kaya war ehrlich genug, freiheraus zu sagen, daß sie die weite Anfahrt doch überrascht, sogar irritiert hatte. Wer einmal den Weg von der Innenstadt zu uns hier draußen zurückgelegt hat, versteht, was sie meinte.
Vom Hermannplatz aus war sie durch die östliche Innenstadt gefahren, dann, anstatt gleich auf die Altlandsberger zu gehen, zunächst die Karl-Marx-Allee entlanggefahren (vielleicht, weil die sie vom Namen her an die vertraute Neuköllner Karl-Marx-Straße erinnert hatte), am Tierpark Friedrichsfelde nach links abgebogen und über die Allee der Kosmonauten (»Mondlandschaft«) schließlich auf die Altlandsberger gelangt.
Dieser Umweg hatte Zeit gekostet, deswegen die Verspätung. Überhaupt war das eine Reise durch verschiedene Zeitzonen gewesen, durch die Hinterlassenschaften verschiedener Gesellschaftssysteme – mal in Stein gehauen, mal großflächig, so weit das staunende Auge reichte – zubetoniert.
Bisher hatte Frau Kaya sich offensichtlich noch nie so weit in die östlichen Vorstädte vorgewagt, man sah ihr an, daß sie gerade eine verwirrende Reise hinter sich hatte.
Bestimmt wäre es jetzt vernünftiger gewesen, Frau Kaya nach ihrer beschwerlichen Anfahrt zunächst erst einmal ins Bürogebäude zu lotsen, ihr dort Kaffee und Kekse, vielleicht sogar einen Tee anzubieten, bevor man mit dem Rundgang begann. Aber Norbert hielt an seinem Besucherprogramm fest, die Besichtigung der SB – Einlagerungshalle stand da an oberster Stelle. Für mich war das praktisch, so lernte ich gleich an meinem ersten Arbeitstag im Schnelldurchlauf die gesamte Firma kennen.
An diesem Vormittag hörte ich auch zum erstenmal Norberts Vortrag, den ich mir später, in zig Variationen, noch oft anhören sollte.
»Das SB – Einlagerungssystem ist, wie so vieles, über den großen Teich zu uns herübergeschwappt.«
Wahrscheinlich, vermute ich, vermied Norbert mit Rücksicht auf eventuelle religiöse Präferenzen bei unserem potentiellen Neukunden »Arslan Im- und Export« die direkte Nennung Amerikas.
Die akribische Vorführung des Reißwolfes im Filterbereich hätte Norbert sich meines Erachtens sparen können. Das machte auf Frau Kaya bis auf ein unbewußtes malmendes Zähneknirschen, das ich nur deshalb bemerkte, weil ich während des Zerkleinerungsvorgangs direkt neben ihr stand, wenig Eindruck – mir schien das nicht zielführend zu sein.
Zwar hatte Frau Kaya mit deutlich hochgezogenen dünnen Augenbrauenstrichen gestaunt, wie sich der Berg aussortierter Rechnungsstapel im Handumdrehen vor unseren Augen in lange, sinnlos sich kringelnde Papierstreifen verwandelt hatte, doch deswegen hatte sie wohl kaum die Weltreise von Neukölln zu uns unternommen.
Abmarschbereit klemmte sie ihre Handtasche unter den Arm, und dann ging es direkt in die Halle – und hier, gewissermaßen im Vorbeigehen, als wir an den Lagerboxen vorbei die langen Gänge durchschritten, kamen die harten Fakten.
Kurz, zum Mitschreiben: Schon seit 30 Jahren gibt es das SB – Einlagerungssystem, 40 000 Anlagen davon allein im Mutterland dieser Idee, das mit einer Gesamtfläche von 186 Millionen Quadratmetern weltweit die Nummer eins darstellt. Dort heißt es übrigens »Self Storage«, ebenso wie in Großbritannien, wo es immerhin schon 780 derartige Anlagen gibt. Deutschland jedoch habe, wie so oft, den Trend verschlafen. Dafür gebe es hier momentan hohe Zuwachsraten. Noch könnten Erstkunden großzügige Treuerabatte eingeräumt werden, bis zu 30 Prozent bei einer Einlagerungszeit von mindestens drei Jahren.
Frau Kaya hörte sich das alles schweigend an.
Dann schaute sie, als hätte sie plötzlich eine Eingebung gestreift, nach oben und fragte, warum hier die Heizkörper an der Decke befestigt waren.
Stimmt, das sah ich jetzt auch, und es wunderte mich ebenso.
»Sie wollen Platz sparen«, sagte Norbert, »wir müssen – das ist unser Credo! Ganz einfach: Dadurch verteilt sich die Wärme gleichmäßig, und wir verlieren keinen Zentimeter Platz in den Kundenboxen wegen heißer Heizröhren und eventuell einzuhaltender Sicherheitsabstände. Im Moment haben wir übrigens, das wird Sie interessieren, noch alle Größen vorrätig, von der Minimalvariante, drei Quadratmeter, die für Sie wohl eher nicht in Betracht kommt«, mit einem Seitenblick vergewisserte sich Norbert, ob dieses versteckte Kompliment bei unserem potentiellen Großkunden auch richtig angekommen war, »bis hin zum Großlagerraum, der Sie sicher viel mehr interessieren dürfte. Sie können also jederzeit bestellen. Das, Frau Kaya, ist doch eine gute Nachricht, oder?«
»Und die schlechte?« wollte streng unsere ungläubige Besucherin wissen.
»Ah, sehen Sie – da habe ich gleich noch eine gute Nachricht für Sie: Es gibt keine schlechte Nachricht!«
»Na gut, wir überlegen uns das.«
Vor allem, das wiederholte sie, als wir nun gemeinsam zum Ausgang der Halle schritten, hatte der lange Anfahrtsweg Frau Kaya gestört. Norbert nickte bekümmert.
Was nun aber speziell das letzte holperige Wegstück betraf, so versicherte er: »Die Zufahrt zum Gelände soll gemacht werden.« Ob dieses »soll« reines Wunschdenken ausdrückte oder ob es tatsächlich diesbezügliche Planungen gab, das blieb sowohl für Frau Kaya, die fragend zu mir herüberblickte, als auch für mich im Ungewissen. Inzwischen weiß ich es.
»Sie hören von mir«, sagte Frau Kaya, und nach höflichem Kärtchentausch und kurzem Händeschütteln fuhr sie ab.
Wir hörten nie wieder etwas von »Arslan Im- und Export«.
Norbert, der das wahrscheinlich schon geahnt hatte, stand mit hängenden Schultern am Tor. Seine Enttäuschung war ihm anzusehen. Er sah dem auf und ab wippenden Auto hinterher – und eine große Hoffnung entschwinden.
Schweigend gingen wir in sein Büro.
In einer gemeinsamen Fehleranalyse, die wir nun, Punkt für Punkt, vornahmen, kamen wir unter anderem auf die Frage »Barzahlung«, ja oder nein, zu sprechen.
Mehrfach hatte Norbert Frau Kaya darauf hingewiesen, daß auch eine direkte Barzahlung (»Cash, Frau Kaya!«) möglich sei. Mir war aufgefallen, daß unsere Besucherin deutlich abwehrend darauf reagiert hatte und von da an wahrscheinlich sogar Zweifel an der Seriosität unseres Unternehmens hegte.
»Ja, vielleicht war das der Fehler«, räumte Norbert ein, trübsinnig knabberte er an einem Keks herum und schob mir die offene Schachtel über den Tisch.
Ich knabberte nun auch; vor allem aber knabberte ich noch an der Frage herum, weshalb Norbert denn überhaupt die Möglichkeit einer Barzahlung so nachdrücklich, so zaunpfahlwinkend ins Feld geführt hatte.
»Warum? Tja, gute Frage, Hannes. Ich will es mal so sagen: von wegen Leichen im Keller. Manche haben da noch ganz andere Sachen liegen, viel gefährlichere! Schwarze Rechnungen, Belege von dubiosen Geschäften und so weiter. Es gibt Kunden, die bestehen auf Barzahlung. Wenn die Anmietung einer Box bei uns cash erfolgt, also nicht über die Bücher läuft, dann ist dieser externe Raum hier draußen sozusagen eine Steueroase, eine Kaimaninsel mitten in Deutschland. Die Steuerprüfung kann zu Hause bei unserem Kunden dann ruhig alles auf den Kopf stellen, sie tappt ins Leere, denn sie kriegt ja nie Wind davon, daß die wirklich heißen Sachen bei uns liegen.«
Das waren Finessen der Geschäftsabläufe, graue Randzonen betreffend, von denen ich an meinem ersten Tag in der Firma natürlich noch keine Ahnung hatte.
Ich fragte mitfühlend, ob der Firma denn jetzt sehr viel Geld entgangen sei?
»Ach, Geld«, sagte Norbert tiefsinnig, »Geld allein ist auch nicht alles.«
Ich nickte; mir gefiel diese Einstellung.
Norbert biß herzhaft von seinem Keks ab und grinste mich an: »Bißchen Immobilienbesitz und paar gut gestreute Aktien, die gehören schon auch noch mit dazu, oder?«
Ich war froh, dann endlich für mich zu sein und mein Büro einräumen zu können. Ehrfürchtig strich ich über die Schreibtischplatte, die leer und verheißungsvoll vor mir glänzte. Ich begann damit, Aktenordner von A bis Z zu beschriften und ins Regal zu stellen.
Kurz vor der Mittagspause schaute Norbert noch mal bei mir vorbei. Er wollte mich unbedingt in der Abteilung Kasse / Buchhaltung vorstellen, mit der ich in Zukunft oft, beinahe täglich, zu tun haben würde.
Die Frau im Kassenraum – Kurzhaarschnitt, mit langer Strähne ins Gesicht, die einen feurig-verwegenen Stich in ein unnatürliches Rot hatte, überdimensioniertem Ohrgehänge, dreiviertel langen Hosen – sah mir auf den ersten Blick sehr nach einem Doppelnamen aus.
»Das«, sagte Norbert – und wie so oft sollte sich auch hier meine untrügliche Menschenkenntnis bewähren! –, »ist Frau Koch-Wengerski.«
Ich lächelte ihr zu. Da ich, ohne sie zu kennen, bereits so viel von ihr gewußt hatte, betrachtete ich sie von nun an als eine alte Bekannte.
Sie war resolut von ihrem Platz aufgestanden und hatte mir ihre Hand hingehalten, so wie man ein bereitgelegtes, schon etwas vergilbtes, zerknittertes Aktenstück herüberreicht, versehen allerdings mit einigen wichtigen roten Anstreichungen an den Fingernägeln.
»Felix«, sagte ich leise, »Hannes Felix.«
Während Frau Koch-Wengerski mit der rein rechnerischen Abwicklung der Geschäfte befaßt war, bestand mein Aufgabenbereich darin, hinter die Zahlen zu schauen. War Frau Koch-Wengerski mit ihrer Abrechnung plus / minus null durch, war sie fertig: Für mich begann dann erst die eigentliche Arbeit.
Aus den Kundenkarteien und – abrechnungen sollte ich ersehen, wer eventuell, zum Beispiel über ein gestaffeltes Rabattsystem, längerfristig an die Firma gebunden werden konnte, wo es, von der Natur der eingelagerten Sachen her, noch ungenutzte Reserven gab und die Geschäftsbeziehungen zielstrebig ausgebaut werden konnten.
Wenn jemand lediglich im Wechsel der Jahreszeiten die Sommer- beziehungsweise Winterreifen seines Autos bei uns einlagerte, oder, einzig aus Pietätsgründen, die Gründerzeitanrichte, das wurmstichige Erbstück seiner Großtante, per Dauerauftrag bei uns abstellte, war natürlich nicht viel zu machen.
Ganz anders und viel ausbaufähiger sah es bei den kontinuierlich anwachsenden Aktenbeständen eines Charlottenburger Notariats aus. In diesem speziellen Fall gelang es mir sogar, Schritt für Schritt den gesamten Altaktenbestand an uns zu ziehen.
Ebenso erfolgreich war ich, als es um die Einlagerung von saisonalen Überkapazitäten eines bekannten Berliner Sargherstellers ging; statistisch gesehen gibt es gute und schlechte Sterbemonate. Daß diese Geschäftsbeziehung uns dann eines Tages beinahe vor große, fast unüberwindliche Schwierigkeiten gestellt hätte, war eine andere Sache, das lag ganz sicher nicht an mir.
In all diesen Fällen mußte ich mir natürlich jeweils die entsprechenden Vorgänge von Frau Koch-Wengerski holen. Es ist klar, daß die sich da manchmal kontrolliert vorkam, obwohl ich auf die detaillierten Abrechnungen, lange Zahlenkolonnen, nie im einzelnen achtete. Rückblickend muß ich sagen, das war vielleicht ein Fehler. Ein herzliches Verhältnis konnte sich so gesehen, schon aus rein beruflichen Gründen, jedenfalls nie zwischen uns entwickeln.
Außerdem zeichnete ich noch für die Außendarstellung unserer Aktivitäten verantwortlich: also Anzeigen, Werbung und so weiter. Gut und gern hätte ich noch ein paar zuverlässige Mitarbeiter brauchen können. Schon allein auf Grund unserer externen Lage an der Peripherie der Stadt war es nie ganz einfach, unsere Angebote den Kunden auch nahezubringen, sprich: sie zu uns heraus aufs freie Feld zu locken.
Kommt man auf der Autobahn aus nördlicher Richtung, fährt man praktisch direkt an uns vorbei, die Autos brausen im Sekundentakt vorüber.
Letzten August, als ich noch mit Monika hier vorbeigefahren war, aus südlicher Richtung kommend, auf dem Weg nach Heringsdorf, hatte sie nur stumm und ehrfürchtig an unserem riesigen grauen Blechkasten hochschauen können. Die vier meterhohen Buchstaben auf dem Dach sind nicht zu übersehen.
Die unmittelbare Autobahnnähe ist allerdings eine Finte des Schicksals: Man kann ja nicht auf dem Standstreifen anhalten, Warnblinklampe anschalten und mit seinen Siebensachen einfach mal so kurz über die Mittelplanke klettern und, in einem freien Moment, über die Gegenfahrbahn sprinten.
Das Ziel scheint zum Greifen nahe – man muß sich dennoch wieder von ihm entfernen, muß gewissermaßen einen großen Anlauf nehmen, um es zu erreichen.
Kommt man zum Beispiel von Norden, heißt es also, noch fast fünf Kilometer weiter zu fahren, unser grauer Riesenkasten im Rückspiegel wird immer kleiner, bis er hinter einer Kurve und der neuen Autobahnbrücke ganz verschwindet, an der nächsten Abfahrt raus, dann ein Stück Landstraße und gleich nach der zweiten Biegung scharf aufpassen, runter vom Gas, damit man unser Firmenschild (mit Richtungspfeil nach rechts) am Straßenrand nicht verpaßt.
Unsere im Vergleich zu den Innenstadtlagen unschlagbar günstigen Quadratmeterlagerpreise sind insofern teuer erkauft, als nun das schwierigste Wegstück kommt, die eigentliche Herausforderung, vor allem für Möbelwagen: über eine unbewachte Bahnschranke, das geht noch, dann Anfahrt auf einem etwa anderthalb Kilometer langen, vom Regen ausgehöhlten, sporadisch mit Schotter aufgefüllten Holperweg, der direkt zum Firmengelände führt.
Es ist ein Zwischenreich.
Weder gibt es richtig Natur (weniger übrigens als in der Stadt, wo immerhin Bäume stehen, Gesträuch wuchert und Gras sprießt, das regelmäßig und kostenlos von den Großstadthunden gedüngt wird), noch gibt es hier Städtisches, das schon mal gar nicht. Hier ist nichts. Und wir befinden uns in seinem Zentrum.
Was wir hier reichlich haben, ist Platz.
Die graubraune Gegend wird in weitausholenden, schwungvollen Linien von der A 10 im Osten, S-Bahn-Gleisen im Norden und einer wenig befahrenen Eisenbahnstrecke (vorwiegend Güterzüge) im Südwesten durchschnitten und in große, größtenteils jedoch ungenutzte Areale zerteilt.
Auf der Freifläche vor unserem Firmengelände stehen manchmal Rehe und äsen. Kein Mensch weiß, wo die herkommen und wohin die abends, nach getaner Arbeit, wieder verschwinden. Manchmal denke ich, das sind nur Attrappen. Alle Wege sind ja abgeschnitten.
»Tierliebe«, meinte neulich Herr Wodak, unser Pförtner, als er das Rudel aufmerksam durch die großen Glubschaugen seines Zeiss-Feldstechers beobachtete, »geht durch den Magen.«
Er faselte dann noch was von Rotkraut und Klößen und ließ es auch an, für meinen Geschmack, makaberen Details nicht fehlen, »… und schön die Seiten mit Speckstreifen spicken«, da hatte ich aber schon meinen Schlüssel genommen und war weitergegangen. Menschlich ist Wodak eine Katastrophe, aber sonst ganz nett.
Hat man unser eingezäuntes Gelände erreicht, findet man am Eingang, gleich neben Wodaks Glashäuschen, auf einem Blechschild den kompletten Firmennamen, das, wofür NOAH steht: Neue Optimierte Auslagerungs- und Haushaltsordnungssysteme.
Wenn sie mit draußen telefonieren, ersetzen manche Kollegen »neue« neuerdings auch durch das in Mode gekommene »nachhaltige«. Aber weder das eine noch das andere paßt richtig. Übrigens wäre es, da wir eine SB – Einlagerungshalle betreiben, korrekter, von Einlagerungssystemen zu sprechen, da hätten wir auch begrifflich Ordnung, aber dann käme das natürlich mit NOAH nicht mehr hin.
Intern kursiert auch noch der Begriff »Norberts olle Abfall-Halde«. Einige glauben, Norbert habe damals nur deswegen irgendwas mit n in unseren Firmennamen eingeschmuggelt, damit »N« wie »Norbert« ganz vorne steht.
Für Erstkunden geht es vom Kundenparkplatz, vorbei an zwei stiefmütterlich bepflanzten Betonschalen, zur Anmeldung, wo zunächst die Formalitäten erledigt werden.
Die anderen nehmen sich gleich einen Trolley und zotteln los, rollen das, was sie temporär loswerden wollen, in die SB – Einlagerungshalle zu ihrer Box beziehungsweise holen von dort das ab, was sie momentan brauchen.
Bevor man den Halleneingang erreicht, passiert man einen Schlauch, wir nennen ihn den »Filter«: Abfall- und Altpapiercontainer, Aktenvernichtungsgeräte. Auch der gefräßige stahlgrüne Reißwolf lungert dort hungrig herum: ein Service, den wir gegen ein kleines Entgelt anbieten und der gern angenommen wird.
Dinge, die man zur SB – Einlagerung aussortiert hat, sind ja aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen worden, sie verlieren auf einmal ihren Sinn, sie sind wie verwirrte Alte, die hilflos in der fremden Gegend herumstehen.
Es lohnt nicht, den teuer bezahlten Platz damit zuzustellen und Monat für Monat Geld dafür auszugeben, wenn man sie so schnell und kostengünstig entsorgen kann. Natürlich, es steht jedem frei, auch alles aufzuheben, aber das macht kaum jemand.
In dem weißen Flachgebäude, wo vorn die Anmeldung ist, befinden sich die Büros, das Chefzimmer, Mitarbeiterräume, die Kantine, Umkleidekabinen, die WCs.
In dem Büro ganz hinten rechts, mit Panoramablick auf die Autobahn, sitze ich. Das ist mein Reich.
[Menü]
Interne Betrachtungen
Gleich in meiner ersten Arbeitswoche bei NOAH machte ich von meinem Bürofenster aus eine wichtige Entdeckung.
Viertel vor zwölf war ich von meinem Platz aufgestanden und zwischen Tisch und Ablageschrank auf und ab gegangen, um mir die müden Füße – vor allem den halb eingeschlafenen linken – zu vertreten, dann hatte ich mich ans Fenster gestellt: kurze Frischluftzufuhr. Tief atmete ich ein und wieder aus. Blick nach links, Blick nach rechts. Mein Blick blieb rechts hängen, an etwas Weißem.
Am Hinterausgang der Küche, zwischen den bauchigen grünen Plastiktonnen für die Essensabfälle, stand die junge Frau aus der Küche, Vanessa.
Einen Arm angewinkelt und an den Bauch gepreßt, im runden Handteller ruhte der Ellbogen des anderen Arms, der steil in die Höhe ragte. Der Ärmel der Küchenjacke war herabgerutscht, man sah das Handgelenk, auch ein Stück des schlanken, blassen Unterarms.
Am Ende des aufgestützten Arms, zwischen den roten Fingerspitzen, klemmte eine Zigarette.
Ab und an zog Vanessa daran.
Ansonsten bewegte sie stumm ihre Lippen. Sie hatte die Augen geschlossen und war wie in einer Trance, wippte leicht mit dem Oberkörper vor und zurück.
Mich sah sie nicht. Dafür sah ich den weißen Stöpsel in ihrem Ohr und die Strippe, die sie mit dem iPod im Innern ihrer Küchenjacke verkabelte.
Von diesem Tag an war es zum Ritual für mich geworden, Vanessa mittags zu beobachten. Trotz der vorbeirasenden Autos jedes Mal ein Bild der Stille, das ich still für mich genoß.
Egal was für Wetter ist, ob es regnet oder schneit oder ob die Sonne vom Himmel knallt: Immer steht Vanessa kurz vor zwölf in ihrer weißen Küchenkleidung am Hinterausgang der Küche zwischen den Tonnen, hat die Augen geschlossen und bewegt stumm und ausdrucksvoll ihre Lippen.
Vielleicht singt sie ja auch laut mit. Das kann man auf die Entfernung nicht wissen. Außerdem ist die Autobahn viel zu laut.
Es ist die Ruhe vor dem Ansturm, der Punkt zwölf einsetzt, da öffnet die Kantine, der Rolladen geht ratternd hoch, und Vanessa, jetzt mit weißer Haube, steht in ihrer Luke und reicht mürrisch die Teller heraus.
Die Kantine bildet das geheime Zentrum der Firma. Nicht nur, daß sie sich, rein räumlich, genau in der Mitte des Bürogebäudes befindet, auch zeitlich laufen dort, exakt in der Mitte des Tages, zur Mittagspause um zwölf, alle Fäden zusammen.
Daß die Männer aus dem »Filter« und dem Lagerbereich, die körperliche Arbeit leisten, den Vortritt haben, ist ein ungeschriebenes, von allen respektiertes Gesetz.