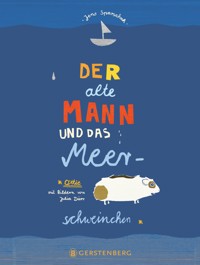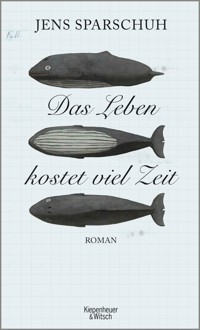16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ende der Sommerzeit: Ein faszinierendes literarisches Rätsel auf den Spuren Vladimir Nabokovs Jens Sparschuh entführt den Leser auf eine fesselnde Spurensuche, die von einer rätselhaften Skizze in Nabokovs Kriminalroman Verzweiflung ausgeht. Der Protagonist, ein Gastdozent und leidenschaftlicher Nabokovianer, begibt sich nach einem Vortrag über "Nabokovs Berliner Jahre im Spiegel seiner Romane" auf eine intensive Recherche. Hat der für seine Perfektion bekannte Schriftsteller tatsächlich den Ziestsee bei Kolberg gemeint, obwohl die Zeichnung Ungereimtheiten aufweist? Die Suche führt den Helden nicht nur zurück an die Orte seiner Kindheit im Berliner Umland, sondern auch zu zwei Frauen: seiner treuen Vertrauten Lea und der amerikanischen Dozentin Deborah, deren Nabokov-Begeisterung er geweckt hat. Jens Sparschuh, selbst profunder Kenner und Bewunderer von Nabokovs Werk, erzählt mit Witz und Tiefgang davon, wie Literatur auf das Leben wirken kann. Ende der Sommerzeit ist ein großes Lesevergnügen, das gekonnt mit den Grenzen zwischen Realität und Fiktion spielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
TitelWidmungEinleitungHauptteilBuchAutorImpressumWidmung
für Vera
Einleitung
PLAYBOY:Sind Sie je psychoanalysiert worden?
Nabokov: Ob ich was worden bin?
PLAYBOY:Ob Sie sich einer psychoanalytischen Behandlung unterzogen haben.
Nabokov: Warum das, um Himmels willen?
PLAYBOY, Januarausgabe, 1964
Hauptteil
Als Vladimir Nabokov Russisch-Professor an der Cornell University in Ithaca, N. Y., war (1948–1959), zeichnete er diese flüchtige Skizze vom Schauplatz seines 1932 im deutschen Exil geschriebenen Kriminalromans »Verzweiflung« in das einzige verbliebene Exemplar der englischen Erstausgabe:
Im Vorwort zu einer späteren Neuausgabe schrieb Nabokov: »1937 brachte der Londoner Verlag John Long Limited ›Verzweiflung‹ in einer handlichen Ausgabe heraus, mit einem systematischen Verzeichnis seiner Verlagsveröffentlichungen am Schluß. Trotz dieser Zugabe verkaufte das Buch sich schlecht, und ein paar Jahre später vernichtete eine deutsche Bombe den gesamten Lagerbestand. Das einzige noch vorhandene Exemplar ist, soweit ich weiß, mein eigenes – doch zwei oder drei lauern vielleicht noch unter vergessenem Lesestoff in den dunklen Bücherregalen von Pensionen am Meer zwischen Bournemouth und Tweedmouth.«
Im Unterschied zu versprengten Einzelgängern der Erstausgabe, die womöglich noch immer unentdeckt irgendwo vor sich hin dämmern, kann man sich heute ohne Probleme diesen Roman in einer Neuausgabe beschaffen.
Auch die oben aufgeführte Skizze ist relativ leicht zu finden. Man muß im Internet nur unter den Suchbegriffen »This map, hand-drawn by Nabokov, shows Kolberg« nachschauen, und schon flimmert dieser Lageplan auf.
»Diese von Nabokov handgezeichnete Karte«, so erfährt man aus der englischsprachigen Bildunterschrift, »zeigt Kolberg am Wolziger See, wo er, Véra und ihre Cousine Anna Feigin 1929 Land gekauft hatten. Das Grundstück bildete die Mord-Szenerie in Verzweiflung.«
Auf Nabokovs mysteriöser Karte liegt Kolberg allerdings im Norden von Berlin, während es sich in natura südlich davon befindet. Das Stück Land, das die Nabokovs kauften, lag keineswegs, wie der Eindruck entstehen könnte, am Wolziger See. Und der Mord muß, nach allem, was im Roman steht, etliche Kilometer von Kolberg entfernt, in einem Waldstück am Rande einer Chaussee, verübt worden sein.
Sollte also jemand auf die Idee verfallen, anhand dieser Skizze Nabokovs damaliges Grundstück und jene Stelle im Wald zu suchen, wo der Mord geschah, müßte er sich vorher die Mühe machen, das Geheimnis dieser verdrehten Karte zu entschlüsseln.
Oder aber man versucht es ganz anders und hält sich an den Roman selbst. In dem hat Nabokov zahlreiche, gut sichtbare Wegweiser aufgestellt und auch einige versteckte Hinweisschilder angeschraubt.
Folgt man ihnen, wird man bald sehen, wohin das führt.
Es war Gregory von der Russisch-Abteilung des James Colleges, der mich auf jene rätselhafte Lebensspur aufmerksam machte, die Nabokov einen Sommer lang in die Wälder der Mark Brandenburg geführt hatte und die heute, nach über achtzig Jahren, verschwunden zu sein scheint.
Ich bewohnte in der kleinen Stadt, die zum College gehörte, ein weißes Holzhaus am Ende der Mainstreet, schon fast draußen, am Rande der langgestreckten, rechteckigen Maisfelder, fuhr jeden Tag endlose, schnurgerade Asphaltstrecken mit einem geliehenen Fahrrad, meist zu einem See, wo ich von einer Bank aus staubige Waschbären beobachtete, und mußte nur einmal in der Woche, am Montagabend, mit einer übersichtlichen Gruppe hochmotivierter Studenten über deutsche Literatur und Geschichte reden; so stand es in dem Vertrag mit dem German Department, das mich für das Frühjahrssemester 2009 als ausländischen Gastlektor eingeladen hatte. Goethe (mit zackigem Ordensstern), eine buntgescheckte Oberflächenkarte Deutschlands sowie Schloß Schwanstein aus luftig romantischer Höhe schauten dabei von den Wänden des Seminarraums auf uns herab. Manchmal sahen wir uns auch nur Filme an – mit oder ohne Untertitel.
Mein Postfach im Keller des College-Hauptgebäudes war bis auf Einladungen zu Grillpartys, Ankündigungen von Konzerten des Studentenorchesters und die wöchentlich verbreiteten allgemeinen Hinweise der Campus-Verwaltung stets auf vorbildliche Weise leer geblieben, so daß ich, wenn ich 12 Uhr mittags ins College kam, die tägliche Post mit einem einzigen Handgriff erledigen konnte. Neben dem Fächerkasten stand praktischerweise ein von der rastalockigen Öko-Gruppe des Colleges gestifteter Altpapierkarton.
Um so erstaunter war ich, als ich eines Tages einen Brief in meinem Fach fand, einen richtigen Brief. Der Umschlag war blaßgelb. Es handelte sich um eine Einladung der Russisch-Abteilung zum Vortrag »V. Nabokovs Berliner Jahre im Spiegel seiner Romane«. Krakelig unterschrieben hatte den Brief Professor Galin.
In den ersten Wochen meines Aufenthalts hatte ich ihn, wenn wir uns zufällig am späten Montagabend nach meinem Seminar auf dem langen Flur im er-sten Stock begegnet waren, nur als »Gregory« gekannt: ein großer, wuchtiger Mann mit einem störrischen, rötlichgrauen Haarkranz. Sein rostiger Vollbart und das an einer Kette vor der erdbraunen Jackettbrust baumelnde imposante Gestell einer eckigen, goldenen Lesebrille, das entfernt an das Kreuz eines russischen Popen erinnerte, entrückten seine Erscheinung auf sympathische Weise dem profanen Collegeleben.
Er »bewohnte«, anders kann man es nicht nennen (in der ganzen Zeit hatte ich ihn nie außerhalb des Campus zu Gesicht bekommen), ein kleines, quadratisches Büro im ersten Stockwerk, fast am Ende des Gangs.
Stand die Tür zu seinem Büro offen, was selten der Fall war, fiel der Blick zuerst auf eine mattgolden schimmernde Ikone, eine Gottesmutter – in ihren Armen saß aufrecht ein Kind, es sah aus wie ein geschrumpfter Erwachsener. Die Gottesmutter hielt ihre sanfte, feingliedrig ausgestreckte Hand über Gregorys Kopf, so als wollte sie den zufällig Vorüberkommenden damit sagen: Schaut nur auf diesen fleißigen Mann, von früh bis spät (und wahrscheinlich auch von spät bis früh) sitzt er an seinem Apple-Computer und arbeitet – woran? Das weiß niemand.
Dann, bei einem Empfang des Rektors anläßlich der Einweihung der neuen Tennisanlage hinter der Eisenbahnlinie, an der Ausfallstraße nach St. Helena, erfuhr ich es schließlich doch.
Wir standen ein paar hellblaue Cocktails lang nebeneinander im holzgetäfelten Kaminraum der James jr. Hall an der Fensterfront und blickten hinaus in den Park. Die Bäume und Sträucher draußen hatten sich noch nicht endgültig zwischen Grau und Grün entscheiden können.
»Warten wir es ab«, sagte Gregory, »das geht hier von einem Tag auf den anderen, gerade noch Frost – und plötzlich ist Frühling, nein: Sommer, und schon laufen alle in Shorts herum, das ist ganz anders als bei Ihnen in Deutschland.«
Gregory zeigte sich sehr interessiert daran, daß ich aus Berlin kam. Als er mir verriet, daß er Nabokov-Forscher sei, und ich daraufhin kurz und kennerisch die Augen schloß und den Mund spitzte, betrachtete er mich prüfend über den Rand seines Cocktailglases.
»Sie können übrigens auch Grigori zu mir sagen«, sagte er. Wir prosteten uns stumm zu, ließen dumpf die Gläser zusammenklacken.
»Und Sie? Was verbindet Sie eigentlich mit Nabokov? Weshalb lesen Sie ihn?«, fragte er mich.
Ich wischte mir mit dem Handrücken über den Mund.
»Oscar Wilde hat einmal gesagt: ›Mein Geschmack ist denkbar simpel‹ …«
»… ›einfach immer nur das Beste!‹«, ergänzte Grigori. Er nahm noch einen kleinen Schluck. Aufmerksam sah er aus dem Fenster.
Eigentlich, so erklärte er, beschäftigten ihn im Moment lediglich ein paar Anmerkungen und Kommentare zu Nabokovs »Berliner« Romanen – er wandte sich zu mir um, gespannt blickte er mich an.
Mir fiel, passend dazu, ein Zitat Charles Kinbotes ein, des sinisteren Herausgebers von Nabokovs Meisterwerk »Fahles Feuer«: »Es ist der Kommentator, der das letzte Wort hat.«
Da löste sich die Spannung in seinem Gesicht, und bald lösten sich der Park, die monströsen dunkelroten Gardinen und alles Übrige, das uns bis dahin umgeben hatte, in Luft auf. Wir hatten unser eigenes Weltreich betreten.
Kein Laut des Smalltalks drang mehr zu uns vor; wir waren in einem Dialog, wie er so vielleicht nur unter alten Nabokovianern möglich ist: ein schnelles Frage- und Antwortspiel, als jeweilige Kommentare genügten ein wissendes Lächeln, eine leicht angehobene Augenbraue oder ein fragend verzogener Mundwinkel.
Grigori war Mitglied der Freien Nabokov-Assoziation Mittlerer Westen, die, so deutete er es an, seit Jahren eigene Wege beschritt, sich strikt von der »Nabokov-Mafia« abgrenzte und deshalb in einer gewissen Konkurrenz oder, genauer gesagt, Opposition zu den entsprechenden, nur eben sehr viel größeren, etablierten Clubs an der Ost- und Westküste stand.
Seine Detailkenntnisse waren frappierend, nicht nur was Orte, Jahreszahlen und Erscheinungsdaten betraf. Egal, worüber wir sprachen, aus dem Stegreif hatte er jeweils die genau passende Zitatstelle oder Interviewantwort des alten Magiers parat. Jeder Gedankenschmetterling Nabokovs schien bei ihm in einem eigenen schwarzen Schächtelchen deponiert zu sein, das er bei Bedarf blind aus einem imaginären Schrank von unendlichen Ausmaßen hervorziehen und aufklappen konnte.
Meine sehr viel geringere Reputation konnte ich immerhin damit aufbessern, daß ich im Unterschied zu ihm bereits Nabokovs Geburtshaus in St. Petersburg besucht hatte, in der Morskaja-Straße – »Bolschaja morskaja 47«, wie er halblaut, mit geschlossenen Augen einen inneren Stadtplan auseinanderfaltend, präzisierte –, und auch schon im Montreux Palace Hotel gewesen war, wo Nabokov von Anfang der 60er Jahre bis zu seinem Tod 1977 in einer kleinen, möblierten Wohnung gelebt hatte.
Diese Suite, das wußte Grigori, war nach Nabokovs Tod umgebaut worden. Ein Besuch lohnte sich nicht mehr.
»Waren Sie da eigentlich auch an seinem Grab?«, wollte er von mir wissen.
Ich verneinte.
Wenn man über jemanden etwas erfahren will, sind Friedhöfe mit Abstand der uninteressanteste Ort. Dort sind die Menschen im allgemeinen tot. Besucht man sie, sind es nur pietätvolle Pilgerfahrten nach Nirgendwo.
Viel aufschlußreicher sind doch die Orte, wo jemand gelebt hat, wo man sehen kann, wie das Licht ins Fenster fiel, welche Bäume vor dem Fenster standen, ob eventuell Blätter flirrende Schatten auf seinen Schreibtisch gesprenkelt hatten, überhaupt: wie die Landschaft oder auch eine Stadt jemanden geprägt hat. Auf dem Friedhof prägt einen nichts mehr.
»Dann kennen Sie sicher auch nicht die absolut rätselhafte Inschrift auf seinem Grabstein«, sagte Grigori, »Vladimir Nabokov / Ècrivain 1899–1977.« Er sah mich fragend an: »Nabokov, der nie ein Wort zuviel verwendet hat – warum fügt er da ›Schriftsteller‹ hinzu? Das weiß doch sowieso jeder.«
»Hm. Das hat er ja nicht selbst geschrieben.«
»Richtig. Aber da er immer ein paar Züge vorausgedacht hat, nehme ich nicht an, daß er das dem Zufall überlassen hat.«
»Vielleicht«, vermutete ich halbherzig, »… Bescheidenheit?«
»Ich bitte Sie! Doch nicht bei Nabokov. Man kann ihm ja alles mögliche zum Vorwurf machen, Bescheidenheit gehört mit Sicherheit nicht dazu.«
Er sah wieder aus dem Fenster. »Ich denke, das zeugt, noch über das Grab hinaus, von einer gewissen Skepsis, was die Nachwelt betrifft. Oder –«, er nahm den letzten Schluck aus seinem Glas, »es ist einfach nur ein sublimer postumer Scherz, den er sich da mit uns erlaubt.«
Der Termin für den Vortrag rückte heran, es war ein Donnerstag, Anfang Mai, zweieinhalb Wochen vor meiner Abreise.
Ich saß auf einer Bank in der parkähnlichen, ulmenbestandenen Grünanlage, die die verschiedenen Teile des Campus voneinander trennte und sie ebenso, durch verschlungene Pfade und Wege, miteinander verband: das langgestreckte, im viktorianischen Stil erbaute Hauptgebäude, dessen hohe Eingänge von Efeu überwuchert waren, mit seinen Rundbögen, Glockentürmen und spitzgiebeligen Erkern; angrenzend daran die Sport- und Schwimmhalle sowie der Neubau der Mensa und, auf der gegenüberliegenden Seite, die modernen Studentenunterkünfte.
Im Zentrum aber stand, so daß sie von überall her auf kürzestem Weg zu erreichen war, die beinahe rund um die Uhr geöffnete Bibliothek – ein Leuchtturm der Wissenschaft, der auch nachts sein kaltes weißes Licht hinaus in die dunkle Prärie schickte.
Physisch saß ich zwar noch auf dieser Bank – metaphysisch aber saß ich bereits auf gepackten Koffern. Meine Zeit hier ging allmählich zu Ende, und ich hatte noch keine Ahnung, was mich drüben, im alten Europa, erwartete.
Vor mir, am dicken Stamm einer Ulme, hockte deprimiert ein graues US-amerikanisches Eichhörnchen. Vorwurfsvoll betrachtete es mich. Ich zuckte die Schultern, ich konnte es nicht mehr ändern und drückte die leere Macadamianußtüte aus dem Walmart zu einer knisternden Silberkugel zusammen, die ich zielgenau im Basketballkorb eines Abfallbehälters, der direkt neben der Bank stand, versenkte.
Das Eichhörnchen hatte verstanden. Unverrichteter Dinge machte es sich auf den Rückzug: eine nervöse Aufwärtsspirale, so als würde es sich selbst jagen, rund um den graubraunen Stamm herum, wobei es immer wieder für kurze Momente innehielt und mich aus seinen schwarzglänzenden, gläsernen Augenknöpfen betrachtete, bis es schließlich hoch oben, im undurchsichtigen Geäst, verschwand – während ich aufgestanden war und hinüber zum Hauptgebäude ging, wo um 7 Uhr p. m. der Vortrag beginnen sollte.
Erst dachte ich, ich hätte mich im Raum geirrt oder vielleicht in der Zeit. Aber Punkt 19 Uhr betrat Grigori den Raum, ein kleines Auditorium im ersten Stock. Er nickte in die leere Runde, schritt erhobenen Hauptes nach vorn, legte seine Mappe auf dem Tisch ab, dann kam er zu mir an den Platz und begrüßte mich, persönlich, mit Handschlag.
»Im Grunde«, sagte er, »ich bin ganz froh, daß wir heute unter uns sind. Es ist ja doch eher etwas – ich würde sagen – für Spezialisten.« Er sah auf die Uhr. »Entschuldigen Sie, wir warten nur noch einen Moment bis …«
In diesem Moment schob sich durch die offene Tür eine Frau ins Auditorium. Frühes Mittelalter, schätzte ich. Grigori verbeugte sich. Sie war ganz in Schwarz: Blazer, T-Shirt, Jeans, Stöckelschuhe. Nur ihr halblanges, ebenfalls schwarzes Haar – hinten kurz, vorne länger, was ihrem Kopf etwas Sphinxhaftes gab – war von einigen silbergrauen Strähnen durchwirkt.
Grigori stellte uns einander vor. Deborah kam aus Montreal, Kanada, arbeitete aber schon lange in den USA, zur Zeit lehrte sie an der Universität in St. Helena, sie war – und eine leichte Frage schwang in seiner Stimme mit, als Grigori das sagte – »feministische Literaturwissenschaftlerin«.
Ich nickte ihr freundlich zu. Da ich mit Literaturwissenschaft sowieso nichts am Hut habe, störte mich auch das »feministisch« nicht weiter. An der Lehne rückte ich einen Stuhl vom Tisch ab, damit sie neben mir Platz nehmen konnte.
Grigori präsentierte in seinem Vortrag die Grundzüge einer größeren, noch in Arbeit befindlichen Studie. Sie sollte das Einleitungskapitel zu einem Sammelband sein, in dem herausragende internationale Wissenschaftler und Schriftsteller – sein Blick war zwischen Deborah und mir unschlüssig hin- und hergewandert – aus unterschiedlichen Perspektiven Nabokovs Berliner Zeit (1922 bis 1937) als Zwischenstation auf dem Weg von Ost nach West, von Rußland nach Amerika, von der russischen Sprache in die englische behandelten. Im Zentrum: das Berlin der 20er und 30er Jahre, eine Art »Transitraum«, wie Grigori sich ausdrückte, in dem die russischen Emigranten versuchten, sich provisorisch einzurichten.
Dabei, so Grigori, kam es zu der paradoxen Situation, daß die Adligen und Bürgerlichen, die im Berliner Westen, dem sogenannten »Charlottengrad«, lebten, sich dort mit einer Abart jenes sowjetrussischen Kommunalwohnungstyps begnügen mußten, vor dem sie 1917 eigentlich geflüchtet waren. Mangels finanzieller Mittel lebte man zur Untermiete, in möblierten Zimmern oder in Pensionen, man teilte sich in Küche, Bad und Klo ebenso wie in das übrige Leben.
Grigori hob den Blick von seinen Papieren – und er hob die Stimme zu einem ersten Fazit: Bereits hier deutete sich jenes Lebensgefühl einer grundsätzlichen Unbehaustheit an, das Nabokov bis zu seinem Lebensende nicht mehr verlassen sollte. Ich nickte ihm zu.
Ein kurzer Seitenblick: Auch meine Nachbarin schrieb aufmerksam mit. Die herabhängenden Haare verdeckten zwar ihr Gesicht, aber man konnte es ihr an der Nasenspitze ablesen, wie konzentriert sie war.
Grigori ging chronologisch vor. Besonders beschäftigten ihn die raffinierten Romananfänge. Zunächst widmete er sich Nabokovs erstem Roman, »Maschenka«, in dem das Innenleben solch einer russischen Pension in Berlin beschrieben wurde.
Er begann mit jener Stelle, gleich am Anfang, wo sich Alfjorow und der Held des Romans, Ganin, in der stockfinsteren Fahrstuhlkabine, die dann steckenbleibt, befinden.
Den Namen »Ganin« betonte Grigori übrigens auf besondere Weise, indem er nach der ersten Silbe eine längere Pause ließ, damit das »n«, mit dem die zweite Silbe begann, desto deutlicher zu hören war, »Ga---nin«, wahrscheinlich, um Verwechslungen mit seinem eigenen Namen, Galin, auszuschließen.
Alfjorow also stellt sich Ganin vor und tritt ihm dabei, weil er nichts sehen kann, aus Versehen auf den Fuß, worauf Ganin aus dem Dunkel antwortet: »Sehr angenehm.«
Grigori verzog den linken Mundwinkel zu einem Lächeln, er ließ eine kleine Pause, um die Situation auf uns wirken zu lassen.
Im Unterschied zu manch anderen Romanen aus dem Berliner Emigrantenmilieu, die »das Leben geschrieben« habe, was unbedingt als Synonym für schlechtgeschriebene Romane zu verstehen sei – das Leben kann nicht schreiben, es liefert nur chaotische, undurchdachte Entwürfe! –, leuchte bereits in dieser kleinen Szene ein erster Widerschein jener existenziellen Komik auf, die Nabokovs spätere Werke auszeichnen sollte.
Mit jedem neuen Buch überstrahlte der Stern Sirins, wie Nabokov sich in Anlehnung an einen aus der russischen Mythologie stammenden Paradiesvogel nannte, immer heller die Literatur der russischen Emigrantenszene.
Ausführlich ging Grigori auf das Meisterwerk »Lushins Verteidigung« von 1930 ein, obwohl es hier keinen direkten Berlinbezug zu geben schien; im Gegenteil: Dieses Buch nimmt seinen Anfang in der Sommerfrische, auf einer Datscha.
Deborah wollte wissen, was speziell dieses Buch denn zu einem Meisterwerk mache.
»Alles«, sagte Grigori.
Er setzte seinen Vortrag fort, hielt dann aber noch einmal kurz inne und sagte, an Deborah gewandt: »Ich könnte sagen, wie aus einem Spiel tödlicher Ernst wird. Aber das wäre bereits eine Deutung. Sie sollten ›Lushin‹ einfach selbst lesen, dann werden Sie verstehen, was ich meine.«
Als weiteres Beispiel, und zwar eines außerordentlich kühnen Anfangs, zitierte er noch die ersten beiden Absätze des 1933 erschienenen Romans »Gelächter im Dunkel«, der tatsächlich wieder in der Großstadt Berlin beginnt.
»Es war einmal ein Mann, der hieß Albinus und lebte in der deutschen Stadt Berlin. Er war reich, angesehen und glücklich; um eines jungen Mädchen willen verließ er eines Tages seine Frau; er liebte; wurde nicht geliebt; und sein Leben endete in einer Katastrophe.
Das ist schon die ganze Geschichte, und wir hätten es dabei bewenden lassen, läge nicht Nutzen und Vergnügen im Erzählen; und wenn auch auf einem Grabstein Raum genug ist, die gekürzte, in Moos gebundene Fassung eines Menschenlebens aufzunehmen, so sind doch Einzelheiten stets willkommen.«
Die letzten Worte wiederholte Grigori noch einmal leise, für sich. Dann, laut: »Haben Sie bemerkt: Gegen alle Regeln verrät der Autor hier gleich zu Beginn schon die ganze, übrigens ziemlich gewöhnliche Geschichte. Offenbar ist er sich seiner Sache sehr sicher und will auf etwas ganz anderes hinaus als auf den banalen Ablauf von äußeren Ereignissen – wir ahnen es: Für ihn zählen nur die Einzelheiten.«
Bevor Nabokov seinen letzten großen Roman in russischer Sprache, »Die Gabe«, 1938 abschloß (manche meinen: seinen besten überhaupt), hatte er noch, wahrscheinlich vom kommerziellen Erfolg der Dreiecksgeschichte »König Dame Bube« beflügelt, die als Vorabdruck in der Vossischen Zeitung erschienen war und ihm, zusammen mit den deutschen Buchrechten, 7500 Reichsmark eingebracht hatte, zwei weitere dem kriminalistischen Sujet verpflichtete Romane publiziert: das bereits erwähnte »Gelächter im Dunkel«, zuerst unter dem Titel »Camera obscura« erschienen – und »Verzweiflung«.
Vielleicht täusche ich mich, aber mir schien, als Grigori den Titel »Verzweiflung« nannte, zunächst nur auf Russisch: »Ottschajanije«, bevor er zum englischen »Despair« wechselte, lag tatsächlich so etwas wie tiefe Verzweiflung auf seinem Gesicht.
Diese Beobachtung – eine wichtige Einzelheit! – wollte ich mir notieren. Als ich meine Papiere umblätterte, rollte mein grüner Bleistift von der Tischplatte und stürzte hinab in die dunkle Tiefe. Zwar hatte ich wie immer eine ganze Kollektion gutgespitzter Bleistifte vor mir liegen, trotzdem, instinktiv tauchte ich sofort ab, ich wollte, nein: ich konnte auf diesen grünen Faber-Castell, meinen treuen Begleiter, mit dem ich die letzten Wochen hier in der Prärie verbracht hatte, auf keinen Fall verzichten. Er lag neben Deborahs schwarzem Absatz.
Interessiert, auch ein wenig erstaunt betrachtete Deborah mich von oben herab. Als ich mit hochrotem Kopf und dem triumphierend in die Höhe gereckten Bleistift wieder auftauchte, beendete Grigori gerade seinen Vortrag. Da er, abgesehen von seinen Zusammenfassungen, Satz für Satz vom Blatt abgelesen und seine Ausarbeitungen dabei dicht vors Gesicht gehalten hatte, während die Lesebrille arbeitslos vor der Brust baumelte, hatte er wahrscheinlich nicht einmal mitbekommen, daß ich kurzzeitig von der Bildfläche verschwunden gewesen war.
Er nahm einen tiefen Schluck Wasser, die Diskussion konnte beginnen.
Zunächst bedankte er sich für unsere Aufmerksamkeit. Bevor wir etwas sagen konnten, merkte er einschränkend an, daß womöglich der mit dem Verlag vereinbarte Titel unglücklich gewählt worden sei: »… im Spiegel seiner Romane«. Dabei seien Nabokovs Romane doch alles andere als nur einfache Abspiegelungen der »Wirklichkeit«, seine Romane wiederholten nicht einfach die Welt, sie schufen völlig neue, einzigartige Welten.
Deborah interessierte sich für das Motiv der Unbehaustheit. Ihr fiel auch gleich »Lolita« ein, und sie erinnerte sich an die endlose Odyssee, die Humbert Humbert und Lolita von Motel zu Motel geführt hatte: Ob man nicht auch darin ein Symbol der Unbehaustheit sehen könne?
Ich hatte sofort das leicht galvanische Zucken in Grigoris Unterkieferbereich bemerkt, doch er sagte nichts. Erst als er ihr antwortete, machte er sie, zwar nur in einem Nebensatz, aber doch unmißverständlich auf diese gängige Verwechslungspraxis aufmerksam: »Nabokov, übrigens nicht zu verwechseln mit Lolita …«
Was er dann im einzelnen sagte, läßt sich etwa so zusammenfassen: Immer, wenn man glaubt, ein gültiges Etikett (»Unbehaustheit«) gefunden zu haben, löst es sich nach einer Weile vom Korpus des lebendigen Werkes, fällt als welkes Altpapier zu Boden und wird vom Wind weggetrieben.
»Das erleben wir übrigens auf beinahe jeder unserer Jahresversammlungen, wirklich, man kann darauf Wetten abschließen: Da gibt es mindestens immer eine einfältige Seele, die, um ihre Halbbildung unter Beweis zu stellen, es irgendwann nicht unterlassen kann – bloß weil Nabokov Lepidopterologe war –, jedem seiner Gedanken unbedingt das blumige Etikett ›Schmetterling‹ anzukleben. Verstehen Sie, was ich meine?«
Stumm nickte Deborah ihm zu, ich notierte mir nachdenklich einen sinnlosen Kringel auf dem Blatt und strich ihn wenig später unauffällig durch.
Grigori fixierte Deborah. Für ein facettenreiches Gesamtbild sei es daher unerläßlich, gerade auch den frühen, oft weniger bekannten, russischen Nabokov gründlich zu betrachten, den Roman »Verzweiflung« zum Beispiel, mit dem er sich gerade beschäftige und der ihm erhebliches Kopfzerbrechen bereite. Ein Sonderfall übrigens auch insofern, als im Unterschied zu anderen Romanen sich in diesem Fall tatsächlich relativ genau der Schauplatz der Handlung lokalisieren lasse: nämlich an einem kleinen See im Südosten Berlins.
Stechend richtete sich beim Stichwort »Berlin« sein graublauer Blick auf mich, automatisch nickte ich, obwohl ich mich an Einzelheiten dieses Romans nicht mehr erinnerte.
Sicher, ich mußte ihn irgendwann einmal, wie alle Romane Nabokovs, gelesen haben. Der Berlinbezug war mir damals nicht aufgefallen, und daß ein Teil der Handlung im Umland Berlins gespielt haben sollte, das hatte ich wohl einfach überlesen.
Dort, im Südosten Berlins jedenfalls, hatten Nabokov und seine Frau Véra von den Resthonoraren aus »König Dame Bube« eine Anzahlung auf ein kleines Stück Land gemacht, auf dem sie später eine Datscha bauen wollten. Die Landschaft (See, Kiefern und, vor allem, die Birken) hatte sie an die Umgebung St. Petersburgs erinnert. In der »Behaustheit der Natur«, wie Grigori es ausdrückte, vollendete Nabokov auch »Lushins Verteidigung«, ein Buch, von dem Véra am 26. Juli 1929 in einem Brief an ihre Schwiegermutter, die von einer kleinen Rente der tschechischen Regierung in einem Prager Vorort lebte, berichtet hatte: »Die russische Literatur hat dergleichen noch nicht gesehen.« Das Buch wurde kein Erfolg.
Drei Jahre später, als sie das Landstück schon nicht mehr besaßen, sie hatten einige der fälligen Monatsraten nicht überwiesen, bildeten dieser Ort und seine Umgebung immerhin noch die Szenerie für »Verzweiflung«.
»Und wo genau«, wollte ich nun endlich wissen, denn das interessierte mich brennend, »soll denn das gewesen sein?«
Zwar war ich Grigoris Vortrag durchaus mit Interesse gefolgt, nichts hatte gefehlt, nicht einmal – meine Retourkutsche für Grigoris Kritik an den Nabokov’schen Gedankenschmetterlingen machte sich polternd auf den Weg – das in diesem Zusammenhang unvermeidliche »Charlottengrad«, aber erst seit er von dieser Datscha erzählt hatte, war ich hellwach. Schon allein die Vorstellung: der große Nabokov inmitten einer deutschen Kleingarten- oder Laubenpieperkolonie – unvorstellbar!
»Dazu wollte ich später noch gesondert kommen«, sagte Grigori, »ich selbst habe da auch noch einige offene Fragen – speziell an Sie. Jetzt vielleicht erst einmal grundsätzliche Bemerkungen, die von allgemeinem Interesse sind.«
Vielleicht, so vermutete Grigori, brauchte Nabokov gerade im Fall von »Verzweiflung« einen Anhaltspunkt, mußte er sich von einer speziellen landschaftlichen Umgebung inspirieren und den dunklen oder vielmehr dunkelgrünen genius loci auf sich wirken lassen, einfach, um Boden unter den Füßen zu behalten – denn in diesem Roman war er zum ersten Mal mit der Aufgabe konfrontiert, sich in die Wahnwelt eines absoluten Psychopathen und späteren Mörders, des Deutschrussen Hermann Karlowitsch, hineinzuversetzen. »Stellen Sie sich vor, wie unendlich schwierig das ist: ›Verzweiflung‹ ist aus der Sicht des Mörders erzählt!«
Zwar interessierte mich, seit Grigori das erwähnt hatte, eigentlich nur noch, wo genau sich dieses Grundstück der Nabokovs befunden hatte, doch ich wollte den allgemeinen Gang der Diskussion nicht stören, und so versuchte ich nun, eine Verbindung zwischen dem, was Deborah gesagt hatte, und dem frühen, russischen Nabokov herzustellen. Da ich bis auf meine Zwischenfrage noch nichts zur Diskussion beigesteuert hatte, fand ich, war das jetzt an der Zeit.
»Ich möchte, wenn es erlaubt ist, einige Worte zu ›Der Zauberer‹ sagen.«
Grigori schloß die Lider halb, er nickte.
Diese Erzählung, »der erste Pulsschlag Lolitas«, wie Nabokov einmal bekannt hatte, gehörte noch zur russischen Periode seines Schaffens, entstanden war sie 1939 in Paris, wurde aber schon nicht mehr auf Russisch veröffentlicht, erst viele Jahre später, nach Nabokovs Tod, erschien 1986 eine englische Übersetzung.
»Ich behaupte«, behauptete ich, »wer ›Der Zauberer‹ nicht kennt, kennt auch ›Lolita‹ nicht.«
Schon bei verschiedenen Gelegenheiten hatte ich mit diesem Gongschlag einer kühnen These für Sprachlosigkeit und Verblüffung gesorgt – Kunststück!, kaum jemand kennt diesen schmalen Text, kaum jemand konnte mir da also ernsthaft widersprechen.
Selbst Grigori, der Experte, nickte nachdenklich.
»Fernab vom amerikanischen Motel-Ambiente des späteren ›Lolita‹-Romans«, fuhr ich fort, »entfaltet diese knappe, diese scheinbar ort- und zeitlose Geschichte das Archetypische der ungleichen Mann-Mädchen-Beziehung.«
Ich registrierte, daß Deborah sich eine Notiz dazu machte, ganz bewußt hatte ich ihr mit der Ort- und Zeitlosigkeit einen Ball zugespielt, den sie, falls sie Lust dazu hatte, bequem Richtung »Unbehaustheit« verlängern konnte.
»Weiß eigentlich jemand«, fragte ich, »wie Nabokov in ›Der Zauberer‹ die Uhr nennt?«
Grigoris Augenbrauen wanderten in die Höhe. Deborah schaute kurz, ratsuchend, auf ihre Armbanduhr, aber auch sie wußte es nicht. Vor mir auf der Tischplatte saß eine große, schillernde Fliege. Sie rieb sich erwartungsvoll die Hände.
»Er nennt sie … ›Glasauge der Zeit‹.«
Eine luzide Formulierung, die sofort einen beseligten Glanz in Grigoris Augen zauberte, ein feierlich-wehmütiges Schimmern.
Vielleicht bekam Deborah hier zum ersten Mal einen Eindruck davon, wie im Mahlstrom einer überraschenden Metapher des Meisters ein echter Nabokovianer in ungeahnte Tiefen gezogen werden konnte.
»Treffend formuliert«, bestätigte Grigori leise, fast flüsternd, »extrem treffend.«