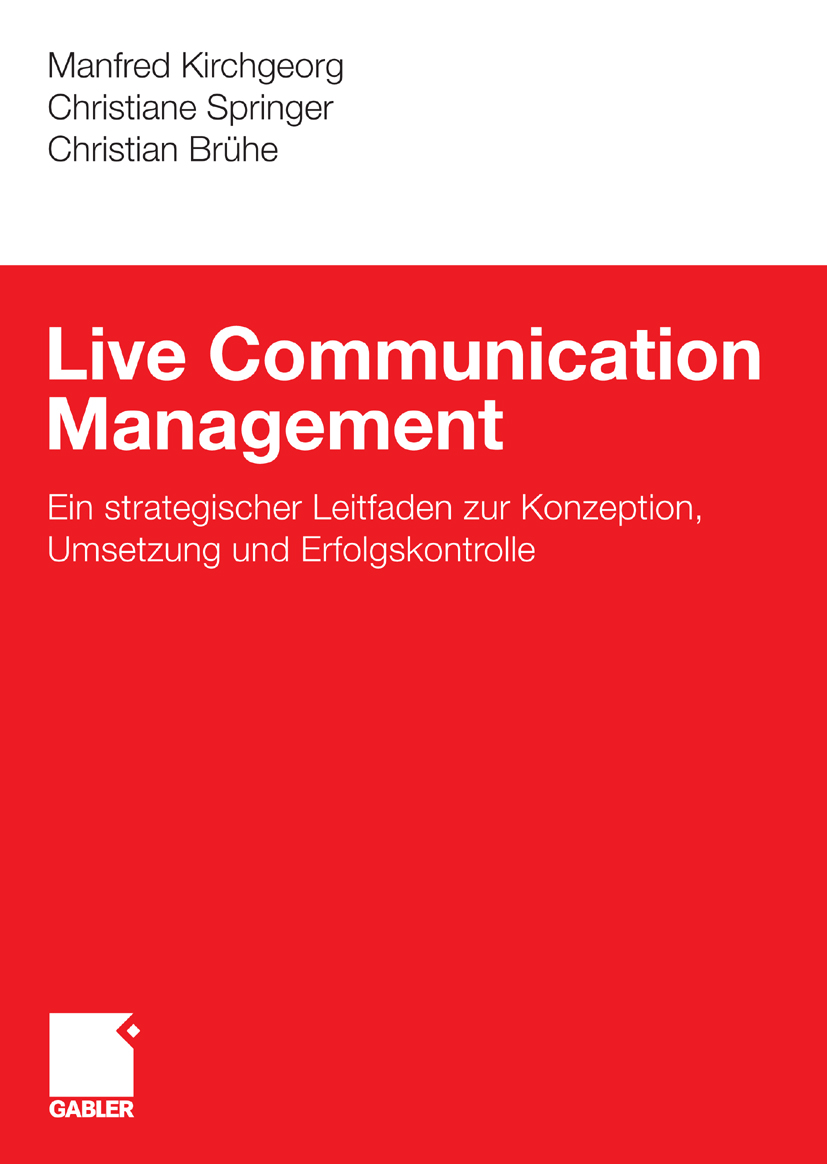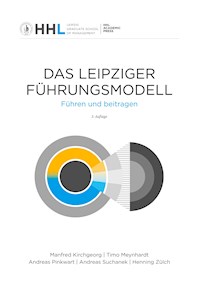
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Leipziger Führungsmodell ist ein mehrdimensionaler Orientierungsrahmen, der sich an Studierende und Führungskräfte richtet. Er kann auf verschiedene Organisationsgrößen und -arten in unterschiedlichen Branchen wie auch in öffentlichen Organisationen angewendet werden. Im Mittelpunkt stehen vier zeitlose Führungsfragen: _ Verfolgen wir ein übergeordnetes Ziel? (Purpose) _ Denken und handeln wir unternehmerisch? (Unternehmergeist) _ Ist unser Handeln legitim? (Verantwortung) _ Sind wir effektiv? (Effektivität) Neu (im Sinne einer Wiederbesinnung) daran ist die konsequente Verknüpfung von Sinn- und Wertfragen mit den strategischen und operativen Aufgaben unternehmerischer Tätigkeit. Mit dem Modell geht auch die Überzeugung einher, wonach es in einer grundsätzlich nicht beherrschbaren Welt darauf ankommt, handlungsfähig zu bleiben und eine Haltung auszubilden, wonach die Führungskraft sich über einen Wertbeitrag und nicht über Status, Wissen oder Macht definiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grußwort des Rektors
zur 3., verbesserten Auflage
In diesem Jahr feiern wir ein Jubiläum: 120 Jahre Handelshochschule Leipzig. Seit der Gründung 1898 stehen wir über die Zeitläufte hinweg für exzellente Aus- und Weiterbildung. Unsere Mission als heutige HHL Leipzig Graduate School of Managament heißt daher auch: „We educate effective, responsible and entrepreneurial business leaders through outstanding teaching, research and practice.“ Diesem hohen Anspruch gerecht zu werden, bedeutet auch, uns selbst immer wieder zu hinterfragen und zeitgemäße Antworten auf die drängenden Herausforderungen der Gegenwart in Forschung, Lehre und Praxis zu entwickeln. Ein Ergebnis dieser permanenten Auseinandersetzung ist das Leipziger Führungsmodell, welches 2016 erstmals veröffentlicht wurde und seither einen wichtigen Platz in unserer Arbeit einnimmt. Mit den im Modell vorgestellten Ideen reagieren wir auf den gestiegenen Orientierungsbedarf zur Frage, was „gute“ Führung eigentlich bedeutet und wollen damit einen Beitrag für die Lehre und Praxis leisten. Wir haben uns mit dem Modell einen Kompass gegeben, der Führungskräften aber auch uns selbst den Weg weisen soll, die „richtigen“ Fragen zu stellen. Verfolgen wir ein übergeordnetes Ziel? Denken und handeln wir unternehmerisch? Ist unser Handeln legitim? Sind wir effektiv? Diese Fragen haben uns auch bei der Formulierung der künftigen Ausrichtung der HHL geholfen. In der heutigen Zeit bringt vor allem der technologische Fortschritt in Gestalt der Digitalisierung neue Chancen und Risiken für Unternehmen, die Gesellschaft und nicht zuletzt für jeden Einzelnen mit sich. Gute Führung bemisst sich mehr denn je an einer Haltung, in deren Zentrum der Mensch und die Auswirkungen auf das größere Ganze stehen. Insofern steht das Leipziger Führungsmodell auch für die Positionierung der HHL, bei der neben der Ausrichtung auf Unternehmertum, der Aufbau und die Vermittlung von Führungsfähigkeiten identitätsstiftend wirken. Mit der vorliegenden Ausgabe des Modells möchte das Kernteam dem Interesse an einer handlichen Version nachkommen, in der die deutsche und englische Ausgabe separat vorliegen. Die Autoren haben die Gelegenheit genutzt, minimale redaktionelle Korrekturen vorzunehmen und in einer neuen Einleitung erste Erfahrungen in Lehre und Weiterbildung zu reflektieren. Daneben wurde die Einbindung des Modells in die Weiterentwicklung des Curriculums aktualisiert. Ich danke herzlich für die geleistete Arbeit dem Kernteam mit Manfred Kirchgeorg, Timo Meynhardt, Dorian Proksch (für den beurlaubten Andreas Pinkwart), Andreas Suchanek und Henning Zülch. Ebenso danke ich Daniela Neumann und Christina Stockmann-Zipfel für die sorgfältige redaktionelle Bearbeitung. Ein besonderer Dank gilt auch unserem Kollegen Christian Strenger, der mit einer großzügigen Förderung diese verbesserte Auflage erst ermöglicht hat.
Leipzig, im Herbst 2018
Prof. Dr. Stephan Stubner
Einführung
zur 3., verbesserten Auflage
Das Leipziger Führungsmodell bewegt – Studierende, Praktiker und die wissenschaftliche Community. Die positive Aufnahme der Modellgedanken seit der Erstvorstellung im November 2016 motiviert uns, weiter intensiv daran zu arbeiten. Im Spannungsfeld von praktischer Relevanz und wissenschaftlicher Begründung suchen wir einen gangbaren Weg, ganz nach dem Motto: „Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie“ (Kurt Lewin). Wir befinden uns aktuell in einer weiteren Lern- und Weiterentwicklungsphase. Die vorliegende Ausgabe enthält daher vor allem nur kleinere redaktionelle Überarbeitungen und liegt nunmehr in getrennten Version auf Deutsch und Englisch vor. Insofern gibt es keine substanziellen Neuerungen zu berichten. Dennoch möchten wir die Gelegenheit für eine erste Reflexion nutzen und auf Fragen eingehen, die uns immer wieder begegnen, im Hörsaal wie im Sitzungssaal. Zunächst und im Bild: Das Modell dient uns als eine Art „Knochengerüst“ guter Führung – alle wesentlichen Grundbausteine sind vorhanden, das „Fleisch an den Knochen“ kommt durch die Praxis und aus den reflektierten Erfahrungen. So notwendig Praxisbeispiele zur Illustration sind, so verführerisch erscheint der Gedanke an eine durchgängige Operationalisierung. Das Leipziger Führungsmodell möchte – und kann – kein fertiges Rezeptbuch sein, aber eben auch keine rein philosophisch-theoretische Abhandlung. Die gesunde Balance zu finden ist eine bleibende Aufgabe.
Beobachtungen und Reflexionen
In der Praxis begegnet uns immer wieder die Frage: „Kann man in der heutigen Zeit überhaupt noch ein Modell verfolgen oder sind nicht eher multiple Ansätze gefragt?“ Wir meinen, unser Modell ist offen genug, um andere Zugänge zu integrieren bzw. Anschlussfähigkeit herzustellen. So beschäftigen wir uns derzeit mit Bezügen zum Design Thinking, Agilität, dem ethischen Grundprinzip „do no harm“ und nicht zuletzt mit systemtheoretischen Überlegungen.
Schnell kommt dann auch die Frage auf, wie unser Modell zu anderen Ansätzen steht, zum Beispiel zum gegenwärtig populären „Start with why“ von Simon Sinek (2009). Unser Modell ist bewusst so angelegt, immer wieder Berührungspunkte zu anderen Zugängen zuzulassen und einen Dialog zu ermöglichen. Jedes Modell lenkt die Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen und muss andere ausblenden. Besonders aktuell ist derzeit der „Purpose“-Gedanke, der gerade von Beratungsgesellschaften stark thematisiert wird und auch bei Sinek dominiert. Gleichzeitig ist die Frage nach der Daseinsberechtigung nicht neu und wurde in verschiedensten Kontexten – vom Start-up bis zum Familienunternehmen –immer wieder aufgeworfen.
Für uns ist die Fokussierung auf den Purpose eine zentrale, aber eben keineswegs die einzige Dimension guter Führung. Erst in der stimmigen Verbindung der einzelnen Anforderungen entsteht das, was als „gute“ Führung wahrgenommen wird. Vor allem vertreten wir eine spezifische Purpose-Idee, wonach sich ein Purpose guter Führung immer auf einen Sinn und Zweck bezieht, der über den eigenen Vorteil hinausgeht und sich an Wertbeiträgen für die Organisation und – nicht zuletzt – die Gesellschaft und das Gemeinwohl bemessen lässt. Im Zusammenspiel der Modelldimensionen Purpose, Unternehmergeist, Verantwortung und Effektivität ergeben sich dabei immer wieder Spannungsfelder, aber auch neue Potenziale für Wachstum und Weiterentwicklung.
Mit Blick auf Wirkungen und Wechselwirkungen bringt das Führungsbild des Leipziger Führungsmodells daher besonders die Aspekte Wertbeitrag und Stimmigkeit ein:
Wertbeitrag: Gute Führung bedeutet im Leipziger Führungsmodell, einen Beitrag zu einem größeren Ganzen zu leisten, den Dritte als sinn- und wertvoll erachten, ohne dass legitime Rechte und Ansprüche Dritter verletzt werden. Die Führungsleistung bemisst sich konsequent am Wertbeitrag auf der Ebene des Individuums, der Organisation und der Gesellschaft, d.h. dem Gemeinwohl.
Stimmigkeit (Konsistenz): Im Mittelpunkt steht immer die Frage nach dem Warum und Wozu (Purpose), die dann mit dem Was (Effektivität) und dem Wie (Verantwortung, Unternehmergeist) in Bezug gesetzt werden. Erst aus der Stimmigkeit im Zusammenwirken entsteht Glaubwürdigkeit als Einheit von Wort und Tat, die sich wiederum positiv auf die Führungsleistung auswirkt.
Das Neue
Neu an unserem Modell (im Sinne einer Wiederbesinnung) ist die konsequente Verknüpfung strategischer und operativer Aufgaben unternehmerischer Tätigkeit mit Sinn- und Wertfragen. Dies ermöglicht einen ganzheitlicheren Zugang zur Analyse und Gestaltung von komplexen Führungskontexten und strategischen Positionierungen.
Mit dem Modell geht auch die Überzeugung einher, wonach es in einer grundsätzlich nicht beherrschbaren Welt darauf ankommt, handlungsfähig zu bleiben und eine Haltung auszubilden, die sich über einen Wertbeitrag und nicht über Status, Wissen oder Macht definiert. Umgekehrt bietet das Modell eine Vorstellung, dem eigenen Status, dem Wissen oder der Macht einen Sinn zu geben.
In der Fokussierung auf fundamentale Kerndimensionen und deren Beziehungsgeflecht entsteht für uns eine Perspektive auf Führung, die in der Praxis immer wieder anzutreffende und in der wissenschaftlichen Debatte reflektierte Fragestellungen in einem heuristischen Modell bündelt. Als solches möchte das Modell Orientierungswissen statt Rezeptwissen vermitteln und stellt auf individueller, organisationaler und gesellschaftlicher Ebene vier Führungsfragen, die im Zusammenhang betrachtet werden:
Purpose
Warum?
– Verfolgen wir ein übergeordnetes Ziel?
Unternehmergeist
Wie?
– Denken und handeln wir unternehmerisch?
Verantwortung
Wie?
– Ist unser Handeln legitim?
Effektivität
Was?
– Sind wir effektiv?
Immer wieder berichten Studierende und Praktiker, wie ihnen das Modell helfe, ihre eigene Führungssituation zu analysieren und die verschiedenen Perspektiven im Unternehmen in einen Kontext zu stellen. Positiv überrascht sind wir auch, mit welcher Kreativität die Studierenden mit dem Modell umgehen. In einer Lehrveranstaltung wurden zum Beispiel Erklärvideos erstellt, in denen das Modell „in Szene gesetzt“ wurde. Einmal war es die Begleitung eines jungen Mannes auf seiner Suche nach geeigneten Führungsprinzipien. In einem anderen Video wurde der Bogen weit geschlagen: von der innovativen Start-up Szene in unserem Spinlab (Accelerator für junge Unternehmen in der Leipziger Baumwollspinnerei) bis hin zur friedlichen Revolution von 1989, die in Leipzig begann.
Rollen- und Menschenbild
Mit dem Leipziger Führungsmodell wird insgesamt ein Rollenbild der Führungskraft, aber auch einer Organisation akzentuiert, in dem der jeweils geleistete Beitrag zum größeren Ganzen zum Maßstab guter Führung erhoben wird. Damit knüpfen wir an Traditionen in der Führungsforschung an, die das Motiv des Dienens und Beitragens als Legitimations- und Motivationsressource betonen, Peter Drucker, Chester Barnard und Philip Selznick. Zur aktuellen Forschung ergeben sich daher besondere Bezüge zum Ansatz des Servant Leadership und zum Konzept der transformationalen Führung, wie sie von James MacGregor Burns angeregt wurde. Innerhalb einer systemtheoretischen Perspektive steht das Modell u.a. in der Denktradition von Russell Ackoffs Ansätzen über die Gestaltung zweckgerichteter Systeme („on purposeful systems“) und dem Konzept des soziotechnischen Systems nach Frederick Edmund Emery und Eric Lansdown Trist.
In vielen unseren Diskussionen zeigt sich über die sozialwissenschaftliche Theoriebildung hinaus insgesamt eine hohe Anschlussfähigkeit des Modells an Ideen der europäischen Geistes- und Kulturgeschichte zur Rolle der Wirtschaft in der Gesellschaft, zum Umgang mit Macht und individueller Verantwortung und nicht zuletzt zu den Möglichkeiten und Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit und Kreativität.
Das von uns vertretene Menschenbild ist geprägt von gegenseitigem Respekt und dem Recht auf persönliche Freiheit und Partizipation. Dahinter steht der normative Ausgangspunkt, wonach es eine große zivilisatorische Errungenschaft ist, dass in einer freiheitlichen Ordnung die Menschen sich ihre Zwecke selbst setzen können und diese nicht von oben herab verordnet werden. Denn: Ohne einen breiten Konsens über die Voraussetzungen einer funktionierenden Gesellschaft kann diese nicht überleben und der Einzelne sich nicht entwickeln. Dies lässt sich auch auf Unternehmen und andere Organisationen übertragen, die eine „license to operate“ benötigen, um dauerhaft wirksam sein zu können.
Das Modell thematisiert ganz bewusst das Spannungsfeld von Abhängigkeit und Freiheit, in welchem Führung stattfindet.
Der Einzelne als handelndes Subjekt ist gleichzeitig nicht nur selbst Produkt des Handlungskontextes, sondern erfährt durch diesen auch Beschränkungen, die es zu beachten gilt. Damit wird eine systemtheoretisch inspirierte Perspektive eingenommen, bei der komplexe Interaktionen zwischen unterschiedlichen Akteursebenen (Individuum, Organisation, Gesellschaft) angenommen werden.
So gesehen wird Führung ermöglicht und zugleich begrenzt durch den Rahmen (gesellschaftlicher) Kontinuitäten und Innovationen. Führungsarbeit und Führungsleistung erfüllen immer auch eine gesellschaftliche Funktion (Drucker, 1973) und können daher weder auf die Interaktion zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern noch auf die erfolgreiche Unternehmensführung reduziert werden.
Diese Gedanken erscheinen uns besonders wichtig, um neuere Ansätze von Agilität, Holokratie oder auch Design Thinking einordnen und bewerten zu können.
Ausblick
In den Lehrveranstaltungen „arbeiten“ die Studierenden mit dem Modell: Sie analysieren und vergleichen den Leipziger Ansatz mit den etablierten Theorien in der Führungslehre und zeigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. Man darf vermuten, dass diese intensive Auseinandersetzung auch eine gewisse Sättigung bewirken kann, wenn immer wieder Bezüge zum „Hausmodell“ hergestellt werden.
Wir sehen allerdings die damit verbundene Reflexion eigener Haltung und individuellem Habitus als wesentlichen Impuls für die eigene Persönlichkeitsentwicklung über die Wissensvermittlung im engeren Sinne hinaus. Es geht um Führung mit Haltung.
Ganz im Sinne der eigenen Modelllogik soll und muss das Modell aber auch beweglich bleiben und weiterentwickelt werden. Dazu gehören nicht nur interne Differenzierungen und Konkretisierungen, sondern grundsätzliche Überlegungen: In welcher Form können wir den jeweiligen Kontext der Führungsarbeit besser einbeziehen und die umgebenden Systemdynamiken erfassen? Wie kann der Prozesscharakter von Führung durchschaubarer gemacht werden? Wie kann dem interdisziplinären Charakter des Modells Rechnung getragen werden, ohne alles mit allem in Verbindung zu bringen? Auf der Suche nach Antworten gilt für uns das Einstein’sche Prinzip: „Man soll die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher.“
Wo geht die Reise hin? Das Modell ist mittlerweile fester Bestandteil des Curriculums in allen Studiengängen der HHL Leipzig Graduate School of Management.
In der offenen Gesprächsreihe Leipzig Leadership Talk, welche sich an Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Kultur richtet, diskutieren wir seit Februar 2018 mit renommierten Fachleuten neueste Entwicklungen zum Thema Führung vor dem Hintergrund des Modells. Im Forschungsalltag werden unterschiedlichste Fragestellungen in Masterarbeiten und Dissertationen verfolgt. Dazu gehört u.a. auch die Entwicklung von Diagnoseinstrumenten zur Standortbestimmung ganzer Organisationen und zur Analyse individueller Führungsqualität. In unseren Weiterbildungsangeboten für Führungskräfte aller Ebenen in Unternehmen, Vereinen, aber auch der öffentlichen Verwaltung werden diese Erkenntnisse intensiv genutzt. Dabei ergeben sich immer wieder auch spannende Diskussionen und Bewährungsproben für das Modell. Wir greifen daraus erwachsende Impulse auf und möchten das Modell kontinuierlich entwickeln. Sie sind als Leser und Leserin herzlich eingeladen, daran mitzuwirken.
Das Kernteam des Leipziger Führungsmodells
Grußworte
zur 1. und 2. Auflage
Dr. Tessen von Heydebreck
Vorsitzender des Aufsichtsrats der HHL, u. a. Vorsitzender des Kuratoriums der Deutsche Bank Stiftung, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Postbank AG
Führung ist täglich Brot
Vom Mitarbeiter bis zum Konzernvorstand wird jeder Einzelne in seinem Tätigkeitsfeld beständig mit einer Vielzahl von Führungsaufgaben konfrontiert und bleibt dabei zugleich in seiner gesamtgesellschaftlichen Einbindung in vielen anderen Bereichen stets von der Führung anderer abhängig.
Gute Führung ist in diesem Sinne ein substanzielles Bindeglied gelungenen menschlichen Zusammenlebens und stellt nach wie vor ein hohes Gut dar, dessen Erschließung einerseits persönlichen Einsatz, Erfahrung und Charakter erfordert, andererseits aber auch der äußeren Orientierung und Reflexion bedarf, um in den verschiedensten Kontexten situativ angemessene und gleichermaßen nachhaltige Entscheidungen zu treffen.
Mit dem Leipziger Führungsmodell wird nun ein Konzept vorgelegt, das sich den Herausforderungen unserer Zeit stellt und im Spannungsfeld politischer Instabilität und gesellschaftlichen Wandels zu einem ganzheitlichen Führungsverständnis an regt. Komplementär zu etablierten systemischen Managementmodellen stellt das Leipziger Modell dabei wieder das Individuum in den Mittelpunkt und versteht sich als wissenschaftlich fundierte Orientierungshilfe, die der einzelnen Führungskraft in ihrem spezifischen Aufgabenbereich einen theoretischen Leitfaden zur gezielten Umsetzung effektiver Führungskompetenzen bietet.
Unternehmerischer Optimismus und verantwortungsvolles Handeln sind dabei zentrale theoretische wie praktische Richtwerte, die auf individueller wie gesamtgesellschaftlicher Ebene über die erfolgreiche Realisierung zukunftsweisender Potenziale unserer Gegenwart entscheiden. Mit dem in vorliegender Publikation eingeführten Leipziger Führungsmodell ist ein wegweisender Schritt in diese Richtung getan.
Die HHL Leipzig Graduate School of Management ist dabei in besonderem Maße nicht nur ihren überaus engagierten Wissenschaftlern und Mitarbeitern, sondern auch den Mitgliedern der Gremien zu großem Dank verpflichtet. Wertvolle Hinweise und konstruktive Kritik aus den Reihen von Aufsichtsrat, Kuratorium und Gesellschafterversammlung haben den akademischen Fokus um wichtige Impulse aus Wirtschaft und Politik ergänzt und unterstreichen die interdisziplinäre und dialogorientierte Ausrichtung eines innovativen neuen Führungskonzepts, das auf ständige Fortentwicklung ausgelegt ist und dabei Ihrer steten Anregungen und Kritik bedarf. In diesem Sinne ist dem Modell ein produktiver diskursiver Austausch und erfolgreicher Weg in die Praxis täglicher Führung zu wünschen.
Dr. Tessen von Heydebreck