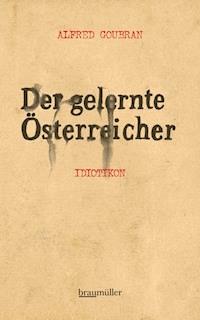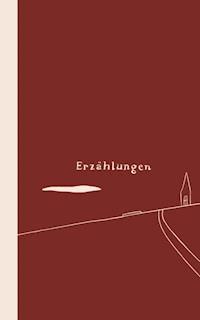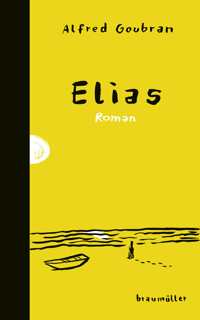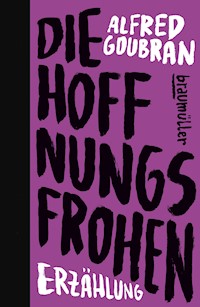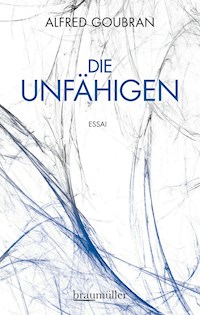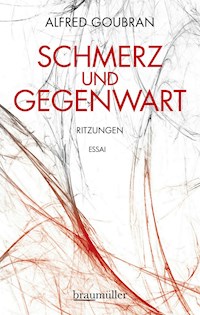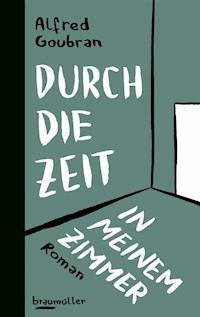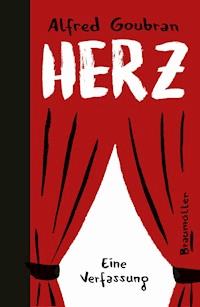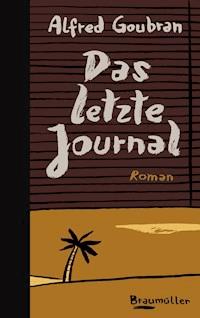
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Alles noch einmal in die Hand nehmen. Ein letztes, ein allerletztes Journal schreiben. Dann das Buch zuklappen und alles, was man darin aufgezeichnet hat, vergessen." Wien, Herbst 2008. Nach 41 Jahren begegnet der Schriftsteller Aumeier seiner Jugendliebe Terése wieder und zieht auf ihr Anwesen, wo er beginnt, sein Journal zu schreiben. Er erfährt die Ursache für ihre gewaltsame Trennung und sieht sich in der Gestalt des alten Schwarzkoglers mit einem mächtigen Gegenspieler konfrontiert. Das letzte Journal ist ein in sich abgeschlossenes Buch. Es verweist jedoch auch auf Goubrans bisher erschienene Romane und wirft ein neues Licht auf die fragwürdigen Umstände von Aumeiers Tod (AUS.) und seine Beziehungen zum "Schwarzen Schloß" (Durch die Zeit in meinem Zimmer).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Alfred Goubran * Das letzte Journal
Alfred Goubran
DasletzteJournal
Roman
Der Text basiert auf den Regeln der sogenannten „alten deutschen Rechtschreibung“. Abweichungen und Eigenheiten in Aumeiers Manuskript – etwa die Schreibung des Namens Terése – wurden, wo es sich nicht um offensichtliche Fehler handelte, beibehalten, Unterstreichungen kursiv gesetzt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Photokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
1. Auflage 2016
© 2016 by Braumüller GmbH
Servitengasse 5, A-1090 Wien
www.braumueller.at
Covergestaltung: Nicolas Mahler
ISBN Printausgabe: 978-3-99200-133-0
ISBN E-Book: 978-3-99200-134-7
für Terése
Inhalt
Sonntag, 30. November 2008
Mittwoch, 3. Dezember 2008
Freitag, 5. Dezember 2008
Montag, 8. Dezember 2008
Mittwoch, 10. Dezember 2008
Donnerstag, 11. Dezember 2008
Freitag, 12. Dezember 2008
Sonntag, 14. Dezember 2008
Montag, 15. Dezember 2008
Dienstag, 16. Dezember 2008
Mittwoch, 17. Dezember 2008
Donnerstag, 18. Dezember 2008
Freitag, 19. Dezember 2008
Samstag, 20. Dezember 2008
Sonntag, 21. Dezember 2008
Montag, 22. Dezember 2008
Dienstag, 23. Dezember 2008
Donnerstag, 25. Dezember 2008
Sonntag, 28. Dezember 2008
Montag, 29. Dezember 2008
Dienstag, 6. Jänner 2009
Mittwoch, 7. Jänner 2009
Montag, 12. Jänner 2009
Dienstag, 13. Jänner 2009
Donnerstag, 15. Jänner 2009
Sonntag, 15. Februar 2009
Dienstag, 17. Februar 2009
Mittwoch, 18. Februar 2009
Donnerstag, 19. Februar 2009
Freitag, 20. Februar 2009
Sonntag, 22. Februar 2009
Montag, 23. Februar 2009
Dienstag, 24. Februar 2009
Mittwoch, 25. Februar 2009
Montag, 9. März 2009
Sonntag, 22. März 2009
Mittwoch, 25. März 2009
Dienstag, 31. März 2009
Samstag, 4. April 2009
%
Montag, 6. Juli 2009
Alfred Goubran
Sonntag, 30. November 2008
Ich muß die Augen nicht schließen, um meinen Traum zu erinnern. Alles ist gleichzeitig da, ohne sich zu stören: die schreibende Hand, die flüsternde Stimme, der Nachtschatten der Bäume, aus dem die Männer, einzeln oder in kleinen Gruppen, auf die mondhelle Lichtung hinaustreten. Glasig der Blick. Trunken. Unförmige Gestalten, die Körper mit Mänteln und Jacken verhangen, breitkrempige Hüte und Pelzkappen auf den Köpfen. Die Knüppel und Keulen in ihren Händen sind mit Eisennägeln gespickt, die Holzstöcke und Stangen an den Enden zugespitzt. Bauernlanzen.
Jeschek führt sie an. Mit beiden Händen hält er den Kriegshammer, hebt ihn hoch, gibt das Zeichen. Keuchend und schnaubend stürmen die Männer den Hügel hinab, fallen in den Kirschgarten ein, hasten das Teichufer entlang. Erst am Kiesweg halten sie an. Ein ungeordneter Haufen. Zwanzig, vielleicht dreißig Mann. Sie recken die Schnauzen in die Luft, nehmen Witterung auf. Dann marschieren sie los, zögerlich zuerst, verhalten. Ein rhythmisches Scharren, das sich Schritt um Schritt den Gebäuden zu gräbt …
Sie haben den Weg zum Treibhaus eingeschlagen. Dort brennt nur mein Licht. Das gelbe, warme Licht der Leselampe. Eine Kerze in dieser Nacht. Ich sitze auf meinem Pfauenthron, ein Buch auf dem Schoß, lausche, horche, halte den Atem an, den chinesischen Beistelltisch im Blick, die Teekanne, die durchscheinenden Tassen … Wie zerbrechlich das alles ist (denke ich jetzt). Dieser Raum, der um mich gewachsen ist … mein Orchideenzimmer … die Wände aus Blumengestellen improvisiert. Blütenwände. Stark duftende Orchis. Zitrone, Zimt, Vanille. Der Geruch von frisch geschälten Mandarinen. Die Blütenköpfe erinnern an Nachtfalter, Seesterne, andere an Kristalle. Verwirrende Vielfalt. Aus dem Überfluß geschöpft. Keine der Pflanzen kenne ich mit Namen. Die Zeiten, als ich noch mit einem Bestimmungsbuch durch die Wälder gegangen bin, die Grammatik der Rosen gelernt und meinen Linné studiert habe, sind lange vorbei. Und wenig ist mir davon im Gedächtnis geblieben.
Heute will ich die Namen nicht mehr wissen, die Systematiken und Ordnungen. Wozu auch? – Man muß kein Architekt sein, um ein schönes Haus zu bewohnen.
Meine Zelle ist nach oben offen, und es ist tatsächlich ein Himmel, der diesen Raum bestirnt, ein echter Wiener Hinterglashimmel, der zu keiner Stunde gleich ist und dessen Licht nicht tief reicht, sodaß ich auch tagsüber der Leselampe bedarf.
Der Lichtmangel stört mich nicht, ich bin ihn gewöhnt. Manche Winter habe ich in dieser Stadt verbracht, ohne ein einziges Mal den Kopf zu heben, die Sonne zu sehen oder den Himmel zu schauen. Das gibt, zumindest im nachhinein, den Geschäftigkeiten und Dringlichkeiten etwas Lächerliches, Niedriges, Gebücktes – wenn man sein Leben derart mit der Nase am Boden verbracht hat, die Augen in Schaufensterhöhe, wenn man nie hochgeblickt und sich mit dem Widerlicht zufriedengegeben hat, ohne ein einziges Mal nach der Sonne zu schauen.
Für das Schreiben ist die Anonymität im Öffentlichen eine bessere Haut, als es die eigenen vier Wände je sein können. Für sich kann man ja nicht anonym sein – namenlos, unbekannt. Immer ist man sich selbst ein Gewesener, Gewordener, ein Leichnam, der wächst, ein Kadaver und ein Grabstein, den man mit sich herumschleppt, immer ist man sich selbst ein Gewicht – ein Gewicht, das schwerer wiegt, wenn man alleine ist und etwas Lebendiges in die Welt bringen will, eine Gegenwart, etwas, das noch nicht ist, und die Sätze und Worte, wie Geröll aus einem herauspurzeln, weil man selbst nur eine einzige Versteinerung ist. Doch wenn das Schreiben glückt, spielt es keine Rolle, woraus es seinen Anfang genommen hat.
Im Januar habe ich mir von Muschg eine Wohnung in der Währinger Straße als Arbeitsraum gemietet. Die Nordfront der Mansarde ist verglast und bietet eine schöne Aussicht in die Höfe und über die Dächer der angrenzenden Häuser. Ich genoß dort die Abendstimmungen, die Übergänge vom Tag zur Nacht, wenn unten in den Straßen und tiefergelegenen Stockwerken die ersten Lichter angehen, der Lichthof verschattet, während sich oben die Taghelle ausdünnt, der Himmel erblaßt und das Bleiweiß der Wolken zu grauen Schlieren und dunstigen Nebelbänken zerfließt. Der Tag versickert, die Bilder werden porös, das Raster gröber. Dann hebt man den Kopf und stellt verwundert fest, daß es dort oben schon Nacht geworden ist. Den Übergang bekommt man nie in den Blick.
Seltener waren die Tage, an denen die Sonne schien, ein Abendrot im westlichen Fenster den Himmel färbte oder ein prachtvoller Sonnenuntergang: ein Feuer, das sich irgendwo hinter den Häusern entzündet, sein orangeroter Widerschein, der langsam die Fassaden hochkriecht, Glutnester und Flammenzungen an den Dachfirsten, die in die Weite des Himmels auflodern, während es ringsum schon Nacht ist und sich im Nordwesten, hoch über der Stadt, die ersten Sterne zeigen.
Ich hatte gedacht, die kleine Dachwohnung in der Währinger Straße wäre ideal zum Schreiben – ein Adlerhorst, viel Licht, keine Erinnerungen, keine Bücher … – doch rückblickend muß ich feststellen: Ich habe dort keinen Satz geschrieben, der hält.
Immerhin wurde in dieser Zeit das Café Stadelmann mein Stammcafé und, einige Häuser weiter, die Buchhandlung Bartalszky zu meinem zweiten Wohnzimmer. Das möchte ich nicht missen. Eine Zeitlang führte ich das Leben eines Pensionärs. Morgens frühstückte ich im Stadelmann, querte die Straße, stieg die fünf Stockwerke in das Mansardenzimmer hoch, schlug zwei, drei Stunden mit Schreibversuchen tot, stieg die fünf Stockwerke wieder hinab, querte die Straße, schaute zu einem Plausch in der Buchhandlung vorbei, querte die Straße, stieg die fünf Stockwerke wieder hoch, korrigierte an den Schreibversuchen vom Vortag herum, sichtete, ordnete, bis zumindest ein gewisser Grad an Zufriedenheit erreicht war, stieg dann die fünf Stockwerke wieder nach unten, querte die Straße und betrat das Café Stadelmann, um dort zu Mittag zu essen. – Der Schriftsteller-Vormittag war abgearbeitet und ich in den Nachmittag entlassen. Und so tagaus, tagein, die Wochenenden ausgenommen. Manchmal war ich von der Sinnlosigkeit dieser Kreisgänge so erschöpft, daß ich gar nicht mehr herausfand und bis in die Abendstunden hinein zwischen Buchhandlung, Café und Mansardenzimmer hin und her irrte.
Drei- oder viermal traf ich Muschg, ohne mich mit ihm verabredet zu haben, im Stadelmann, wo er mich mit seinen Geschichten vom Theater und Indiskretionen aus dem Betriebsbüro und der Direktion langweilte. Ich denke auch, daß er mir auflauerte. Diese Begegnungen waren mir unangenehm und erschienen mir jedesmal wie ein böses Omen dafür, daß ich aus meiner Währinger-Straßen-Situation, nie mehr herausfinden würde. Solche Befürchtungen waren mir neu. In schwierigen, ja unhaltbaren Lebenssituationen hatte bei mir stets die Neugier überwogen.
Ich mußte mich bei Muschg angesteckt haben.
Ein Sackgassenmensch.
Ich beschloß, ihn künftig zu meiden.
Also halte ich die Stellung. Steige Tag für Tag die Stiegen hinauf und wieder hinunter. Treppauf, treppab. Die Zeit scheint stillzustehen. Ich begegne niemandem, den ich nicht schon kenne, sage, denke und schreibe nichts, was ich nicht schon hundertmal gesagt, gedacht oder geschrieben habe. Die Welt hat auf mich vergessen, und ich mache keinen Versuch, etwas daran zu ändern, schreibe keine Briefe, rufe niemanden an. An trüben Tagen ist die Versuchung groß, wieder einmal zum Zentralfriedhof hinauszufahren. Die Währinger Straße ist eine Wüstenei, in der man den Frühsommer nur erahnen kann. Vor dem Institut Français stehen ein paar Bäume. Die Hinterhöfe sind kahl. Das wenige Grün auf den Balkonen könnte auch Plastik sein. Ich habe dort ohnehin noch nie einen Menschen gesehen.
Als ich mich Anfang Juni, nach einem Wochenende zu Hause, montags wieder zum Dienst in der Währinger Straße einfinde, ist die Eingangstür des Café Stadelmann verschlossen. Durch verdreckte Fenster spähe ich in den Gastraum: Der Boden ist aufgerissen, Reste der Holzverkleidung hängen von den Wänden. Lose Kabel. Ein Heizkörper lehnt unter der Fensternische. Dazwischen Kübel und Schutthaufen. Ich trete einen Schritt zurück: Über die ganze Länge der Hausfront prangt ein rechteckiges Plastikschild. „Zum goldenen Drachen“ steht darauf zu lesen, rot auf blattgrünem Grund, dazu in Goldfarbe irgendwelche chinesischen Schriftzeichen. Ich bin ratlos, finde mich kurze Zeit später in der Buchhandlung Bartalszky wieder. Die Besitzerin lotst mich nach hinten, in eine Art Lagerraum. Auf einem kleinen Campingtisch steht eine Tasse Kaffee, und zwei Croissants liegen daneben auf einer Papiertüte.
„Bitte“, sagt sie, und: „Wie wollen Sie Ihren Kaffee – mit Milch?“
Ich verneine.
„Heute sind Sie früh.“
„Ja. – Das Stadelmann hat geschlossen.“
Sie schien nicht zu verstehen.
„Das Café Stadelmann, hier gleich um die Ecke.“
„Ah, da war ich noch nie.“
„Ja. Einfach zu. Ausgeräumt. Weg.“
„Stört es Sie, wenn ich rauche?“
„Ich habe dort jeden Tag gefrühstückt.“
Sie zündet die Zigarette an, inhaliert, hält den Rauch in den Lungen, die Augen geschlossen, dann atmet sie aus, lächelt mich an: „Einen Kaffee, Herr Aumeier, können Sie bei mir immer bekommen.“
Ich nahm das Angebot an. Statt im Café Stadelmann frühstückte ich von nun an in der Buchhandlung Bartalszky. Und für das Mittagessen wählte ich das Hotel Regina, ein schönes Haus im Schatten der häßlichen Votivkirche, mit leicht überambitioniertem Management, internationaler Speisekarte und kleinen Portionen auf übergroßen Tellern. Dort konnte man auch im Freien sitzen.
In jener Nacht träumte mir, daß ich, aus dem Haupttor des Zentralfriedhofs tretend, plötzlich vor dem Café Stadelmann stand und im Vorbeigehen durch die Fenster mich selbst an einem der Tische erblickte.
In alten Büchern heißt es: Wer seinem Doppelgänger begegnet, wird nicht mehr lange leben. – Gilt das auch für den Doppelgänger?
Die Lähme hielt an. Alles blieb ruhig und ich in meiner fruchtlosen Routine ungestört.
Mitte Juni überlegte ich mir zum ersten Mal ernsthaft, die Wohnung aufzugeben. Der Grund: heftige Schmerzen im Knie, die mich von einem Tag zum nächsten, ohne ersichtlichen Anlaß, heimsuchten. Vielleicht wegen des vielen Treppensteigens oder weil mein Arbeitstisch in der Währinger Straße zu nieder war. Bald konnte ich nur noch humpeln. Eisbeutel verschafften mir kurzfristig Linderung. Ich nahm Parkemed, weil ich eine Entzündung vermutete, und machte mir Umschläge aus Heilerde. Einen Arztbesuch wollte ich so lange wie möglich hinauszögern, da ich nicht versichert war. Das Treppensteigen wurde mir zur Qual. Egal ob hinauf oder hinunter, ich schaffte die fünf Stockwerke nicht, ohne mindestens drei Pausen einzulegen. Oben erwartete mich eine weitere Schikane: Die Mansarde, begünstigt durch die mangelnde Isolierung, heizte sich an warmen Tagen derart auf, daß schon zur Mittagsstunde an kein Bleiben mehr zu denken war.
Da ich es wegen meines lädierten Knies weder lange am Tisch noch, wegen der Hitze, lange auf dem Bett aushalten konnte, improvisierte ich mir ein Lager auf dem schmalen verfliesten Streifen vor der Spüle. Dort arbeitete ich an den heißen Tagen. Die Kühlschranktür ließ ich offen.
Die Schwellung am Knie klang ab, nach zehn Tagen bereitete mir das Auftreten keine Schmerzen mehr.
Anfang Juli wurde das Haus eingerüstet und schweres Arbeitsgerät in den Hof geschafft. Zwei mangogelbe Container, bei denen ich lange rätselte, ob es Schlaf- oder Werkzeugcontainer waren, entpuppten sich als Bestandteile einer einzigen Maschine, deren Funktion, abgesehen von der Lärmerzeugung, sich mir nicht erschloß. Ein Container schien der Tank zu sein, der andere beherbergte die Technik. Dort war ein Arbeiter unentwegt mit der Bedienung dreier Hebel beschäftigt – zumindest jedesmal, wenn ich in den Hof sah. Manchmal hatte das Einfluß auf den Lärmpegel, manchmal nicht. Ich schrieb auf einer Baustelle. Die Tauben vertrieb es nicht.
An neuen Texten zu arbeiten, hatte ich unter diesen Umständen bald aufgegeben und mir zuerst die Pariser Tagebücher aus den 80er Jahren mitgenommen, um sie für eine Veröffentlichung zu prüfen. Gut war, daß die Einträge kaum Persönliches enthielten, doch störte mich selbst noch die Chronologie – das war mir zu nahe an meinem Leben. Ich begann mit mathematischen Modellen zu experimentieren, Spielereien, bis ich eine Methode fand, nach der ich die Einträge neu ausrichten konnte.
Inhaltliche Ordnungen und Zusammenhänge interessierten mich, wiederkehrende Sequenzen, Rhythmen und Bildfolgen, die ich dem Nacheinander der Datumsangaben als System unterlegte. Es ist ein Spiel geworden. Mit eigenen Regeln. Und ich nehme es immer wieder gerne zur Hand.
Weniger glücklich war ich bei einem anderen Text, der die Verbrechen der Familie Höller während der Kriegszeit zum Thema hatte, die Aufdekkung der Zustände in einem Entbindungsheim für Zwangsarbeiterinnen, das von den Glaswerken Höller betrieben worden war. Eigentlich ein Kriminalfall, den ich als Bericht einer Recherche angelegt und vorläufig mit OMERTA betitelt hatte, ohne zu ahnen, daß dieser Titel auch für mein Schreiben Programm sein würde, denn das Schweigen wuchs, je mehr ich recherchierte, je mehr ich an Fakten und Informationen anhäufte. Etwas ging bei diesen Aufzählungen verloren, wurde von den Tatsachen verdrängt und von der Betroffenheit, die sie in mir auslösten, erstickt. Was mir erkennbar war, faßbar wurde, deutete auf anderes hin, das in seinem vollen Umfang nicht gesagt werden konnte – was ich an Furchtbarkeiten auch aufdeckte, es minderte nur das Grauen, das diesen Furchtbarkeiten zugrunde lag und das seinem Wesen nach unaussprechlich blieb, vormenschlich. Ein Leviathan.
Im August kamen die Spechte. Scharen von Maurern und Maurergehilfen, die mit kleinen Hämmern an der Fassade herumklopften. Gut möglich, daß sie Nester bauten. Die Sprache, in der sie sich unterhielten, verstand ich nicht (es könnte auch Steirisch gewesen sein).
Mitte August fiel für zwei Wochen das Frühstück in der Buchhandlung aus, da Frau Bartalszky, die Straße auf einem Zebrastreifen bei Grün überquerend, vorschriftsmäßig von einem linksabbiegenden Lastkraftwagen erfaßt wurde (hier fehlt nur ein Komma, aber es gefällt mir so. Wer weiß, in wessen Auftrag der Fahrer unterwegs war).
Möglicherweise aus Mitgefühl – die Aushilfe in der Buchhandlung sprach von Verletzungen an der Hüfte und den Beinen – begann mein Knie wieder zu schmerzen. Ich packte meine Heilerde aus, mein Parkemed und meine Eisbeutel, humpelte meiner Wege, bis nach zehn Tagen die Schwellung zurückgegangen war und ich eines Vormittags um elf, vollständig genesen und schmerzfrei, zur Erneuerung unseres Frühstücksarrangements mit einem Blumenstrauß und frischem Schurgebäck in der Buchhandlung Bartalszky erschien, um Frau Bartalszky persönlich mein Bedauern über den Unfall auszusprechen und meine Glückwünsche zur baldigen Genesung zu überbringen.
Ich hätte anrufen sollen. Frau Bartalszky war nicht da, und es würde wohl noch einige Zeit dauern, bis sie wieder ins Geschäft kommen könne, wie mir die Aushilfe mitteilte. Ich gab ihr die Blumen, sie ging nach hinten, um eine Vase zu holen. Jetzt erst bemerkte ich, daß ich nicht der einzige Kunde im Laden war. Vor einem der Regale stand eine Frau und las in einem Buch. Sie trug ein ärmelloses rotes Leinenkleid, die Haare hochgesteckt, die sehnigen braungebrannten Unterarme fielen mir auf, die starken Knöchel an den Fingern – und wie stets bei solchen Begegnungen wanderte mein Blick automatisch zu den Waden, dann wieder hoch, zu ihrem Gesicht …
„Terése …?“
Sie hob nur den Blick, nicht den Kopf, sah mich abschätzend über den Rand der Brille an. Die Aushilfe kam mit der Vase. Terése stellte das Buch ins Regal zurück. Ich bot ihr meinen Arm und hielt die Tür auf. Grußlos verließen wir die Buchhandlung.
Im Hotel Regina aßen wir zu Mittag. Es war nicht der Ort, um über jene Dinge zu sprechen, die uns am Herzen lagen. Ich überlegte, ob ich sie auf mein Zimmer einladen sollte, doch dann fiel mir das Gerüst und der Baulärm ein, und ich erwähnte das Höllenzimmer erst gar nicht. Terése hatte noch in der Stadt zu tun und wir verabredeten uns für den nächsten Tag bei ihr zum Frühstück.
Ich blieb noch eine Weile sitzen. Das Wetter war angenehm lau, lud zu einem Spaziergang ein, doch ich wollte niemandem begegnen und bestellte mir eine Flasche Rotwein. Gestern erst war mir auf der Währinger Straße, Ecke Türkenstraße, der ehemalige Bundeskanzler begegnet. Ein Rattengesicht. Er trug Jeans und Sakko. Zeigte mir die Zähne. Das ist auch nur in Österreich möglich, denke ich mir. Daß so einer am hellichten Tag ohne Leibwächter durch die Stadt marschieren kann. Eine Insel der Seligen – zumindest für die Etablierten. Ich fühlte mich wie festgenagelt an meinen Stuhl, hinter den Thujen. Kein Ort fiel mir ein, an den ich jetzt gerne gegangen wäre, ausgenommen der Zentralfriedhof, doch das war mir zu weit. Der Wein zeigte bald Wirkung. Die trüben Gedanken verloren an Gewicht. Ich ließ mir vom Kellner eine Zigarette bringen. Ich war ganz allein im Gastgarten. Hinter der Thujenhecke rasten die Autos, alle zehn Minuten dröhnte die Straßenbahn vorbei. Ich döste, nickte ein. Der Kellner weckte mich, murmelte etwas von „Dienstwechsel“ und legte die Rechnung auf den Tisch. Ich zählte das Geld hin, stand auf und schlug, noch immer leicht benommen, den Weg zu meinem Arbeitszimmer ein. Oben angelangt, konnte ich meinen Zimmerschlüssel nicht finden. Ich machte wieder kehrt, hastete die fünf Stockwerke hinunter, querte die Währinger Straße, klopfte an die Fenster der Buchhandlung, die schon geschlossen hatte, querte die Währinger Straße, bahnte mir einen Weg durch Trauben von Studenten, die plötzlich aus dem Pharmakologischen Institut auf den Bürgersteig strömten, nur um im Hotel Regina zu erfahren, daß man auch dort meine Schlüssel nicht gefunden hatte. Ich ging langsam zurück, überlegte: Eine Option war es, Muschg anzurufen, eine andere, den Schlüsseldienst zu holen. Ich betrat den Innenhof. Die Arbeiter waren schon gegangen. Die Maschine schwieg. Eine Leiter lehnte am Container. Ich stellte sie an die Hauswand und kletterte in das Gerüst hinauf. Pro Stockwerk war jeweils ein Laufsteg angebracht, die Querstangen dienten als Geländer, die einzelnen Stege waren durch Aluminiumtreppen verbunden. Der Aufstieg war mühelos.
Mein Zimmer befand sich an der Hausecke, der Stiege gegenüber, sodaß ich den ganzen Steg zurückgehen mußte. Das Dach reichte hier tiefer. In die Schräge war ein großes Fenster eingelassen, durch das ich in den Raum dahinter sehen konnte. Bisher war ich der Meinung gewesen, daß sich neben meinem Zimmer nur ein Dachboden befand, nun sah ich in einen Wohnraum, der etwa fünfmal größer als Muschgs Höllenzimmer war. In der Mitte des Raumes, dem Fenster zugewandt, stand ein weißes Ledersofa, an den Seiten zwei Fauteuils, davor lag ein alter Seidenteppich, die Farben ausgeblichen – vielleicht ein spätmittelalterlicher Wandbehang. Ich nahm das alles mit einem Blick auf, auch die Masken und geschnitzten Köpfe, die im Raum verteilt auf weißen Stelen thronten oder an unsichtbaren Fäden von der Decke hingen; afrikanisch auch die Speerträger, die ein flaches Metallbecken flankierten, das in die Wand, an die mein Zimmer grenzte, eingelassen war. In dem Metallbecken züngelten blau- und orangerote Flämmchen – ich hatte so etwas schon einmal gesehen, in Paris, in einer Wohnung im 15., wo es als Heizung Verwendung fand. Der Brennstoff war Methanol. Methylalkohol. Vollkommen geruchlos und rauchfrei. Ich war von diesem Feuersee im Zimmer sofort fasziniert gewesen. Auch die übrige Einrichtung schien mir vertraut, der Stil, der eigentlich kein Stil war, sondern Stilisierung von Artefakten, die in keinem Zusammenhang standen, weder ästhetisch noch kulturhistorisch. Eine Voodoo-Hütte aus den Sümpfen Floridas, museal arrangiert. Wo war ich dem schon einmal begegnet? – Saß dort eine Frau? Ich sah nur den unteren Teil eines Kleides oder Rockes, weiß wie das Sofa, dazu helle Sandalen, der Rest nur ein Schatten. Vielleicht war es eine Puppe. Ich drehte den Kopf zur Seite und ging, weiter in den Raum hineinschielend, in Richtung meines Zimmers. Die Gestalt bewegte sich nicht. Ich könnte ja auch irgendwer sein. Ein Ingenieur oder Polier, der nach dem Rechten sieht. Baupolizei. Ja, Baupolizei. Endlich kam ich vor das westliche Fenster meiner Mansarde. Meine Aktentasche stand da, auf dem Tisch lag die Kladde mit meinem Vorschrieb für OMERTA. Daneben die Thermoskanne, die ich seit Frau Bartalszkys Unfall jeden Tag von zu Hause mitnahm … Alles sah sehr aufgeräumt aus. Ich probierte das Fenster. Wenn ich es von unten leicht anhob, ging es ein Stück weit auf. Ich wandte mehr Druck an, und nach einigen Versuchen schwang der Fensterflügel plötzlich auf. Ich taumelte zurück, trat ins Leere, versuchte, mich an dem Staubnetz hinter mir festzuklammern, aber es riß entzwei und ich schwang daran nach außen. Einen Moment schwebte ich über dem Hof, dann prallte ich gegen das Gerüst und schlug mit dem Kopf gegen das Eisengestänge. Augenblicklich verlor ich die Besinnung, ließ das Staubnetz fahren und stürzte im freien Fall die restlichen vier Stockwerke hinab. Kein letztes Wort. Kein Schrei. Nur eine Abfolge von Geräuschen.
Früh am Morgen fand mich ein Trupp Arbeiter, der gekommen war, um das Gerüst abzubauen.
Mittwoch, 3. Dezember 2008
Als ich tags darauf – ungefähr zu der Zeit, als man in der Parallelwelt meiner Todesphantasie den leblosen Körper meines Doppelgängers in den Leichenwagen hob – auf meinem Weg zu Terése durch die Währinger Straße ging, an der Buchhandlung Bartalszky vorbei und dem fünfstöckigen Zinshaus, das mein Höllenzimmer beherbergte, fand ich zu meiner Überraschung das Café Stadelmann an gewohnter Stelle und vollkommen unbeschädigt wieder. Mein Irrtum erklärte sich wie folgt: Das leere Geschäftslokal mit den chinesischen Schriftzeichen lag, vom Schottenring kommend, zwei Häuser vor der Buchhandlung, das Café Stadelmann zwei Häuser danach. Da ich die Währinger Straße stets auf Höhe der Buchhandlung querte, war mir das leerstehende Geschäftslokal nie aufgefallen, sonst hätte ich es erkannt und nicht mit dem Café Stadelmann verwechseln können. Ich mußte also damals, in völliger Gedankenlosigkeit, die Währinger Straße schon eher gequert haben, wahrscheinlich auf dem Zebrastreifen, auf Höhe der Berggasse. Daß sich mein Irrtum nicht eher aufgeklärt hatte, lag daran, daß das Café Stadelmann auf meinen Wegen vom Haus zur Buchhandlung gewissermaßen im toten Winkel liegt. Wenn ich in diese Richtung sehe, dann nach den buschigen Köpfen der Bäume vor dem Institut Français.
Also gehe ich an jenem Vormittag, statt in die Mansarde hinaufzusteigen, um mich wie ein Schriftstelleruhrwerk aufzuziehen und mir irgendwelche Texte aus den Rippen zu schneiden, an den fünf Stockwerken, der Buchhandlung und dem Café Stadelmann vorbei, hinunter zur Nußdorfer Straße, weiter zum Gürtel und dann in den 18. Bezirk hinein, wo ich bald in den 19. abschwenke, nach Döbling, in Gassen, die mir vertraut sind, weil ich eine Zeitlang hier gelebt habe, nicht im Villenviertel, das ich jetzt passiere, doch habe ich auch an diese Gegend meine Erinnerungen, etwa an den Jungen, der sein philippinisches Kindermädchen mit einem abgebrochenen Goldrutenzweig wie ein Kalb die Gasse hinunterjagt. – Es ist kein Spiel. Sobald sie stehenbleibt, schlägt er ihr mit dem Zweig auf die nackten Waden, sodaß sie vor Schmerz aufschreit. Der Junge ist vielleicht zehn. Sein Glück, daß ich zu weit entfernt bin, um einzugreifen. Oder meines … Ich will gar nicht wissen, wer seine Eltern sind … Noblesse oblige.
Ein paar Straßen weiter die Villa des „Privatgelehrten“ und Schriftstellers Röhrle, ein Bürgermeistersohn aus Mürzzuschlag, der, nachdem er in Wien das Künstlerleben für sich entdeckt hatte, so gerne, wie die Mehrzahl der österreichischen Schriftsteller seines Jahrganges, jüdische Vorfahren gehabt hätte und in den letzten Jahren vor allem als Tugendwächter und Sprachpolizist von sich reden gemacht hatte. Über sein literarisches Tätigsein weiß ich nur, daß sein letzter Roman, vom Feuilleton als „literarische Sensation“ ausgelobt, mit dem Satz „der Schnee fiel lotrecht aus dem Himmel“ endet. – Das muß genügen.
In der persönlichen Begegnung ist Röhrle beflissen, beinahe liebdienerisch, kann einem nicht in die Augen sehen, der Händedruck ist lau. Alles in allem ist er eine sehr alltägliche, biedere Erscheinung bar jeden Charismas. Einmal war ich bei ihm zu Gast gewesen – ich weiß nicht, aus welchem Mißverständnis heraus, doch früher hatte ich noch manchmal solche Einladungen erhalten, vielleicht weil man meine Verträglichkeit prüfen wollte – oder sollte es doch besser heißen: meine Verdaulichkeit? – Der dumme Robert war auch da und in seiner Rolle als Paradeintellektueller verkündete er – man weiß nicht, in welchem Auftrag – mit jesuitischem Eifer die baldige Aufhebung jeder Souveränität und die Auflösung der Nationalstaaten in Europa. So war das also. Man saß im Schatten, unter hohen Bäumen. Eine Holzveranda, eine grün-weiß gestreifte Markise. Es gab Apfelstrudel, selbstgemachte Sachertorte und mit der Hand geschlagenes Schlagobers. Immerhin hatte es Röhrle geschafft, in eine halbjüdische Familie einzuheiraten und so an einiges Kapital und in den Besitz dieser Villa zu kommen. Die Eltern seiner Braut waren noch vor dem „Anschluß“ in die Schweiz geflohen. Wenige Monate später kamen sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Tochter war bei zwei Großtanten aufgewachsen, die im völlig abgedunkelten zweiten Stockwerk des Hauses vor sich hin dämmerten, bettlägerig, siech, ohne Pflegerin, nur von der „Dame des Hauses“ und einem Arzt betreut, der auch an jenem Nachmittag anwesend war und sich die Kuchenstücke hineinschob, als gäbe es kein Morgen.
Röhrle, vielleicht weil er die Suada schon zu oft gehört hatte, unterbrach den dummen Robert, indem er ihm grundsätzlich zustimmte, denn die Souveränität, so Röhrle, sei ja ein altes, längst überkommenes patriarchalisches Prinzip – dabei warf er der anwesenden Lyrikerin einen bedeutungsvollen Blick zu – für das in einer pluralistischen, modernen Gesellschaft wie der unseren kein Platz mehr sei.
„Wie Gott“, entfuhr es mir.
„Bitte?“
Ich hatte ganz vergessen, daß Röhrle zum mosaischen Glauben konvertiert war, und stopfte mir schnell ein Stück Apfelstrudel in den Mund. Der dumme Robert sah mich böse an.
„Göttlich“, nuschelte ich mit halbvollem Mund und deutete auf den Apfelstrudel, und wirklich entspannte sich Röhrle, der schon mit einer Attacke gerechnet hatte, augenblicklich, denn er hatte den Apfelstrudel selbst gemacht, wie er mir gleich versicherte, und in der nächsten Stunde waren, zum Leidwesen der lyrischen Suffragette und des dummen Robert, weder Faschismus noch Souveränität noch Demokratieverlust ein Thema, sondern es ging nur noch um Mehlspeisen, Kuchen, Torten, Knödel, Marmeladen, Backwerk und Zutaten aller Art. Die Rezepte, die „Küchengeheimnisse“ und „Tricks“ purzelten nur so aus Röhrles Mund, ein ganzes Kochbuch, und wenn er nachließ und in seinem Redefluß zu ermatten drohte, ermunterte ich ihn mit Zwischenfragen, stachelte ihn auf, mehr und mehr von seinem Wissen preiszugeben. Seine Begeisterung war echt, seine Aufgeregtheit, seine Leidenschaft und Liebe zum Detail unverstellt. Das machte ihn mir sympathisch. Ich sah ihn mit der Schürze in der Küche stehen, ein kleiner, dicklicher Bub vom Land, ein Pummerl, das den Kochlöffel schwang und vielleicht gerne Konditor geworden wäre – so ein runder, zufriedener Mensch, wie man sie in diesem Berufsstand noch manchmal antrifft. Nicht diese wichtigtuerische Beflissenheitskröte, die sich, vom bürgermeisterlichen Geltungswahn getrieben und der Schuld, die man in sie hineingeredet hatte, auf das Gebiet der Literarisiererei verirrt und zum dozierenden Privatgelehrten verunstaltet hatte.
Natürlich wußte ich, daß Röhrle mein Feind war. Er hatte, unter Pseudonym, als Redaktionskürzel, in mehreren Zeitschriften Verrisse meiner Bücher und bei mehreren Gelegenheiten gehässige Kommentare gegen mich verfaßt, außerdem des öfteren in Jurys massiv gegen eine Preisvergabe an mich interveniert. Die Feindschaft traf also auch existentiell, war schon ein Vernichtungswille, das muß man gar nicht schönreden. Es war unsere erste – und einzige – persönliche Begegnung, und ich hatte die Einladung nicht angenommen, um mit ihm abzurechnen. Freilich, hätte er sich die geringste Invektive geleistet, wäre sie nicht unbeantwortet geblieben. Doch wie immer bei solchen „persönlichen Begegnungen“ mit Feinden von mir, abseits der Bühnen, blieb jeder nett und alles im harmlosen Rahmen. – Dort also ging ich vorbei. Schaute zu den Fenstern im zweiten Stock hinauf. Dachte an die zwei Alten und daran, was sonst noch in diesen Villen so vor sich gehen mochte, bei den Oberärzten und Edelpsychologen, die sich hier niedergelassen hatten. Döbling eben – nicht meine Gegend.
Ich mußte die Karte zur Hand nehmen, denn nun kamen Gassen, von denen ich noch nie gehört hatte. Unbekanntes Terrain. Die Häuser traten zurück, versteckten sich hinter Büschen und Bäumen. Endlose Gartenzäune. Bald sah man überhaupt keine Häuser mehr, auch kaum Autos, Menschen schon gar nicht. Manche Grundstücke waren von hohen Mauern umgeben, Kameras an den Toren. Eine Gartentür ohne Hausnummer zwischen zwei abgezäunten Grundstücken, am Postkasten kein Name, dahinter ein Feldweg – das mußte es sein. Ich läute. Nach einiger Zeit erscheint Terése am Ende des Feldweges, läuft winkend auf mich zu. „Es ist offen, es ist offen“, ruft sie, aber ich rühre mich nicht vom Fleck, stehe wie angewachsen, sprachlos, dann ist sie bei mir, und wir umarmen uns, über das Gartentor hinweg, halten uns fest, ich drücke sie an mich, rieche ihr Haar, schaue blicklos auf den Weg, den sie gekommen ist, dann gibt etwas nach in mir – ich schließe die Augen und lasse den Kopf sinken.
„Terése“, sage ich. „Meine Terése“ will ich sagen, doch ich bringe es nicht heraus.
Eine Weile stehen wir so, dann lösen wir uns, sie hält meinen Kopf mit beiden Händen, küßt mich auf die Wange, auf die Stirn, schaut mir in die Augen, streicht mir über den Kopf. Ich bin wie erstarrt, ganz witzlos hat mich die Berührung gemacht, die Nähe … Sie öffnet das Tor, und ich trete ein.
„Schließt du nicht ab?“
Sie zuckt mit den Achseln. „Wer soll schon kommen?“
Hand in Hand gehen wir das kurze Stück Weg. Ich sehe, daß sie Gummistiefel anhat. An der Wegbiegung bleiben wir stehen. Das Grundstück liegt in einer Senke, und man hat von hier oben alles im Blick. Gegenüber, am tiefsten gelegen, ein schilfumwachsener Teich, dahinter der Kirschgarten, links, leicht erhöht, ein Glashaus, rechter Hand das Hauptgebäude, daran anschließend ein Schuppen, dann ein Stall oder eine Tenne, dazwischen Kieswege, Wiesen, Hecken, Obstbäume und ein eingezäunter Garten.
Terése muß nichts sagen, ich weiß, daß dies ein Schwarzkogler-Besitz ist. Ich kann es förmlich riechen.
„Bist du noch verheiratet?“
„Nein“, sie tritt einen Schritt zurück, „… geschieden. Schon lange.“
„War das die Abfindung?“ Ich nicke auf das Anwesen hinaus.
„Kann man so sagen …“
Es ist mir unangenehm, daß ich so grob gefragt habe. Doch das Schwarzkoglerische ist mir verhaßt wie sonst nichts auf der Welt.
Terése lebt in ihrem Haus wie in einem großen Zelt. In den Räumen, die sie bewohnt, herrscht eine zigeunerhafte Gemütlichkeit. Das Provisorische und Improvisierte stört nicht. Es ist kein Ausdruck von Nachlässigkeit oder Schlamperei. Die Dinge verkommen nicht unter ihren Händen.
Hier, in einer solchen Umgebung, einer solchen Ordnung, ist auch Platz für einen wie mich.
Nach dem Frühstück begleite ich Terése in den Garten, hinter dem sie ein kleines Kartoffelfeld anlegen will. Die Erde ist locker, leicht sandig. Während Terése das Feld absteckt, nehme ich einen Spaten und beginne mit dem Umgraben. Es ist schön, so selbstverständlich nebeneinanderher zu arbeiten. Jeder weiß, was zu tun ist, und ich beginne wirklich zu hoffen, daß ich dem Höllenzimmer entwischt bin, daß ich meine Zeit abgesessen habe. Aber mit Sicherheit weiß man das nie.
Die nächsten Tage, während Terése im Garten arbeitet, verbeiße ich mich in einen riesigen Rosenstrauch, einem Rosenstrauchgemenge, das vor dem Haus bis in den zweiten Stock hinaufwuchert. Ich glaube, er ist noch nie beschnitten worden. Nach der Arbeit essen wir im Haus oder, wenn es schön ist, auf der Terrasse zu Mittag, dann gehe ich zurück in die Stadt. Abends telefonieren wir, und es wird mir zur lieben Gewohnheit, für Terése kleine Besorgungen in der Stadt zu erledigen. Ich fahre jetzt auch mit dem Bus, nur das letzte Stück gehe ich zu Fuß. Nach den Arbeiten im Garten und an den Rosensträuchern folgen die Hecken, die Obstbäume und zuletzt der Kirschgarten. Der Steg beim Teich ist baufällig, die Bretter sind morsch, die Pfosten angefault – ich lasse es, wie es ist.
Eine Niederlage mußte ich auch beim Mähen mit der Sense hinnehmen. Egal, wie oft Terése es mir zeigte, jedesmal fuhr ich mit der Spitze in die Erde. Ich fällte das Gras, ich mähte es nicht.
Mitte Oktober waren die notwendigsten Arbeiten im Freien erledigt, die Ernte eingebracht. Die Tage wurden kälter, und Terése verbrachte mehr Zeit im Gewächshaus, wo sie sich mit ihren Studien und Züchtungen beschäftigte. Dort gab es nichts für mich zu tun. Ich erledigte kleinere Arbeiten am Haus, tauschte die Schaumgummidichtungen an den Fenstern, erkundete die unbewohnten Zimmer im Obergeschoß, wo auch die Bibliothek untergebracht ist.
Hier wird nicht geheizt, und selbst am schönsten Sonnentag bleibt es düster wie in einer Kirche, und die Kälte kriecht aus den Mauern. Die Zimmer sind mit dunklen Eichenmöbeln vollgestellt, Antiquitäten und Bauernkästen, Holztruhen in den Ecken, fingerdicken Teppichen auf den Böden, barocken Spiegeln an den Wänden. Es gibt auch eine mittelalterliche Rüstkammer, vollgeräumt mit verrostetem Werkzeug, mit alten Waffen, Schilden, Helmen, Arm- und Beinschienen aus den unterschiedlichsten Epochen. Daran anschließend eine kleine Kammer, die wohl einmal den Jagdtrophäen vorbehalten war. Heute steht nur noch ein mannshoher ausgestopfter Schwarzbär darin, gleich hinter der Tür, das Fell stumpf und staubig, der Zottelkopf dem Hoffenster zugewandt.
Eine Sammlung russischer und griechischer Ikonenbilder in den Korridoren sowie bemalte Heiligenfiguren in den Mauernischen rundeten die Grundausstattung eines Schwarzkoglerischen Anwesens, wie ich es kannte, ab. Auch die Bibliothek bot in dieser Hinsicht wenig Überraschendes. Der Bestand setzt sich zum Großteil aus Militaria, Biographien und kulturhistorischen Werken zusammen.
Ich suchte einige Bände heraus, die mir interessant erschienen, trug sie hinüber in das Gewächshaus, nahm in dem Pfauenthron, wie Terése den geflochtenen Korbstuhl nennt, Platz, und versuchte zu lesen. Nach zwei Tagen ließ ich es sein, starrte auf die Pflanzen, schaute in den Himmel hinauf, wechselte mit Terése ein paar Worte, sonst tat ich nichts. Oft bin ich eingeschlafen und erst am späten Nachmittag wieder aufgewacht. Das war mir neu, diese Erschöpfung, aber nicht unangenehm, denn der Schlaf war erfrischend. Ich schrieb es abwechselnd dem Alter zu, den Folgen der körperlichen Arbeit, die ich nicht gewohnt war, oder dem speziellen Klima, das in dem Treibhaus herrschte. Wenn ich aufwachte, tranken wir Tee, aßen eine Kleinigkeit, Terése kehrte wieder zu ihren Orchideen zurück und ich in mein von Träumen durchwobenes Pflanzendasein. Orchis aumeieris, die Pfauenthron-Orchidee, zu der ich mutiert war.
Das Erzählen verlief zwanglos, wir ließen uns sprechen, spannen die Fäden lose, manchmal anlaßbezogen, manchmal, weil die Nähe dazu einlud. Wir schlugen das Buch von hinten auf. Im Krebsgang tasteten wir uns zurück in der Zeit, durch die Jahre und Jahrzehnte, da wir nichts voneinander gewußt hatten, zurück an den Anfang, zu den wenigen, gemeinsam verbrachten Wochen und den Erinnerungen, die wir daran teilten.
Zwei Leben waren es, die wir uns erzählten. Wir hatten lange darauf gewartet.
Wir ließen uns Zeit.
Das Glück machte uns scheu. Je weiter die Erzählung fortschritt, je mehr ich mir der Konsequenzen, die unsere erste Begegnung für Terése gehabt haben mußte, bewußt wurde, desto verunsicherter war ich.