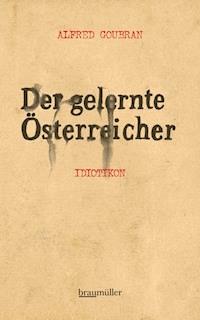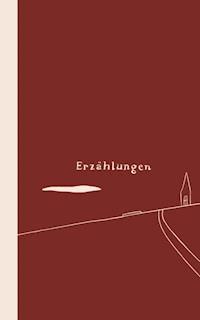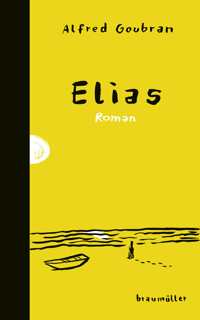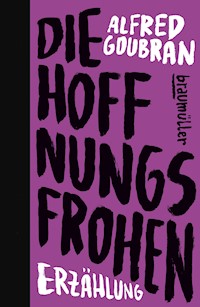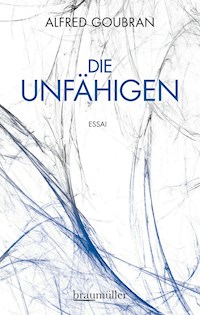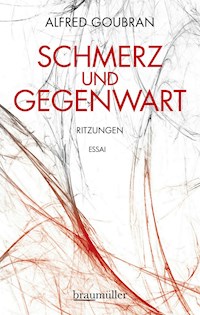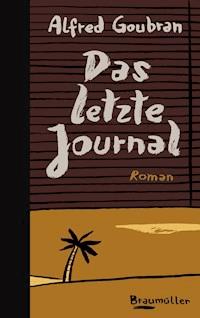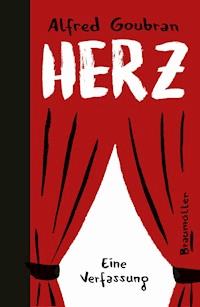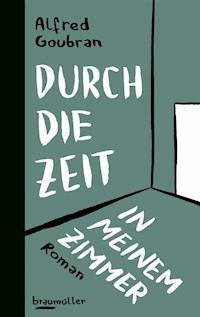
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem einzigen Raum konzentriert Alfred Goubran diesen "Roman einer Reise", der den Leser ans Ende der Welt führt, in das "Schwarze Schloss" im Niemandsland einer verschneiten Bergödnis, das niemand verlässt, der es je betreten hat. Elias verbringt sein Leben ohne Verpflichtungen, den Zufälligkeiten und Gelegenheiten ergeben. Die Verweigerung jeglicher Konvention, seine Suche nach Individualität und Freiheit führt ihn an die Randzonen der Gesellschaft, zu den Außenseitern, dem "Volk der Nacht", den Ausgegrenzten und Unangepassten. Doch dort ist auf die Dauer kein Bleiben. Die Entscheidung zum Aufbruch fällt in dem Zimmer, das er bewohnt und das sein Vater einst als "Investition" erworben hat. Nicht ob der Aufbruch gelingt, ist entscheidend, sondern wohin er führt. Zwei Wege sind es, die sich auftun: Der eine führt ihn in die Berge, der andere, durch eine lebensbedrohliche Erkrankung, in gefährliche Zwischenwelten, wo die Zeit aufgehoben scheint und die Grenzen zwischen Erinnerung und Fieberfantasien, Gegenwart, Traum und Halluzination verschwimmen. "Durch die Zeit in meinem Zimmer" ist eine große Erzählung, ein Roman mit einer ungeheuren Sogwirkung, der man sich kaum entziehen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Alfred Goubran
Durch die Zeitin meinem Zimmer
Roman einer Reise
Der Text folgt in weiten Teilen den Regeln der alten Rechtschreibung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schrift liche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
1. Auflage 2014© 2014 by Braumüller GmbHServitengasse 5, A-1090 Wienwww.braumueller.at
Covergestaltung: Nicolas MahlerISBN der Printausgabe: 978-3-99200-104-0ISBN E-Book: 978-3-99200-105-7
Inhalt
I.
II.
III.
IV.
V.
I.
Schnee ist das Blut der Geister.
Graffiti, anonym
Februar. Herbst des Winters. Die Tage werden länger, aber er nimmt es kaum wahr.
Er ist an die Dunkelheit gewöhnt, die Nächte, die Schatten, das fahle Licht zwischen den Dämmerungen, den bleifarbenen Himmel am Morgen, wenn er aus der Stadt in sein Zimmer zurückkehrt. Vorstadt. Die innere Stadt endet an den Geleisen. Da entschied es sich jedesmal, ob er die Unterführung nahm oder, wenn noch Geld übrig war, den Schienen zum Bahnhof folgte, um in der Kantine zu frühstücken. Wann immer ich ihm auf diesem Weg folge, sehe ich über den Geleisen die Sonne aufgehen. Mangofarbene Schleier mischen sich in den Dunst der Stadt. Darunter die Waggons. Die überdachten Pontons der Bahnsteige. Die Uhren. Rufe im Nebel. Die Bremser, die Weichensteller, die Streckengeher. Ich kenne sie alle. Ich habe einen Sommer lang dort gelebt. Die Arbeiter haben uns geduldet. Wurde es hell, mußten wir den Bahnhof verlassen. Dann haben wir unsere Schlafsäcke zusammengerollt und sind zum Fluß hinuntergegangen, um bei Miros zu frühstücken. Miros der Zigeuner – zumindest behauptete er von sich, einer zu sein – reparierte alte Autos, Kühlschränke, Radios. Manchmal gab es für ihn auch Arbeit in der Stadt, Malerarbeiten, Umzüge, Gelegenheitsjobs. Wer wenig Geld hatte und sich keinen Handwerker leisten konnte, rief Miros an. Das Haus hatte er von Jacky gepachtet, der auf dem Grundstück in einem ehemaligen Werkzeugschuppen wohnte. Jacky war ein Krüppel, Alkoholiker und Psychopath. Von seinen Beinen waren nur noch zwei etwa zehn Zentimeter lange Stümpfe übrig. Es hieß, er hätte sich vor einen Zug geworfen, aber keiner wußte es genau und niemand wollte ihn fragen. Wer Jacky kannte, gab darauf acht, außerhalb der Reichweite seiner Arme zu bleiben, egal wie harmlos das Gespräch war. Durchaus glaubwürdig war auch die Geschichte, daß er zwei Zeugen Jehovas, die sich auf sein Grundstück verirrt hatten, aus dem Rollstuhl angesprungen, verprügelt und einen von ihnen so lange gewürgt hatte, bis dieser das Bewußtsein verlor. Selbst Miros Kinder hielten sich von ihm fern. Die kleinste Regung von Mitleid ihm gegenüber war lebensgefährlich. Der einzige Mensch, den er an sich heranließ, war Miros Frau. Sie ging zu ihm in den Schuppen, räumte auf, sah nach ihm. „Er hat Schmerzen“, sagte sie. Manchmal fand sie ihn in der Früh vor dem Werkzeugschuppen auf dem Boden liegen. Dann hatte er wieder „getanzt“. War er betrunken genug, wuchtete er sich aus dem Rollstuhl, turnte auf den Händen über den Erdboden, rollte und hüpfte fluchend und schimpfend über das Grundstück und attackierte jeden, der sich ihm näherte. Und wenn es schlimm kam, erklomm er das Flachdach des Schuppens, schrie und brüllte, bis er keine Stimme mehr hatte oder vor Erschöpfung einschlief. Er weigerte sich auch am nächsten Tag, wieder herunterzukommen, und Miros Frau mußte ihn dann auf dem Dach mit dem Notwendigsten versorgen. Das dauerte aber nie länger als zwei Tage.
Jacky war so unberechenbar, daß sie ihn im Krankenhaus nicht mehr behandeln wollten. Auch die Polizei ließ ihn in Ruhe. Soviel ich weiß, leben Miro und seine Familie nicht mehr dort. Keine Ahnung, wer jetzt auf ihn achtgibt. Vielleicht niemand. Aber solche Orte, die es überall gibt, ziehen immer Menschen an, Menschen im Übergang, die an den Rändern und im Ungesicherten leben – ganze Dörfer habe ich so entstehen sehen. Im Süden, während der Sommermonate, treffen sich die Vagabunden, ohne sich vorher abgesprochen zu haben, in irgendeiner namenlosen Bucht, kommen mit ihren Rucksäcken und ausgebauten Lastwagen an. Manche schlafen im Auto, Zelte werden aufgestellt, Toiletten, Koch- und Wasserstellen improvisiert. Ehe man sie vertreiben kann, sind sie schon wieder verschwunden und in alle Windrichtungen verstreut. Zeitzonen sind es, an den Rändern der zivilisierten Welt, die so entstehen. Sie beherbergen jene, die noch nicht ganz aus der Welt gefallen sind. – Den Kaputten, Enttäuschten, Abgeräumten aber sind andere Orte vorbehalten. Wir sind ihnen immer aus dem Weg gegangen. Auch den Volksküchen und Armensuppen, den Obdachlosenheimen und Kleider ausgabestellen, den Arbeits- und Sozialämtern. Schon möglich, daß wir sie einmal in Anspruch nehmen werden müssen. „Zu Grunde gehen“ kann man aus jeder Lebenssituation heraus.
Das andere nicht.
Damals dachte ich, ich könnte ihn gehen lassen. Den Schulabbrecher und Taugenichts. Oder ihn irgendwo hinführen, von wo er nicht mehr alleine zurückfand. Es mußte ja kein schlimmer Ort sein, vielleicht ein Ort, wo es ihm besser ging. Irgendwo im Süden. Marokko schlug ich vor. Und es schien ihm zu gefallen. Er hatte noch nichts gesehen von der Welt. War aus dieser Kleinstadt nie hinausgekommen. Eine Kindheit in einem Vorstadthaus mit Garten. Die Eltern immerzu beschäftigt, war er meist sich selbst überlassen. Die Schule langweilte ihn. Er nahm die Lehrer kaum wahr. Die Erwachsenen, die Eltern und Großeltern, der Priester, die Kindergärtnerin – sie waren nicht mehr als Statisten in seinem Kinderleben. Er las gern, erkundete die Umgebung mit dem Rad, liebte die Filme, die während der Ferien im Nachmittagsprogramm gezeigt wurden. Dann zog er die Vorhänge zu, saß allein in dem dunklen, kühlen Zimmer. Mit zwölf begann er an den Wochenenden ins Kino zu gehen, ohne daß seine Eltern davon wußten. Geld fand sich immer irgendwo im Haus. Die Freunde, mit denen er die Zeit verbrachte, blieben so unwirklich wie die Erwachsenen, kleine Kollegen, Schicksalsgenossen, neben denen er in der Schule saß, zum Schwimmen ging oder zum Fußballspielen. Er nahm sie nie mit ins Kino. Oder zu seinen Ausflügen. Was verboten war, unternahm er allein. Das änderte sich erst später, als er auf Gleichgesinnte traf. Der erste Erwachsene, der ihn wirklich erreichte, war sein Mathematiklehrer und Klassenvorstand, der ihn am Gang wegen irgendwelcher Schwierigkeiten zur Rede stellte. Genaugenommen war es nur ein Satz, eine Frage, die zu ihm durchdrang, und seine Antwort war, daß er von einem Tag zum nächsten mit der Schule aufhörte. Er lebte damals schon seit einem halben Jahr in einem kleinen Zimmer, das sein Vater irgendwann „als Investition“ gekauft hatte. Im übrigen kümmerte es seine Eltern nicht, daß er die Schule abgebrochen hatte. Sie hörten sich seine Erklärungen ruhig an, die nicht mehr als Ausreden waren, nickten zu seinen Plänen, die er vor ihnen ausbreitete, und fanden es „im großen und ganzen“ sehr vernünftig, daß er sich selbständig machen wollte.
„Ich kann in der Schule nichts mehr lernen“, hatte er gesagt. Der Satz blieb an ihm haften und erinnerte sich ihm von Zeit zu Zeit. Es war einer dieser Erwachsenensätze, die besser klangen, wenn man sie vor anderen aussprach. Er hatte keine Vorstellungen davon, wie sein Leben weitergehen sollte. Sprach ihn jemand darauf an, ließ er sich reden. Fabulierte drauf los. Wie bei den Prüfungen in der Schule, für die er sich nicht vorbereitet hatte. Nur, daß es jetzt egal war. Was er sagte, blieb folgenlos. Es hatte keine Bedeutung, solange er nichts von den anderen wollte. Und die anderen nichts von ihm. Keiner, dachte er sich, will im Grunde etwas vom anderen wissen. Das ist natürlich. Jeder wächst für sich …
Soweit es ihn betraf, wuchs er in ein Leben ohne Verpflichtungen hinaus, regellos, ohne feste Bindungen; ein Leben, das sich in den Begegnungen erschöpfte, die zufällig blieben, ein Leben, das ihn den Tagmenschen entfremdete, ihrer Routine und den Geschäften, für die er kein Verständnis aufbrachte. Denn was waren ihre Leben anderes als ein Geschäft. Und die Währung, in der es bezahlt wurde, das bißchen Lebenszeit, das ihnen zur Verfügung stand. Eine andere Währung gab es nicht. Eine Erbsünde mag es nicht geben, eine Erbschuld schon. Das Leben, das man sich schuldig geblieben ist, das ungelebte, das nicht gelebte Leben, das man sich aus diesen oder jenen Gründen aufgespart hat, in jedem Fall aber, um im Bequemen zu bleiben und das der andere dann einlösen soll, der Nachkommende. Oder einer, der dumm genug ist, die Schuld auf sich zu nehmen und mit seiner eigenen Lebenszeit zu tilgen. Lebenszeit: Zu Münzen geronnenes Schicksal, jede Banknote ein Wechsel. How much, Schatzi? Jeder hat seinen Preis, jeder trägt die Schulden des anderen mit. Ungefragt. Das ist sozial. Die fremde Last. Was aber war seine Last? Was sein Wechsel? – Er wußte es nicht. Sein Lebenswandel führte ihn jeden Tag tiefer in die Nacht, in Diskotheken und Frühbars, Bordelle, Trinkhallen und obskure Lokale, er freundete sich mit den Besitzern an, den Türstehern und Kellnerinnen, er machte Bekanntschaft mit den Huren und ihren Zuhältern, den Schlägern, den Dealern und Spielern, den Schlaflosen, den Säufern und verkrachten Existenzen. Auch die Welt der Arbeiter reichte dort hinein. Saison- und Bauarbeiter, die sich unter der Woche auf irgendwelchen Baustellen kaputtmachten und am Wochenende an ihren Einfamilienhäusern weiterarbeiteten. Die Solidarität unter ihnen war groß, jeder half jedem, und wenn sie in die Lokale einfielen, zu siebt oder zu acht, ging es nie ohne Schlägereien aus. Das Volk der Nacht drängte sich in dieser kleinen Stadt auf wenigen Plätzen. Konflikte waren vorprogrammiert. Die „normalen Leute“ sah man an den Wochenenden in den Diskotheken, nur in der Ballsaison verirrten sie sich auch regelmäßig in die Frühbars. Mädchen in feenhaften Ballkleidern, Schüler in ihrem ersten Anzug, die ihre ersten Schnäpse tranken und, mehr tollwütig als betrunken, vor ihren Begleiterinnen versuchten, Männer zu spielen – am falschen Ort. Sie lachten über die Käuze, die sie dort vorfanden. Die Typen. Auch über ihn hatten sie gelacht. Er war allein gewesen. Zuerst hatte ihn das Gekicher und Getuschel der Mädchen, sie waren nicht viel jünger als er, gestört. Je länger es andauerte, desto unsicherer wurde er. Scham stieg in ihm auf, er wußte nicht, warum oder wofür, er fühlte sich wehrlos, ausgeliefert und wollte schon zahlen, als Maggie, eine ehemalige Hure, die hier als Geschäftsführerin ihr Auskommen gefunden hatte, sich zu ihm an den Tisch setzte. Sie stellte zwei Cognacgläser auf den Tisch und bot ihm eine Zigarette an. Die Hyänen am Nebentisch verwandelten sich bei Maggies Anblick beinahe augenblicklich in kleine Mädchen, Täubchen, die mit ihren Schnäbeln umständlich an ihren Proseccogläsern nippten, während die Jungen mit erhitzten Gesichtern auf die Tischplatte starrten … Verkleidete Kinder. Eine Kindergeburtstagsparty am falschen Ort. Zur falschen Zeit. Mehr nicht …
„Gehts dir eh gut?“
Er nickte. Maggie stieß mit ihm an, trank das Glas in einem Zug aus und ging, die brennende Zigarette in der Hand, wieder hinter die Theke zurück. Da wußte er, daß er dazugehörte. Daß man ihn akzeptierte, wäre vielleicht zuviel gesagt, aber man mochte ihn und hatte sich an ihn gewöhnt. Diese Welt, in der er allmählich Fuß zu fassen begann, die Orte und Menschen waren seinen Eltern unbekannt. Wo anders wäre die Schuld, die Last, ihr Ungelebtes, in das er hineingeboren war, zu finden, wenn nicht in einer Welt, die für sie gar nicht zu existieren schien …
Geldsorgen hatte er keine. Anfangs, wenn er knapp war, hatte er sich noch manchmal etwas von zu Hause geholt, jetzt schon lange nicht mehr. Er hielt sich mit kleinen Gelegenheitsjobs über Wasser, half hinter der Theke aus, kassierte Eintritt bei Konzerten, versuchte sich als Zeitungsverkäufer, plakatierte, verteilte Flugzettel und Werbematerial, schleppte Möbel und Umzugskisten, alles war ihm willkommen und er sich für keine Arbeit zu schade, solange es nichts Regelmäßiges war. Im übrigen konnte er in den Lokalen, wo er Stammgast war, anschreiben. Das half über schlechte Zeiten.
Er dealte auch, kleine Mengen nur, meist Gras, das er an Leute verkaufte, die er noch von der Schule her kannte oder die keine connections hatten. Abgesehen von den Zigaretten, hatte er kein Problem mit Drogen. Meist wurde er eingeladen oder bekam etwas zugesteckt. Hatte er nichts, war es auch in Ordnung. Für sich, wenn er allein war, brauchte er wenig. Kaffee und Zigaretten, das war es schon. Dabei fiel ihm ein: Er hatte keine guten Schuhe mehr. Immer kam er mit nassen Füßen heim. Eiszapfen zwischen den Zehen. Er stopfte die Schuhe mit Zeitungspapier aus und stellte sie vor den Ofen. Es war nur eine Geste, denn sie wurden nie ganz trocken, so wenig wie die Socken, die er auf das Ofengitter legte. Den fehlenden Knopf am Mantel hatte er durch eine Sicherheitsnadel ersetzt. Darunter trug er dieselben Anzüge und Hemden, die er auch im Sommer getragen hatte. Die Anzüge waren etwas zu groß, die Hemden gelbfleckig und an den Kragenrändern aufgescheuert. Bisher hatte ihn das nicht gestört, fehlende Knöpfe, ein kaputter Schuh, das zerschlissene Innenfutter, die Löcher in den Taschen, jetzt begann es ihm aufzufallen. Er registrierte es eher verwundert, als hätten die Dinge, die er besaß, begonnen, ein Eigenleben zu ent wickeln. Er sah den Verfall nicht, die Verkommenheit, auch wenn sie ihm nun gehäuft entgegentraten, als das, was sie waren, begriff sie vielmehr als Zeichen einer vorübergehenden Heimsuchung, etwas wie Ausschlag, der von selbst wieder verschwinden würde. Der abgetretene Teppichboden, die fleckigen Wände und schmutzigen Fenster, die Staubnetze in den Ecken, die ausgeschlagenen Tassen und Teller, die stumpfe Patina, die auf allem lag, der Lampe, den Möbeln, den Tür- und Fenster stöcken. Und im Spiegel – er schaute nicht gern in den Spiegel: Sein bleiches Gesicht, aufgequollen, teigig, die gelben Zähne, die unreine Haut, die Pickel und Bartreste, das seit zwei Jahren ungeschnittene, fettige Haar. Nach und nach fiel ihm das auf und meist vergaß er es, sobald er wieder unter Leuten war. Der Blick in den Spiegel zeigte ihm nur ein Gesicht. Ob es ihm gefiel oder nicht: Es war nicht wirklich, es war nicht sein einziges Gesicht. Und: Es war nicht das Gesicht, das die anderen sahen.
Mit solchen Gedanken im Kopf mag auch Dorian Gray sein unheimliches Portrait betrachtet haben. Die Zeit war unmerklich unter den Firnis des Bildes gekrochen, das Alter, die Vergänglichkeit. Die Zeit: Feine Haarrisse waren es nur, durch die sie in sein Zimmer sickerte. Und mit ihr die Kälte. Er zog sich in die Schatten zurück, in das Halbdunkel der Stimmungen, entwickelte eine Vorliebe für Kerzen, erstand irgendwo eine Petroleumlampe und zog die Vorhänge auch tagsüber nie ganz zurück.
Der Winter machte ihm zu schaffen. Er hatte den stinkenden Ölofen im Sommer gegen einen kleinen Kohlenofen ausgetauscht, dabei aber nicht bedacht, daß er keinen Kohlenkeller besaß. Und mit den Briketts, die er sich von der Nachttankstelle holte, bekam er das Zimmer nie ganz warm. An den Fenstern wuchsen die Eisblumen, und die Menschen auf den Straßen glichen wandernden Kleidersäcken, die sich steifbeinig und plump durch die Schneelandschaft schoben. Zwischen den Häuserzeilen wölbten sich die naßglänzenden Rücken der Fahrbahnen, in den Abwasserrinnen sammelte sich der Splitt. Asche und Salz auf allen Wegen, unterbrochen von schlammigen Eiswasserpfützen, die bis an die Knöchel reichten. Männer auf den Dächern, die den Schnee abkehrten, die Dachtraufen freilegten und die Eiszapfen von den Fernsehantennen schlugen. Nachts donnerten schwere Schneepflüge durch die Straßen, Arbeiterkolonnen mit grellen Schutzwesten wurden in Bussen herangekarrt, schoben den Schnee zu großen Haufen zusammen, scheuerten dabei mit ihren breiten Schaufeln über den Asphalt, während es sonst stillblieb, bis die Bagger kamen, um die Schneeberge Mulde für Mulde auf Lastwagen zu laden.
Morgens krochen die Einwohner aus ihren Betten, um in der klirrenden Kälte die Autos freizuschaufeln, die Zufahrtswege und Einfahrten, ihre Windschutzscheiben abzukratzen, während in irgendwelchen unbewohnten Häusern die vereisten Wasserrohre platzten und der Frost an den Grundmauern nagte. Unablässig lag ein Brandgeruch in der Luft, eine Dunstglocke aus Ruß und Ab gasen, die sich mit den zähflüssigen Nebeln vom nahen See und den Wäldern am Fluß mischte und oft wochenlang über der Stadt hing. Selten, daß man in diesen Wintern den Himmel sah, die Sonne, den Mond, die Sterne. Nur das emulsionsfarbene Firmament, aus dem lautlos die Schneeflocken fielen. Der Himmel in diesen Wintern war ein träges, walgraues Meer, das Nacht für Nacht, vom Widerlicht der Straßenlampen erhellt, noch ein Stück tiefer herabzusinken schien.