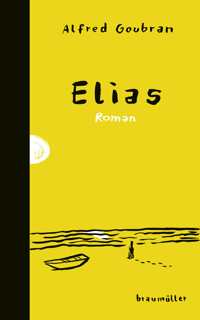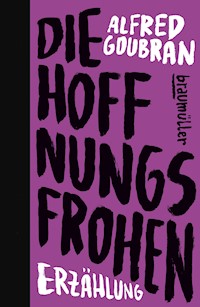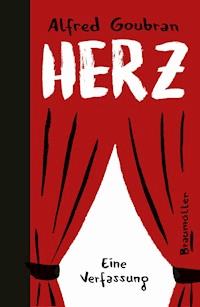20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Zwei Lebensgeschichten, zwei Welten. Georg Münther, Literaturredakteur, und Elias Schwarzkogler, Leiter einer Nervenheilanstalt, spüren auf unterschiedliche Weise dem "Fremden im Eigenen" nach und der Frage, ob ein selbstbestimmtes Leben überhaupt (noch) möglich ist. Münther, indem er versucht, sich von allem Angelernten, den Prägungen, Normen und Vorurteilen, soweit es möglich ist, zu befreien, während sich Elias dem Problem auf wissenschaftlichem Weg über die Parasitologie annähert und dabei auch Anstaltspatienten für seine Experimente mißbraucht. Münthers Weg führt ihn über Paris, Tirol und die Schweiz im Jahr 2038 wieder zurück nach Wien, wo er sich endlich Klarheit über das Schicksal eines alten Freundes verschaffen will, der vor über zwei Jahrzehnten in Elias' Nervenheilanstalt eingewiesen und seitdem nicht mehr gesehen worden war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
1. Auflage 2024
© 2024 by Braumüller GmbH
Servitengasse 5, A-1090 Wien
www.braumueller.at
Covergestaltung: Nicolas Mahler
Lektorat: Anita Luttenberger
Druck: Prime Rate Kft. Megyeri út 53. H-1044 Budapest
ISBN 978-3-99200-348-8
Inhalt
***
Tubuline
Herkommen
Anna perennis
Der Schwarze Spiegel
Die dunkle Seite des Mondes
Die Verwandlung der Anna Kerf
Frühling in Wien
Barbès
Hall
Kein Mensch ist eine Katze
Einströmung
Die Methode
Der Zungenbeißer
Schwester Anke
Cour des Miracles
***
17:03
Als ein Bildnis des Gelächters
stand ich da, ein neuer Heiliger.
Doch der Dämon, unbestimmbar
seufzend, bückte sich und schrieb mit
seinem Finger auf die Erde.
Aus: Christian Morgenstern,
„Das Symbol des Menschen“
***
„Homma a Identität …“
Er hält dem Kontrolleur die Karte hin, den Blick auf der regennassen Straße. Das aufgedunsene Gesicht des Mannes, durchscheinend und geisterhaft. Der Körper eine Hyäne, die sich schwerfällig durch den menschenleeren Wagenkasten schiebt, die Vorderpfoten auf den Lehnen der Rückbänke, den Thorax aufgerichtet. Flecken von Melasse schlieren über den Rücken und die Oberschenkel des Mannes. Der dicke Overall ein flachsfarbenes Fell. Vielleicht die Montur eines Erschossenen … Doch es ist nur die landesübliche Kostümierung der Öffentlichen Hand. Dazu die kniehohen Schaftstiefel. Natürlich aus Plastik. Leder ist unerschwinglich, Gummi Mangelware.
Die Straßenbahn hält, die Hyäne steigt aus. Münther nimmt das Manuskript, das er auf den freien Nebensitz gelegt hat, wieder zur Hand.
Noch drei Stationen.
***
Tubuline
Herkommen
Städte und Landstriche wie Grade auf einer Schmerzskala: Wien, Zirbenburg, Hall, Merenschwand. Zuletzt: In einem Kaff verschwinden wie in einer Remise und seine Tage leben. „Ich versuche mich an meine Zufriedenheit zu gewöhnen“, hatte Münther zu dem Verleger und Kunstsammler Helmut Zither gesagt, der eines Tages vor seiner Tür gestanden hatte, den Jazzposaunisten und Landschaftsmaler Ricardo Aton im Gepäck, die er beide flüchtig aus seiner Zeit als Literaturredakteur in Wien kannte.
Sie sahen beide ziemlich mitgenommen aus. Zither, kahlköpfig, mit seiner maikäferbraunen Leinenhose und dem karneolfarbenen, knopflosen Leinenhemd, das er locker über der Hose trug, ein Ledertäschchen am Gürtel, wirkte in Aussehen und Habitus beinahe mönchisch. Aton trug einen Hut, den er auch später im Lokal nicht abnahm, ein Streifenhemd, Lederjacke, Anzughose – seine übliche Künstlermontur. Er war etwa zwei Köpfe größer als Zither. Plus Hut.
Münther hatte sie nicht ins Haus gebeten, sondern war mit ihnen zum Landgasthof Schwanen gegangen. Sie bestellten Tee. Die Küche hatte geschlossen, doch die Kellnerin erbot sich, ihnen ein Zvieri aufzuwarten – „eine Jause“, übersetzte Münther.
Der Imbiß löste zumindest Aton die Zunge. Er berichtete, daß sie auf dem Weg zur Villa Diodati am Genfersee gewesen und in Luzern von „den Ereignissen“ überrascht worden waren. In Ermangelung anderer Alternativen hatten sie sich schließlich entschlossen, auf dem Fußweg nach Österreich zurückzukehren …
„Welches Österreich?“, unterbrach ihn Münther.
Zither hatte bisher kein Wort gesprochen, still seine Milchbrötchen gegessen und seinen Tee in kleinen Schlucken getrunken. Im Gegensatz zu Aton schien er verstanden zu haben, was die Stunde geschlagen hatte.
Münther wollte sie nicht im Haus haben und verwies sie für einen Schlafplatz an die Kaplanei. Es war nicht weit, und er nahm gern einen kleinen Umweg in Kauf, um sie nicht begleiten zu müssen.
*
Er bewohnte ein kleines Holzhaus mit Garten in der Bremgartenstraße, das er von seiner Halbschwester Alice geerbt hatte. Eigentlich ein großes Glück, doch die Umstände, wie er von dieser Erbschaft erfahren hatte, waren es nicht. Die Nachricht hatte ihn in Hall in Tirol erreicht, wo er seit einem halben Jahr wohnte. „Da Ihre Schwester vor Inkrafttreten des Testaments gestorben ist“, hieß es in dem Brief des Notars, „treten Sie, als nächster und einziger Verwandter, in die Erbfolge ein.“
Münther mußte den Brief mehrmals lesen, um ihn ganz zu verstehen. Zum einen sträubte sich etwas in ihm gegen diese Sprache, das Rotwelsch und Amtsdeutsch der Rechtspfleger, zum anderen war der Tod seiner Schwester, von der er bis zu diesem Zeitpunkt selbstverständlich angenommen hatte, daß sie am Leben sei, so beiläufig erwähnt, daß ihm die Ungeheuerlichkeit nicht gleich zu Bewußtsein kam.
Der Brief war in dieser Hinsicht tatsächlich verwirrend, da ihm eigentlich mitgeteilt wurde, daß zwei Menschen gestorben waren: seine Schwester Alice und die Ehefrau eines Patienten, den sie bis zu dessen Tod betreut hatte. Der Mann war vor seiner Frau gestorben, die Frau nach Alice. Drei Tode. Drei Kreuze.
Die umfangreiche Anlage des Briefes enthielt ein Konvolut mit Kopien des Testamentes der Frau, einen Katasterplan, Grundbuchauszüge sowie die Geburts- und Todesdaten von Alice und den Eheleuten. Demnach war Alice bereits vor einem Jahr gestorben. Juli – da war er noch in Wien gewesen. Am Nullpunkt. Am Ersticken. Erst später in Paris hatte er wieder Atem geschöpft und sich seit langem wieder wohl in seiner Haut gefühlt. Seit er die Beziehung zu Anna beendet und seinen Job bei der Zeitung aufgegeben hatte. Seit Aumeier sich aus dem Fenster gestürzt, sie seiner Feuerbestattung beigewohnt und im Jahr darauf Münthers Tochter am Zentralfriedhof verabschiedet hatten. Er und Muschg, den er auch, wie Anna, vollkommen aus den Augen verloren hatte.
Münther glaubte sich zu erinnern, daß er Muschg zum letzten Mal bei der Bestattung seiner Tochter gesehen hatte. Der Spaziergang zurück in die Stadt, vom Zentralfriedhof bis zum Schwarzenbergplatz, war ihm unvergeßlich. Sie hatten kein Wort miteinander gesprochen. Anna lag im Spital. Er war innerlich ganz schwarz vor Wut und Ohnmacht gewesen, verdunkelt von der alten Wut, die ihn beim Babyfriedhof beinahe überwältigt hätte. Also war er gegangen und Muschg neben ihm her. Die endlose Simmeringer Hauptstraße entlang wie durch einen Tunnel. Jeder Schritt eine Behauptung, während sich die alte Wut in ihm austobte, genährt von Selbstmitleid und den Vorwürfen, die er der Welt machte, ihm etwas genommen zu haben, daß ihm wirklich gewesen war. Daß seine Welt kleiner, leerer, enger geworden war. Diese alte Wut, die ihn blind und uneinsichtig gegen die eigene Erbärmlichkeit sein ließ, war Münthers bewährtes Mittel der Schuldumkehr, mit dem er sich, wenn auch nur für kurze Zeit, gegen dieses Gefühl der Schwere, das auf ihm lastete, seit er denken konnte, Luft verschaffte, bis er sich, hatten sich die Anklagen erschöpft, anfangs noch ein wenig trotzig, wieder seinem Schicksal fügte und weitermachte wie zuvor.
So war es jedenfalls bisher gewesen. Münther konnte nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es der Tod seiner Tochter gewesen oder einfach etwas in ihm zu Ende gekommen war, das diesen Kreisgang beendet hatte. Auch ließ ihn die Ahnung nicht los, daß Muschg und ihr gemeinsamer Weg zurück in die Stadt etwas damit zu tun hatten.
*
Münther hatte Anna damals vorgeschlagen, ihr Kind, nach seiner Schwester, Alice zu nennen. Anna hatte der Name gleich gefallen und als Münther ihr erläuterte, daß es eine französische Form des Namens Adelheid sei und von edlem Wesen bedeute, stimmte sie gleich zu. Ein Name, der perfekt zum Kerfschen Anwesen ihrer Eltern in Zirbenburg paßte, zu der Nobilitätssehnsucht ihres Vaters und dem verarmten Minderadel der Vorfahren ihrer Mutter.
Münthers Motive waren andere: Seine Schwester war in Pflegeheimen groß geworden. Der Vater hatte sie nicht haben wollen. Der Mann ihrer Mutter, Münthers Vater, später auch nicht. Alice war eine Jugendsünde seiner Mutter, eine Schande, wie er zu Hause immer wieder zu hören bekam. So hat sie ihren eigenen Weg gemacht, ist Ärztin geworden, in die Schweiz gegangen, hat geheiratet, Kinder bekommen. Münther hat sie dort einmal besucht, der Onkel aus Wien, seitdem schrieben sie sich oder telefonierten gelegentlich miteinander. Die Mutter wollte sie nicht sehen. Über die Vergangenheit sprachen sie nicht. In dem Jahr vor Aumeiers Tod wurde sie vom Hanusch-Krankenhaus zum ersten Mal als Konsiliarärztin verpflichtet und war danach auch beruflich oft in Wien. Doch er traf sie nur selten, weil er meist vorgab, beschäftigt zu sein.
Münther bewunderte Alice, für all das, was sie geschaffen hatte, was sie geworden war, doch es machte ihn auch scheu. Er wollte sie mit seinem verbogenen Leben nicht stören, seinen Lasten, seine Verquältheit in ihr Leben und das ihrer Kinder hineintragen, das ihm glücklich und, im Gegensatz zu seinem, geglückt schien.
Und da war auch noch die Scham, Teil einer Welt gewesen zu sein, die sie nicht gewollt und abgelehnt hatte.
Letztlich war ihm auch das, nach dem Tod seiner Tochter, zuviel geworden: seine Scham so gut wie ihr glückliches, geglücktes Leben, und er hatte den Kontakt zu ihr abgebrochen.
Anna perennis
Während Anna noch im Spital lag und von den Folgen ihrer Fehlgeburt genas, holte Münther seine Sachen aus ihrer Wohnung, warf den Schlüssel in den Postkasten und schrieb ihr einen langen Brief, den er nie abschickte. Er scheute die Auseinandersetzung und wußte, daß jeder Kontakt nur zu neuen Verletzungen geführt hätte. Dafür fehlte ihm die Kraft. Auch war er im Grunde feige, was man ihm erst auf den zweiten Blick anmerkte, da er gerne den starken Mann gab und dabei aus den Aggressionsreservoirs seiner Verletztheit schöpfte, seiner alten Wut und den Vorwürfen, die er sich der Welt zu machen angewöhnt hatte. Doch zur Durchsetzung bei entscheidenden Lebensfragen war das zuwenig, zur Lösung aus unwürdigen Verhältnissen, wie sie in der Redaktion herrschten, oder gegen die Demütigungen, die Anna ihn aussetzte, sei es wegen des mangelnden beruflichen Erfolges oder seiner unsicheren, nicht gefestigten Existenz, die sie ihm vorwarf, um damit die Axt jedesmal dort anzusetzen, wo es ihn am meisten traf: im Selbstbild seines Mannseins.
Sie waren beide Schmerzenskinder, die glücklich sein wollten und, jeder auf seine Art, alles dafür taten, daß sie es nicht wurden. Münther durch seine Unentschiedenheit und Anna, die immer dann, „wenn es ernst wurde“ und sie kurz davor waren, ihrer Beziehung eine gemeinsame Grundlage im Außen zu schaffen – Heirat, eine Wohnung, ein Haus –, aus irgendeinem nichtigen Anlaß wie im Zwang alles zerschlug, sodaß sie wieder am Anfang standen, von der Hoffnung lebten, der Verheißung eines gemeinsamen Lebens, in dem sie beide aufgehoben und „sicher“ waren.
… in ihrem Willen zum Unglück und zum Unglücklichsein, in dem sie sich eingerichtet und an das sie sich gewöhnt hat, notierte Professor Elias Schwarzkogler, zu dem Anna nach der Fehlgeburt und der Trennung von Münther in Therapie ging, in sein persönliches Journal. Und weiter:
A. K. ist im Leiden, das sie kennt, in der Unzufriedenheit, die sie fördert, zu Hause und „zufrieden“. Ursache: Vertrauensverlust (i.e. schwaches Vaterbild).
Jede Festlegung, die kein Ablaufdatum hat, löst Panik in ihr aus. In diesem Zusammenhang interessant, daß sie eine erfolgreiche Schauspielerin wurde. Die Rollen, die sie spielt, sind temporär. Menschenkostüme. Als Filmschauspielerin allerdings miserabel; starr, gestisch, unbeholfen, da sie den Raum, in dem sie gesehen („angeschaut“) wird, nicht – wie von der Bühne aus – kontrollieren kann. Mangelndes Hingabevermögen wird durch Leistung kaschiert (sich nicht Hingeben, sondern Weggeben). Dementsprechend die Sexualität, die, wenn nicht als verstörend empfunden, das Verhältnis Schauspieler–Regisseur variiert (theatralisch).
Fehlt die Rollenbeschreibung, durch die sie sich, ganz Dame, auch im sozialen Umfeld und im gesellschaftlichen Rahmen bewegt, gibt sie das Mädchen, die Verletzliche, Hilfsbedürftige (beinahe kindlich). Der Vertrauensverlust manifestiert sich in einer ständigen Bedrohungserwartung. Häufig wird sie deshalb, aus Voreiligkeit oder einem Mißverständnis, zum Aggressor. In den Sitzungen besteht keine Gefahr, da der Therapeut durch die Rollenverteilung geschützt ist.
A. K. ist sich dieser Zusammenhänge mehr oder weniger bewußt. Was sie mir erzählt, ist so uninteressant wie ihr Fall Klischee (Histrionische Persönlichkeitsstörung); was sie über sich erzählt, hat sie anderen wohl schon hundertmal erzählt; die Sitzungen gleichen Sprechproben.
Sie ist kultiviert, charmant, kann sich gut artikulieren und weiß um ihre Ausstrahlung und Wirkung auf andere (Kalkulierte Anmut). Doch finde ich das Gesicht durch übergroße Willenshaltung schon teilweise entstellt. Insgesamt erweist sich die äußere Erscheinung – auf den zweiten Blick – als schlecht gefügt, Zerrbild der Schieflage ihrer Verhaltungen: ein überproportional großer Kopf (unter der Löwenmähne), Mädchentorso, lange Arme, kurze Bocksbeine (aber schön geformte Waden). Nur die Augen sind unverletzt …
Körperliche Selbstverletzungen (sieht man von der operierten Nase ab) scheiden aus, da die Angst vor Narben überwiegt …
*
Der Wohlklang von Annas tiefer, dunkler Stimme ließ Elias mehr als einmal an Isabel denken. Früher hatte sie ihm vorgelesen. Im Schwarzen Schloß. Vor vierzig Jahren … am Anfang. Heute war niemand mehr am Leben, der um diesen Anfang wußte. Franziska nicht, der Alte Schwarzkogler nicht, Isabel … – Anna Kerf nannte Elias „Herr Professor“, obwohl sie gleich alt waren. Er kannte ihre Familie, hatte Anna aber nur gelegentlich bei offiziellen Anlässen – Taufen, Hochzeiten, Einweihungen oder Begräbnissen – zu Gesicht bekommen, den einzigen Gelegenheiten, bei denen die drei Familien – die Kerf, die Schwarzkogler und die Höller – gemeinsam öffentlich auftraten. Sonst trafen sie sich regelmäßig in der Loge, zu der Anna keinen Zutritt hatte. Annas Bruder hatte Elias nach einem solchen Treffen von ihrer Fehlgeburt erzählt und ihn gebeten, sie in Behandlung zu nehmen. Obwohl Elias, seit er die Leitung der Nervenheilanstalt Schwarzenberg übernommen hatte, keine Privatpatienten mehr behandelte, konnte er ihm die Bitte kaum abschlagen.
Nachdem Anna zwei Jahre lang jeden Freitag, wenn sie keine Vorstellung gehabt oder sich im Ausland aufgehalten hatte, zur Therapie ins Büro gekommen war, begann ihm diese Verpflichtung lästig zu werden. Den Gesprächen – er war meist nur Zuhörer und Stichwortgeber – war zwar ein gewisser Unterhaltungswert nicht abzusprechen, doch stahlen sie ihm die Zeit, die er lieber für seine Forschungen aufgewandt hätte.
Elias hatte sich im Untergeschoß der Klinik ein Labor einrichten und für die Probanden einen Pavillon adaptieren lassen, der endlich bezugsfertig war. Er bot maximal drei Patienten Platz. Zwei, die geeignet schienen und auch sonst alle Anforderungen erfüllten – keine chronischen Krankheiten oder physischen Beeinträchtigungen, keine Neigung zu aggressivem Verhalten oder Gewalttätigkeit, keine Verwandten usf. –, hatte er in der geschlossenen Abteilung ausfindig gemacht. Schwieriger erwies sich die Suche nach einer geeigneten Betreuung, idealerweise eine Pflegerin oder Krankenschwester, welche, abgesehen von Elias, die einzige Bezugsperson für die Probanden werden sollte … Das waren in etwa die Gedanken, die ihm an jenem Freitag, der ihre Beziehung von Grund auf ändern sollte, im Kopf herumgingen, während Anna Kerf sich auf seinem Sofa kunstvoll ihr Leben und Leiden zusammenbuchstabierte.
Als sie gegangen war, rief der Bruder des Alten Schwarzkogler an, um mit ihm die nächsten Schritte für den Wiederaufbau des Hauptgebäudes des Schwarzen Schlosses zu besprechen. Elias notierte sich alles, erhob kaum Einwände, sprach sich nur für den Erhalt der beiden baufälligen Treibhäuser aus, die Isabels Mutter für die Orchideenzucht genutzt hatte. Es war eine Frage des Prinzips, denn Elias war an diesen Treibhäusern nichts gelegen, doch er wußte, daß sich der Alte Schwarzkogler schon einmal gegen den Abriß verwehrt hatte. Der Alte Schwarzkogler, sein Förderer und späterer Schwiegervater, hatte ihm das Studium ermöglicht, ihn in der disciplina arcani unterwiesen und in die Loge als seinen Nachfolger eingeführt. Elias fühlte sich ihm verpflichtet, besonders nachdem er in seine Fußstapfen getreten und die Leitung der wissenschaftlichen Unternehmungen der Familie Schwarzkogler übernommen hatte. Die wirtschaftlichen Belange unterstanden weiterhin dem Bruder des Alten Schwarzkogler, der sich Elias gegenüber, obgleich dieser nur angeheiratet war, stets respektvoll verhielt.
Nach dem Telefonat blieb Elias noch am Schreibtisch sitzen. Draußen wurde es langsam dunkel.
Dann begann es zu regnen.
Der Schwarze Spiegel
Er hatte das Bedürfnis zu rauchen.
Ohne das Licht anzumachen, öffnete er die oberste Schublade des Schreibtisches, tastete nach dem Apothekerfläschchen, drückte den Gummisauger, drehte die Pipette heraus und tropfte sich den Inhalt unter die Zunge.
„All die Toten … all die Geheimnisse …“, sagte er zu Isabel in das dunkle Zimmer hinein, schraubte die Pipette wieder hinein und schloß die Schublade.
„Manchmal habe ich das Gefühl, daß mir die Heimlichkeiten zulaufen wie herrenlose Hunde. Oder Kinder, die mich über die Schulter ihrer Mütter anlachen, große Augen machen und Gesichter schneiden. Die Kerf hat ihre Heimlichkeiten in Tagebücher geschrieben. Was nicht klug war … Denn ihr Lebensgefährte hat sie eines Tages gelesen. Du warst klüger, Isabel … Erst als ich mich nach Deinem Tod in Deine Arbeit vertieft habe, ist mir bewußt geworden, daß der wahre Grund, weshalb Du der ‚Familientradition‘ gefolgt und nicht Schauspielerin, sondern Pathologin geworden bist, nicht der Wunsch Deines Vaters, sondern Deine eigene Entscheidung gewesen war – als eine Entscheidung gegen Deinen Vater, gegen seine Arbeit und später auch gegen mich.
Ich weiß nicht, wie Du ihm auf die Schliche gekommen bist, aber ich vermute, es war Franziska, die Dich auf die richtige Spur gebracht hat. Schon als Kind hat sie im Schwarzen Schloß gelebt und war eine enge Freundin Deiner Mutter – die einzige, soviel ich weiß. Ich erinnere mich noch gut an das Entsetzen, das mir der Anblick ihres entstellten Gesichtes eingeflößt hat, als ich ihr damals im Wald begegnet bin. Und Du hast mich – ahnungslos wie ich war – mit der Erklärung abgefertigt, daß es sich bei ihrer Erkrankung, um einen Tumor handelt, der allmählich die Haut verrindet und irgendetwas von einem Papillomavirus geschwatzt, das daran beteiligt sei …“
Die Wirkung des Elixiers1 setzte ein.
1 Ein psychotroper Pflanzencocktail nach der Rezeptur von Isabels Großvater, der das bildhafte Denken anregt und gleichzeitig eine Muskelerschlaffung bewirkt, ähnlich der Schlaflähme, die den Träumenden davor bewahrt, sich zu verletzen. Die Einnahme hat eine Bewußtseinsspaltung zur Folge, durch die man sich gleichzeitig als Geträumter (Doppelgänger) und Träumender wahrnimmt.
Elias hatte den Impuls aufzustehen, blieb jedoch sitzen, sah sich selbst zu, wie er aufstand und auf Gummibeinen zum Fenster trippelte. Er kicherte, als er sich aus sich erhob. Ein gnomischer Laut, der charakteristisch für die Ablösung war.
Draußen schmiegte sich das Kleid der Nacht an die Stadt. Der Geträumte schaute den Regen. Die Lichter der Straßenlampen an der Auffahrt zur Klinik. Dahinter der Park mit den schwarzen Kuppen der Bäume.
Er ging vom Fenster zum Sofa und setzte sich dem großen Schreibtisch gegenüber. Elias wußte, daß er nicht zu Isabel gesprochen hatte. Ihr Bild war nach ihrem Tod rasch verblaßt, ihre Gegenwart nach ihrem Verschwinden ein leeres Wort geworden, der Name einer legendären Stadt, von der nur die Ruinen ihrer Arbeit und die Arbeitsunterlagen überdauert hatten, in die er sich später eingewühlt hatte, aus wissenschaftlichem Interesse, aber auch weil es ihm eine Parallelwelt ihrer gemeinsamen Jahre zugänglich gemacht hatte, die ihm zu ihren Lebzeiten verschlossen gewesen war. Schon früh hatten sie vereinbart, nicht über die eigene Arbeit miteinander zu sprechen – was Elias davor bewahrt hatte, sie anzulügen oder sich vor ihr zu verschweigen, denn vieles, was ihn der Alte Schwarzkogler gelehrt hatte, war nicht für Dritte bestimmt – auch nicht, wie dieser mehrmals betont hatte, für seine eigene Tochter.
Die Schatten waren einer Finsternis gewichen, in der er sich schaute wie in einem Schwarzen Spiegel. Die direkte Konfrontation des Geträumten mit dem Träumenden, die sich aufs Haar glichen, hob die Bewußtseinsspaltung nicht auf, doch bewirkte sie eine Art Kurzschluß, der die Wahrnehmung beider veränderte. Daß man in seinem Sessel saß und sich aufstehen und durchs Zimmer gehen sah wie einen Fremden und im selben Moment aus dem Fenster in die Nacht hinausblickte, mochte ja noch angehen und war nicht weiter ungewöhnlich. Es glich im Resultat einer Doppelbelichtung, Erlebnissen im Halbschlaf oder einer Halluzination, Emanationen von Bewußtseinsresten, Verdrängtes, das Erscheinung werden wollte, psychedelischen Erfahrungen, bei denen die Grenze zur Außenwelt durchlässig und die Realität trügerisch wurde. Doch für Elias stellte dies – die temporäre Bewußtseinsspaltung und Erschaffung des Doppelgängers als Bild mit Hilfe des Elixiers – nur einen ersten Schritt bei der Herstellung des Schwarzen Spiegels dar, in der ihn der Alte unterwiesen hatte. Darauf folgte die direkte Konfrontation von Träumer und Geträumten, die den Schwarzen Spiegel erwirkte und letztlich die Einholung des Geträumten in den Träumenden ermöglichte.
„Die Doppelgängeraufnahme“, wie sich der Alte damals ausgedrückt hatte …
*
„Und letztlich: Die Doppelgängeraufnahme“, sagte der Alte mit einem triumphalen Unterton in der Stimme. Elias hätte gern seine Begeisterung geteilt, doch erschloß sich ihm nicht, weshalb man zuerst eine Bewußtseinsspaltung provoziert und einen Doppelgänger erschafft, nur um ihn dann wieder in sich aufzunehmen. Warum, so sein Einwand, die Bewußtseinsspaltung nicht gleich in sich hervorrufen …
„Weil Sie dann geisteskrank sind“, unterbrach ihn der Alte schroff.
„Die Erschaffung von Doppelgängern“, fuhr er fort, „ist auf viele Weisen möglich, und Sie werden in unserem Archiv einige Literatur darüber finden. ‚Der Geträumte‘, wie wir ihn auch nennen, hat, im Gegensatz zu anderen Spielarten des Doppelgängers, kein Eigenleben. Er ist ein lebendes Bild, abgelöst von Ihrer äußeren Erscheinung, kein Abbild, sondern ein Bild. Und ein Bild, wie es uns Oscar Wilde in seinem Dorian Gray so trefflich beschrieben hat, ist nicht den Gesetzen der Zeitlichkeit unterworfen.“
Der Alte war in seinen belehrenden Ton verfallen, der, wie Elias fand, wenngleich etwas anstrengend, gut zu seinem enzyklopädischen Wissen paßte. Trotzdem reizte ihn dieser Ton (wie damals noch alles Autoritäre), und er hatte einwenden wollen, daß auch Bilder Alterungsprozessen unterworfen sind, eine Patina bekommen usf., doch sich dann erinnert, mit wem er es zu tun hatte und sich das Klügeln verkniffen. Es war schon klar, daß der Alte nicht die Bilder auf Leinwänden meinte …
„Und was ist der Unterschied zum Abbild?“
„Abbilder sind gefrorene Zeit. Bilder leben. Sie parasitieren an der Gestalt.“
Das klang stimmig und vertraut, doch Elias, obgleich er jedes Wort verstand, begriff das Gesagte nicht. Ähnliche Erfahrungen hatte er schon früh bei philosophischen Lektüren gemacht. Manchmal kam die Einsicht später, manchmal nicht. Für den Moment jedoch löste es ein Gefühl des Unvermögens und Versagens in ihm aus, das sich auch bei einfachsten Tätigkeiten einstellen konnte.2
2 Besonders traumatisch in diesem Sinn war für Elias das Basteln eines Quaders aus vorgestanztem Karton für den Mathematikunterricht gewesen.
„Ich formuliere es nicht absichtlich so, daß Sie es nicht verstehen können, Elias … – Ja?“
„Ja.“
„Gut. – Weiter: Bei der direkten Konfrontation von Träumer und Geträumten wird der eine, sieht man von den jeweiligen Hintergründen ab, zum Spiegelbild des anderen. Im Grunde vervierfacht man sich in dieser Situation. Träumer wie Geträumter schauen einerseits in den Spiegel hinein, andererseits – da sie gleichzeitig ‚Angeschaute‘ sind – aus dem Spiegel heraus. Sind Betrachter und Objekt der Betrachtung.
Also: Zwei Betrachter plus zwei Betrachter ergibt vier. Das klingt komplizierter als es ist, weil wir daran gewöhnt sind, ein Spiegelbild nicht als Spiegelbild wahrzunehmen – Beckett hat das gleich verstanden.“
„Samuel Beckett?“
„Ja. Sie finden von ihm, falls es Sie interessiert, eine wunderbare Übersetzung der ‚Arbeiter des Meeres‘ von Victor Hugo im Archiv.“
Der Alte Schwarzkogler besaß eine Bibliothek mit exklusiven, für ihn angefertigten Übersetzungen von Autoren, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren.
„Aber das sind Geschichten für einen anderen Tag. – Jedenfalls: Spiegelbild, Abbild, Ebenbild – wer hier nicht zu unterscheiden weiß, kann kein gültiges Wirklichkeitsverständnis entwickeln. Er klebt an der Realität wie ein totes Insekt an der Windschutzscheibe eines Kraftwagens.“
Der Alte stieß ein kurzes, meckerndes Lachen aus und verließ grußlos das Labor. Elias machte sich noch einige Notizen, die später hilfreich sein konnten, wenn er das Elixier einnehmen würde. Manchmal fragte er sich allerdings, ob die verwirrende Art der Unterweisung beim Alten Schwarzkogler nicht Methode war, um ihn zu prüfen und ihm absichtlich Fallen zu stellen. Die Praktiken, die er lehrte, waren nicht ungefährlich. Eine Versehrung, sei es geistiger oder körperlicher Natur, war noch das kleinste Übel, mit dem er dabei zu rechnen hatte.
*
Im früheren Rußland stellten junge Mädchen zu Heiligabend einen großen Spiegel einem kleineren gegenüber und dazwischen eine Kerze. Das Mädchen bat den Spiegel, ihr den zukünftigen Mann zu zeigen, und sobald dieser sichtbar wurde, mußte sie schnell „Gott stehe mir bei“ ausrufen, sonst konnte der Doppelgänger des Gezeigten aus dem Spiegel treten und dem Mädchen, das ihn gerufen hatte, Böses antun … Solche und ähnliche Legenden las Elias am Abend jenes Tages in dem Spiegelbrevier, das ihm der Alte zur Lektüre empfohlen hatte. Über Schwarze Spiegel fand er wenig. John Dee, der Astrologe, Mathematiker und Hofmagier der Königin Elizabeth, soll einen Spiegel aus Obsidian besessen haben, mit dessen Hilfe er Engel anrief. Schwarze Spiegel