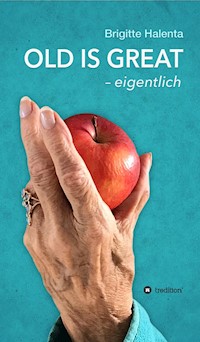5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Mutter überrascht ihren siebzehnjährigen Sohn in ihrem Keller bei dem Versuch, ein fremdes dreijähriges Mädchen zu missbrauchen. Der Sohn flieht, die Mutter kümmert sich um das Kind. Das vernachlässigte kleine Mädchen klammert sich an die fremde Frau und erwählt sie zu seiner besseren Mutter. Es entwickelt sich eine Familiengeschichte der besonderen Art, die nicht nur vorführt, wie leicht man unschuldig schuldig werden kann, sondern auch wie schnell erfundene Geschichten zur Wahrheit werden. "Erst die Liebe zu Dodo hatte es möglich gemacht, auch endlich zu sich selbst freundlich zu sein. Jetzt, indem sie Dodo liebte und deren Bedürfnisse wichtiger waren als ihre eigenen, heilte sie sich selbst. Sie war nicht mehr dieselbe."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Brigitte Halenta
Das letzte Wort hat Dorothee
Die vierunddreißigjährige Protagonistin Marlies Hanloe ist eine durchschnittliche Person, der ein durchschnittliches Schicksal vorgezeichnet gewesen wäre, aber sie begeht eine strafbare Handlung, aus der ihr ein ganz besonderes Leben erwächst.
Sie verliebt sich in ein Kind, das ihr nicht gehört, und behält es wider besseres Wissen bei sich. Sie glaubt, damit ihren siebzehnjährigen Sohn zu schützen, der sich wahrscheinlich an der kleinen Dorothee vergangen hat. In Wahrheit aber folgt sie zum ersten Mal in ihrem Leben ihrem Herzen.
Mit dieser strafbaren Handlung beginnt der schwierige Weg ihrer Entwicklung zu einer außergewöhnlichen Frau. Sie baut für Dorothee, für sich und für den Sohn eine fiktive Wirklichkeit auf, die alle drei vor der Wahrheit schützt. Dorothee wächst zu einer fröhlichen, musikalisch sehr begabten jungen Frau heran, die nichts von ihrer wahren Herkunft ahnt.
Erzählt wird eine Geschichte über diese absurde Welt, in der das größte Recht das größte Unrecht sein kann – und umgekehrt: das größte Unrecht das größte Recht. Dabei geht es auch um die Liebe als der einzigen Kraft, die Unrecht wiedergutmachen kann.
Brigitte Halenta, Jahrgang 1937, lebt und schreibt in Lübeck. Bis 2010 war sie als Psychotherapeutin in eigener Praxis tätig. Obwohl sie schon immer geschrieben hat und Texte von ihr in verschiedenen Literaturzeitungen erschienen sind, konnte sie sich erst nach Aufgabe ihrer Berufstätigkeit ganz dem Schreiben widmen. Im März 2007 stellte sie ihren ersten Roman DIE BREITE DER ZEIT (Orlanda Verlag, Berlin) in einer stark gekürzten Fassung im Buddenbrookhaus in Lübeck vor. Die Neuauflage des Romans ohne Kürzungen ist 2016 bei Tredition, Hamburg, erschienen.
Brigitte Halenta
DAS LETZTE WORT HAT DOROTHEE
Roman
Impressum:
© 2016 Brigitte Halenta, Grillenweg 17, 23562 Lübeck
3. Auflage 2017
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Lektorat: Ingeborg Mues, Berlin
Satz: Jeannette Zeuner
Layout & Umschlag: David Halenta, Design & Development
Umschlagfoto: photocase.de (pollography #425445)
Druck & Vertrieb: tredition GmbH, Hamburg
978-3-7439-5192-1 (Paperback)
978-3-7439-5193-8 (Hardcover)
978-3-7439-5194-5 (e-Book)
Erfahren Sie mehr über die Autorin unter: www.brigittehalenta.de
1. Kapitel
Wer sein altes Leben aufgab, um an einem anderen Ort ein neues zu beginnen, sollte auf alles gefasst sein. Einmal von den Fesseln seiner gewöhnlichen Ordnung befreit, machte das Herz womöglich nur noch, was es wollte. Das konnte nicht gutgehen. Ordnung war das halbe Leben, hatte sie gelernt; vielleicht – aber nur vielleicht – war das ganze: Unordnung. Undeutlich tauchte die Vision von einem Leben auf, das ganz war und darum glücklich. Das Bild versank so unvermutet, wie es gekommen war. Mutti hatte kein Auge für Glück, nur für Ordnung.
Marlies Hanloe war gerade im Keller ihres Mietshauses auf der alten Chaiselongue ihrer Mutter aufgewacht. Es war endlich Dienstag, der 7. August 1979, und es war der erste Tag ihres neuen Lebens in Bremen. So lange hatte sie auf diesen Tag gewartet, und jetzt sollte sie sich eigentlich freuen und weiter nichts, nur freuen, aber leider verdarb ihr ihre Mutter auch an diesem Morgen die Laune. Obwohl sie seit sechs Jahren tot war, hörte sie ihre Stimme, zwar leise, aber so eindringlich, als säße Mutti neben ihr:
Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, Marlies! Als wenn wir euch nicht genug Geld hinterlassen hätten, um in einem anständigen Hotel zu übernachten. Was sollen die Mieter denken, wenn sie dich dabei überraschen, wie du dich heimlich in der Waschküchewäschst. Als Eigentümerin kannst du dir so etwas nicht leisten, es untergräbt den Respekt. Überhaupt, Marlies, du kannst sagen, was du willst, das Ganze ist eine Schnapsidee. Sieh dich doch einmal an. Du bist vierunddreißig, unverheiratet mit einem unehelichen Sohn, der mit siebzehn schon so oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, dass er lange im Gefängnis gelandet wäre, wenn du Albrecht nicht gehabt hättest. Den hättest du heiraten sollen, das war ein feiner Mann. Aber mit dir und Thommi hält es ja wohl kein Mann lange aus. Jetzt wäre doch der Augenblick gekommen, endlich einmal Stabilität in dein Leben zu bringen. Du hast unser Haus geerbt, damit kannst du wirklich zufrieden sein. Ein Haus in Bremerhaven, in dieser Lage, am Leher Tor, wird immer gute Mieten bringen! Von den Einnahmen kannst du leben, und die große Wohnung im Erdgeschoss für dich und Thommi allein, damit hast du doch einen Stand und bist wer. Wenn du deine Arbeit im Krankenhaus aufgibst, kannst du endlich ganz für Thommi da sein; vielleicht wird dann ja noch etwas Anständiges aus ihm. Aber was machst du? Du gibst Thommi in eine Einrichtung und ziehst nach Bremen an die Universität. In unserer Familie hat noch nie jemand studiert. Dafür bist du auch viel zu alt. Du wirst schon sehen, wie dich die jungen Studenten ansehen. Jeder muss da bleiben, wo ihn sein Schicksal hingestellt hat, und seine Pflicht erfüllen. Das haben wir dir damals gleich gesagt, als du mit sechzehn ankamst und schwanger warst: Große Sprünge wirst du nicht mehr machen können, wenn erst einmal das Kind da ist. Du kannst dich noch froh und glücklich schätzen, dass du diese Schwesternausbildung hast. Aber dafür hat Thommi bezahlt, da kannst du sagen, was du willst. Ich war immer voll und ganz für meine Kinder da. Das wurde auch einfach erwartet, ihr jungen Frauen heute, ihr macht ja, was ihr wollt, und dann sind die Kinder die Leidtragenden, wie Thommi, der nicht weiß, was Recht und Ordnung ist, keinen Respekt vor Erwachsenen hat, für die Schule nichts tut, nur mit seinen Kumpeln herumhängt und seine Mutter anbrüllt, wenn sie etwas von ihm will.
Ach, Mutti!
Marlies drehte sich mit dem Gesicht zur Betonwand, machte sich krumm, um dem Höcker in der Polsterung der Chaiselongue auszuweichen. Genau deshalb war Thommi jetzt in Bremerhaven im Jugendförderungswerk bei Olli Timm, da hatte er noch eine Chance. Olli hatte gesagt, er mache sich gut, er habe Potential. Thommi hörte auf Olli. Sie schlossen Verträge ab: eine Woche keinen Alkohol, regelmäßiger Besuch des Unterrichts, alle Schularbeiten pünktlich und dergleichen. Thommi hielt sich daran. Seit sechs Wochen hielt er sich daran. Als Belohnung bekam er Punkte für Vergünstigungen. „Wenn er so weitermacht“, hatte Olli gesagt, „hat er in einem Jahr seinen Hauptschulabschluss in der Tasche und gleichzeitig das erste Lehrjahr als KFZ-Mechaniker.“ Olli hatte auch gesagt: „Eigentlich ist Thommi ein ganz Lieber.“
Es war Olli, der sie in letzter Minute überredet hatte, Thommi doch noch die Musiktruhe zu überlassen. Die Möbelträger hatten sie in den Keller gestellt. Am Sonnabend hatte Olli Zeit, dann wollten die beiden das schwere Ding mit Ollis Auto abholen. Sie hatte Thommi vorgestern den Zweitschlüssel zum Keller gebracht. Alles war besprochen. Sie würde sich in Bremen etwas Neues kaufen. Was Modernes, vonBraunvielleicht, in Weiß, so wie Albrecht es hatte.
Seit drei Monaten war sie nicht mehr in seiner Wohnung gewesen und Albrecht nicht in ihrer, telefoniert hatten sie auch schon lange nicht mehr. Die endgültige Trennung war so schleichend gekommen, dass sie es gar nicht gemerkt hatte. Ohne Thommi hätte es geklappt, sie hätten vielleicht sogar geheiratet, aber einen straffälligen Jugendlichen in der Familie zu haben, das konnte sich ein Rechtsanwalt wie Albrecht nicht leisten.
Sie legte sich auf den Rücken und tastete nach der buckeligen Erhebung in ihrer Unterlage. Eine Verwerfung in der Polsterung, harmlos unter ihrer Hand, aber ein Folterwerkzeug in ihrem Kreuz. Für eine Nacht würde das schon gehen, hatte sie gestern Abend noch gedacht, und wahrscheinlich war es hier unten sogar angenehm kühler gewesen als in den von der Tageshitze aufgeheizten Wohnungen der Mieter über ihr, aber ihr Kreuz fühlte sich an, als würde es bei dem Versuch, sich aufzurichten, nicht mitmachen, sondern einfach auseinanderbrechen.
Eine schlechte Verfassung, um ein neues Leben zu beginnen, aber sie passte zu ihren Zweifeln und zu ihren Ängsten. Noch immer konnte sie nicht glauben, dass es ihr tatsächlich gelungen war, alles zu regeln. Die erdrückende Sorge um Thommi war sie endgültig los, und sie hatte für das Wintersemester 1979/80 einen Studienplatz für Germanistik. Dass man sie ohne Abitur, nur aufgrund ihrer Ausbildung als OP-Schwester und ihrer langjährigen Berufserfahrung, zugelassen hatte, wunderte sie noch immer.
Der Studienplatz war das eine Glück, das andere war die schöne neue Wohnung in der Mathildenstraße, die ihr in ihrer Größe so viel angemessener für eine Person erschien als die Riesenwohnung am Leher Tor, die sie alleine mit Thommi nie wirklich mit Leben hatte füllen können. In Bremerhaven ließ sie nur die Brüder zurück, und die interessierten sich nicht für sie. Horst redete schon seit Muttis Tod nicht mehr mit ihr. Für Vatis Lieblingssohn waren sie alle krank, und mit Kranken wollte der Inhaber der GlasereiHanloe und Sohnaus Rücksicht auf seine Kunden nichts zu tun haben. Marlies’ uneheliches Kind war genauso ein Makel wie Erwins Medikamentenabhängigkeit. Nur gut, dass Mutti nicht mehr mitansehen musste, wie schlecht es Erwin in den letzten Jahren gegangen war, obwohl er doch alle Aktien geerbt hatte und nicht mehr arbeiten musste.
Ja, wenn Ulla noch da wäre! Dann hätte sie einen Rückhalt. Als sie mit Thommi schwanger war, hatte Ulla, die damals noch Fräulein Obermaier hieß, ihr geholfen. Ohne Ulla hätte sie das gar nicht durchgestanden. Ein Kind sei eigentlich etwas Wunderbares, hatte Fräulein Obermaier gesagt, und deshalb hatte sie auch alles mit dem DRK geregelt, das Heim für ledige Mütter, die Ausbildung zur Krankenschwester. Jetzt, fast zwanzig Jahre später, hatte ihr Ulla aus Israel geschrieben: Du solltest wirklich studieren, wenn es das ist, was du dir wünschst. Ulla war immer auf ihrer Seite gewesen.
Ja, studieren, das wollte sie. Viele Romane lesen, ohne dass Mutti fragte: Hast du nichts Besseres zu tun?, und am Ende vielleicht noch eine Lehrerin wie Ulla werden oder in einer Bibliothek die Bücher ausleihen oder in einer Buchhandlung die Kunden beraten. Krankenschwester hatte sie nie werden wollen. Trotzdem, sie hatte ihre Arbeit immer gut gemacht. Wenn es darauf ankam, konnte sie funktionieren wie eine Maschine, auch wenn sie völlig übermüdet war oder Sorgen mit Thommi hatte. Alle, Ärzte, Kolleginnen und Patienten, konnten sich auf sie verlassen. Nur mit Thommi hatte sie es nicht gut gemacht. Er konnte sich nie auf sie verlassen. „Sie waren noch zu jung“, hatte Dr. Becker zu ihr gesagt. Therapeuten entschuldigten immer alles. Es hätte nicht passieren dürfen, war aber passiert. Und jetzt war Thommi bei Olli, und alles würde gut werden.
Der Krach, den draußen der Müllwagen machte, drang sogar bis in den Keller, dessen Fenster doch nicht zur Straße, sondern nach hinten zum Gartenhof lagen. Sie entschloss sich, endlich die Augen zu öffnen, auf ihre Armbanduhr zu schauen und sich dem Tag zu stellen. Um zehn wollte sie zusammen mit Herrn Wetzel von der Hausverwaltung Glentschen die Wohnung an die neuen Mieter übergeben, um drei Uhr wollte der Möbelwagen mit ihren Sachen in Bremen, in der Mathildenstraße, ankommen. Es war erst halb acht. Leider. Sie sah hinüber zu ihrem Korb, der auf dem Kapitänsstuhl stand, mit einer großen Flasche Mineralwasser, den Schlüsseln für die alte und die neue Wohnung, den Mietverträgen für die neuen Mieter, mit ihrer Kulturtasche, einem kleinen Handtuch, Tempotaschentüchern, einer angebrochenen Packung Haferkekse und zwei Brötchen, die sie gestern Nachmittag noch für heute Morgen zum Frühstück geschmiert hatte. Sie hatte jetzt aber keine Lust auf durchgeweichte Marmeladenbrötchen. Sie wollte nur weg. So schnell wie möglich alles hinter sich lassen. Die A 27 nehmen, bei Bremen-Überseestadt von der Autobahn gehen, auf die B 6 in Richtung Hauptbahnhof, Utbremer Straße, Breitenweg, Rembertiring, Dobben, und endlich die Mathildenstraße! Ankommen. Sie hatte alles genau im Kopf. Und dann ihre neue Wohnung in Besitz nehmen: drei Zimmer mit einem Küchenbalkon in den Hof und einer Loggia zur Südseite. Um drei Uhr kamen die Möbel. Sie hatte Stellpläne gemacht, wo alles hin sollte. Auf die Kartons hatte sie Nummern geklebt: 1-12 in die Küche, 13-15 ins Bad, 16-21 ins Schlafzimmer, 22-28 ins Wohnzimmer und 29-38, die schweren Bücherkartons, in ihr Arbeitszimmer.
Die Vorstellung davon, wie sie ihre Bücher in die Regale einräumte, machte sie hellwach vor Freude. Sie wälzte sich herum und streifte die dünne Wolldecke ab, lindgrün, eine widerliche Farbe. Mit der Decke konnte sie nachher Muttis Chaiselongue abdecken, damit sie nicht einstaubte. Und für den Kapitänsstuhl gab es bestimmt auch noch irgendwo ein Tuch zum Abdecken.
Und wofür? Wozu? Wie lange?
Es war unmöglich, Mutti zufriedenzustellen.
Ich will dir mal was sagen, Marlies, wenn du schon all unsere guten Möbel verramschst, dann hättest du auch die Chaiselongue und den Kapitänsstuhl nicht übrig lassen müssen. Glaub mal ja nicht, dass die Sachen, wenn die hier im Keller herumstehen, besser werden. Den Kapitänsstuhl hat noch dein Großvater gekauft, er stammt aus dem 19. Jahrhundert, da wusste man Qualität noch zu schätzen. Das ist Rüster, und so gut, wie der erhalten ist, ist der mindestens tausend Mark wert.
Und wenn schon.
Sie stellte ihre nackten Füße auf den Betonboden. Kalt, aber nicht unangenehm. Eine Spinne seilte sich keinen Meter entfernt von einem der in die Luft ragenden gedrechselten Beine des Kapitänsstuhlsab. Zu Hause hatte er immer im Flur seinen Platz. Seit Muttis Tod, seit sie wieder in die Wohnung eingezogen war, hatte der Stuhl immer nur im Keller gestanden, sie hatte nie eine Verwendung für ihn gehabt. Die Spinne war auf dem Karton gelandet, der dem Kapitänsstuhl als Unterlage diente, und lief eilig auf der Fläche hin und her. Ein fast zwei Zentimeter großes Ungeheuer mit viel zu langen Beinen für den schmalen Körper. Acht Beine zählte sie, als die Spinne einen Augenblick verhielt, unschlüssig, was sie tun sollte. Sie war so nah, dass Marlies die Haare auf den Beinen sehen konnte. Sollte sie aufstehen und die Spinne töten oder mit einem Glas einfangen? Sie hatte hier unten aber kein Glas, nur den Becher von ihrer Thermosflasche. Die Spinne verschwand in der Ritze, den die beiden Hälften des Deckels gelassen hatten. Nun war sie im Karton, krabbelte in Muttis Fleischwolf herum, in den alten Durchschlägen aus Emaille, in dem Geschirr mit den Streublümchen, das vielleicht Thommi einmal brauchen könnte, wenn er eine eigene Wohnung hatte.
Gut so. Sie würde nicht die einzige Spinne bleiben. Marlies hatte ein Paradies für Spinnen geschaffen. Wenn Thommi die Musiktruhe abgeholt hatte, würden die Spinnen hier so lange ungestört leben und sich vermehren können, bis sie mal wieder Lust hätte, sich diesen Keller voller Überreste ihres alten Lebens anzugucken. Denn Thommi sollte ihr unbedingt den Kellerschlüssel mit der Post nach Bremen schicken. Das hatte sie ihm eingebläut. Sie wollte nicht, dass er hier, am Leher Tor, noch als Sohn der Hauseigentümerin auftauchte und womöglich von unzufriedenen Mietern angesprochen wurde. Damit sollte sich jetzt die Hausverwaltung Glentschen herumschlagen. Hoffentlich vergaß er das nicht wieder. Man konnte sich auf ihn einfach nicht verlassen. Oder vielleicht jetzt doch? Sie musste sich erst daran gewöhnen, dass Olli meinte, Thommi habe einen guten Kern.
Mutti hatte Erwin gehabt mit seinen komplizierten Ernährungsplänen und der ewigen Angst, dass er blöd würde, wenn er etwas Falsches gegessen hatte, und sie hatte Thommi mit der ewigen Angst, dass er wieder etwas angestellt hatte. Vielleicht wenn er einen Vater gehabt hätte, aber er hatte keinen. Nur sie, und sie war immer müde gewesen, zu müde, um mit ihm zu spielen. Wenn man den Lernschwestern nicht so viel abverlangt hätte, wenn sie mehr freie Zeit gehabt hätte, dann hätte sie sich auch besser um Thommi kümmern können. So war sie immer nur froh gewesen, wenn er friedlich war und sie sich ausruhen konnte. Sie war viele Jahre eine alleinerziehende Mutter am Rande ihrer Kraft gewesen, die ihrem Kind nicht einmal den Namen seines Vaters nennen konnte. Mottki war ein Phantom.
Sie hatte tatsächlich nicht gewusst, wie Mottki richtig hieß; keiner nahm ihr das ab, aber es war die Wahrheit. Klaus, hatte er, glaubte sie, zu Anfang mal gesagt, er hieße Klaus, aber sie nannte ihn immer nur Mottki nach der Aufschrift auf seinem Volkswagen:Mottki – Reinigung mit System.Vielleicht war er in Bielefeld zu Hause, er redete aber auch von Osnabrück, sie wusste es nicht, und sie hatte sich nie dafür interessiert. Das Tollste an Mottki war, dass er sie von der Schule abholte und dass dann alle ihre Freundinnen ihn sehen konnten. Sie beneideten sie um einen erwachsenen Freund, der ein bisschen wie Dieter Borsche aussah, der ein Auto besaß und über Geld verfügte.
Die Freundinnen nannten ihn Mottki, also nannte sie ihn auch Mottki, und am Montagmorgen konnte sie ihnen erzählen, was sie am Wochenende alles mit Mottki gemacht hatte, in Bremen oder in Cuxhaven. Meistens fuhren sie nach Cuxhaven. Wenn er sie am Sonntagabend ein Stück entfernt vom Leher Tor absetzte, damit es nicht auffiel, und sagte: „In vierzehn Tagen wieder“, war sie glücklich. Mehr wollte sie gar nicht, denn das Wichtigste an Mottki war, dass er Aufmerksamkeit für sie hatte. Er begutachtete die Länge ihrer Röcke, lobte die neuste Frisur, hörte sich geduldig ihre endlosen Geschichten über ihre Familie und die Schule an, bestellte in den Restaurants widerspruchslos alles, was sie probieren wollte, und er ging mit ihr ins Kino. Zusammen sahen sie so unterschiedliche Filme wieDon Camillo, Lieben Sie Brahms?undSchwarzwaldmädel, und die ganz Zeit hielt er ihre Hand. Mottki fand nichts dabei, wenn sie sich vor Vergnügen auf die Schenkel klopfte oder beim Happy End in Tränen zerfloss.
Zum Dank ließ sie ihn abends im Hotelzimmer gewähren; er machte es schnell und diskret, so als sollte sie möglichst wenig davon mitbekommen. Zwar war sie im Schulunterricht über die Tatsachen der Fortpflanzung aufgeklärt worden, aber irgendwie hatte das nichts mit dem Geschehen in den Hotels zu tun. Sexualität, unter der sie sich das Wunder der Liebe vorstellte, das sich ganz von selbst entfalten würde wie eine Blüte am Morgen unter den ersten Strahlen der Sonne, konnte nichts mit diesen paar Minuten unter der Decke zu tun haben, die einfach nur ein seltsames Gefühl im Bauch erzeugten, das schnell vorüberging.
Irgendwann kam Mottki nicht wie versprochen. Irgendwann, nach Wochen, in denen sie an jeder Straßenecke weiße Volkswagen auftauchen sah, gab sie es auf, darauf zu warten. Sie hatte keine Verbindung zu ihm, keine Telefonnummer, keine Adresse. Dass er nicht mehr kam, war eine große Enttäuschung, die sie so lange vor ihren Freundinnen mit fantasievollen Geschichten vertuschte, bis ihr flacher Bauch sich derart rundete, dass ihr niemand auch nur ein Wort glaubte.
Mutti hatte schon seit längerem halbherzige Fragen gestellt, auf die sie keine Antworten erwartete: „Mit dir ist doch wohl alles in Ordnung?“ Oder: „Wie kann das angehen, dass dir der rotkarierte Rock schon wieder nicht mehr passt!“
Zu Muttis Geburtstag im März waren Tantlene und Onkel Wolfgang mit den Kindern da, Eddy, Angela und Renate. Eddy und Erwin, beide fünf, vertrugen sich gut und spielten wie die Bekloppten Kriegen um den Tisch herum. Angela – mit drei – nervte alle mit endlosen Fragen, und Renate, noch ein Baby, schrie. Marlies bekam wie immer von Tantlene auch noch ein verspätetes Geburtstagsgeschenk, ein Necessaire-Etui, und weil plötzlich für einen Augenblick, als sie das Geschenk auspackte, alle Aufmerksamkeit bei ihr war und ihr unbehaglich wurde, bedankte sie sich hastig, wendete sich zur schreienden Renate und nahm sie mit hinaus. Ihre Abwesenheit vom Familientisch gab ihnen vielleicht Gelegenheit, über sie zu reden, gab Mutti wahrscheinlich die letzte Gewissheit und den Mut, ihre verstreuten, undeutlichen Wahrnehmungen in der einzig logischen Schlussfolgerung zu verdichten: Marlies war schwanger.
Als die Verwandtschaft abgefahren war, stellten sie sie zur Rede. Vati und Mutti, in Vatis Arbeitszimmer. Es war ein Verhör. Sie hatte nicht vor zu leugnen. Sie hatte auf diese Stunde gewartet, sie war vorbereitet. Es hatte fünf Monate gedauert, bis sie es merkten. Vati war immer mit seinem Betrieb beschäftigt, Mutti mit Erwin und seiner Phenylketonurie, sie hatten ja auch nicht bemerkt, dass sie ganze Wochenenden nicht zu Hause gewesen war. Der gemurmelte Name einer Freundin hatte genügt, Mutti zweitägige Abwesenheiten zu erklären. Marlies war bei Heide oder bei Gerti oder bei Beeke. Sie fragten nicht einmal nach, ob bei Heide, Gerti oder Beeke vielleicht auch Jungs dabei wären. Sie waren es so gewohnt, dass sie keine Probleme machte, sie dachten einfach nicht daran. Mutti wusste, dass sie seit drei Jahren ihre Periode hatte, aber Marlies war nicht sicher, ob Vati es auch wusste. Aufklärung gab es in der Schule, darum hatten Vati und Mutti sich nie gekümmert. Sie war sich ziemlich sicher, dass auch Vati Horst nie beiseite genommen hatte. Sexualität kam in der Familie einfach nicht vor. Zärtlichkeiten übrigens auch nicht, weder zwischen Vati und Mutti, noch mit den Kindern, sobald sie in die Schule gingen.
Mutti brach in hysterisches Schluchzen aus, Vati schrie mit hochrotem Kopf: „Wie kannst du uns das antun!“, dabei hatte sie jede Frage, so gut sie konnte, beantwortet. Nicht nur, dass seine Tochter der Familie Schande machte (und was sollten die Kunden denken!), machte ihn wütend, die Tatsache, dass es keinen Verursacher gab, dem man die Schuld geben undden man zu Zahlungen heranziehen konnte, beleidigte Vatis Vorstellungen von Recht und Ordnung. Sie hatte Vati und Mutti noch nie so außer sich gesehen, obwohl mit Hilfe von Fräulein Obermaier doch schon alles geregelt war. Da hatte sie auch geschrien, einen Satz nur, der ihr wie von selbst auf die Zunge kam, von dem ihr erst später, als sie darüber nachdachte, klar wurde, dass er wahr war. Noch nie hatte sie Vati und Mutti Widerworte gegeben, aber jetzt schrie sie: Wenn ihr euch mehr um mich gekümmert hättet, wäre das nicht passiert! Da wurden sie ganz still, dann fing Mutti leise an zu weinen, und Vati verließ türenschlagend sein Arbeitszimmer und redete die nächsten zwei Jahre kein Wort mehr mit ihr.
Darauf war sie noch immer stolz, auf diesen Satz, und darauf, dass sie tatsächlich noch vor Ostern zu Hause ausgezogen war. Mit sechzehn, im siebten Monat schwanger. Niemand hatte versucht, ihr das auszureden. Wie schön wäre es gewesen, wenn Mutti gesagt hätte: „ Du kannst doch auch bei uns wohnen bleiben, wenn du deine Ausbildung machst. Dein Zimmer ist doch groß genug, auch für ein Baby, und tagsüber bringst du es dann in die Betreuung.“ Aber das sagte Mutti natürlich nicht, weil Vati es nicht geduldet hätte.
Die letzten Wochen zu Hause lebte sie wie in einer leeren Blase; niemand redete mit ihr über das bevorstehende Ereignis oder fragte mal nach, wie es ihr denn so gehe. Mutti sah sie von Zeit zu Zeit nur vorwurfsvoll seufzend an, so, als hätte sie gerade von ihr nicht erwartet, dass sie ihr zu den großen Sorgen um Erwin noch zusätzliche aufbürdete.
In dieser Zeit wurde Ulla ihre Ersatzmutter, auch wenn sie sie da noch Fräulein Obermaier nannte. Für ihre Mitschülerinnen war der sich rundende Bauch allerdings höchst interessant. Sie waren nicht alle freundlich zu ihr, sie hörte manches hämische Wort hinter ihrem Rücken. Später erfuhr sie, dass sogar die Eltern von zwei Mitschülerinnen sich bei der Direktorin beschwert hatten, ihr Anblick verderbe die guten Sitten. Sie verdankte es einzig und alleine Ullas Fürsprache, dass sie die zehnte Klasse beenden konnte. Sie war immer eine sehr gute Schülerin gewesen, das hatte die Sache wahrscheinlich erleichtert. Lieb war Beeke, wenn sie auf dem Schulhof extra auffällig ihren Arm nahm und mit ihr herumspazierte; sie war auch die Einzige von allen Schulfreundinnen, die sie nach der Entbindung im DRK- Krankenhaus besuchte.
Thommi wurde am 2. Juli 1962 geboren, morgens um vier. Sie hatte nicht viel davon mitgekriegt, weil es ein Kaiserschnitt war. Es war eine Querlage, so fing das schon an mit ihm. Er lag immer quer. Sie nannte das Baby Thomas nach Ullas früh verstorbenem Bruder. Außer von Ulla und Beeke hatte sie keinen Besuch. Sie hatte zu Hause nicht Bescheid gesagt, dass das Baby da war. Sie hatten ja nicht mal nach dem berechneten Geburtstermin gefragt. Mutti hatte ihr später deshalb Vorwürfe gemacht, es hätte sich einfach gehört, dass man den Großeltern Bescheid sagte. Mutti rief Anfang August im DRK-Mutterhaus an und fragte sich durch. Sie besuchte Thommi zum ersten Mal, als er schon vier Wochen alt war. Unglücklicherweise war sie gerade auf Station und konnte bei diesem ersten Treffen von Großmutter und Enkel nicht dabei sein. Zwei Tage später bekam sie ein Päckchen mit drei Strampelanzügen. Da hatte sie geheult.
Es war halb neun. Sie griff sich ihre Kulturtasche und das Handtuch und lief auf nackten Füßen, in Bluse und Unterhose, so wie sie die Nacht verbracht hatte, in die Waschküche. Eine Waschmaschine lief, von den Mietern war niemand zu sehen. Am Ausgussbecken war am Wasserhahn ein kurzer Schlauch angebracht, dessen Ende am Boden über dem Abfluss lag. Sie wendete vergebens ihre ganze Kraft auf, um den Schlauch abzuschrauben, aber ohne Werkzeug war hier nichts zu machen. Sie widerstand dem Impuls, das Sieb zu reinigen, stellte das Wasser an und fuhr sich einen Schritt neben dem Abfluss mit dem Strahl so ungeschickt über das Gesicht, dass nicht nur ihre Füße, womit ja zu rechnen gewesen war, sondern auch ihre Bluse nass wurde. Hastig tupfte sie Gesicht und Bluse ab und lief zurück zu ihrem Kellerraum. Plötzlich war die Vorstellung, jemand aus dem Haus könnte sie beim Zähneputzen über dem Ausgussbecken überraschen, unerträglich. Ich habe Frau Hanloe doch tatsächlich im Keller beim Zähneputzen gesehen mit nackten Füßen und ungekämmt, mit nichts weiter an als ihrem Schlüpfer und einer nassen, zerknitterten Bluse. Darüber würden sie sich mit Vergnügen die Mäuler zerreißen.
Marlies aß zwei Haferkekse und spülte sich den Mund mit einem großen Schluck aus der Wasserflasche. Der Blusenstoff klebte unangenehm kühl an ihrer Haut, und sie hatte nichts zum Wechseln. Doch! Vielleicht war in dem Karton mit den alten Kleidern, die sie eigentlich zum DRK hatte bringen wollen, noch etwas Brauchbares. Vielleicht hatte sie deshalb vergessen, ihn wegzubringen, damit sie heute Morgen noch etwas Trockenes zum Anziehen hatte.
Es war fast halb zehn, als sie bis auf die rosa Bluse, die sie eigentlich nur wegen ihrer Farbe aussortiert hatte, alles zurück in den Karton stopfte. Der Stoff war noch gut, nicht mal sehr zerknittert. Heute Morgen war Rosa okay. Als sie die Bluse übergezogen hatte, sah sie an sich herunter und fand nichts an sich auszusetzen. Zu ihrer leichten hellgrauen Hose sah die Bluse sogar gut aus. Damit war sie fertig angezogen, ordentlich gekämmt und unauffällig geschminkt. Alles, was herumgelegen hatte, konnte wieder im Korb verstaut werden. Das war es dann wohl. Ach ja, Muttis Chaiselongue. Sorgfältig deckte sie Muttis Prunkstück mit der grünen Decke ab; für den Kapitänsstuhl hatte sie nichts Geeignetes mehr gefunden. Das war nicht so schlimm. Da er auf dem Kopf lag, konnte er nur auf der Rückseite einstauben.
Jetzt hatte sie Lust auf die Wärme des Tages, von dieser dämmrigen Kellerkühle hatte sie genug. Es war Zeit, in die Wohnung zu gehen. Entschlossen griff sie nach ihrem Korb – und setzte ihn gleich wieder auf die Kiste zurück. Er war zu schwer, um ihn den ganzen Morgen mit sich herumzuschleppen, außerdem blieb das Mineralwasser hier unten kühler. Sie nahm nur die Mietverträge heraus und den Schlüsselbund für die neuen Mieter, warf sich ihre kleine Umhängetasche über die Schulter und verließ den Keller. Auf der Treppe horchte sie, ob irgendwelche Mieter im Treppenhaus unterwegs waren. Sie hatte keine Lust, noch irgendjemand zu begegnen, um erneut Abschiedsfloskeln zu tauschen. Sie hatte sich gestern von allen verabschiedet und damit basta. Es war aber ganz still im Haus, nur die Wärme nahm mit jedem Schritt nach oben spürbar zu. Sie schloss die Wohnungstür auf, schlüpfte hinein und schloss die Tür schnell wieder hinter sich, so geräuschlos wie möglich.
Gut, dass sie schon eine halbe Stunde früher da war, in den Räumen stand die heiße Luft. Sie ging von Zimmer zu Zimmer, als wäre es eine fremde Wohnung, um die sie sich kümmern musste, und riss alle Fenster auf. Dann war nichts mehr zu tun, als zu warten. Sie lehnte sich in Vatis Arbeitszimmer an die Wand, dort war es am kühlsten, sein Fenster ging nach Norden. Es fiel ihr ein, dass es vielleicht klüger gewesen wäre, die Flasche Wasser mit heraufzunehmen, aber sie verspürte auch keine Lust, deshalb noch einmal in den Keller zu gehen. Sie hatte noch keinen Durst, aber Trinken hätte vielleicht die Wartezeit verkürzt. Möglicherweise kam Herr Wetzel ja auch früher, oder die Familie Meinken mit ihren vier Kindern hatte vor lauter Vorfreude die Fahrt von Hannover bis Bremerhaven schneller geschafft als geplant. Sie war gespannt auf die Familie. Deshalb hatte sie auf einer persönlichen Schlüsselübergabe bestanden, sie wollte keine fremden Leute in der Wohnung haben. Herr Wetzel, der mit dem Ehepaar gesprochen und auch Fotos von den Kindern gesehen hatte, hatte ihr versichert, dass ihr die Familie Meinken gefallen würde.
Pünktlich um zehn Uhr klingelte es. Herr Wetzel nur in Hemd und Hose mit gelockertem Kragen, kleinen Schweißperlen auf der Stirn und einer Aktentasche. Er war nicht mehr der Jüngste, und die Hitze machte ihm mehr aus als ihr.
„Frau Hanloe, guten Morgen, bitte entschuldigen Sie meinen Aufzug, ich habe mir erlaubt, mein Jackett im Auto zu lassen, wir haben jetzt schon neunundzwanzig Grad, ich bin sicher, das Quecksilber klettert heute wieder über dreißig Grad.“
Herr Wetzel war auch ohne Jackett eine würdevolle Erscheinung, graumeliert und beleibt, im Übrigen war ihr alles recht, nur schnell sollte es gehen. Sie machte eine beschwichtigende Handbewegung: „Kommen Sie, wir gehen nach hinten, die Räume zum Hof sind die kühlsten.“
Herr Wetzel folgte ihr. Dann breitete er die vorbereiteten Mietverträge auf der Fensterbank aus, ging noch einmal alle Artikel mit ihr durch, verbesserte handschriftlich ein Detail in ihren Vertragskopien und berichtete lang und breit von der Verhandlung mit dem Ehepaar Meinken und von dem strittigen Punkt, an dem die Unterzeichnung der Verträge im Büro gescheitert war, nämlich der Erlaubnis, Tiere zu halten. Die vier Meinken-Kinder wollten einen Hund. Man hatte sich jetzt einigen können auf die Haltung solcher Kleintiere wie Vögel, Hamster oder Fische, sogar einer Katze hatten sie zugestimmt, aber keine Hunde, ihr Gebell könnte die Ruhe im Haus stören.
Marlies war beeindruckt, wie professionell Herr Wetzel von der Hausverwaltung Glentschen vorging. Die sieben Prozent Honorar, die von nun an jeden Monat von den Mieteinnahmen abgingen, waren für ihre Sorgenfreiheit nicht zu teuer bezahlt. Herr Wetzel legte die Verträge mit ihren Kopien unterschriftsbereit in der Küche auf der Arbeitsfläche aus, und dann hatten sie nichts mehr zu reden. Sie standen herum. Mittlerweile war es halb elf. Nur um irgendetwas zu tun, durchschritten sie noch einmal alle Räume. Herr Wetzel machte fachkundige Bemerkungen über den Zustand der Fenster, die Mutti nach Vatis Tod alle hatte erneuern lassen, über die optimale Lage der Räume zu den vier Himmelsrichtungen, über das solide Mauerwerk, für das die Erbauer des Hauses vor fünfzig Jahren gesorgt hatten, und als ihm gar nichts mehr einfiel, fantasierte er laut, wie er sich mit seiner vierköpfigen Familie hier einrichten würde.
Marlies ließ ihn reden, nickte von Zeit zu Zeit, mehr Interesse konnte sie nicht aufbringen. Ihre Gedanken kreisten um die nicht eingeplante Verspätung. Um drei kam der Möbelwagen, aber vorher, hatte sie sich vorgenommen, wollte sie alle Zimmer noch einmal feucht durchwischen, darauf konnte sie, wenn die Zeit zu knapp würde, noch am leichtesten verzichten, aber irgendwann müsste sie auch mal etwas essen, und von Bremerhaven bis Bremen, von Wohnung zu Wohnung, fuhr sie bei günstiger Verkehrslage eine Dreiviertelstunde, das hatte sie schon mehrmals ausprobiert. Ein Uhr, rechnete sie sich aus, ein Uhr, das war der allerletzte Augenblick, den sie noch da sein würde, wenn es ein Uhr wäre, und sie wären hier immer noch nicht fertig, dann würde sie alles Herrn Wetzel allein machen lassen und losfahren.
„Ein Stau auf der Autobahn“, mutmaßte Herr Wetzel, der ihre Unruhe bemerkte.
Es war kurz vor halb zwölf. Langsam wurde es trotz der geöffneten Fenster immer wärmer. In der Küche trank sie aus dem Hahn und ließ sich kaltes Wasser über die Handgelenke laufen. Genau in diesem Moment schellte es an der Haustür, es überraschte sie fast. Sie versuchte, sich an der Hose die Hände trockenzureiben, Herr Wetzel hatte die Familie Meinken schon hereingelassen und rief nach ihr. Sie eilte in den Flur und gab allen nacheinander, sich entschuldigend, ihre feuchte Hand, Frau Meinken, Herrn Meinken und den vier Töchtern, die sich wie vier Orgelpfeifen vor ihr aufgestellt hatten, alle strohblond wie ihr Vater, von fünf bis elf. Leider war die Zeit, zu der sie brennende Neugier auf die Familie gehabt hatte, schon verstrichen, sie interessierte sich jetzt nur noch für eine schnelle Erledigung der Formalitäten, einen allgemeinen Eindruck von der Familie Meinken musste sie sich auch nebenbei verschaffen können.
Zu ihrer wachsenden Ungeduld lief aber Herr Wetzel erst jetzt zu seiner ganzen Form als Bevollmächtigter der Hausverwaltung Glentschen auf. Er veranstaltete eine Führung durch alle Zimmer, erläuterte Einzelheiten, auf die er bisher ihr gegenüber verzichtet hatte, alles so langatmig und umständlich, dass die beiden jüngsten Meinken-Töchter anfingen, in der weitläufigen Wohnung Fangen zu spielen. Schließlich stand man in der Küche, und nachdem mit allerlei Bedenken von beiden Seiten die Verlegung eines neuen Fußbodenbelags zu Lasten der Vermieterin verhandelt worden war, kam man endlich zu den Verträgen. Es war ein Viertel vor eins.
Marlies atmete tief durch und unterbrach Herrn Wetzels Redefluss. Jetzt war ihr alles egal: Weitere Kosten, die womöglich noch auf sie zukamen, die neuen Mieter samt ihren vier niedlichen Töchtern und Herrn Wetzels Ehre als Makler. Für die sieben Prozent, die sie zahlte, konnte er den Rest der Formalitäten alleine abwickeln. Sie legte die Schlüssel für die Wohnung auf die Arbeitsplatte, verabschiedete sich hastig und wahrscheinlich wenig höflich, denn in diesem Augenblick war es ihr gleichgültig, was die anderen von ihr dachten, warf die Wohnungstür hinter sich ins Schloss und war mit zwei Sätzen bei der Haustür, die mit dem vertrauten Geräusch ihrer Automatik hinter ihr einrastete.
Sie hatte sich immer vorgestellt, wie es wohl sein würde, wenn sie die Haustür ein letztes Mal hinter sich schließen würde, seltsam, beklemmend oder vielleicht auch befreiend, aber es war gar nichts, auch das war ihr gleichgültig.
Ihr VW parkte direkt vor dem Haus, und sie hatte keinen Strafzettel, obwohl die Parkgenehmigung für den Umzug schon abgelaufen war, aber auch eine Verwarnung hätte jetzt nichts bedeutet. Sie startete den Motor, schaltete ungeschickt gleich in den dritten Gang, aber der Motor nahm ihr das nicht allzu übel. Sie war in einem ängstlichen Erregungszustand, den sie von sich kannte, fast war es so etwas wie Panik, sie könnte womöglich ihr neues Leben verpassen, wenn sie nicht rechtzeitig um drei Uhr in Bremen ihre Möbel in Empfang nähme.
Es herrschte viel Verkehr, an der Kreuzung Hafenstraße dauerte die Rotphase endlos, in der Grimsbystraße gab es einen kleinen Stau wegen eines Lieferwagens, der seine Waren entlud. Endlich war sie auf der A 27 und lehnte sich erleichtert zurück. Erst jetzt spürte sie, wie durstig sie war, ihr Mund war ganz trocken, und gegessen hatte sie auch nichts außer zwei Keksen … sie hätte fast gebremst vor Schreck. Nein! Das nicht auch noch! Sie hatte ihren Korb im Keller vergessen. Das Wasser, die Kekse, die Marmeladenbrötchen, die verschimmeln würden, das alles hätte sie sich selbst überlassen können. Aber sie musste zurück. Umkehren! Umkehren! Sie musste umkehren, weil auch die Schlüssel für die neue Wohnung im Korb waren. Und noch immer fuhr sie Richtung Bremen. Es brauchte seine Zeit, bis sie wirklich bereit war, zu wenden und zurückzufahren, weil es sein musste.
Als sie endlich wieder in Bremerhaven war und nur in der Pestalozzistraße, nahe dem Leher Tor, einen Parkplatz fand, war die rosa Bluse am Rücken und unter den Brüsten durchgeschwitzt. Beim Laufen gaben ihre Sandalen an den nackten Füßen Geräusche von sich. Die Haare hingen ihr in feuchten Strähnen ins Gesicht. Sie schloss die schwere Haustür so leise auf, wie ihre bebenden Hände es zustande brachten, und stürzte die Treppen in den Keller hinunter. Auf dem schmalen, dämmrigen Flur zu ihrem Kellerraum, dem größten, die Keller der Mieter waren alle kleiner, bemerkte sie dunkle Flecken auf dem Estrich und wunderte sich, bis ihr einfiel, dass es die Abdrücke ihrer eigenen Füße waren, die sie hinterlassen hatte, als sie morgens mit nassen Sohlen aus der Waschküche gekommen war.
Ihre Kellertür war nur angelehnt, obwohl sie sich ganz sicher war, dass sie sie, bevor sie nach oben in die Wohnung gegangen war, sorgfältig abgeschlossen hatte. Sie erschrak. Wer von den Mietern war so dreist und verschaffte sich hier Zugang, kaum dass sie das Haus verlassen hatte? Sehr langsam und sehr vorsichtig öffnete sie die Tür einen Spalt, trotzdem oder gerade wegen der Langsamkeit quietschte die Tür erbärmlich. Im trüben Licht, das durch die beiden Kasematten hereindrang, stand Thommi und starrte sie mit aufgerissenen Augen an. Sein Gesicht hatte einen Ausdruck, den sie noch nie an ihm gesehen hatte. Seine Hosen waren bis zu den Schuhen heruntergelassen, die braune Leinenhose, die sie zusammen bei C&A gekauft hatten, zuunterst und darüber der helle Wust seines Schlüpfers. Unter dem kurzen blaukarierten Hemd, das er immer bei der Arbeit trug, ragte sein halb erigierter Penis hervor. Auf der Chaiselongue lag ein regloses Häufchen roter Volants. Es schien ihr, als hätte sie minutenlang dort hinschauen müssen, um zu begreifen, dass zu dem duftigen Haufen Stoff zwei Kinderbeinchen gehörten, es waren aber nur Sekunden. Zwischen den Beinchen quoll ein Tröpfchen Blut und vergrößerte den roten Fleck auf der grünen Decke. Thommi raffte seine Hosen hoch und stürzte davon.
2. Kapitel
Als sie wieder zu sich kam, hockte sie am Fußende der Chaiselongue und wusste nicht, wie sie dahin gekommen war. Ihr war kalt bis unter die Haut, und gleichzeitig liefen ihr Schweißtropfen über das Gesicht. Mechanisch wischte sie mit einem Zipfel ihrer Bluse im Gesicht herum. Auf dem grauen Estrich zu ihren Füßen waren fahlgelbe Farbflecken, große und kleine Tupfer. Sie schob den rechten Fuß auf einen besonders großen Fleck. Die kleine Bewegung kostete eine ungeheure Anstrengung. Dann sah sie die Spinne, eine Spinne, groß wie ein Unterteller mit furchterregend langen Beinen. Das Tier lief eilig hin und her, näherte sich ihrer Sandale, schlug kurz vor ihren Zehen einen Haken, kehrte wieder um, hastete über ihren nackten Fuß, als gehöre der nicht zu ihr, und verschwand.
Jetzt erst hörte sie das Wimmern, obwohl sie genau wusste, dass es schon die ganze Zeit da gewesen war. Jemand weinte. Ein Kind weinte. Es musste ein Kind sein. Jetzt fiel es ihr wieder ein. Thommi hatte es mitgebracht. Das wimmernde Weinen wurde immer lauter. Wenn jemand weint oder schreit, muss man sofort helfen, das hatte sie in ihrer Ausbildung gelernt. Mit einer Langsamkeit, die sie selber erstaunte, drehte sie den Kopf in die Richtung, aus der das Weinen kam – und übergab sich auf die grüne Decke.
Sie beobachtete, wie der gelblich-weiße Schaum ihres Erbrochenen in die Decke einsickerte, und für den Bruchteil einer Sekunde war das eine Erleichterung, dann begann sich der riesige Hohlraum in ihr mit einer zähen schwarzen Masse zu füllen, für die sie keinen Namen wusste. Aber ihr Bewusstsein sprang an wie ein Motor, den jemand zuvor ausgestellt und nun wieder angelassen hatte: Thommi!
Thommi hatte!
Ein Kind! Was war mit dem Kind?
Sie stand auf, schwankte, als ob ihr der Boden unter den Füßen weggezogen würde, stand endlich und suchte Halt bei den Dingen im Raum, indem sie den Blick über die aufgestapelten Umzugskartons schweifen ließ, zu den beiden Kasematten, die einen Sonnenstrahl in den dämmrigen Raum leiteten, und von da zu dem primitiv gezimmerten Holzregal am Eingang, das bis auf die letzte Spalte vollgestellt war mit sorgfältig eingepackten Haushaltsgegenständen, die niemand haben wollte, die aber zum Wegwerfen noch zu schade waren. Die Kellertür daneben stand sperrangelweit offen.
Wie in Zeitlupe ging sie zur Tür, steckte Thommis Schlüssel um, der noch immer außen im Schloss stand, und schloss von innen ab. Von einer neuen Welle Übelkeit gepackt lehnte sie sich mit dem Rücken gegen die Tür, schloss die Augen und presste die Hände gegen den Magen. Als die Welle abebbte, öffnete sie die Augen wieder, und das Bild, dem sie nicht mehr ausweichen konnte, brannte sich für immer in ihre Erinnerung ein: Muttis Chaiselongue unter der grünen Decke, auf der das Kind in schmutzigen roten Volants nicht mehr lag, sondern saß und sie mit von Angst geweiteten Augen stumm anstarrte, den Mund zum Weinen verzogen, das Gesichtchen verschmiert von Tränen und Dreck. So ein winziges blondes Dingelchen.
Ganz langsam bewegte sie sich auf das Kind zu, verfiel ohne Absicht in den leisen, beruhigenden Singsang, den sie für den Umgang mit Sterbenden oder Schwerverletzten gelernt hatte. Das Kind, das bei ihrem ersten Schritt in seine Richtung zurückgewichen war, fing nicht erneut an zu weinen und ließ es auch zu, dass sie sich an seiner Seite auf die Kante der Chaiselongue setzte. Ohne ihr Gemurmel zu unterbrechen, begann sie das ihr zunächst liegende Händchen sacht zu streicheln. Das Kind stieß einen Schluchzer aus, während aus seinen aufgerissenen blauen Augen, einfach so, als wären da kleine Quellen, große Tränen tropften.
„Mami?, sagte es in einem verzweifelt fragenden Tonfall.
Marlies nahm das Wort in ihre Litanei auf.
„Ruhig, ganz ruhig, alles wird gut, bald bist du wieder bei deiner Mami, alles wird gut. Deine Mami kommt, alles wird gut.“
Tatsächlich wurde das Kind allmählich ruhiger. Seine Pulsfrequenz normalisierte sich. Sie zog ihm das hochgerutschte Volant-Röckchen über die nackten Beine, strich ihm die feuchten Haarlocken aus der Stirn, das alles ohne auch nur eine Sekunde auszusetzen, mit immer denselben Sätzen: Alles wird gut, deine Mami kommt.
Schließlich wagte sie es aufzustehen, um ihren Korb zu holen. Das Kind beobachtete sie ängstlich, weinte aber nicht mehr. Sie nahm ein Tempotaschentuch, befeuchtete es mit Fachinger aus der Flasche und begann mit hauchleichtem Druck, als versorge sie eine verbrannte Haut, das Gesicht des Kindes sauberzutupfen. Als sie an die Lippen kam, schnappte das Kind nach dem Tuch und wollte daran saugen.
„Das nicht, das ist schmutzig, du hast bestimmt Durst. Warte, hier ist Wasser.“
Eilig schraubte sie den Becher von ihrer Thermosflasche und füllte ihn halb voll mit Wasser. Sie hielt dem Kind den Becher an den Mund, während sie beschwörend irgendwelche blödsinnigen Sätze über schönes kühles Wasser murmelte. Erst kniff das Kind die Lippen zusammen, öffnete sie dann doch, als ein wenig Wasser gegen seine Oberlippe schwappte, und trank schließlich den ganzen Becher leer. Für einen Augenblick lag ein Schimmer von Befriedigung über dem kleinen Gesicht, dann verzog es sich schon wieder.
„Mami?“, fragte es kläglich – und dann kam noch etwas hinterher, das Marlies nicht verstand.
Das Kind musste hier weg! Das Kind musste aus ihrem Keller. Aber doch nicht am helllichten Tag! Und wenn es nun schwer verletzt war? Ohne Ankündigung schlug sie voller Entsetzen das Röckchen wieder hoch, und das Kind begann sofort zu schreien. Sie strich das Röckchen wieder herunter und nahm ihr beruhigendes Gemurmel und Streicheln wieder auf, aber hinter dem Gemurmel schlugen in ihrem Kopf die Gedanken ein wie Blitze aus einem Gewitterhimmel. Sie musste das Kind untersuchen, sie musste es wissen. Aber wie? Bis auf ihre Schlaftabletten hatte sie keine Medikamente dabei. Termazepam war nicht für Kinder geeignet. Aber ein Viertel oder ein Achtel davon! Wie alt war das Kind? Zwei? Höchstens drei. Körpergewicht? Höchstens fünfzehn Kilo, eher zwölf. Es war ein zierliches Kind. Es musste sein. Es ging nicht anders. Das war vielleicht sogar gut. Vielleicht konnte das Kind einfach alles wegschlafen. Sie suchte mit der freien Hand in ihrem Korb nach den Schlaftabletten, fand sie, drückte eine Tablette aus dem Blister und sah sich um, ob sich etwas Geeignetes fände, um sie zu zerteilen. Währenddessen erzählte sie dem Kind, dass es gleich wunderbar schlafen würde und dass seine Mami da sein würde, wenn es aufwachte. Mit der scharfen Unterkante der Thermosflasche zerbröselte sie schließlich die Tablette auf dem Boden zu ihren Füßen, nahm den größten Krümel, der allenfalls ein Viertel der Tablette sein konnte, in die eine Hand, einen Becher mit einem Schluck frischem Wasser in die andere Hand und beschwor das Kind, den Mund aufzumachen. Es trank tatsächlich noch einen Schluck, und blitzschnell legte sie ihm das Krümelchen zwischen die Lippen und ließ es wieder trinken.
Die List gelang, das Kind hatte das Medikament geschluckt. Sie sah auf ihre Armbanduhr. Wie lange musste sie jetzt warten, zwanzig Minuten bis eine halbe Stunde. Es war halb drei.
„Hast du Hunger? Willst du vielleicht einen Keks?“
Das Kind sah sie verständnislos an, griff aber sofort nach dem Keks, den sie ihm hinhielt, und biss ein großes Stück ab. Alle Milchzähne schienen schon da zu sein. Also vielleicht doch eher drei. Sie versuchte, sich zu erinnern, wie Thommi war, mit drei oder mit zwei, wann er Zähne bekommen hatte. Aber es ließ sich kein Bild des kleinen Thommi heraufbeschwören. Sie sah immer nur den großen Thommi mit der heruntergelassenen Hose und dem fremden Gesicht.
Über dem zweiten Keks schlief das Kind schon fast ein. Es ließ sich jetzt widerstandslos hinlegen. Sie schlug von den Seiten her die grüne Wolldecke über den kleinen Körper, sorgfältig darauf achtend, dass die feuchte Stelle ihres Erbrochenen die Füße des Kindes nicht berührte. Sie musste noch warten, bis das Kind wirklich im Tiefschlaf lag. Wieder sah sie auf ihre Uhr. Zehn Minuten vor drei. Irgendwie kam ihr das bekannt vor, so als wäre um drei irgendetwas Wichtiges gewesen. Lange konnte sie sich nicht besinnen, was es war. Dann wurde es plötzlich hell in ihrem Kopf, als hätte das grelle Licht eines Schweinwerfers eine Schneise in die Dunkelheit geschnitten. Der Umzug! Um drei sollte der Möbelwagen kommen.
Sie musste telefonieren. Sie musste zur nächsten Telefonzelle. Das Kind schlief. Wo war am Leher Tor die nächste Telefonzelle? Sie konnte sich nicht daran erinnern, obwohl sie doch in der Gegend um das Leher Tor den größten Teil ihres Lebens verbracht hatte. Verdammt! Irgendwo musste doch eine sein. Sie stürzte aus dem Keller – zweimal fiel ihr der Schlüssel beim Abschließen herunter – und rannte aus dem Haus. Fast wäre sie an der Telefonzelle, die nur fünfzig Meter vom Haus entfernt stand, vorbeigelaufen. Sie war nicht besetzt. Die Erleichterung darüber vermischte sich sofort mit Schrecken, weil sie zuerst in ihrer kleinen Tasche den Zettel mit den Bremer Telefonnummern nicht finden konnte, aber er steckte dann doch in ihrer Börse, im Fach für die Scheine. Münzen hatte sie auch. Es war zu spät, die Spedition anzurufen. Sie wählte die Nummer der Mieterin unter ihr, die wegen der Maler einen Schlüssel zu ihrer Wohnung hatte, und betete, während die Wahlscheibe surrte, Frau Simonis möge da sein und ans Telefon gehen. Sie war da und rief ihren Namen ins Telefon, als kündige sie die dazugehörige Dame für einen spektakulären Auftritt an:
„Anette Simonis!“
„Ein Notfall“, keuchte Marlies, „bitte schließen Sie meine Wohnung für die Möbelleute auf, ich bin noch in Bremerhaven, ich komm hier nicht weg, bitte, entschuldigen Sie, bitte, ein Notfall.“
„Ist ja schon gut, mache ich natürlich, nun regen Sie sich mal nicht auf“, antwortete Frau Simonis in deutlich veränderter Tonlage.
Marlies hängte auf und rannte zurück. Wenn das Kind nun aufwachte, während sie weg war, und anfing zu schreien? Das Ende! Das absolute Ende! Und wenn sie jemand sähe? Daran hatte sie vorhin gar nicht gedacht. Es durfte sie niemand sehen. Niemand! Auch das wäre eine Katastrophe. Aber sie erreichte den Keller, ohne dass sie jemandem begegnete. Auf ihrer Armbanduhr war es Punkt drei. Das Kind hatte sich auf die Seite gedreht und schlief mit gleichmäßigen Atemzügen fest und tief.
Es war ein hübsches Kind. Seine Züge hatten sich entspannt. Sie betrachtete die vollendete Linie von der Stirn, in die sich ein paar Locken ringelten, über das fein gebildete Näschen zum leicht offenstehenden Mund, unter dem sich ein kleines, weiches Kinn rundete, und plötzlich überfiel sie eine geradezu bleierne Müdigkeit. Aber sie riss sich zusammen. Das hatte sie doch gelernt, wach und konzentriert zu sein, wenn es darauf ankam. Sie schaltete die Deckenbeleuchtung ein, eine schwache Birne unter einem ovalen Schutzkorb. Der Unterschied in den Lichtverhältnissen war kaum auszumachen. Kein Licht, keine Hygiene, kein Spekulum. Sie musste das Kind untersuchen! Bei denkbar schlechter Beleuchtung mit bloßen, ungewaschenen Händen. Sie hatte doch vorhin Blut gesehen! Wenn das Kind medizinische Versorgung benötigte, konnte sie keinen Augenblick länger mehr zögern, dann war die Katastrophe schon eingetreten. Wenn aber nicht … dann hatte Thommi vielleicht noch eine Chance. Thommi, Thommi, Thommi! Wie von Sinnen hieb sie auf die Chaiselongue ein. Faustschlag auf Faustschlag: Thommi, immer Thommi!
So plötzlich, wie die Wut gekommen war, kamen die Tränen, ein Weinen, das sie schüttelte, sie würgte, sie der Luft zum Atmen beraubte. Als es vorüber war, sackte sie auf die Knie, Arme und Kopf sanken auf die Chaiselongue, schwach konnte sie den säuerlichen Geruch ihres Erbrochenen riechen. Der Geruch begleitete sie in den Operationssaal, wo sie ihrem gefürchteten Chef, Professor Martens, bei einer riskanten Operation assistierte. Sie machte alles falsch, reichte ein Skalpell, als er eine Schere brauchte, aber er nahm es ihr nicht übel, schnauzte sie nicht an, wie man es von ihm gewohnt war, sondern sagte ganz liebevoll zu ihr: Das wissen Sie doch, das ist der Geruch von Leichen. Sie antwortete, dass sie nicht mehr stehen könne, weil ihr die Knie wehtäten. Als sie sich setzen wollte, merkte sie, dass sie gar nicht stand, sondern kniete, und dass der harte, unebene Estrich schmerzhaft auf ihre Kniescheiben drückte. Mühselig rappelte sie sich auf, setzte sich auf die Kante der Chaiselongue, direkt auf den goldfarbenen Chintz, mit dem sie bezogen war. Sie wollte es nicht glauben, aber sie hatte kniend geschlafen. Auf der Armbanduhr war es ein Viertel vor vier. Das Kind hatte von all dem Aufruhr nichts mitbekommen, es schlief.
Vorsichtig schlug sie die grüne Decke ein wenig zurück, schob das Kleidchen hoch. Das Kind rührte sich nicht, Seine kleine Scham war weiß, glatt und unschuldig. Es musste doch irgendetwas angehabt haben – ein Höschen oder sogar eine Windel. Sie sah sich suchend um, konnte aber nichts entdecken, das einem Höschen ähnlich sah. Sie starrte wieder auf den Unterleib des Kindes, auf seine Beine, an denen keine Verletzung zu sehen war. Nicht einmal ein Mückenstich. Es schien ihr unendlich schwer, diese kleine Spalte, die wie fest verschlossen wirkte, zu öffnen. Sie rückte näher heran, dachte an ihr Krankenhaus, an die hunderte von Untersuchungssituationen, bei denen sie aktiv dabei gewesen war, und zog behutsam rechts und links mit Daumen und Zeigefinger erst die äußeren, dann auch die inneren Labien auseinander. Die Schleimhaut sah gesund und rosig aus, nur oben links, in der Nähe der Klitoris war ein oberflächlicher, nicht mehr als einen halben Zentimeter langer, blutverkrusteter Einriss. Das Hymen war, soweit sie das bei der schlechten Beleuchtung erkennen konnte, vollkommen intakt. Sie war rechtzeitig gekommen! Wenn sie gleich umgekehrt wäre, als sie ihren Fehler bemerkte, hätte sie das Ganze vielleicht sogar noch verhindern können. Aber sie war immer noch rechtzeitig gekommen. Sie ließ die Hände sinken. Die kleine Schleimhautverletzung würde in zwei, höchstens drei Tagen vollständig unsichtbar sein. Schleimhaut heilte schnell.
Sie stand auf und suchte nach dem Höschen. Schließlich fand sie es zerknüllt zwischen zwei Kartons. Es war ein ganz normales, winziges Kinderunterhöschen in zartem Rosa, eine Windel hätte nicht hineingepasst. Die Kleine war also trocken. Sie zog ihr das Höschen an, strich das Hemd glatt hinein, zog das Röckchen darüber, ohne dass das schlafende Kind aufgewacht wäre. Es seufzte nur einmal im Schlaf, um dann, wie es ihr schien, nur noch tiefer in seine Träume zu sinken, in offenbar angenehme Träume, denn ein angedeutetes Lächeln zuckte um seinen Mund. Was für ein wunderschönes kleines Mädchen! Sie zog ihm die Sandalen von den Füßen und hüllte die Kleine noch enger in die Decke. Wenigstens frieren sollte sie hier unten nicht. Es war erst kurz nach vier. Wann wurde es dunkel? Sie wusste es nicht genau. Mitte August? Um zehn Uhr war es bestimmt dunkel. Sechs Stunden bis dahin. Mindestens.
Die gefürchteten sechs Stunden gingen vorbei, sie wusste nicht wie. Später, als sie schon auf der A 27 war, konnte sie sich schon nicht mehr erinnern, wie sie diese sechs Stunden, es waren ja eigentlich sechseinhalb Stunden, hinter sich gebracht hatte. Sie hatte nicht geschlafen, sie hatte die meiste Zeit empfindungslos vor sich hingestarrt oder das Kind beobachtet. Einmal war sie aufgestanden und hatte in einem Anfall von Bewusstseinshelle die aufgeweichten Brötchen gegessen und den kalten Kaffee getrunken, das Wasser hatte sie nicht angerührt, das war für das Kind. Sie hatte nach fünf Stunden ein weiteres Krümelchen ihrer Schlaftabletten in einem Schluck Wasser aufgelöst und dem schlafenden Kind eingeflößt. Das musste sein. Es ging nicht anders.
Dann hatte sie wieder dagesessen und darauf gewartet, dass auch die letzte Stunde verging. Durch die Kasematten fiel kaum noch Licht, draußen wurde es also langsam dunkel. Sie hatte nicht gewusst, wie still es hier unten im Keller ihres Hauses war. Von dem Verkehrslärm der Straße drang so wenig zu ihr wie von dem Leben der Bewohner in den fünf Stockwerken über ihr. Nur einmal hatte sie Schritte in der Waschküche gehört, aber vielleicht hatte sie sich das auch nur eingebildet.
Als sie endlich im Schutz der Dunkelheit mit dem grünen Bündel im Arm zu ihrem Auto in der Pestalozzistraße gelaufen war, war sie gerannt wie eine, die mit allem rechnet und doch auf ein Wunder hofft, wie eine verzweifelt Flüchtende, die im Kugelhagel um ihr Leben rennt. Sie hatte niemanden gesehen, der sie mit dem Kind im Arm beobachtet hätte, und erreichte ihr Auto ohne Zwischenfall. Sie musste noch erst die Rückbank freiräumen, bevor sie das Kind bequem betten konnte. Inzwischen baute sie auf seine Schlaftiefe. Auch wenn sie das Kind regelrecht narkotisiert hatte, sie hatte keine andere Wahl.
Noch bevor sie den Motor startete, war ihr mit Entsetzen eingefallen, dass das Termazepam der Schlaftabletten noch am nächsten Tag im Blut des Kindes nachweisbar sein würde. Sie hatte den Gedanken weggewischt. Erst einmal raus aus Bremerhaven, weg von ihrem Keller. Sie hatte geglaubt, sobald sie sicher im Auto wäre, könnte sie auch wieder klar denken. Aber auch jetzt war es nicht viel besser. Das Denken war zäh wie Schleim in den Bronchien, den man trotz aller Anstrengungen nicht in Bewegung bringen konnte. Sie versuchte sich zu erinnern, wo auf der Strecke Rastplätze waren. Es fiel ihr nicht ein. Vielleicht gab es auch keine.
Die erste Parkplatzanzeige kam schneller, als sie erwartet hatte. Sie war an der Ausfahrt schon vorbei, bevor die Botschaft in ihrem trägen Gehirn überhaupt angekommen war. Dieser Parkplatz lag auch noch zu nahe an Bremerhaven, versuchte sie, sich zu beruhigen. Es war wenig Verkehr um diese Zeit, sie fuhr mit durchgetretenem Gaspedal. Sie könnte wegen Übertretung der Geschwindigkeitsregeln in eine Polizeikontrolle geraten, fiel ihr ein, und abrupt zog sie ihren Fuß zurück. Sie musste sich unauffällig verhalten. Unauffällig, unauffällig, unauffällig, hämmerte es in ihrem Kopf, als könnte ihr Hirn nur ein einziges Wort auf einmal begreifen. War es unauffällig, wenn sie um diese Zeit auf einen unbeleuchteten Waldparkplatz fuhr, auf dem es außer ein paar Bänken, dem Toilettenhäuschen und Papierkörben nichts gab? Sie konnte das Kind auf eine der Bänke legen, die zum Picknicken vorgesehen waren.
Das nächste Schild, das einen Parkplatz ankündigte, erschien im Lichtkegel ihrer Scheinwerfer, kaum dass sie den Gedanken zu Ende gedacht hatte. Diesmal bog sie rechtzeitig ab. Der Parkplatz, der nicht viel mehr als eine zweite, im Bogen gezogene Spur neben der Autobahn war, lag dunkel und menschenverlassen da. Kein weiteres Auto hatte dort angehalten. Genauso wollte sie es. Sie parkte neben einer Sitzgruppe aus Stein, zwei Bänke, ein Tisch, machte die Scheinwerfer aus und stellte den Motor ab. Sie hatte immer Angst vor Dunkelheit gehabt. Nie und nimmer hätte sie in der Nacht auf solch einem Parkplatz angehalten, und wenn ihre Blase noch so voll gewesen wäre, aber jetzt hatte sie Angst vor etwas, das viel größer war als die Angst vor Dunkelheit. Es ging um ihr Leben. Sie spähte angestrengt in das undurchdringliche Dunkel und konnte doch nichts weiter erkennen als die von einem leichten Wind bewegten großen Büsche, mit denen die Anlage umpflanzt war. Als sie ausstieg, umfing sie die laue Luft einer der seltenen Sommerabende, in denen man noch lange draußen sitzen konnte. Das war gut für das Kind, dann würde es nicht frieren, bis es gefunden würde. Wenn es überhaupt noch in der Nacht gefunden wurde und nicht erst am Morgen. Sie klappte die Rücklehne nach vorne, bückte sich in den Wagen hinein und hob das Bündel mit dem Kind so vorsichtig, wie es ihr möglich war, von der Rückbank hoch. Trotzdem war sie ungeschickt und stieß mit einer Schulter des Kindes gegen den Türrahmen, wahrscheinlich war es die Schulter, so genau konnte man das durch die zwei Lagen Wolldecke nicht ausmachen, aber das Kind schlief unbehelligt weiter. Sie legte das Bündel auf eine der Bänke, achtete darauf, dass die Kleine gut eingepackt war, schlug noch das freie Ende der Wolldecke über sie und ging zum Auto zurück.
Sofort kamen ihr Zweifel. Würde einem Autofahrer, der hier nichtsahnend hielt, das Bündel auf der Bank überhaupt auffallen? Sollte sie das Kind nicht besser auf den Tisch legen? Sie ging zurück und legte das Bündel in die Mitte des großen Tischs. Aber wenn es sich bewegte und von der Platte herunterfiel? Der Tisch war fast zweimal so hoch wie die Bank. Sollte sie das Kind nicht überhaupt auf den Boden legen, damit es, wenn es sich im Schlaf bewegte oder sogar aufwachte, sich nicht verletzen konnte? Dann sah es aber keiner! Wer achtete schon auf ein Bündel im Gras? Nein, sie musste das Kind bei der Toilette ablegen, deshalb hielten die Leute doch auch nachts hier an, dort würde es bald gefunden werden.
Und wenn keiner kam? Die wenigen Autos auf der Autobahn fuhren alle vorbei. Eben war das noch ein beruhigender Gedanke gewesen, jetzt machte er ihr neue Angst. Sie nahm das Bündel, das, je länger sie es herumtrug, immer schwerer geworden war, und ging zum Toilettenhäuschen. Das hatte rundherum unter dem überstehenden Dach ein schmales, knapp einen Meter breites Podest. Als sie das Bündel zwischen Damen und Herren ablegte, erfasste sie eine kräftige Windbö. Jetzt schien es ihr wahrscheinlich, dass es auch regnen könnte, die Luft war so schwül. Aber das Kind hatte für diesen Fall nun ein kleines Dach über dem Kopf. Jeder, der hier anhielt und auf die Toilette wollte, würde es sehen. Wenn es durch eine Bewegung von der kleinen Stufe herunterrollen sollte, würde es sich nicht wehtun.
Sie rannte zum Auto, ohne sich umzusehen, warf sich auf den Sitz, schlug die Tür zu und startete den Motor. Ein paar vereinzelte Regentropfen rannen über ihre Windschutzscheibe. Sie starrte die Tropfen an und wie sie von oben nach unten über die Scheibe liefen, als sähe sie das zum ersten Mal. Es würde also regnen. Sie schaltete den Motor wieder ab, stieg aus und lief zum Toilettenhäuschen. Sie rückte das Bündel dicht an die Wand, damit es mehr im Schutz des Daches lag, und rannte zu ihrem Wagen zurück. Aber sie stieg nicht ein, sondern lehnte sich gegen das Auto, plötzlich von aller Kraft verlassen. Es fiel kein weiterer Regen, nur der stärker werdende Wind zerrte an den Büschen. Der Himmel, der in Bremerhaven wenn auch mondlos, so doch sternenklar gewesen war, hatte sich bewölkt. Sie legte ihren Kopf auf das kühle Blech des Daches und weinte.
Sie weinte mit krampfartigen Schluchzern aus der Tiefe, und sie weinte nicht, sondern stand daneben, fand diesen Ausbruch unangemessen und drängte zur Eile. Dieser andere Teil von ihr wollte nicht, dass sie weinte, und er wollte auch nicht, dass sie zurückging und das Kind holte, um es wieder auf die Rückbank zu legen, weil es hier draußen nicht bleiben konnte.
Aber es musste sein. Es ging nicht anders. Sie musste zwischen sich und dem Kind die größtmögliche Distanz legen. Mit dem Ärmel ihrer Bluse wischte sie ihre Tränen ab, setzte sich ans Steuer und startete den Motor. Die ersten Kilometer fuhr sie, als wäre jemand hinter ihr her, gehetzt, an der äußersten Leistungsgrenze des Autos. Dann setzte Regen ein, der sich langsam steigerte. Sie war gezwungen, langsamer zu fahren. Von einem Augenblick zum anderen war sie mitten in einem Unwetter. Von ferne hörte sie Donnergrollen. Die Scheibenwischer schafften es manchmal nicht, ihr die Sicht frei zu halten. Sie musste die Geschwindigkeit immer mehr drosseln, wenn sie noch etwas sehen wollte.