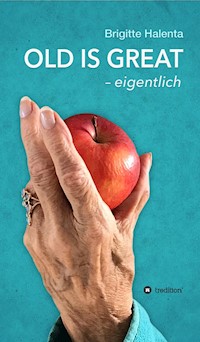4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebesgeschichte oder die Geschichte einer Obsession, vielleicht auch eine klinische Falldarstellung, denn was man gemeinhin die große Liebe nennt, kann vieles sein, je nachdem, was die Liebenden mitbringen und ineinander sehen wollen, aber die Intensität des Erlebens hebt sie über alle anderen Beziehungen. Der Mythos von den Kugelwesen, die Zeus zur Strafe für ihren Übermut in zwei Hälften teilte, sodass seitdem jede Hälfte sehnsüchtig nach ihrer einzig richtigen anderen Hälfte suchen muss, spiegelt diese universelle Erfahrung. Erzählt wird in 20 Kapiteln die Liebesgeschichte von Cordelia und Jonathan, die dreimal in ihrem Leben ein Paar sind, bis Cordelia endgültig zu der Einsicht kommt, dass diese Liebe nicht in ein gemeinsames Leben münden kann, und sich trennt. Die Geschichte spielt von 1958 bis 1980 in Deutschland. Cordelia und Jonathan sind das klassische Liebespaar, das allen Widrigkeiten zum Trotz nicht voneinander lassen kann. Für Cordelia ist Jonathan der Eine, der wichtigste Mann in ihrem Leben, den sie nie aufhören wird zu lieben. Für Jonathan ist Cordelia die liebste Geliebte, die in ihm Gefühle weckt, die ihn, weil sie ihn überwältigen, um seine Unabhängigkeit fürchten lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Brigitte Halenta
Der Eine
Eine Liebesgeschichteoder die Geschichte einer Obsession,vielleicht auch eine klinische Falldarstellung,
denn was man gemeinhin die große Liebe nennt, kann vieles sein, je nachdem, was die Liebenden mitbringen und ineinander sehen wollen, aber die Intensität des Erlebens hebt sie über alle anderen Beziehungen. Der Mythos von den Kugelwesen, die Zeus zur Strafe für ihren Übermut in zwei Hälften teilte, sodass seitdem jede Hälfte sehnsüchtig nach ihrer einzig richtigen anderen Hälfte suchen muss, spiegelt diese universelle Erfahrung.
Erzählt wird in 20 Kapiteln die Liebesgeschichte von Cordelia und Jonathan, die dreimal in ihrem Leben ein Paar sind, bis Cordelia endgültig zu der Einsicht kommt, dass diese Liebe nicht in ein gemeinsames Leben münden kann, und sich trennt. Die Geschichte spielt von 1958 bis 1980 in Deutschland.
Brigitte Halenta, Jahrgang 1937, lebt und schreibt in Lübeck. Bis 2010 war sie als Psychotherapeutin in eigener Praxis tätig. Sie ist verwitwet und hat drei Kinder. Obwohl sie schon immer geschrieben hat und Texte von ihr in verschiedenen Literaturzeitungen erschienen sind, konnte sie sich erst nach Aufgabe ihrer Berufstätigkeit ganz dem Schreiben widmen. Im März 2007 stellte sie ihren ersten Roman DIE BREITE DER ZEIT (Orlanda Verlag, Berlin) in einer stark gekürzten Fassung im Buddenbrookhaus in Lübeck vor. Die Neuauflage des Romans ohne Kürzungen erschien 2015. Seitdem veröffentlichte sie zwei weitere Romane: DAS LETZTE WORT HAT DOROTHEE und LAVENDEL IST BLAU.
Brigitte Halenta
Der Eine
Roman
Impressum
© 2016, Brigitte Halenta, Grillenweg 17, 23562 Lübeck
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Lektorat: Ingeborg Mues
Satz, Layout & Umschlag: David Halenta Development
Umschlagfoto: www.istockphoto.com
ISBN:
978-3-7345-6398-0 (Paperback)
978-3-7345-6399-7 (Hardcover)
978-3-7345-6400-0 (e-Book)
Erfahren Sie mehr über die Autorin auf ihrer Website:
www.BrigitteHalenta.de
Inhaltsverzeichnis
Das Zimmer in der Willebrechtstraße
Jonathan Ruf
Vierjährig im Oktober
Lass uns spielen
Tauben in der Hand
Barfuß und heimatlos
Fliegen auf der Nase
Viel Glück in Frankfurt
Wo der Wind sie hingetragen
And sing myself
Wir könnten uns lieben
Der Brei auf dem Teller
Zieh die Stiefel aus
Die alte Geschichte
Der schwebende Jonathan
Schwalbach
Himmel und Hölle
Unerhörte Totenstille
Ganz oder gar nicht
Das letzte Kapitel
Das Zimmerin der Willebrechtstraße
Niemand kommt unverletzt aus seiner Kindheit. Heilung durch Liebe ist nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich, und so hoffen alle Liebenden auf die gegenseitige Rettung vor dem Schmerz.
Als Cordelia Becker nach dem Abitur ihr Elternhaus verließ, um in München Literaturwissenschaften zu studieren, war sie gerade siebzehn geworden. Ein ungeliebtes Kind, das zu Hause nichts mehr hielt, weil sie sich von jeder Ferne eine bessere Zukunft versprach. Die Mutter hatte sich immer mehr für ihre alteingesessene Weinhandlung und für ihren Sohn Clemens interessiert als für die Tochter, und der Vater, auf den Cordelia lange ihre ganze kindliche Hoffnung setzte, hatte sie, je älter sie wurde, immer weniger beachtet.
Heinrich Johann Becker, geborener Höppken, stammte aus einfachen Verhältnissen. Als er als junger Mann in einer Kochlehre entdeckte, dass er eine außergewöhnliche Sensibilität für Aromen und Geschmacksnuancen besaß, wünschte er sich nichts sehnlicher als ein eigenes Geschäft. Für die Erfüllung dieses Lebenswunsches hatte er die Heirat mit der übergewichtigen Erbin der renommierten Hamburger Weinhandlung Becker samt der Aufgabe seines eigenen Namens in Kauf genommen. Allerdings hatte er nicht vorausgesehen, dass er diesen Handel mit dem Spaß am Leben bezahlen musste. Er wurde zu Hause schon bald ein misslauniger, verschlossener Mensch, den nichts mehr freute. Als pünktlich neun Monate nach der Heirat der Stammhalter zur Welt kam, waren seine Familienpflichten so gut wie abgeschlossen, nur im Geschäft hatte er sich unentbehrlich gemacht. Nach außen hatte seine Frau ihn als die Autorität aufgebaut – mein Mann meint, mein Mann hat entschieden, ließ sie wie einen Refrain in ihre Rede einfließen – , aber hinter verschlossenen Türen hatte er nichts zu sagen. Er war nur die Zunge des Geschäfts, die ein untrügliches Gespür für erstklassige Weine hatte.
Dass nach dem Sohn zwei Jahre später noch ein Mädchen geboren wurde, war eigentlich nicht vorgesehen. Das Kind kam den Eltern ungelegen, und es war auch nichts weiter als ein Versehen, dass der Säugling Cordelia genannt wurde. Ein Hörfehler, ein Missverständnis zwischen den Eltern, an denen kein Mangel war, eine unbewusste Rache des Weinhändlers Becker an seiner übermächtigen Frau, vielleicht auch nur eine Verwechslung der Namen durch den Standesbeamten. Was auch immer oder alles zusammen, es führte dazu, dass das Mädchen nicht auf Cornelia, wie die Mutter es gewollt hatte, sondern auf den ungewöhnlichen Namen Cordelia getauft wurde.
Cordelia, so hieß auch König Lears jüngste Tochter, deren Liebesbeweise den Vater so wenig überzeugen konnten, dass er sie verstieß; und Cordelia war ebenfalls der Name der ahnungslosen jungen Schönen, die in Kierkegaards Tagebuch des Verführers planmäßig von Johannes um den Verstand gebracht wird. Aber darüber machten sich die Eltern keine Gedanken, genauso wenig wie über die Bedeutung des Namens.
Wenn einige Namensforscher recht haben, dann beeinflusst nämlich die verborgene Botschaft im Namen eines Menschen die Bildung seines Charakters und die Gestaltung seines Lebenswegs. Als Cornelia wäre dieses unwillkommene kleine Mädchen womöglich eine andere geworden, denn der Name leitet sich von dem altrömischen Geschlecht der Cornelier her, sodass seine Interpretation heute beliebig erscheint. Mit Cordelia aber, diesem Namen, den das Kind am Beginn seines Lebens zuerst und unter all den anderen Wörtern, die auf es eindrangen, am häufigsten wahrnahm, verhält es sich ganz anders. Die Sprachforscher sehen seinen Ursprung in dem griechischen Wort für Mädchen und dem lateinischen für Herz. Mädchen und Herz. Wer immer Cordelia beim Namen nannte, er beschwor auch die guten Wortbedeutungen mit, die besonders dem Herzen als Sinnbild des Lebens und der Liebe zugeschrieben werden. So wuchs sie, als sie größer wurde, sprechen lernte, sich selbst Cordelia nannte, in diesen anspruchsvollen Namen hinein, war Cordelia und niemand sonst. Den Versuchen ihrer Mitschüler, ihren Namen zu modernisieren oder zu verniedlichen, trat sie energisch entgegen. Sie war nicht Cora, nicht Cordel, sie war Cordelia.
Die Vorsehung, die es auch sonst gut mit ihr meinte, hatte ihr nicht nur diesen bedeutungsvollen Namen geschenkt, sondern auch mit anderen guten Gaben nicht gegeizt. Cordelia war nicht nur mit herausragender Intelligenz, sondern auch mit einem nicht zu übersehenden Liebreiz ausgestattet, zwei Eigenschaften, die in der Schule mehr geschätzt wurden als zu Hause, sodass sie sich durch Leistung und Beliebtheit dort die Aufmerksamkeit hatte verschaffen können, die ihr zu Hause abging. Ohne Kindergarten und Schule, ohne eine Reihe von Lehrern, die, von ihrer Intelligenz fasziniert, sich ihrer besonders annahmen, ohne das warme Nestchen von Freundschaften, wäre wohl ein sehr düsterer Mensch aus ihr geworden, aber es wurde eine sehr beherzte Person aus ihr, liebevoll und mutig in einem. Sie konnte strahlen, wie sonst nur geliebte Kinder es tun, nicht immer, aber immer dann, wenn sie sich sicher fühlte.
Früh hatte Cordelia in der Welt der Bücher einen Ort gefunden, an dem sie mehr zu Hause war als in der großen, düsteren Wohnung in Eppendorf. Für ihren Vater blieb sie das Mädchen, auch als sie schon studierte und nur in den Semesterferien nach Hause kam.
„Wo ist das Mädchen?“, fragte er bei Tisch, wenn sie sich verspätete.
Mehr Aufmerksamkeit wurde ihr aber nicht zuteil. Der Vater übersah seine Tochter und gab ihr damit das Gefühl, sie wäre unsichtbar. Cordelia konnte in der Art der Kinder nur denken, dass es an ihr liegen musste, dass er sie nicht wahrnahm; sie war nicht hübsch genug, nicht klug genug, denn wenn sie es wäre, würde er sie ja liebhaben.
Und doch musste es eine Zeit des gemeinsamen Glücks gegeben haben, den Anfang einer Zuneigung, die, jäh abgebrochen, so mit Scham besetzt war, dass der Vater seine Tochter nicht ansehen und nicht mit ihr sprechen konnte, denn sonst wäre Cordelia wohl nicht mit dieser sehnsüchtigen, ziellosen Liebe im Herzen erwachsen geworden.
Waren es der Zufall, die Vorsehung, das Karma ihres Namens oder literarische Vorbilder, die derart auf ihren Lebensweg einwirkten, dass Cordelia, die verkannte Tochter, sich früh auf die Suche nach dem Einen begab, der alles wiedergutmachen sollte? Sie träumte von ihm; von ihrer eigenen Rolle, wenn sie ihn denn endlich träfe, ahnte sie nichts. Die Aussicht, dass sie wie Kierkegaards Cordelia sein würde, eine hingebungsvolle, sich selbst aufgebende Geliebte, die alles hinnahm, was der Geliebte ihr zumutete, hätte ihr ganz und gar nicht gefallen.
In München war sie zum ersten Mal allein auf sich gestellt. Keine Freundinnen, keine bekannten Gesichter, keine vertrauten Straßen, nicht einmal das Tagesgerüst der geregelten Mahlzeiten am Familientisch. Es gelang ihr mit jedem Tag weniger, zwischen sich und den Studieninhalten Zusammenhänge herzustellen, die Sinn gehabt hätten. Dass sie Germanistik studierte, erschien ihr so beliebig wie die Straßen, die sie durchwanderte; sie hätte genauso gut sich für Romanistik oder Pädagogik einschreiben können. Als sich der fünf Jahre ältere Robert Ehrentraut, den sie in einer Vorlesung über die Deutsche Romantik kennengelernt hatte, in sie verliebte, war sie so dankbar und gerührt, dass sie seinem Drängen nachgab und sich bald mit ihm verlobte. Für ein ganzes Jahr hatte sie so an seiner Seite einen Platz gefunden, an dem ein Leben als Studentin der Literaturwissenschaften in der bayrischen Metropole seine Richtigkeit hatte. Aber dann, im Wintersemester 1958, ging Robert für sechs Monate nach Basel, weil er dort die Vorbereitung auf die anstehenden Examen mit einem willkommenen Verdienst als Aushilfslehrer in einem Internat verbinden konnte. Cordelia wollte nicht alleine in München bleiben, das ihr ohne Robert noch größer und kälter als vorher vorkam, und entschied sich für Marburg.
Zwei Tage war sie in Marburg vergeblich auf der Suche nach einem Zimmer, das sie bezahlen konnte, dann fand sie das Zimmer in der Willebrechtstraße: vier Meter im Quadrat. Eng. Manchmal ein Nest, aber meistens eine Zelle, in der sie die Zeit absaß. Die zum Überleben nötige Ausstattung war vorhanden; im Detail sogar mit einer Andeutung von Luxus. So hatte das ausrangierte Untergestell einer Nähmaschine, das als Schreibtisch diente, Chippendale–Beine, das Kleiderschränkchen einen schön ausgesägten Aufsatz. Die Bettstatt, als Angelpunkt der ganzen Häuslichkeit, von Grund auf solide und nicht zu engbrüstig, war in Ordnung; sie hatte schon in schlechteren Betten in besseren Zimmern geschlafen. Zwei dicke, mit Chintz abgesteppte Decken lagen schwer darüber. Später im Winter, als die Kälte durch die Pappwände drang, baute sie einen Tunnel daraus, ein Meter sechzig von den Zehen bis zu den Augenbrauen.
Zu ihrem ungläubigen Staunen statteten ihr die Eltern schon ein paar Tage nach ihrem Einzug einen Besuch ab. Sie sah sie schon von weitem vor ihrem Haus stehen, die Mutter wie immer in wallendem Dunkelblau, der Vater daneben so schmal, dass sie zuerst dachte, es wäre Clemens. Aber der saß noch im Auto. Sie hatten Weingüter in der Nähe besucht und waren auf der Rückfahrt. Wenn man die Tochter nicht angetroffen hätte, wäre das ihre Schuld gewesen. An einem Sonntagmittag konnte man erwarten, sie zu Hause vorzufinden.
„Es ist zu teuer“, sagte der Vater, nachdem er sich die schmale Stiege hinaufgequält hatte.
Er hielt den Kopf noch immer eingezogen. Er stand unbequem. Er weigerte sich, sich hinzusetzen. Er blickte auf die Ansammlung von Gegenständen, die die Einrichtung darstellten, und war angewidert: von einem abgesessenen Korbstuhl, von einem selbst gebastelten Tischchen, von zwei mit Folie überzogenen Brettern, die auf schiefen Konsolen die Bücher hielten. So lebte eben das Mädchen.
Cordelia schämte sich für die nette Wirtin, die für ein Viertel ihres Monatswechsels nichts Besseres zu bieten hatte als diese unansehnliche Kammer in ihrem zusammengeflickten Nachkriegshäuschen. Mutter und Vater füllten den knappen Raum derart mit ihrer Anwesenheit, dass Cordelia nicht mehr ordentlich atmen konnte. Sie war erleichtert, als die Mutter ein Restaurant vorschlug. Sie gingen im Hirschen essen, wo der Vater für eine Mahlzeit zu viert so viel bezahlte, wie das Zimmer im Monat kostete.
Als die Familie wieder abgefahren war, fand sie auf dem Bett sitzend, die Beine untergeschlagen, dass das Zimmer in der Willebrechtstraße ihr angemessen war. Das Zimmer war wie sie. Sie war wie das Zimmer: eingeschränkt, aber davongekommen. Sie blieb lange an diesem Wort hängen, davongekommen; das Wort war von Grund auf richtig. Alleine mit sich selbst, ohne den Kontakt zu anderen, fühlte sie sich so: davongekommen. Sie konnte sich nicht erklären, warum das so war. Je länger sie darüber nachdachte, um so deutlicher wurde ihr, dass es nicht nur ein Gefühl war; es war ein Teil von ihr, es saß in den Beinen, den Armen und hinten am Rücken zwischen den Schulterblättern und flüsterte: davongekommen.
Mit Robert in München war es ihr fast immer gelungen, dieses Gefühl abzuschütteln, dann war sie wie befreit gewesen und konnte ihre Lust auf das Leben spüren. In Marburg, wo sie am Anfang tagelang mit niemand redete, drückte sie das schlimme Gefühl wie eine schwere Last. Wenn es allzu unerträglich wurde, ging sie ins Bett, lag lange unfähig zu irgendeiner Bewegung unter der Bettdecke und starrte ins Zimmer. Die Entfernung zwischen Fenster und Tür betrug zwei Körperlängen. Das Wenige, das ihr gehörte, war nah. Bücher und Papiere, zwei Tassen mit Untertassen, drei Teller, zwei Bestecke.
Das Einrichten und Ordnen hatte sie ein paar Tage beschäftigt, erst später fiel ihr auf, wie wenig sie besaß. Nicht länger abgelenkt durch den Mann, mit dem sie sich verlobt hatte, entdeckte sie täglich neue Wahrheiten über sich, die ihr bisher entgangen waren. Die ängstliche Cordelia, die sich im Dunklen auf der Straße fürchtete, lernte sie erst in Marburg kennen, und die wankelmütige Cordelia auch. Noch abends, wenn sie sich schlafen legte, konnte sie glauben, dass sie liebenswert und klug sei und mit Sicherheit einer glücklichen Zukunft entgegenging, aber wenn sie am Morgen aufwachte, war sie überzeugt, dass ihr alles misslingen würde, weil sie dumm und hässlich war und anderen nur Unglück brachte. Cordelia sah in jeden Spiegel, der sich ihr anbot, und hatte Mühe, sich wiederzuerkennen. Sie brauchte die anderen, um zu fühlen, wer sie war, so viel stand fest.
Sie kannte lange niemanden in dieser Stadt, in die sie auf eigenen Wunsch gekommen war, um ihr Studium fortzusetzen. Das Semester hatte noch nicht begonnen. Wenn es ihr in ihrem Zimmerchen zu eng wurde, nahm sie ihren Mantel und lief stundenlang durch die Straßen, bis auch die Stadt für ihre namenlose Frühlingssehnsucht zu eng wurde und sie aus der Stadt heraus bis zum Spiegelslustturm lief. Da starrte sie auf die Stadt zu ihren Füßen, fragte sich, was das alles sollte, dieses unbändige Laufen, und entschloss sich mit dem Rest der ihr noch zur Verfügung stehenden Vernunft, nach Hause zu gehen, obwohl sie eigentlich hätte weiterlaufen wollen und nie zurückkehren. Je weiter sie an einem Tag gelaufen war, umso mehr zwang sie sich am folgenden Tag, an ihrem kleinen Schreibtisch fest auf der Stelle sitzenzubleiben und sich mit ihren Studieninhalten zu beschäftigen. Aber es gelang ihr nicht einmal, in den Werken, die auf ihrer Literaturliste aufgeführt waren, so aufmerksam zu lesen, dass sie mit sich zufrieden sein konnte. Auch Weltliteratur war manchmal ganz schön langweilig. Wenn sie dann so dasaß, den Blick im Kreis über diese eingeschränkte Welt des Zimmers laufen ließ, und die Stunden vorbeistrichen, ohne dass sie irgendetwas geschafft hatte, verzweifelte sie an sich selbst. Manchmal brachte sie eine plötzlich hochschießende Wut auf die Beine. Dann wünschte sie sich, jemand möge kommen und sie schütteln, möge ihre erstarrte Seele im Genick fassen und wie ein scheinbar lebloses Tierchen so lange schütteln, bis das Leben zurückkehrte.
Sie telefonierte lange mit Robert, aber er verstand nicht, wie es ihr ging. Sie konnte es ihm nicht erklären, sie verstand es selber nicht. Es ging ihr nicht gut, so viel war sicher, nein, sie musste es sich eingestehen, es ging ihr richtig schlecht, ohne Robert hatte sie die Orientierung verloren. Aber gleichzeitig wurde ihr auch schmerzhaft klar, dass Robert nur eine Krücke war. Sie liebte in nicht, aber seine Liebe beschützte sie. Mit ihm an ihrer Seite, hatte sie sich einbilden können, dass niemand ihre Einschränkungen sah, dass sie so normal war wie alle anderen Leute auch.
Indem die Tage voranschritten und sich die Vorzeichen des nahenden Sommers vermehrten, kamen auch die Studenten zurück, und plötzlich erschien ihr das schläfrig wirkende Marburg lebendig, jung und fröhlich. Ihre Laune besserte sich. Sie machte Tagespläne, die sie nicht einhielt. Sie wollte lieber draußen sein, als in ihrem Zimmerchen zu lernen, sie wollte in den Cafés sitzen und den Leuten zusehen, wie sie ihr Leben lebten. Selbst in der Universitätsbibliothek an ihrem Arbeitsplatz mit der vor ihr aufgetürmten Sekundärliteratur zu Goethes Wahlverwandtschaften interessierte sie das Kommen und Gehen, das Hin und Her ihrer Kommilitonen mehr als die Frage, ob man bei der Vaterschaft von Ottilies Kind auch eine geistige Zeugung in Betracht ziehen könnte, insofern die Mutter beim Koitus an einen anderen gedacht hatte. Weiß der Himmel, wovon Cordelia träumte. Es waren unbestimmte Träume, die vielleicht eher Fragen glichen. Fragen an das Leben im allgemeinen, an sich selbst, wer sie denn sein wollte, und Fragen an jeden einzelnen Mann, der ihr begegnete, ob er denn möglicherweise, vielleicht, gegebenenfalls derjenige wäre, den sie lieben könnte, weil er der Eine war, der sie erlösen würde.
Jonathan Ruf
Ein großer Hörsaal. Später Nachmittag. Eine Vorlesung über die Literatur des 17. Jahrhunderts. Die Eingänge waren an der Stirnseite, dort, wo auch das Rednerpult stand. Cordelia nahm sich einen Platz ziemlich hinten, aber in der Mitte. Es war noch alles leer, sie war zu früh da. Sie war immer und überall zu früh, weshalb sie den Eindruck hatte, dass sie immer warten musste. Sie beobachtete, wie die anderen hereinkamen, den Saal füllten, ihr näher rückten, mit Stimmen und Gerüchen. Mit einigen gab es schon eine scheue Vertrautheit, ein Wiedererkennen, ein Zunicken. Es war fast ein Defilee. Unter ihren Augen kamen sie zur Tür herein, links oder rechts, suchten ihren Weg durch die Reihen, tauchten unter im Gewimmel der Köpfe, wenn sie sich setzten. Dann kamen zwei, die ließen sich Zeit. Der eine von ihnen spielte keine Rolle, einfach ein Begleiter, größer oder kleiner, austauschbar, aber der andere! Ihn würde sie nie wieder in ihrem Leben vergessen.
Als er da unten erschien, links vom Pult, den Schritt verzögert durch das intensive Gespräch, das er mit seinem Begleiter führte, langsam und mehr zufällig als wählend in den vorderen Reihen einen freien Stuhl fand, weckte jede Bewegung, die er machte, oder besser, wie er sie machte, ihre vollkommene Aufmerksamkeit. Während der ganzen Vorlesung konnte sie sein Profil sehen, ein mageres, scharfnasiges Profil, umrahmt von den weichen Wellen zu langer schwarzer Locken. Kein Mann trug 1958 die Haare lang.
Sie kannten sich noch nicht, aber sie hatten einander bereits wahrgenommen. Später erzählte er ihr, dass er eben mit diesem Freund, mit dem er auch den Hörsaal betreten hatte, in der Präfektur unten auf einer Bank gesessen habe, als sie an ihnen vorbeigegangen und die Treppe in den ersten Stock hinaufgestiegen sei. Er habe ihr nachgeschaut, bis sie aus seinem Blickfeld verschwunden sei, und zu seinem Freund gesagt:
“So wie sie geht, möchte ich mit ihr schlafen.“
Sie hatte ihn in der Präfektur nicht gesehen und auch nicht bemerkt, dass er ihr nachsah. Aber als sie an einem Dienstagabend den Seminarraum betrat, in dem sich wöchentlich Studenten und Studentinnen der Germanistik trafen, um über eigene Gedichte zu sprechen, erkannte sie ihn sofort. Und er sie.
Cordelia Becker und Jonathan Ruf schüttelten sich die Hand. Außer ihr war nur eine andere Frau da, sonst saßen nur Männer um den großen Tisch, der aus vielen kleinen Tischen zusammengestellt war, die allesamt älter waren als sie. Ein zarter blonder Student, der auch neu war, trug stockend sein Gedicht vor, das wie ein Sonett gebaut war. Über eine Stunde gab es eine heftige Diskussion über Form und Inhalt. Sie hatte nicht erwartet, dass man selbstverfasste Gedichte so ernst nehmen konnte, und wurde sich mit jeder Minute sicherer, dass sie ihr eigenes kleines Gedicht diesem Tribunal nicht ausliefern würde.
Von niemanden dazu aufgerufen, einfach kraft der natürlichen Bedeutung, die all seinen Äußerungen anhing, war Jonathan Ruf hier die oberste Instanz in allen Fragen lyrischer Authentizität. Wenn er mit sanfter Stimme fragte: „Können Sie das vielleicht etwas präzisieren?“, las sie in seinen blauen Augen hinter den Gläsern der Hornbrille Verurteilung. Er selbst sprach mit schmalem Mund deutliche Sätze. Wenige zumeist. Und häufig erst in das Schweigen, das entstand, wenn alles auf der Hand Liegende vorgebracht worden war. Besonderes, Überraschendes, das, weil es allen anderen entgangen war, nur ihm hatte einfallen können. Ging in dem Durcheinander sich widersprechender Meinungen der Zusammenhang verloren, er stellte ihn mit ein paar Worten mühelos wieder her. Die Hierarchie war unausgesprochen, aber augenfällig. Als zweiter konnte ein kleiner Krausköpfiger gelten. Es gab schnelle Seitengespräche zwischen ihm und Jonathan Ruf. Unauffällige Verständigung der Eingeweihten über den Köpfen der Menge. Das enfant terrible, das jede Gruppe brauchte, hieß Felix, ein Zweimetermann mit dicken Brillengläsern und der Stimme eines ausgebildeten Sprechers. Felix war ein besonders begabter Selbstdarsteller, der Wirklichkeit und Phantasie mischte allein nach Maßgabe der beabsichtigten Wirkung. Leidenschaftliche Ausbrüche von Felix, kühles Zurechtrücken von Jonathan Ruf. Jonathan Ruf hütete die Vernunft. Er hatte den Überblick. Felix hatte nur Gefühle. Sie hatten einander als Kontrast nötig, der ihre jeweilige Persönlichkeit erst recht zur Geltung brachte.
Felix Mende entstanden über Nacht immer neue Gedichte. Jonathan Ruf fasste seine Lebenserfahrung ein für alle Male in dreißig beherrschten Zeilen zusammen. Sie hatten bequem Platz auf einer Din–A4–Seite. Cordelia war mehr an Beziehungen interessiert als an Gedichten. Die Art, wie die Männer miteinander umgingen, die Art, wie sie mit ihr umgingen. Da war ein anderer Ton, meistens besonders rücksichtsvoll, manchmal auch spöttisch.
„Was hat denn das Fräulein Becker dazu zu sagen?“
Jonathan Ruf war immer besonders höflich zu ihr. Während sie über Gedichte sprachen, probierte sie aus, wie lebendig sie mit ihm sein könnte, lebendiger als mit sich alleine. Am Ende des Semesters überreichte er ihr seine dreißig Zeilen.
Warum gerade ihr? Die handschriftliche Widmung, mit der das Blatt versehen war, erklärte nichts.
Fräulein Becker
Zum Dank für ihre Anwesenheit
Jonathan Ruf
Nun hatte sie den ganzen Jonathan Ruf in dreißig Zeilen. Sie trug ihn nach Hause und behandelte das Blatt wie eine Ehrenurkunde: mit gewisser Achtung, aber ohne Gefühl.
Eine Woche nach Beginn der Semesterferien kam ein Brief. Jonathan Ruf schrieb an Fräulein Becker. Es war ein Brief an eine Frau, die es gar nicht gab. Er war zwei Seiten lang, zwei große Bögen bedeckt mit Puppenbuchstaben, winzige, aber getreue Abbilder der gewöhnlichen Buchstaben. Sie leisteten sich keine Ausschweifungen oder Eigenbildungen, ausgenommen vielleicht den Zug zur Vereinfachung, der die großen Anfangsbuchstaben in die Nähe der Druckschrift brachte. Die einzelnen Wörter aber wahrten einen ungewöhnlich großen Abstand zueinander, was den beiden vollgeschriebenen Blättern eine merkwürdige Wirkung verlieh. Wie bei reversiblen Figuren heftete sich die Aufmerksamkeit abwechselnd auf die Schriftzüge oder auf die Leerstellen, sodass es eigentlich zwei verschiedene Briefe waren. Fasste man, wie es sich gehörte, die Buchstaben fest ins Auge, so erschienen die Wörter wie die Perlen jener auf Nylonfäden gezogenen Ketten, die durch unsichtbare Knoten vor und hinter jeder Perle auseinandergehalten werden, wobei man niemals ganz sicher sein konnte, ob der sorgfältig eingehaltene Abstand die einzelne Perle nur besser zur Geltung bringen sollte, oder ob der Urheber der Kette zwischen den Perlen, die er herzeigte, andere unterdrückte und zu besonderer Verwendung zurückgehalten hatte. Diese Handschrift war die Spur eines Springers, der sich wie jemand im Moor trockenen Fußes von Stein zu Stein – von Wort zu Wort – rettete.
Hielt man die Blätter aber auf Armeslänge entfernt, veränderte sich der Eindruck vollkommen. Jetzt schlossen sich die Leerstellen zu einem Muster zusammen. Die Wörter waren nur noch wie Stäbchen und Luftmaschen in einer feinen Spitzenhäkelei, deren Zartheit wesentlich durch die regelmäßige Anordnung von Löchern zustande kommt: Unterbrechung. Begrenzung. Fassung.
Cordelia kehrte in den Tagen nach der Ankunft des Briefes zwischen den verschiedensten Verrichtungen immer wieder zu diesem Brief zurück. Die beiden Blätter waren ausgelegt auf dem Tischchen am Fenster. Setzte sie sich in den Korbstuhl, ließen sich die Buchstaben bequem entziffern. Von der anderen Seite, vom Bett her, war das verlorene Mühe. Sie musste sich dem Muster anvertrauen, sich auf die Lücken einlassen. Jedes Mal, wenn sie das Zimmer betrat, zögerte sie: Stuhl oder Bett? Zuerst saß sie häufiger im Stuhl; später immer häufiger auf dem Bett, zuletzt ganz.
Im Stuhl las sich der Brief so:
„Fräulein Becker, ich habe Grund, Felix Mende zwar nicht für seine Gedichte, aber dafür dankbar zu sein, dass er mir einen Anlass darbietet, Ihnen zu schreiben. Es handelt sich nämlich um Ihre Verse, die sie Bolero überschrieben haben und die mir unter einem anderen oder gar keinem Titel hinreichend gut für eine Veröffentlichung scheinen. Das muss ich wohl eigens begründen, weil ich den Verdacht hege, dass die Qualität jener Verse Ihnen weniger deutlich ist als mir. Dergleichen kommt zuweilen vor und besagt nichts über das Gedicht.
Ich vermute, die Prosafassung in Ihrer Erzählung sei die erste. Indessen losgelöst aus dem Zusammenhang eines durchweg bildhaften Textes, der die Interpretation über „Bolero“ hinaus erlaubt, werden die Sätze, unter diesem Titel, allzu sehr (und hoffentlich Ihrer eigenen Absicht entgegen) als Beschreibung oder Gestaltung eines einzelnen Vorgangs, eben des Tanzes einer Frau, festgelegt. Erst das Fehlen eines Titels gibt den Blick auf den Hintergrund frei: auf das erotische Erlebnis der Frau. Nur in diesem Doppelsinn besteht der Reiz Ihrer Verse; in der Ungewissheit, ob es sich um ein Liebeserlebnis handele, das vom Abend bis zum Morgen dauert, während das Radio Musik spielt – oder um den Tanz einer Frau. ‚Bolero’ als Titel gesetzt, verengt und verkümmert das Gedicht und verbirgt seine Schönheit. Nicht alle Leser lesen wie ich; wenige kennen Sie.
Bei den Sitzungen vermochte mir die Gegenwart einer schönen Frau manches schlechte Gedicht erträglich zu machen; und wenn ich zuweilen fernbleiben musste, so bedauerte ich es vor allem Ihretwegen.
Teilen Sie mir bitte nach Marburg in die Krämerwende zwei, wo ich zum Ende dieser Woche wieder bin, Ihre Semesteradresse mit, damit ich es nicht dem Zufall überlassen muss, Sie wiederzusehen. Bis dahin nehmen Sie bitte die freundlichsten Grüße entgegen Ihres Jonathan Ruf.“
Er musste sie verwechselt haben! Aber es war von ihrem Gedicht, das sie Felix gegeben hatte, die Rede. Meinte er wirklich Roberts Verlobte, die jetzt ein bisschen weniger verlobt war, weil Robert, was alle wussten, für ein halbes Jahr im Ausland studierte. Eine zweite Ehrenurkunde. Ihr Interesse ehrt mich, wenn ich auch die Form, mit der Sie es zum Ausdruck bringen, nicht immer gutheißen kann. Im Ernst, ich finde Sie anmaßend, eingebildet, eitel, auch unverschämt, aber leider: Ich fühle mich nicht gemeint. Hochachtungsvoll.
Nein! Sie schrieb nicht.
Stattdessen hockte sie auf dem Bett und zählte die Muster dieses Briefes aus. Nach und nach ging es immer besser. Sie fand in den Weiten zwischen den Wörtern einen Zusammenhang mit ihrem eigenen Leben. Sie hatte noch nicht nachgeschaut, aber es kam ihr immer mehr so vor, als müsste es zwischen ihren Wörtern ähnlich aussehen oder als könnten sich dieses fremde Muster und ihr eigenes ergänzen. Sie bewegte sich immer freier durch diesen Brief, den ihr Jonathan Ruf geschrieben hatte. Zusammenstöße mit Wörtern kamen nicht mehr vor.
Ein Mann, den sie nur flüchtig kannte, schrieb an eine Frau, mit der sie sich noch nicht bekannt gemacht hatte:
Ich habe dich gleich wiedererkannt! Die Erinnerung, wie du gehst, wie du lächelst, der Klang deiner Stimme, all das und noch viel mehr, das ich gar nicht alles benennen kann, weil ich die Namen dafür nicht weiß, ist unauslöschbar in mir eingegraben. Andere mögen gehen – gut, ich beobachte das, andere mögen lächeln, ich lächele zurück, andere mögen reden, ich höre es. Aber wenn du gehst, lächelst, redest, fällt es mir ins Herz. Wenn dein Gehen, dein Lächeln, dein Reden mir gilt, geht es mir gut.
Ich schreibe Fräulein Becker. Liebes Fräulein Becker ist unerträglich. Es ist peinlich, floskelhaft. Ich kann das Wort im Blick auf dich nicht bedenkenlos verwenden. Ich schreibe eigentlich auch gar nicht; ich rede dich an, so als nähme ich ein eben fallengelassenes Gespräch wieder auf: Fräulein Becker, hören Sie? Ich bin mir sicher, dass du dieses Hinwegsetzen über eine Formalität richtig einzuschätzen weißt. Was wie eine Unhöflichkeit aussieht, ist im Grunde doch eine Schmeichelei. Für wen? Für uns beide! Ich kann es mir leisten, weil du es verstehen kannst.
So ist es mit dem ganzen Brief.
Dankbar bin ich, einen Anlass gefunden zu haben. Wenn das einfach eine Floskel wäre, hätte unser Gespräch, kaum begonnen, ein Ende. Aber einigen wir uns doch lieber gleich darauf, dem Floskelhaften von nun an keine Bedeutung zuzumessen. Das überlassen wir den anderen. Wir nehmen Wörter beim Wort. Also dankbar. Dankbar einer dritten Person für einen Anlass, dich anzusprechen, und zwar so unmissverständlich, dass du mich und meine Art zu sein (bei Männern sage ich, meine Art zu denken) erkennen kannst. Als hätte ich nicht auch ohne fremde Hilfe einen Anlass finden können! Er bot sich dar, er kam sozusagen auf mich zu, und ich habe ihn ergriffen, weil gerade dieser Anlass Anlass gab, auch die Dankbarkeit einzuführen. Felix ist dabei natürlich vollkommen bedeutungslos. Diese Art von Dankbarkeit ist ungerichtet; am ehesten gilt sie noch mir selbst. Sie setzt sich zusammen aus Befriedigung und einem Gefühl der Genugtuung, dass sich, wenn man so eingerichtet ist wie ich, Wege finden lassen, die angenehm beschreitbar zu den gewünschten Zielen führen. Ich weiß dich allein; ich weiß dich empfindlich für Lob und Kritik an deinen Gedichten. Ich lobe dein Gedicht und damit dich. Solltest du darauf bestehen, dass nur von deinem Gedicht die Rede ist – bitte. Aber ich sage dir gleich, dass du dein Gedicht nicht richtig verstehst. Das kommt zuweilen vor und besagt nichts über das Gedicht. Aber was besagt es über die Dichterin?
Ich habe das gleich gesehen! Du bewohnst dein Haus an einer sehr unübersichtlichen Stelle; eine unsichere und unbefestigte Küste ist es, die wahrscheinlich mit Geröllhalden steil zum Meer abfällt. Innen ist alles drunter und drüber. Wo soll man sich in all der Wirrnis niederlassen? Du hast kaum Essen und Trinken für dich selbst; Gäste setzen dich in Schrecken. Man muss den Ort, an dem dein Haus steht, sichern. Innen muss aufgeräumt werden, damit man die Zimmer wieder bewohnen kann. Du musst mit Nahrung versorgt werden, damit du satt wirst und auch für Gäste etwas übrig bleibt. Du glaubst, dass ich das vielleicht für dich tun könnte? Das musst du alleine tun! Ich will es dir nur zeigen, wie sicher ich wohne in meinem Haus, wie übersichtlich ich darin Ordnung halten kann, wie angenehm ich Gäste bewirte. Da du unsicher, unordentlich und verhungert bist, wird es dir gefallen, dass ich sicher lebe, auf Ordnung halte und täglich satt werde.
So habe ich mich eingerichtet in einem weitläufigen Haus an einer zugänglichen Straße. Es kommen übrigens leicht Leute zu mir. Sie bewegen sich scheinbar frei und nach ihren eigenen Bedürfnissen durch alle Räume, aber an den Türen stehen unauffällig Wächter. Kommt ein Besucher an ein bestimmtes Zimmer, dessen Zugang überhaupt oder vielleicht nur ihm verwehrt ist, lenkt ihn der Wächter durch eine Frage oder eine Bemerkung in eine andere Richtung. So kommt es, dass sich alle wohlfühlen und niemand verletzt wird. Ich will auch dich nicht verletzen. Aber ein bisschen muss ich mich dir schon zumuten. Zur Probe gewissermaßen. Du sollst mich trotzdem lieben. Ich habe dich doch erkannt in diesem Gedicht, das du zur Tarnung unter einen Titel gezwängt hast. Aber mich täuschst du nicht. Mich täuschst du auch dann nicht, wenn es dir (fast) gelingt, dich selbst zu täuschen.
Zeig dich! Leg dein wohlgesittetes, dein töchterliches Gesicht ab. Ich bin dein einziger Zuschauer. Für mich alleine ziehst du dich aus. Zeig her! Jetzt will ich deine Brüste sehen. Heb sie hoch mit beiden Händen. Komm, ich halte den Lichtstrahl der Lampe auf sie. Wenn du die Augen nicht geschlossen hieltest, könntest du sehen, wie mein Glied steigt. Ich werde mir Zeit lassen. Vom Abend bis zum Morgen. Ich nehme mir von deiner Schönheit für meinen Stolz, von deinem Flehen für meine Unerschütterlichkeit, von deiner Lust für meine Lust. Wenn ich so lange bei dir gelegen habe, und du also meine Geduld, meine Beherrschung und meine Zärtlichkeiten kennst, wirst du mich dafür lieben.
Vierjährig im Oktober
Sie hörte das Klingeln unten im Haus. Es ging sie nichts an. Zu ihr kam nie jemand. Sie hörte die Wirtin ihren Namen rufen. Das war unerwartet. Sie musste erst Schuhe anziehen, den Gürtel um das Kleid binden. Alles ging langsamer, als es ihr recht war. Die zerdrückten Haare im Spiegel, ja, ich komme.
Unten, in der mit Schränken vollgestellten Veranda, die als Vorzimmer und Flur diente, stand Jonathan Ruf.
Als sie ihn sah, als sie sich begrüßten, als gäbe es bereits ein Einverständnis zwischen ihnen, wusste sie plötzlich, dass sie mit seinem Kommen gerechnet hatte. Nachdem sie sich auf die gefährliche Liebenswürdigkeit seines Briefes soweit eingelassen hatte, war es nur natürlich, dass er kommen sollte. Aber so schnell? Da war er nun. Er war ihrer Erwartung zuvorgekommen. War auch darin wieder der Handelnde, also der Überlegene. Mit ein paar Sätzen würde er aus einer Bekanntschaft ein Verhältnis machen.
Sie war zum Umsinken verlegen.
Sie vermied es, ihn anzusehen. Es war ihr, als stieße sie mit jeder Bewegung, die sie machte, irgendwo an. Es war entsetzlich eng im Flur. Als sie die Treppe hinaufstieg, mit seinen Augen im Rücken, überschlug sie in der Vorstellung den Zustand ihres Zimmers, in das er gleich eintreten würde. Was lag alles herum? Was könnte sie verraten? Während sie noch standen, legte sie schnell das aufgeschlagene Tagebuch beiseite. Dabei fühlte sie mit dem ihm zugewandten Rücken, dem Nacken, den Seiten der Arme, wie niedrig das Zimmer war und wie lang Jonathan Ruf. Welche Erleichterung, als sie endlich saßen. Er im Korbstuhl, sie auf dem Bett.
Kein Wort über den Brief.
Eine Unterhaltung wie in einem Eisenbahnabteil, wenn zwei beliebige Personen aufeinandertreffen und ihr allgemeines Wohlwollen füreinander durch das Festhalten an dem einzigen Umstand, den sie gemeinsam haben, ausdrücken, nämlich Reisende zu sein mit Herkunftsort, Ziel, Anschlusszeiten und Reisedauer. Sie hatte Mühe mit dem Sprechen. Wörter fehlten. Manchmal war der Ton aus ihrer Stimme. Jonathan Ruf plauderte vom vergangenen Semester, von Leuten, die sie kannten. Sie behalf sich immer öfter mit einem Lächeln. Schließlich sprach er eine Einladung zum Kino aus. Unter diesem Vorwand war er überhaupt gekommen. Erlöst stimmte sie zu. Nun hatten sie ein eindeutiges Programm. Man konnte sich an die einzelnen Punkte halten.
Aber zunächst brachte das Vorhaben, das ihr wie eine Erlösung vorgekommen war, neue Peinlichkeiten mit sich. Unter seinen Augen musste sie sich vor dem kleinen Spiegel die Haare richten. Er schaute in ein Buch, vielleicht in den Garten, aber seine Gegenwart war wie tausend Augen. Aus jedem Winkel des Zimmers. Der Kamm fiel ihr hinunter. Sie schminkte sich hastig das Gesicht, als täte sie etwas Unrechtes. Umziehen war unmöglich. Irgendeinen Mantel oder eine Jacke. Nichts von der sonst unumgänglichen Überprüfung im großen Spiegel unten in der Veranda: Wie sehe ich aus? Wie stimmt dieses äußere Bild heute mit mir innen überein? Ist innen außen oder außen innen? Klafft womöglich ein nicht wegzuschaffender Abstand zwischen beiden?
Mit Jonathan Ruf, der hinter ihr die Treppe hinunterkam, musste sie darauf verzichten. Nur nicht die Treppe hinunterfallen! Sie war danach. Schmal und steil wie eine Bodenstiege. Es war doch alles in Ordnung. Sie waren auf dem Weg ins Kino. Sie musste sich nur die Treppe hinunterbewegen. Stufe für Stufe. Sich nicht in den dünn getretenen Teppichfetzen der Veranda verwickeln. Den Griff der Haustür niederdrücken. Die klemmte, sie hatte sich verzogen infolge der lang anhaltenden trockenen Witterung. Endlich die freie Luft der Straße. Das Gehen.
Drei Tage später, begann sie, weil sie sonst niemand zum Reden hatte, ein Tagebuch.
11. Oktober 1958
Mir klopft das Herz, und ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll, diesen Namen auf das Papier zu setzen: Jonathan Ruf.
Mein armer Liebling Robert. Ich schirme alles ab und lasse den Bereich Jonathan nicht an das rühren, was einmal früher mein Leben war, in dem Robert seinen zentralen Platz hatte. Ich will mir nicht ausdenken, was ich ihm antue, was ich ihm sagen werde, wie es sein wird, ihn zu küssen, in seinen Armen zu schlafen, nachts neben ihm aufzuwachen. Ob er aus meinen Augen erraten kann, was geschehen ist? Ich glaube beinahe, ich könnte bei ihm sein, ihn lieben für die Tage, die er da ist, und dann zu Jonathan gehen, mich in seine weichen Hände geben, mich in die Neigung seines schmalen Körpers schmiegen, der so wach ist und keine Bewegung verloren sein lässt.
Ich weiß wieder einmal nichts, aber diesmal ist es besser. Ich gebe mich ganz bewusst aller Ungewissheit der Zukunft hin. Ich setze es aufs Spiel, dass ich vielleicht wirklich lieben, dass ich leiden, ja auch, dass ich mit diesem Abgrund im Herzen aufwachen könnte. Ich setze es aufs Spiel, dass ich Robert verlieren könnte oder dass Jonathan meiner überdrüssig wird.
Ich muss doch einmal Mut haben und ja sagen können oder nein und nicht nur immer vielleicht und ich weiß nicht. Es geht nicht um Jonathan und darum, dass ich mit ihm schlafe, es geht um mich. Ich muss frei werden, keine Ketten mehr mit mir herumschleifen. Ich will leben, leben, leben.
Ich fühle mich elend heute Morgen. Ich brauchte nicht mit Jonathan zu schlafen, wenn ich all das Elend in mir einmal herausschreien könnte.
13. Oktober 1958
Ich weiß nicht, ob ich ihn liebe, soweit man davon sprechen könnte nach so kurzer Zeit. Ich finde es schwer, mit ihm umzugehen, wenn wir uns nicht küssen und lieben, aber sein junger, schmaler Körper ist mir ganz nah.
Ich habe auch keine Angst mehr.
19. Oktober 1958
Die ersten Minuten für mich, seit Robert wieder fort ist. Vom Bahnhof bin ich gleich zu Jonathan gegangen. Wenn ich wüsste, was ich mit meinem Leben anfangen soll, das so verwirrt ist! Es ist nichts leichter geworden durch Jonathan. Ich ging gestern zu ihm wie eine Puppe, die man aufgezogen hat. Die Beine liefen ganz von selbst in die bekannte Straße. Ich hatte nichts damit zu tun.
Dass ich mich nicht einfach freuen oder traurig sein kann! Einfache Gefühle, die eindeutig sind, sind nicht möglich. Immer ist alles in Verwirrung, und ich habe ein wehes Gefühl in mir. Robert war da, und ich dachte so oft an Jonathan, wenn er mich küsste. Sein Körper war plötzlich zu breit für meine Hände. Er war mir vertraut, manches war schön, aber glücklich war ich nicht. Ob ich es überhaupt kann? Manchmal zweifele ich, ob ich überhaupt lieben kann.
Robert ermüdet mich. Ich fühle mich ausgepumpt. Ich empfinde von jeher, wie lieb er ist und wie sehr er es verdiente, geliebt zu werden – und bin stumpf.
Wenn ich wüsste, wohin ich triebe, wäre alles einfacher. Dann hätte ich ein Ziel. Ich habe Angst. Vielleicht am meisten vor mir selbst. Wenigstens lerne ich jetzt zum ersten Mal, mich zu sehen, wie ich wirklich bin.
23. Oktober 1958
Ich habe heute die Nacht bei ihm verbracht. Bisher habe ich immer darauf bestanden, in meinem eigenen Bett aufzuwachen. Nun bei ihm. Es ist alles so selbstverständlich, das erstaunt mich immer wieder. Wir laufen nackt im Zimmer herum, als handele es sich um Robert und mich. Und es ist auch nicht mehr verschieden davon, nachts wenn ich aufwache und seine Wärme spüre.
Die Liebe mit Jonathan?
Nicht mehr als mit Robert. Allein das noch immer Fremde und Neue und seine größere Behutsamkeit machen den Unterschied und bewirken, dass ich mich nicht langweile, sondern eher zufrieden bin. Es ist etwas Seltsames um dieses Verhältnis. Ich wäre kaum traurig, wenn er sagte, er wolle mich nicht mehr. Genauso kann ich gehen, wann immer ich will. Eine sachliche Zuneigung? Ich nehme ihn hin, ich nehme dieses Abenteuer hin, wie man tanzen geht oder ins Theater. Es ist bloßer Zeitvertreib. Es ist eine warme Hinneigung da, wenn er bei mir ist; er kann mich erregen, wenn er leidenschaftlich ist, aber das ist auch alles. Wenn wir reden, ist er nur jemand, den ich kenne.
Ich hatte mir mehr erhofft von der Liebe mit ihm. Es fing so verheißungsvoll an, und seine kleinen Bewegungen und intensiven Berührungen versprachen mehr, als er halten konnte. Aber ich bin auch froh darüber, wie es ist. Wenn es so geblieben wäre, wie es war, als die Woche begann, bevor Robert kam, hätte eben dieser ganz eigene Zauber Gewalt über mich gehabt.
Ich bin wieder einmal dabei, alles umzukrempeln. Alles ist wirklicher geworden – ich mir selbst, die anderen – vielleicht aber auch weniger aufregend. Wer weiß.
24. Oktober 1958
Ich habe einen langen Brief an Robert geschrieben. Da ich keinen Durchschlag davon habe, mache ich hier eine teilweise Abschrift.
„Ich mache den Prozess des Sich–Entfernens von Dir mit sehr wacher Aufmerksamkeit durch. Aber da es sich gleichzeitig auch um den Vorgang des Zu–mir–Findens handelt, kann ich nicht traurig sein. Denn es ist jetzt wohl zum ersten Mal, dass ich die beschämende Tatsache einsehe, dass ich mir immer etwas vorgemacht habe. Ich stehe mir plötzlich als einem von meinen bisherigen Bildern völlig verschiedenen Menschen gegenüber. Ich habe mit Eigenschaften gelebt, als besäße ich sie, als wären sie ein Teil meines Wesens, den ich nicht verändern könnte, und ich muss mir jetzt eingestehen – das heißt, es ist gar nicht so dramatisch, ich sehe es einfach – ,dass ich mich zusammengebaut hatte nach meinen Sehnsüchten, Wünschen, Hoffnungen und Träumen. Ich hatte mich zu jemand ganz anderem zusammengeträumt, als ich in Wirklichkeit bin.
So kam ich auch zu Dir, Robert.