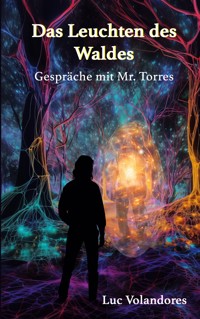
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Titel des Werks: "Das Leuchten des Waldes" Genre: Autobiografische Esoterik, spirituelle Entwicklung Kurzbeschreibung: "Das Leuchten des Waldes" ist eine ehrliche und tiefgreifende Erzählung, die die Leserschaft auf eine Reise durch das Leben von Luc Volandores (ein Pseudonym) führt. Beginnend in seiner Kindheit, erzählt Luc von einer geheimnisvollen Stimme, die den Anfangspunkt seiner spirituellen und persönlichen Entwicklung markiert. Die Erzählung bietet einen Einblick in die frühen Erfahrungen und Herausforderungen, die Lucs Weg prägten. Zielgruppe: Das Buch richtet sich an Leser:innen, die sich für autobiografische Geschichten mit esoterischen und spirituellen Themen interessieren. Es spricht sowohl Suchende als auch Skeptiker an, die Einblicke in die transformative Kraft von Lebensherausforderungen und persönlichem Wachstum suchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Denkwürdige Ereignisse
Die Nachricht
Robin Hood
Der Einbruch
Erwischt
Das Wollen der Unendlichkeit
Goliath und Madam Mim
Das Wollen beschwören
Noch ein denkwürdiges Ereignis
Das Paradies
Lilou
Zio Nobel
Schneewittchen Lilou
Die Grotte
Energiefresser
Lilou und Black Beauty
Zirkusfest
Näher als sonst
Das grosse Ende
Lehrbeginn
Sommer 1990
LSD
Vater in Kinderschuhen
Die kleine Welt
Loslassen
Wachträume
Durch die Wand
Das Leuchten des Waldes
Danksagung
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
in den Seiten von »Das Leuchten des Waldes« entfaltet sich vor unseren Augen nicht nur ein Lebensbericht, sondern ein echtes Epos der menschlichen Seele. Luc Volandores, ein Name, der gleichsam als Pseudonym und als Symbol für Transformation steht, öffnet das Fenster zu seinem tiefsten Inneren und lädt uns ein, ihn auf einer Reise zu begleiten, die sowohl persönlich als auch universell ist.
Die Reise beginnt in seiner Kindheit, in einem Moment, als Luc zum ersten Mal eine Stimme vernahm – nicht irgendeine Stimme, sondern eine, die das Versprechen einer Odyssee in sich trug. Diese Stimme war der Funke, der eine lebenslange Suche nach Wahrheit, Sinn und Verbindung entzündete. »Das Leuchten des Waldes« ist damit weit mehr als eine blosse Autobiografie; es ist eine Chronik spiritueller Entdeckungen und Erkenntnisse.
Seine Geschichte ist durchzogen von den dunklen Schatten der Fehltritte ebenso wie von den strahlenden Lichtern geistiger Höhenflüge. Sie ist ein Zeugnis dafür, wie tiefgreifende Erlebnisse und Begegnungen – mit Menschen, mit der Natur, mit dem Unbekannten – uns formen und unsere Perspektive auf die Welt verändern können.
Ein zentrales Kapitel des Buches widmet sich Lucs Lehrzeit bei Mr. Torres – einem Mann von geheimnisvoller Aura und tiefer Weisheit. Mr. Torres erscheint als Wegweiser, der Luc nicht nur lehrt, sondern ihn auch dazu inspiriert, über den Horizont des Sichtbaren hinauszuschauen und die verborgenen Dimensionen des Lebens zu erkunden. Diese Begegnung markiert den Beginn einer Transformation, die Luc auf Pfade führt, die sowohl herausfordernd als auch erhellend sind.
»Das Leuchten des Waldes« ist eine Reise, die uns lehrt, dass die Suche nach Sinn und die Sehnsucht nach Verbindung universelle Erfahrungen sind, die uns alle verbinden. Lucs Geschichte ermutigt uns, in die Tiefe unseres eigenen Seins zu blicken, und auf die Stimme seines eigenen Botschafters zu hören, die uns vielleicht auf unsere eigene Odyssee führt.
Ich lade Sie herzlich ein, sich von Lucs Erzählung inspirieren zu lassen und vielleicht ein eigenes Fenster zur Seele zu öffnen, um das Licht, das in uns allen leuchtet, zu entdecken und zu umarmen.
Mit herzlichen Grüssen, Luc
Denkwürdige Ereignisse
Das Buch »Das Wirken der Unendlichkeit« von Carlos Castaneda, herausgegeben in einer Neuauflage 2010 beim Fischerverlag, enthüllt in einem Abschnitt das Konzept eines persönlichen Albums. Stellen Sie sich vor, Sie blättern durch ein Fotoalbum, doch anstelle von gewöhnlichen Bildern – Geburtstagsfeiern, Urlauben, alltäglichen Momenten – enthalten die Seiten Ihres Albums Aufnahmen von Ereignissen, die das Fundament Ihres Seins erschüttert und Ihre Wahrnehmung der Welt verändert haben. Diese Bilder fangen nicht bloss Augenblicke ein; sie sind Fenster zu tiefgreifenden Erfahrungen, die Ihre Essenz und Ihre Verbindung zum Universum offenbaren. Dies ist das Herzstück des Konzepts, das Carlos Castaneda in seinem Werk »Das Wirken der Unendlichkeit« vorstellt – ein metaphorisches Album von denkwürdigen Ereignissen.
Denkwürdige Ereignisse sind jene seltenen Momente in unserem Leben, die eine unvergängliche Prägung hinterlassen. Es sind die Episoden, in denen das Gewöhnliche durchbrochen und uns das Geheimnis der Existenz – die Kraft der Unendlichkeit – offenbart wird. Diese Ereignisse sind weit entfernt von alltäglichen Belanglosigkeiten; sie sind tiefgründig und bedeutsam, oft begleitet von einer starken emotionalen oder spirituellen Erweckung.
Die Nachricht
Nach langem Nachdenken war ich mir unsicher, ob ich diesen bestimmten Abschnitt in meinem Kapitel überhaupt erwähnen sollte.
Denn eigentlich habe ich diesen Abschnitt in meinem Leben, immer und immer wieder rekapituliert, um mich von diesem Ereignis energetisch zu lösen. Doch ein guter Freund sagte mir dazu:
»Dieser Abschnitt deines Lebens steht in starkem Kontrast zu den Erleuchtungsmomenten, die du erfahren durftest. Doch gerade dieser Kontrast ist es, der deine spirituelle Suche tiefgreifend geprägt hat. Der Missbrauch, ein Kapitel, das von Schmerz und Verletzlichkeit gezeichnet ist, war paradoxerweise auch ein Wendepunkt, der dich zu einer intensiveren spirituellen Erforschung und einem tieferen Selbstverständnis führte. Es war ein Weg, auf dem du lernen musstest, die tiefen Wunden zu erkennen, anzunehmen und schliesslich zu heilen. Diese Reise war nicht einfach. Sie erforderte Mut, Konfrontation mit deinen tiefsten Ängsten und eine fortwährende Auseinandersetzung mit den Schatten deiner Vergangenheit. Aber gerade in dieser Auseinandersetzung fandest du auch eine ungeahnte Kraft und Weisheit, die dich auf deinem spirituellen Pfad stärkten und dir halfen, deinen inneren Frieden zu finden.«
Indem ich diese Erfahrungen hier teile, möchte ich zeigen, wie eng verwoben die dunklen und hellen Fäden unseres Lebens sind und wie aus den tiefsten Tälern der Verzweiflung oft die stärksten Impulse für Wachstum und Transformation entstehen können.
An einem nebligen Montagmorgen des 4. Februar 1985, als ich elf Jahre alt war, kehrte meine Mutter weinend von einem Gespräch mit den Schulbehörden nach Hause zurück. Sie liess sich am dunklen hölzernen Küchentisch nieder, der stets mit einem Plastiktischtuch bedeckt war.
Mit brüchiger Stimme sprach sie: »Ich habe dich schon tausendmal gewarnt: Wenn du dich nicht zusammenreisst, wirst du ins Heim geschickt. Jetzt kann ich nichts mehr für dich tun, Luc! Sie weigern sich, dich weiterhin zur Schule zu lassen!«
Ich war schockiert und konnte mir nicht vorstellen, was das für mich bedeuten würde. Ich stand da wie erstarrt und schaute auf das altmodische beige-braune Tischtuch mit Blumenmuster.
»Warum stehst du nur da? Hast du verstanden, was ich gerade eben gesagt habe? Du musst nächste Woche ins Heim!«
Immer noch auf das Tischtuch starrend, überkam mich eine Art Panikattacke. Mein Herz raste, die Atmung verflachte, und ein Gefühl der Ohnmacht überkam mich. Mein Körper begann zu kribbeln, und der Anblick des Tischtuchs verschlimmerte meinen Zustand. Es gab nur eine Lösung: Ich rannte ohne ein Wort aus der Wohnung im fünften Stockwerk des Hochhauses, in dem unsere fünfköpfige Familie lebte. Das Gebäude hatte dieselbe Farbe wie das Tischtuch ein langweiliges beige-braun, und befand sich im Rorschacherberg.
Es war eine Zeit, in der das Gebäude modern und im Kontrast zu den umliegenden Bauten stand.
Eilig drückte ich auf den Fahrstuhlknopf, doch der Aufzug liess auf sich warten.
»Nicht weinen, nicht weinen!«, flüsterte ich mir immer wieder in Gedanken zu.
Die Idee, das Treppenhaus zu nehmen, wäre eine Option gewesen. Leider war der Geruch im Treppenhaus nach Urin so übelriechend, dass mir beim Betreten, immer gleich hundsmiserabel wurde. Ironischerweise war ich selbst für diesen abscheulichen Gestank verantwortlich. Ein Jahr zuvor wollte ich herausfinden, wie lange mein Pipi brauchen würde, um nach unten zu gelangen. Die Neugier trieb mich dazu, den Fahrstuhl bis zum zehnten. Stockwerk zu nehmen. Das Treppenhaus war, mit einer offenen Mitte gebaut worden, ähnlich einer Wendeltreppe. Meine ersten Versuche, Spielzeugautos und andere Gegenstände fallen zu lassen, um ihre Fallgeschwindigkeit zu testen, waren nicht erfolgreich – sie kamen nur 3 bis 4 Stockwerke tief. Ich hatte keine Ahnung von Physik, aber ich war entschlossen, es zu versuchen. Ich holte meinen Pullermann aus der Hose und pieselte drauf los. Jeder, der schon einmal von einer grossen Höhe aus gepieselt hat, weiss, was dann passiert.
Ich hatte das halbe Treppenhaus mit Spuren meines Urins markiert, wie ein Hund, der seine Duftmarke hinterlässt. Mein Experiment endete im fünften Stockwerk. Die Bemühungen meines Vaters, der sich bei jedem Reinigungsvorgang lautstark über den penetranten Gestank beschwerte, schienen wirkungslos zu verpuffen. Bald darauf begannen andere Kinder, im Treppenhaus ihre Urinspuren zu hinterlassen.
Mein Vater, der sich neben seinem Hauptberuf als Kondukteur, den Job des Hauswarts aufbürdete, zwang mich zunehmend dazu, das Treppenhaus von den Hinterlassenschaften anderer Kinder zu säubern. Seine Worte über den widerlichen Geruch und die Notwendigkeit, diesen zu beseitigen, hallten in meinem Kopf wider. Seine Haupteinnahmequelle, bei den Schweizerischen Bundesbahnen, liess ihm kaum Zeit, und wir mussten alle mit anpacken. Der Gestank wurde für ihn zu einer unerträglichen Last.
In diesem Hochhaus war es unwahrscheinlich, allein im Fahrstuhl zu sein, aber heute hatte ich Glück im Unglück. Ein Gefühl der Einsamkeit überkam mich, während sich immer mehr, mein Hals zuzog und ich mühsam meine aufsteigenden Tränen zurückhalten musste. Als ich endlich das Erdgeschoss erreichte, eilte ich in Windeseile zur Telefonzelle, die etwa drei Minuten entfernt lag. In diesem Moment sehnte ich mich nach einem Ort der Sicherheit und Geborgenheit. In meinem überstürzten Eifer und unachtsam meinen Gedanken folgend, hatte ich meine Jacke zu Hause vergessen. In der Zelle empfing mich eine mildere Kälte als draussen. Die Emotionen übermannten mich, und ich liess meinen Tränen freien Lauf.
Meine Gedanken kreisten um das düstere Bild des Heims für schwererziehbare Kinder, die als »ganz schlimme Kinder« galten. Die Vorstellung, dorthin verbannt zu werden, schnürte mir die Kehle zu.
Plötzlich klopfte es an die Glastür. Ein Junge von ungefähr 15 Jahren stand da, er hielt eine Zigarette in seiner linken Hand, er hatte schulterlanges, dunkelbraunes Haar, das über den Kragen seiner abgetragenen schwarzen Lederjacke fiel. Sein Aussehen, gezeichnet von alten Jeans und abgenutzten Turnschuhen, verriet eine Jugend, die bereits von den Spuren des Lebens geprägt war. Sein Blick war leer, so als ob in ihm keine Seele wohnen würde. Er stand da und glotzte mich von oben bis unten an, als ich ihm die Tür öffnete. Ich hatte ein seltsames bedrückendes Gefühl in meiner Magengrube. Sein seelenloser Blick, als er vor mir stand und mich erneut musternd betrachtete, versetzte mich in Todesangst. Da war etwas an ihm, das mir ganz und gar nicht behagte. Das seltsame Gefühl in meiner Magengrube hielt an, und ich kämpfte darum, meine Angst nicht zu offenbaren, so gut es eben ging.
»Ich bin Mike Rotz. Ich kenne deinen älteren Bruder Jules. Bist du nicht Luc? Was ist los? Warum weinst du?«, fragte er mich neugierig.
»Ja, er ist mein Bruder und ich weine, weil ich gerade erfahren habe, dass ich in ein Heim für schwererziehbare Kinder abgeschoben werde. Ich habe absolut keine Vorstellung davon, was mich dort erwartet«, erklärte ich schluchzend.
Er schien einen Moment nachdenklich zu sein, überlegte, wie er am besten darauf reagieren könnte.
»Du hast grosses Glück, denn ich kenne mich da bestens aus. Ich war selbst jahrelang in einem Heim. Wenn du magst, erzähle ich dir genau, was dort so abgeht.«
Wir setzten uns auf den Rand des Gehwegs neben der Telefonkabine.
»Ich sehe, dass du Angst hast. Und ehrlich gesagt, du hast jeden Grund zur Sorge. Dort gibt es wirklich schlimme Typen, die dir das Leben zur Hölle machen können«, warnte er mich.
»Wie meinst du das?«, fragte ich mit rasendem Herzen und einem schlimmer werdenden Druckgefühl in meiner Magengegend.
»Du hast wirklich die Arschkarte gezogen, dort gibt es junge Männer in meinem Alter, die dich aufs Klo zerren und dich dort missbrauchen!«, sagte er mit ernster Miene.
Die Angst, die mich überkam, war überwältigend, und ich fühlte mich, als wäre ich nicht mehr wirklich in meinem eigenen Körper. Als ob jemand anderes für mich sprach und handelte. Obwohl ich genau wusste, was Missbrauch bedeutet, schien es mir eine gute Taktik zu sein, ihm zu vermitteln, dass ich jung und schützenswert bin.
Doch er antwortete mir mit einer erschreckenden Geschichte: »Ich wurde selbst einmal von einem Jungen auf die Toilette gezerrt, er zog mir die Hosen runter und drang gewaltsam in mich ein. Die Schmerzen waren, so unerträglich, dass ich tagelang nicht mehr sitzen konnte. Ich zeige dir besser, wie das geht, damit du später keine Schmerzen hast, wenn dich ein anderer Junge missbraucht.«
An diesem Punkt war es egal, was mit mir passierte. Ich schaltete in den Überlebensmodus. Nicht nur der androhende Missbrauch, sondern die Angst um mein Leben wurde immer realer. Ich sah ein Messer in seiner Hose, das zu Beginn unter seiner Lederjacke verborgen war.
»Komm, lass uns zu mir nach Hause gehen und es uns gemütlich machen. Wir können auch einen Film schauen, wenn du willst.«
Ich fühlte mich weiterhin weit von meinem Körper entrückt. Der Gedanke zu fliehen blitzte kurz auf, doch ich war zu langsam und erschöpft. Alles, was ich wollte, war lebendig daraus hervorzugehen, darum folgte ich ihm nach Hause.
Ich versuchte, mir einzureden, dass es dann zumindest nicht mehr so schmerzhaft sein würde, wenn mich ein Junge auf die Toilette zerren möchte.
Mike Rotz hatte ein leichtes Spiel mir zu suggerieren, dass dies der einzige Weg wäre, um mit meiner, bevorstehender Einweisung ins Heim umzugehen.
Im Nachhinein wurde mir klar, dass diese ausserkörperliche Erfahrung, dazu diente, meinen Körper und Geist zu schützen.
Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass Mike mich dann in der Wohnung seines Vaters missbraucht hat. Nach dem Vorfall kehrte ich völlig entkräftet nach Hause zurück. Zuerst wusch ich mir gründlich die Hände, getrieben von einem überwältigenden Bedürfnis nach Reinigung. Meiner Mutter gegenüber schwieg ich beharrlich über das Geschehene, denn ich hatte das Gefühl, dass sie mich bereits aufgegeben hatte. Die Aussicht auf Hilfe von ihrer Seite erschien mir zweifelhaft.
Es dauerte eine Weile, bis ich erkannte, dass trotz alledem, eine grosse Kraft dabei war, mich zu leiten.
Robin Hood
Es war Sonntag, am 3. März 1985, ein leicht bewölkter und kühler Tag, für Rorschacher Verhältnisse ein schöner Tag. Meine Mutter hatte alles zusammengepackt, was man für einen längeren Aufenthalt so benötigte. Es sah so aus, als wäre es eine Reise ohne Wiederkehr. Drei Koffer und vier Taschen enthielten mein gesamtes Hab und Gut. Unsere Mutter legte grossen Wert auf das Erscheinungsbild. Meist trugen mein Bruder und ich dieselben Kleidungsstücke, um das Bild einer harmonischen Familie zu vermitteln. Unsere jüngere Schwester Charlie genoss den Vorzug meiner Eltern und wurde als ihr Liebling betrachtet. Alle Erwartungen ruhten auf ihr, während ich in jeglicher Hinsicht als gescheitert galt. Ich war der Beelzebub, den niemand haben wollte. Ein weiterer Grund, warum die Behörden beschlossen hatten, mich in ein Heim abzuschieben, war meine ausgeprägte kriminelle Neigung im Alter von elf Jahren. Neben Ladendiebstählen kamen, Erpressung und Einbruch hinzu. Erlauben Sie mir, eine Episode aus dem Vorjahr zu erzählen.
Eines Tages kam ein Schulkamerad in der grossen Pause auf mich zu und steckte mir einen Hundert CHF Schein in die Hand. Er war der reichste Junge in der Schule, sein Vater ein Millionär, ein drahtiger alter Mann mit dünnem weissen Haar und markanten Gesichtszügen, Besitzer einer renommierten Schmuckherstellungsfirma. Seine Mutter war bereits seit einigen Jahren verstorben. Heinrich galt nicht nur als der wohlhabendste, sondern auch als der grösste Junge in unserer Schule. Seine Haare schimmerten in einem weissblonden Ton, und seine Beine wirkten im Verhältnis zum Oberkörper ungewöhnlich lang. Seine Kleidung schien nicht aus einem gewöhnlichen Laden zu stammen. Alles an ihm war anders. In seinen beigen Cordhosen und dem blaukarierten Hemd wirkte er wie ein Erwachsener. Seine handgefertigten schwarzen Lederschuhe waren definitiv nicht für ein Rennen unter uns Kindern gedacht. Ich fragte mich, wie er es draussen aushielt, in solch formeller Kleidung zu spielen. Sein gesamter Auftritt deutete darauf hin, dass er nicht aus unserer Gegend stammte. Obwohl Heinrich aus einem wohlhabenden Zuhause kam, war seine Ausdrucksweise vulgär. Unter uns Kindern war eine sittenlose Sprache nichts Aussergewöhnliches, aber bei Heinrich war die Kombination aus Reichtum, gutgepflegter Kleidung und vulgärer Sprache schon etwas eigenartig.
»Wow, verdammt, 100 Franken! Sind die für mich? Woher hast du so viel Kohle?«, fragte ich überrascht über den Hunderter, den er in seiner rechten Hand hielt.
»Das kann ich dir nicht sagen. Nimm es einfach und kauf dir etwas Schönes! Wo ist eigentlich Francesco? Er bekommt auch einen!«, antwortete er mit einem Lächeln in seinem Gesicht.
Francesco war Teil unseres Trios. Er mochte kleiner sein als ich, aber sein Redebedürfnis war umso ausgeprägter. Seine Wurzeln lagen in einer Region Italiens, von der er behauptete, dass die Mafia dort noch Einfluss hatte. In jener Zeit kamen viele Südländer in die Schweiz, auf der Suche nach Arbeit. Für mich brachte ihre Kultur eine erfrischende Abwechslung in unser steifes, lebloses Viertel. An den herrlichen Wochenendtagen versammelten sich zahlreiche Italiener, um den Tag miteinander zu verbringen, sich zu unterhalten und gemeinsame Aktivitäten zu geniessen. Scopa oder Scopone war eines ihrer beliebtesten Kartenspiele. Zudem verfügten sie über eine überdachte Bocciaanlage, die jedes Mal voller Leben war. Das Bocciaturnier war das Highlight des Tages, begleitet von Polenta (Maisbrei mit Parmesan) oder Pizza. Oft wurde ich eingeladen, daran teilzunehmen. Niemand fragte danach, woher ich kam oder was ein kleiner Schweizer dort zu suchen hatte – alle waren ausgesprochen gastfreundlich.
Francesco rannte wie von einer Biene gestochen auf mich zu und wedelte mit der Hunderternote, als hätte er einen Schatz gefunden. Sein Gesicht strahlte vor Aufregung, und er stolperte über seine eigenen Füsse und fiel kurz, bevor er mich erreichte. Ich half ihm aufzustehen, seine Hände waren mit kleinen spitzen Steinen übersät. Doch das schien ihm nichts auszumachen. Immer noch nach Luft ringend fragte er mich: »Hast du auch von Heini einen Hunderter bekommen?«
»Ja!«, antwortete ich mit einem breiten Grinsen. »Es ist unglaublich! Weisst du, woher er das Geld hat?
Das kann doch nicht sein monatliches Taschengeld sein, so viel bekommt er bestimmt nicht.«, sagte ich misstrauisch.
»Er hat mir erzählt, er habe es aus dem Tresor seines Vaters gestohlen. Aber das sei einmalig, es gebe kein weiteres Geld von ihm.«, berichtete Francesco.
»Das ist krass! Als ich ihn gefragt habe, woher das Geld kommt, wollte er mir nichts erzählen.«
»Er sagte mir, dass sein Vater am Abend zuvor lange arbeitete und er in dieser Zeit Zugang zum Tresor hatte. Sein Vater habe nichts mitbekommen, und im Tresor seien noch viel mehr von diesen Scheinen, sogar von den ganz grossen!«, erklärte Francesco.
»Meinst du? Der verarscht uns doch?«
»Nein, wirklich, ich schwöre, im Tresor ist so viel drin, es würde nicht bemerkt werden, wenn er etwas entnimmt. Zumindest behauptet das Heinrich. Frag ihn doch selbst.« Plötzlich zog sich ein hämisches Grinsen auf sein Gesicht, und das Funkeln in seinen Augen verriet mir, dass er gerade eine Idee hatte.
»Warum grinst du so merkwürdig?«, fragte ich ungeduldig.
»Ich habe einen Plan, wie wir an noch mehr Geld kommen können. Tatsächlich sind es sogar zwei Pläne. Der Erste ist, wir brechen in Heinrichs Haus ein, wenn sie nicht zu Hause sind.«
»Sag mal, spinnst du!«, unterbrach ich ihn.
»Nein warte! Oder Plan zwei, wir erpressen Heinrich damit, dass wir seinem Vater alles erzählen werden. Das ist ein verdammt genialer Plan von mir! Nicht wahr?«, prahlte Francesco.
»In deinem Plan gibt es zu viele Fragezeichen. Erstens: Wie kommst du ins Haus? Und woher zum Teufel bekommst du die Kombination, für den Tresor? Wir sind nicht gerade das A-Team, oder weisst du etwa, wie man einen Tresor knackt?«
»Ganz einfach!«, antwortete er, als wäre es die simpelste Sache der Welt. »Ich werde Heinrich einfach danach fragen. Ich bin sein bester Kumpel, du wirst schon sehen!«
Ich fand die Idee mit dem Einbruch ziemlich übel und gefährlich. Dennoch wollte ich nicht als Feigling dastehen und sagte ihm:
»Wir sollten das Ganze nochmal überdenken. Ich möchte nicht im Gefängnis landen!«
»Spinnst du? Wir sind viel zu jung, es gibt in der Schweiz kein Gefängnis für Kinder, und du bist der Oberstrazer!«, erklärte er.
»Oberstrazer« oder »Strazer« bedeutete damals umgangssprachlich, ein Dieb oder Supergauner zu sein.
»Lass uns zuerst Plan eins versuchen, die Erpressung«, schlug ich vor.
Francesco überlegte eine gefühlte Ewigkeit, bis er endlich seine Entscheidung bekannt gab.
»Okay, du Feigling, dann machen wir es zuerst so. Aber weil du solch ein Feigling bist, hast du die Ehre, diesen Part zu übernehmen«, erklärte er.
»Wie meinst du das, Francesco?«
»Na so, wie ich es gerade gesagt habe. Du gehst zu Heinrich und sagst ihm, dass wenn er keine Kohle mehr rüberwachsen lässt, wir alles seinem Vater erzählen werden!«
»Warum gerade ich?«
»Weil er mich lieber mag und du ihm sowieso nicht ganz geheuer bist!«
»Was soll das jetzt heissen? Du erzählst doch nur Mist! Ich habe keine Probleme mit Heinrich.«, sagte ich etwas verwundert.
»Vielleicht nicht du mit ihm, aber er mit dir. Er findet dich seltsam und irgendwie beängstigend. Frag ihn doch selbst.«
Damals wusste ich noch nicht, dass Francesco mich manipulieren wollte, um Heinrich zu erpressen. Ich grübelte die ganze Nacht über das Gesagte nach. Ich konnte nicht glauben, dass Heinrich so über mich dachte. Ich wurde wütend und beschloss am nächsten Tag, vor Schulbeginn zu Heinrich zu gehen, um Plan zwei in die Tat umzusetzen. Der Schulweg von zuhause aus dauerte ungefähr 30 Minuten und führte entlang einer vielbefahrenen Strasse. An der Kreuzung in Richtung Sulzberg, Rorschach und Heiden gab es eine kleine Metzgerei, die die besten Fleischkäse-Brötchen anbot.
Die Kombination aus Fleisch und dem knusprig frischgebackenen Brot, das nach Hefe roch, war einfach ein Hochgenuss. In einem anderen Schweizer Dialekt wird es »Bürli oder Mutsch« genannt (Bürli, Mutsch bedeutet kleines Bauernbrot).
Ich entdeckte Heinrich weiter oben auf dem Katzengoldweg, einem schmalen Kiesweg entlang eines Bächleins.
»Hey, Heinrich, warte mal kurz!«, schrie ich ihm nach, während ich auf ihn zulief.
»Ich habe dir etwas zu sagen!«, sagte ich total ausser Atem, als ich vor ihm stand.
»Könntest du uns, Francesco und mir, jeweils jede Woche einen Lappen mitbringen?« (Lappen war eine andere Bezeichnung für 100 Schweizer Franken.)
»Hast du den Arsch offen?! Mein Vater würde mich umbringen!«, sagte er verärgert, wobei seine Stimme lauter wurde.
»Francesco hat mir erzählt, dass du ihm gesagt hast, dass dein Vater nichts bemerkt, wenn du ihm etwas aus seinem Tresor stiehlst.«
»Wenn ich jede Woche 200 Franken rausholen würde, dann schon! Und ich möchte auch noch etwas davon haben, dann wären es schon 300. Das kann ich auf keinen Fall riskieren!«
»Es tut mir leid, aber Francesco und ich wollen mehr!«
»Das war sicher deine verdammte Scheissidee, Luc?!«
»Das spielt jetzt keine Rolle!«
»Du gibst uns immer am Montag das Geld, ansonsten erzählen wir alles deinem Vater!«, drohte ich.
Sein längliches, blasses Gesicht wurde rot vor Wut. Ich erwartete schon, dass er mir gleich eine runterhauen würde, aber stattdessen begann er zu weinen. Es schien, als habe er begriffen, dass er keine andere Wahl hatte, als uns jede Woche das Geld zu geben. Er zog sein kariertes Stofftaschentuch aus der Hosentasche und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.
In der darauffolgenden Woche war Heinrich nicht in der Schule, und wir dachten schon, dass alles aufgeflogen wäre. Doch am Montag stand er plötzlich vor Francesco und mir, drückte uns, ohne ein Wort zu verlieren, erneut je einen Lappen in die Hand. Francesco und ich warfen uns einen Blick zu. Plötzlich fanden wir die Idee, Heinrich zu erpressen, nicht mehr so verlockend. Wir empfanden Mitleid mit ihm, aber das Geld übte weiterhin eine magische Anziehungskraft auf uns aus. Unser Vorsatz, das Ganze schnell zu beenden, verblasste angesichts der Scheine rasch.
»Wofür gibst du dein Geld aus, Luc?«
»Keine Ahnung. Und du?«
»Wollen wir heute Nachmittag nach der Schule in den Zubi gehen?«
»Was für eine Geile Idee!«, sagte ich völlig aus dem Häuschen.
Zubi war ein grosses Spielwarengeschäft mitten in der Stadt Rorschach mit allem, was das Kinderherz begehrte. Als wir in dem Laden standen, suchte ich zuerst nach den teuren Spielwaren. Ich wollte schon immer ein Piratenschiff von Playmobil haben, aber leider reichten die 100 Franken nicht aus. Dann überfiel mich ein Gedanke: »Egal, was ich mir kaufe, meine Mutter würde dahinterkommen, ich könnte nichts mit nach Hause nehmen.«
Ich lief zu Francesco und berichtete ihm von meiner Erkenntnis.
Er sagte nur lapidar: »Diese Gefahr besteht bei mir nicht!«
»Verdammt! Jetzt habe ich mal Geld, aber kann nichts davon behalten. Was mache ich jetzt?!«
»Kaufe irgendwas und wirf es dann halt weg, oder du versteckst es draussen irgendwo in den Büschen«, sagte Francesco mit einem infamen Grinsen.
»Die Vorstellung, dass jemand meine Spielsachen findet, nervt mich nur. Dann schmeisse ich lieber alles weg!«
»Mach, was du willst! Ich habe jetzt bereits, was ich möchte!«
Mir fiel gar nicht auf, dass neben ihm eine blaue Schachtel auf dem Boden stand, die er aufhob und zur Kasse brachte.
»Hey, warte mal! Was hast du dir gekauft?«, rief ich hinterher.
»Ein Aquarium ohne Fische, die hole ich mir dann mit dem nächsten Taschengeld.«
Das Wort »Taschengeld« betonte er absichtlich lauter, um im Laden nicht verdächtig zu wirken. Ich wusste aber genau, was er mir damit sagen wollte.
Ich stand immer noch wie angewurzelt im Laden. Meine Ideen gingen mir aus. »Was soll ich mir bloss kaufen?«, dachte ich angestrengt nach. Eine Stunde später entschied ich mich für einen »Pfiel und Bogä«, übersetzt ins Deutsche einen Pfeil mit Bogen.
Ich hätte ihn gerne Francesco gezeigt und ein paar Pfeile mit ihm geschossen. Er war sicher schon längst zu Hause und richtete sich einen Platz für sein Aquarium ein. Auf dem Nachhauseweg überlegte ich mir, wie ich meiner Mutter erklären könnte, woher ich diesen Bogen hatte. Die dreiviertel Stunde, die ich nach Hause brauchte, nutzte ich, um mir eine Geschichte zurechtzulegen. Als ich ankam, sagte meine Mutter als Erstes:
»Komm gleich zu mir, bevor du was anderes machst.« Als ich dann vor ihr stand sagte sie: »Woher hast du dieses gefährliche Spielzeug? So etwas kommt mir sicher nicht in meine Wohnung, das bleibt draussen vor der Tür!«
»Woher haben Mütter, diesen verdammten siebten Sinn?«, dachte ich.
»Aber!«
»Keine Diskussion! Entweder geht das Teil vor die Tür, oder du bringst es gleich dorthin zurück, wodu es her hast. Aber vorher wäschst du dir noch die Hände, verstanden!«
Das setzte sich einen Monat lang fort. Jede Woche bekamen wir von Heinrich wie vereinbart einen Hunderter, den wir im Handumdrehen ausgaben. Francesco investierte jedes Mal etwas in sein Aquarium: entweder in eine neue Pumpe oder in einen dekorativen Stein, in dem die Fische sich verstecken konnten. Mir fiel auf, dass er trotz des gefüllten Beckens noch keine Fische kaufte. Auf meine Nachfrage hin erklärte er mir, dass die Fische erst zum Schluss ins Aquarium kommen könnten, da sie sonst sterben würden.
In der fünften Woche kam Heinrich in der Pause zu uns und sagte mit errötetem Gesicht: »Ich lasse mich nicht mehr länger von euch beiden kleinen Scheissern erpressen! Damit das mal klar ist! Ihr könnt alles meinem Vater erzählen, es ist mir inzwischen echt scheissegal!«
Seine plötzliche Enthüllung überraschte uns so sehr, dass wir sprachlos waren. Völlig verdutzt fragte ich Heinrich: »Bedeutet das, dass du auch für dich nichts mehr besorgen kannst?«
»Und selbst wenn, geht es euch nichts an! Mein Vater hat mich gestern Abend fast erwischt. Das war echt knapp!«
Ich war erleichtert, dass es endlich vorbei war, denn ich wusste ohnehin nicht mehr, wohin mit dem Geld.
Mit dem Hunderter, den ich eine Woche zuvor erhalten hatte, fühlte ich mich wie Robin Hood. Da meine Mutter immer misstrauischer wurde und ich nichts mehr mit nach Hause nehmen konnte, ging ich an einem schulfreien Mittwochnachmittag zu meiner Lieblingsmetzgerei. Vor dem Eingang stand ein roter, alter, leerer Kinderwagen. Die Mutter musste das Baby mit in die Metzgerei genommen haben. Als ich reinkam, wurde die junge Dame mit dem Baby bereits von der Chefin bedient. Ich bestellte bei der etwas jüngeren Verkäuferin mein Lieblingsbrot mit Fleischkäse. Die junge Fleischfachverkäuferin wunderte sich, dass ich mit einer 100er Note zahlte.
»Hast du eine Bank ausgeraubt?«, fragte sie scherzend.
»Ähm... nein, ich habe das Kässeli meiner Schwester geplündert.« Kässeli ist ein Schweizer Wort für Sparschwein. Der Witz schien bei der Verkäuferin nicht auf allzu fruchtbaren Boden zu fallen.
»Och, die Arme, hoffentlich stimmt das nicht!«
»Nein, war natürlich nur ein Witz!« Ich wiederholte den Satz, um ihn zu untermauern, aber sie ignorierte mich und zählte das Rückgeld. Die Chefin war immer noch in das Gespräch mit der jungen Mutter vertieft. In dieser Diskussion ging es um irgendwelche Geldprobleme und dass ihr Mann sie verlassen hatte. Sie schienen sich näher zu kennen, denn sie sprachen sehr offen über die aktuelle Situation der Frau.
Mir kam plötzlich eine glänzende Idee. Angesichts des bedauernswerten Zustands der jungen, verlassenen Mutter entschied ich mich dazu, mein Rückgeld beim Verlassen des Ladens in den Kinderwagen zu legen. Mit Bedacht schob ich den gesamten Betrag von 95 Franken unter die flauschige kleine Bettdecke. Ich wollte unbedingt die Reaktion der Frau sehen, wenn sie mit ihrem Baby aus der Metzgerei kam. Ich versteckte mich gegenüber der Metzgerei unten beim Bächlein, von dort aus hatte ich den besten Überblick. Ich musste ziemlich lange warten, das Gespräch schien einfach nicht enden zu wollen. Als sie endlich mit ihrem Kind aus dem Laden kam, legte sie zuerst die Decke im Kinderwagen zur Seite. Dann hörte ich einen undefinierbaren Schrei, der mehr dem eines Adlers oder eines kleinen Äffchens glich. Da sie aber offensichtlich das Geld sah, musste es ein Freudenschrei gewesen sein. Sie schaute sich um und konnte ihr Glück kaum fassen. Sie legte das Kind behutsam aber ersichtlich nervös in den Kinderwagen und ging dann schnell, ohne weitere Reaktion, in die Richtung eines nahegelegenen Wohnquartiers.
Gemischte Gefühle durchströmten mich. Einerseits freute ich mich für die junge Frau, andererseits wuchs mein schlechtes Gewissen gegenüber Heinrich zunehmend.
Der Einbruch
Francesco klingelte am folgenden Tag an meiner Haustür und fragte: »Kommst du raus? Ich muss dich was Dringendes fragen.«
»Nein sorry, habe gerade keinen Bock, schaue gerade Mac-Gyver. Was ist denn so wichtig?«
»Es geht um Heinrich. Ich habe eine Idee, wie wir den ursprünglichen Plan doch noch realisieren können. Du glaubst nicht, was ich in meiner Hosentasche habe!«
»Scheisse Mann, hast du immer noch nicht genug? Ich kann das Geld eh nicht ausgeben«, flüsterte ich, da meine hellhörige Mutter, in der Küche stand und das Abendessen vorbereitete.
»Okay, warte kurz, ich komme raus. Ich sage nur schnell meiner Mutter Bescheid!«
Es interessierte mich brennend, was er in seiner Hosentasche versteckte. Als ich die Tür hinter mir schloss, sagte Francesco: »Wir können auch schnell ins Treppenhaus gehen, es dauert nicht lange!«
»Glaub mir, dort willst du nicht hin!«
»Wieso, was soll da schon sein?«
»Ähm... sagen wir einfach, es stinkt!«
Hinter dem Hochhaus befand sich ein Spielplatz, mit Schaukel und einem Holzklettergerüst mit Rutschbahn. Wir setzten uns beim Sandkasten hin, der etwas abseits vom Klettergerüst stand.
»Also zeig schon, was hast du in deiner Hosentasche?«, drängte ich ihn.
»Wenn ich dir das jetzt zeige, gibt es kein Zurück, und du musst mitmachen!«
Er wusste, wie er mich rumkriegen konnte. Meine Neugier war einfach zu gross.
»Verdammt, zeig schon her!«
»Nicht so schnell. Du musst schwören, mitzumachen, egal, um was es sich handelt!«
»Ja verdammt, ich schwöre!«
Dann zog er einen zerknitterten Zettel aus seiner rechten Hosentasche.
»Wegen solch einem Zettel machst du so ein Drama?«
Er setzte schon wieder sein diabolisches Grinsen auf. Da war mir klar, dass er wieder etwas im Schilde führte, was mich in Teufels Küche bringen könnte.
»Das ist kein normales Blatt Papier! Das ist die Kombination des Tresors!«
»Was!?«, schrie ich fast hysterisch.
»Du hast wirklich die Kombination auf dem Zettel? Wie lautet sie, sag schon!?«
Er kniff die Augen zusammen und las laut vor: »Zwei, fünf, Sieben.« Plötzlich hielt er inne und sagte: »Den Rest hörst du, sobald wir vor dem Tresor stehen!«
»Willst du mich verarschen? Jetzt mach’s nicht so spannend!«
»Nein Luc, ich muss sicher sein, dass du mit von der Partie bist. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Plan! Heinrich sagte mir, dass sie am Samstag in zwei Tagen nach Deutschland einkaufen gehen wollen. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um ins Haus zu kommen!«
»Geht er als Millionär in Deutschland einkaufen, weil ihm die Schweiz zu teuer ist?«, fragte ich erstaunt. »Sag mir jetzt nicht, du hast noch einen Schlüssel von ihm bekommen?«
»Nein, viel einfacher. Heinrich lässt sein Fenster für uns offen. Wenn es geschlossen ist, soll das für uns ein Zeichen sein, noch nicht reinzukommen!«
»Abgesehen davon kann man durch ein geschlossenes Fenster sowieso nicht einsteigen!«, sagte ich und musste laut lachen.
»Wie zum Teufel konntest du ihn von deinem Vorhaben überzeugen?«
»Das bleibt mein Geheimnis«, sagte er mit seinem hämischen Grinsen.
»Also Luc, als Erstes steigst du auf das Flachdach der Villa, um zu überprüfen, ob jemand kommt. In dieser Zeit steige ich bei Heinrich durch sein Fenster im Hochparterre ein und überprüfe, ob der Tresor auch dort ist, wo er es behauptet. Er müsste sich im Untergeschoss beim grossen Klimperkasten hinter einem grossen Ölgemälde mit Sonnenblumen befinden. Heinrich sagte mir noch, wir sollen nur zwei Hunderter nehmen, aber nicht den Schmuck oder das Gold. Das sollen wir in jedem Fall in Ruhe lassen! Wir treffen uns dann am Samstag direkt bei der Metzgerei.«
Wir sprachen noch eine Weile über gewisse Details und verabschiedeten uns mit einem kurzen »Bis dann!«
An diesem Samstagnachmittag, eingehüllt in eine Atmosphäre der Unruhe nach einer schlaflosen Nacht, wurde meine Nervosität immer greifbarer. Draussen hing der Nebel wie ein grauer Schleier über der Stadt, dicht und undurchdringlich, so dass die Konturen der Gebäude nur schemenhaft zu erkennen waren. Es war, als hätte sich die Natur mit mir verschworen, um diesen Tag noch unheilvoller erscheinen zu lassen. Ein feiner, kalter Nieselregen begann zu fallen, leise und beharrlich, als wollte er die Welt in eine stille Melancholie tauchen. Während ich vor der Metzgerei stand, umgeben von diesem fast mystischen Wetter, spürte ich, wie die Anspannung des bevorstehenden Einbruchs mit jedem Atemzug zunahm.
»Heinrich und sein Vater müssten jetzt schon weg sein!«, sagte Francesco, ohne mich zu begrüssen.
Er war kein bisschen nervös. Ganz im Gegenteil schien ihm die ganze Sache Spass zu machen. Wir erreichten die Villa und parkten unsere Fahrräder unauffällig bei der Garage. Dann schlichen wir leise hinter den prachtvollen Bau, an den Ort, der das Flachdach gut zugänglich machte und wo sich Heinrichs Zimmer befand. Mit Francesco an meiner Seite kletterte ich mit Hilfe der sogenannten Räuberleiter auf das Flachdach. Als ich oben stand, sah ich ihm noch zu, wie er unerwartet schnell, wie ein Frettchen durch das Fenster bei Heinrich einstieg. Das Flachdach war grösser, als ich es mir vorgestellt hatte. Überall war Kies, und man hörte jeden meiner Schritte. Ich rannte zuerst nach rechts an den Rand des Daches, dann nach links, um zu überprüfen, ob jemand kommt. Es schien alles in Ordnung zu sein, als ich zurück an die Dachkante rennen wollte, dorthin, wo mir Francesco mit der Räuberleiter hochgeholfen hatte, fiel ich plötzlich mitten auf dem Weg voll auf die Fresse. Der rechte Fuss schmerzte so, als ob mir jemand den Fuss abgehackt hätte. Die Hände brannten wie Feuer, weil ich den Sturz auf dem Kies mit ihnen abfangen wollte. Ich versuchte aufzustehen, aber etwas stimmte nicht mit dem rechten Fuss, ich konnte kaum gehen. Jetzt musste ich so schnell wie möglich vom Dach runter, um meinen Fuss zu untersuchen. Ich schleppte mich zur Dachkante und liess mich von der Dachrinne hängend in das Gebüsch vor Heinrichs Fenster fallen. Ich versuchte, den Schmerz so gut es ging zu unterdrücken. Francesco war immer noch in der Villa. Ich versuchte vergebens, leise zu rufen. Von aussen konnte ich an keiner Stelle Blut sehen, also konnte es nicht so schlimm sein. Ich krempelte mein rechtes Hosenbein hoch, um zu sehen, wo genau ich mich verletzt hatte. Mir wurde speiübel, als ich die Verletzung erblickte eine klaffende Schnittwunde, die nicht blutete, so etwas hatte ich bis dato noch nie gesehen. Ein Teil meines Schienbeinknochens war sichtbar, und das Fleisch wies rote und weisse Punkte auf.
Es war mir ein Rätsel, warum ich nicht blutete.





























