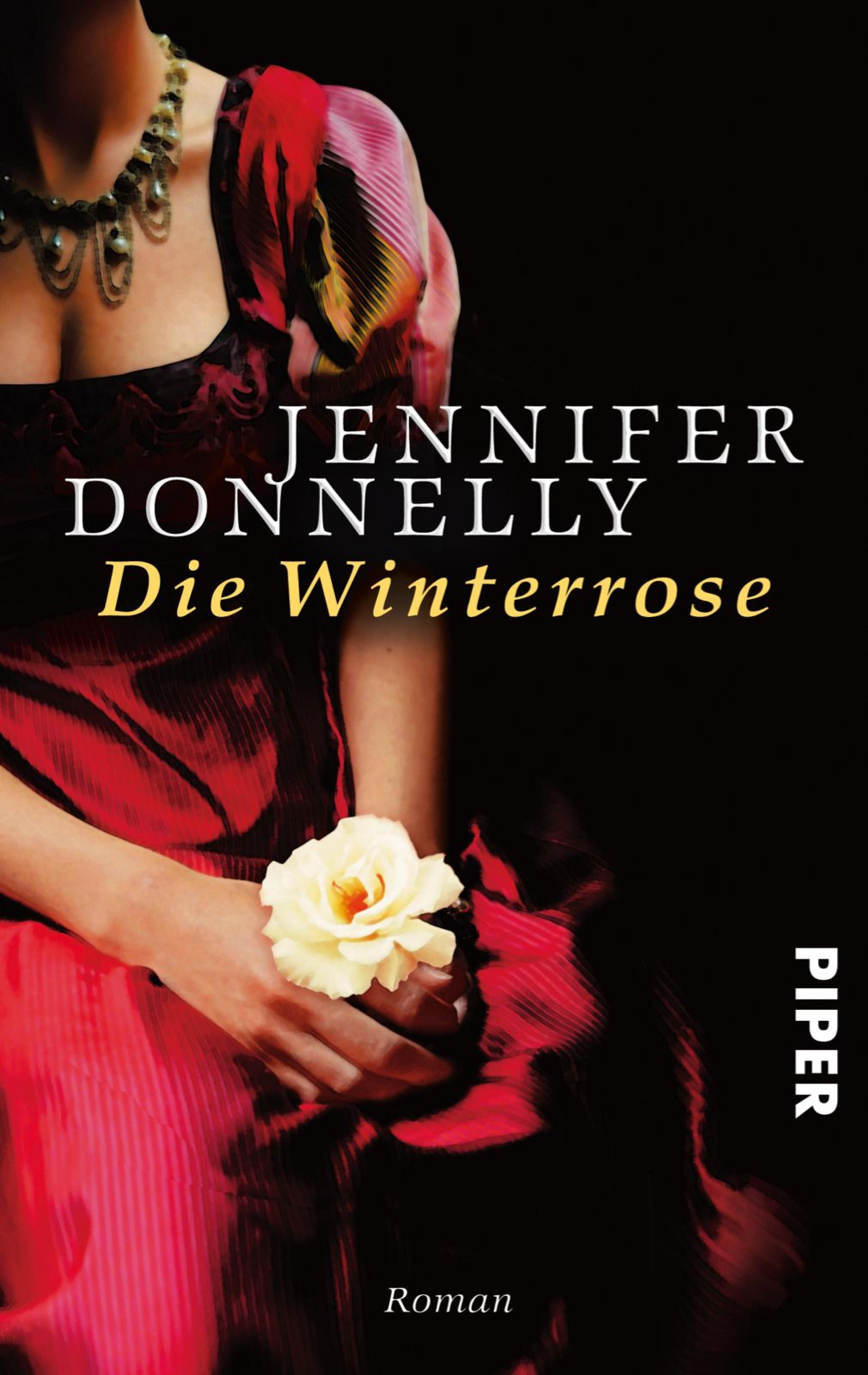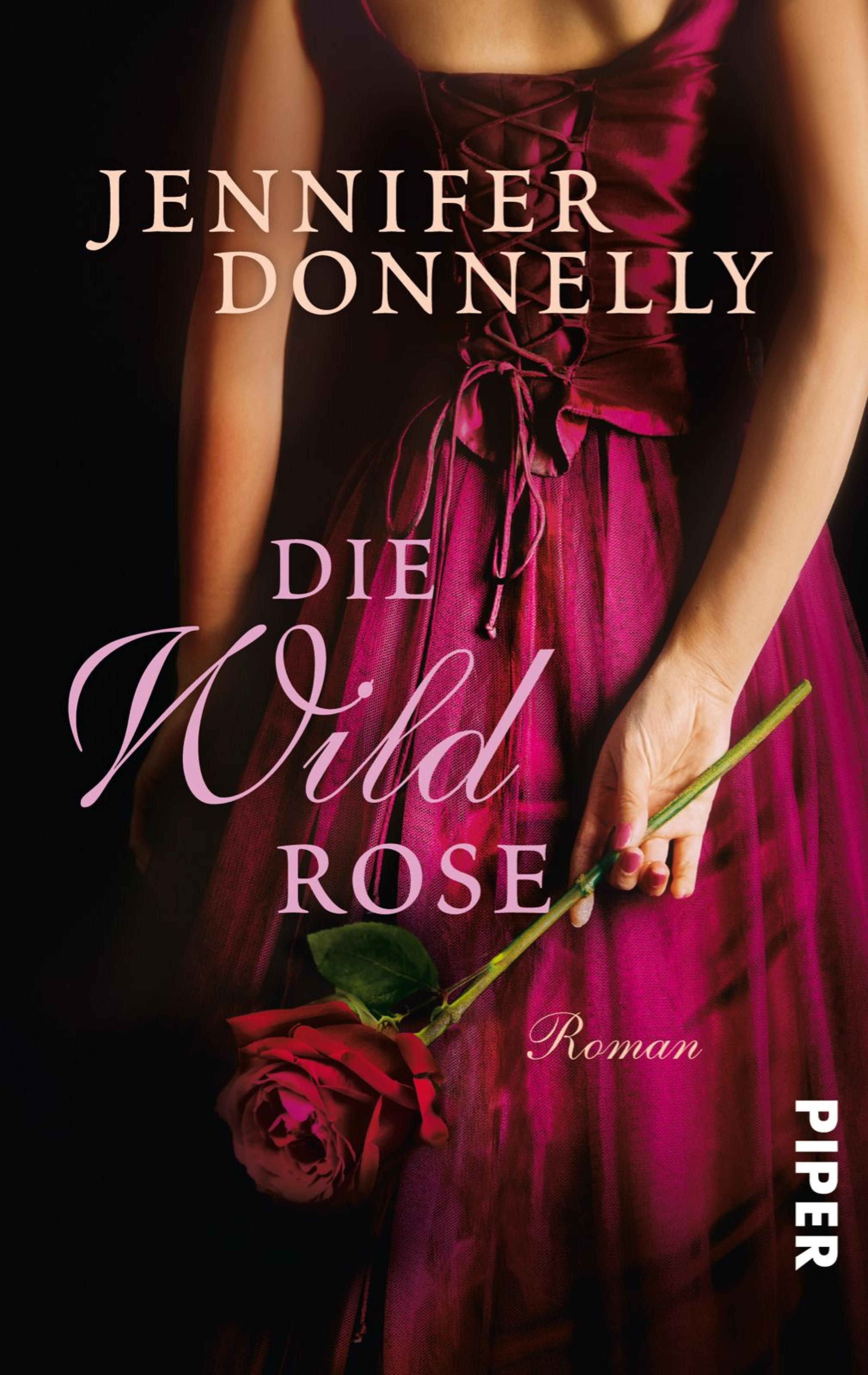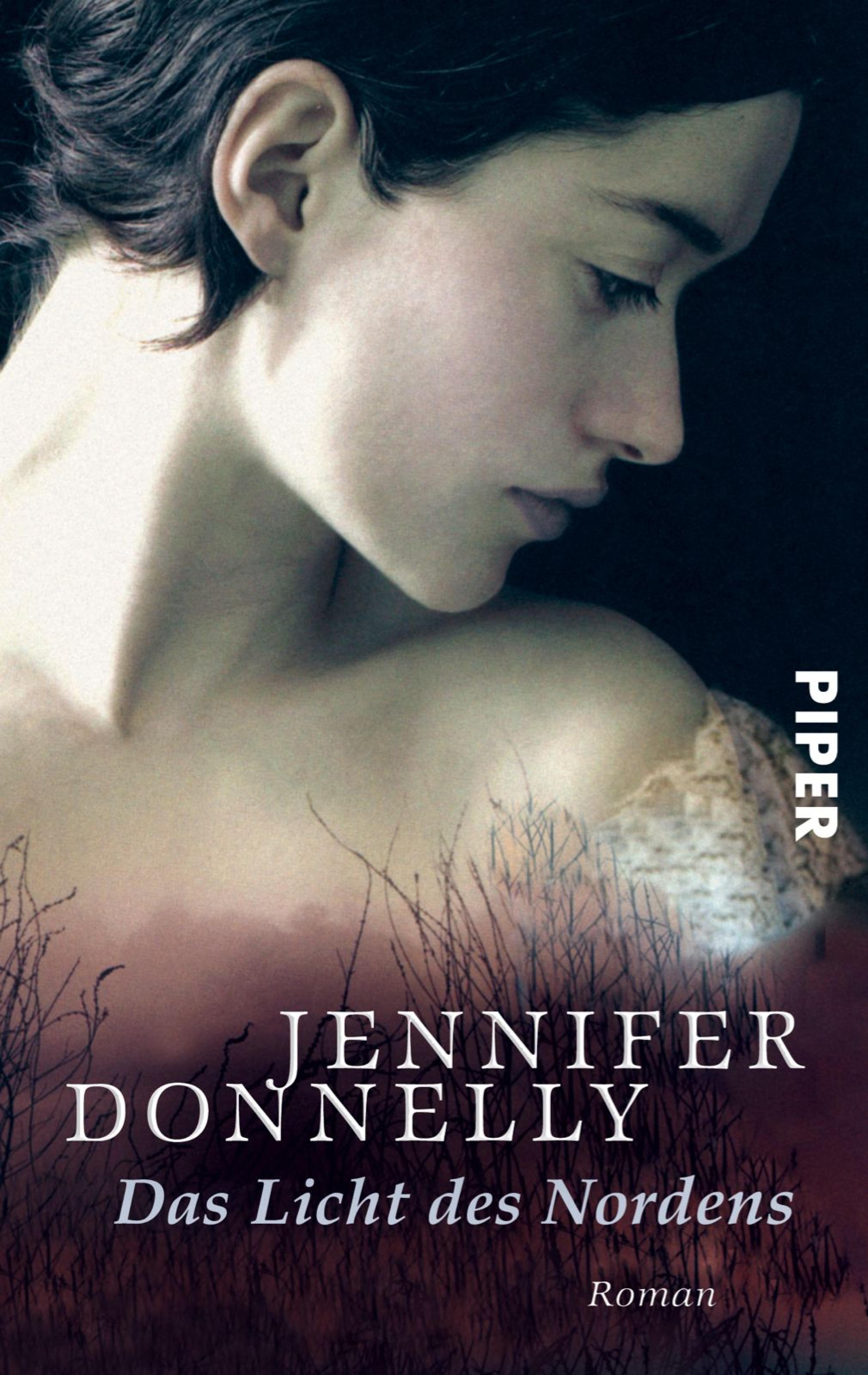
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Der 12. Juli 1906 ist ein schöner, sonniger Tag. Bis man die ertrunkene Grace Brown auf die Veranda des vornehmen Glenmore Hotel legt. Für die junge Mattie, die die Briefe der Toten an ihren Geliebten aufbewahrt, ändert sich mit diesem tragischen Ereignis das ganze Leben … Jennifer Donnelly, die sich von einem wahren Mordfall zu diesem Roman inspirieren ließ, erzählt die ergreifende Geschichte eines jungen Mädchens, das der ländlichen Enge ihrer Heimat zu entfliehen versucht – fesselnder Entwicklungsroman, Kriminalgeschichte und tragischer Liebesroman zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Megan,die dem Zauberwald entkam
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Angelika Felenda
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
10. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-96038-0
© 2003 Jennifer Donnelly
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»A Northern Light«, Harcourt Inc., New York 2003
Deutschsprachige Ausgabe:
© 2005 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: semper smile, München, unter Verwendung eines Artworks von Kelly Eismann
Umschlagmotiv: Laurence Dutton (Mädchen), Richard Clarke / Getty Images (Landschaft), photonica
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
Auch wenn die Sprüche der Weisen
Unterwerfung lehren, unterwerf ich mich nicht,
Sondern seh unversöhnlichen Geists
Mit stetem Trotz zu den Sternen hinauf.
ADELAIDE CRAPSEY
Saranac Lake, 1913
Wenn in den North Woods der Sommer kommt, vergeht die Zeit langsamer. Und manchmal bleibt sie ganz stehen. Der Himmel, der fast das ganze Jahr über grau und trüb ist, wird ein Meer aus Blau, so weit und hell, daß man nicht anders kann, als innezuhalten bei dem, was man gerade tut – beim Wäscheaufhängen vielleicht oder beim Schälen der Maiskolben auf der Hintertreppe –, um hinaufzusehen. Grillen zirpen in den Birken und locken einen aus der Sonne unter die Zweige, und die Hitze läßt die Luft stillstehen, die süß und schwer wie Balsam ist.
Während ich hier auf der Veranda des Glenmore stehe, dem schönsten Hotel am ganzen Big Moose Lake, sage ich mir, daß heute, am Donnerstag, dem 12. Juli 1906, ein solcher Tag ist. Die Zeit ist stehengeblieben, und die Ruhe und Schönheit dieses herrlichen Nachmittags werden niemals enden. Die Gäste aus New York, alle in sommerliches Weiß gekleidet, werden für immer auf dem Rasen Krockett spielen. Die alte Mrs. Ellis wird bis ans Ende der Zeit auf der Veranda sitzen und mit ihrem Stock aufs Geländer klopfen, um frische Limonade zu bestellen. Die Kinder von Ärzten und Anwälten aus Utica, Rome und Syracuse werden für immer lachend und kreischend durch die Wälder laufen, ganz benommen von zu viel Eiscreme.
Ich glaube das alles. Von ganzem Herzen. Denn ich bin geübt darin, wenn es gilt, mir selbst Lügen zu erzählen.
Bis Ada Bouchard aus der Tür tritt und meine Hand nimmt. Und Mrs. Morrison, die Frau des Direktors. an uns vorbeigeht und oben an der Treppe innehält. Zu jeder anderen Zeit bekämen wir was zu hören für unser untätiges Herumstehen. Jetzt scheint sie unsere Anwesenheit nicht mal zu bemerken. Sie verschränkt die Arme vor der Brust, und ihre grauen Augen blikken besorgt aufs Dock und den Dampfer, der längsseits angelegt hat.
»Das ist die Zilpha, nicht wahr, Mattie?« flüstert Ada. »Sie haben den Grund des Sees abgesucht. stimmt’s?«
Ich drücke ihre Hand. »Das glaub ich nicht. Ich glaub, sie haben bloß das Ufer abgesucht. Die Köchin meint, daß sich die beiden nur verirrt haben. Sie haben im Dunkeln nicht zurückgefunden und die Nacht im Wald verbracht, das ist alles.«
»Ich hab Angst, Mattie. Du nicht?«
Ich antworte nicht. Ich hab zwar keine Angst, kann aber nicht erklären, wie ich mich fühle, denn manchmal fehlen mir einfach die Worte. Obwohl ich Websters Lexikon der Englischen Sprache fast ganz durchgelesen habe, wollen sie mir dennoch nicht einfallen. wenn ich sie brauche.
Gerade im Moment suche ich nach einem Wort, das ein Gefühl beschreibt – ein kaltes, grausiges Gefühl tief im Innern –, das einen befällt, wenn man weiß, daß etwas geschehen wird, das einen verändert, ohne daß man etwas dagegen tun kann. Und man begreift zum erstenmal, zum allererstenmal, daß es ein Vorher und ein Nachher, eine Vergangenheit und eine Zukunft geben wird. Und daß man nicht mehr die gleiche Person sein wird, die man gewesen ist.
Ich stelle mir vor, daß Eva sich so gefühlt hat, als sie in den Apfel biß. Oder Hamlet, als er den Geist seines Vaters sah. Oder Jesus als Knabe, als jemand ihm sagte. daß sein Pa keineswegs ein Zimmermann sei.
Während ich unter dem wolkenlosen Himmel auf dieser Veranda stehe, in den Rosen die Bienen summen und aus den Kiefern ein Kardinalsvogel ruft, sage ich mir, daß Ada ein aufgescheuchtes Huhn ist, die sich immer grundlos Sorgen macht. Im Glenmore kann nichts Schlimmes passieren, nicht an einem Tag wie diesem.
Und dann sehe ich die Köchin vom Dock heraufrennen, aschfahl und atemlos, mit geschürztem Rock. und weiß, daß ich mich getäuscht habe.
»Mattie, mach den Salon auf!« ruft sie, ohne die Gäste zu beachten. »Schnell, Mädchen!«
Ich höre sie kaum. Mein Blick ist auf Mr. Crabb gerichtet, den Maschinisten der Zilpha. Er kommt den Weg herauf und trägt eine junge Frau in seinen Armen. Ihr Kopf lehnt wie eine welke Blume an seiner Brust. Wasser tropft aus ihrem Rock.
»O Mattie, sieh dir das an. O Gott, Mattie, schau«, sagt Ada, und nestelt an ihrer Schürze.
»Pst, Ada. Sie ist naß geworden, das ist alles. Sie haben sich auf dem See verirrt … das Boot ist gekentert, sie sind ans Ufer geschwommen, und sie … ist ohnmächtig geworden.«
»Gütiger Gott«, sagt Mrs. Morrison und legt die Hände auf den Mund.
»Mattie! Ada! Warum steht ihr hier rum und haltet Maulaffen feil?« keucht die Köchin und schleppt ihren schweren Leib die Stufen herauf. »Schließ das freie Zimmer auf, Mattie. Das neben dem Salon. Zieh die Rollos runter und leg eine alte Decke aufs Bett. Ada. geh und mach eine Kanne Kaffee und ein paar Sandwiches. Im Eisschrank liegen Schinken und Hähnchen. Jetzt macht schon!«
Im Salon spielen gerade ein paar Kinder Verstecken. Ich jage sie hinaus und sperre die Tür eines kleinen Zimmers auf, das von Postkutschern oder Schiffskapitänen benutzt wird, wenn das Wetter zu schlecht ist. um weiterzufahren. Ich merke, daß ich die Decke vergessen habe, und laufe zum Wäscheschrank, um sie zu holen. Gerade als ich sie über die Matratze breite. kommt Mr. Crabb herein. Ich habe auch ein Kissen und einen schweren Quilt mitgebracht, weil sie völlig durchgefroren sein wird, wenn sie in nassen Kleidern im Freien geschlafen hat.
Mr. Crabb legt sie aufs Bett. Die Köchin streckt die Beine der Frau aus und schiebt ihr das Kissen unter den Kopf. Dann kommen die Morrisons herein, gleich hinter ihnen Mr. Sperry, der Besitzer des Glenmore. Er starrt sie an, wird bleich und geht wieder hinaus.
»Ich hol eine Wärmflasche und Tee und … und Brandy«, sage ich und sehe zuerst die Köchin, dann Mrs. Morrison und dann ein Bild an der Wand an. Überallhin, bloß nicht auf die Frau. »Soll ich? Soll ich Brandy holen?«
»Sei still, Mattie. Dafür ist es zu spät«, erwidert die Köchin.
Daraufhin zwinge ich mich, sie anzusehen. Ihre Augen sind trüb und leer, ihre Haut gelb wie Muskatellerwein. Auf ihrer Stirn ist eine häßliche Wunde, und ihre Lippen sind aufgeplatzt. Gestern hatte sie allein auf der Veranda gesessen und am Saum ihres Rocks gezupft. Ich brachte ihr ein Glas Limonade, weil es heiß war draußen und sie angegriffen aussah. Ich berechnete ihr nichts dafür. Sie sah aus, als hätte sie nicht viel Geld.
Hinter mir bedrängt die Köchin Mr. Crabb. »Was ist mit dem Mann, mit dem sie zusammen war? Carl Grahm?«
»Von ihm gibt’s keine Spur«, antwortet er. »Zumindest noch nicht. Wir haben das Boot, mit dem sie gekentert sind. In South Bay.«
»Ich werde die Familie benachrichtigen müssen«, sagt Mrs. Morrison. »Sie ist in Albany.«
»Nein, da kommt nur Grahm, der Mann, her«, wirft die Köchin ein. »Das Mädchen lebte in South Otselic. Ich hab im Fremdenbuch nachgesehen.«
Mrs. Morrison nickt. »Ich ruf die Vermittlung an und versuche, mich mit einem Geschäft oder einem Hotel dort verbinden zu lassen. Oder mit sonst irgend jemandem, der der Familie was ausrichten kann. Mein Gott, was werd ich bloß sagen? Ach, ihre arme, arme Mutter!« Sie drückt sich ein Taschentuch an die Augen und eilt hinaus.
»Sie wird noch einen zweiten Anruf machen müssen, bevor der Tag zu Ende ist«, sagt die Köchin. »Wenn ihr mich fragt, haben Leute, die nicht schwimmen können, auf einem See nichts zu suchen.«
»Zu sehr von sich überzeugt, dieser Bursche«, sagt Mr. Morrison. »Ich hab ihn gefragt, ob er mit einem Ruderboot umgehen kann, und das hat er bejaht. So was schafft nur ein Dummkopf aus der Stadt, an einem ruhigen Tag ein Boot zum Kentern zu bringen …« Er sagt noch mehr, was ich jedoch nicht höre. Ich habe das Gefühl, als würden mir Eisenbänder die Brust zudrücken. Ich schließe die Augen und versuche, tief zu atmen, aber das macht alles nur noch schlimmer. Ein Bündel Briefe, mit einem blaßblauen Band verschnürt, taucht vor meinem geistigen Auge auf. Briefe, die oben unter meiner Matratze liegen. Briefe. die zu verbrennen ich versprochen habe. Ich kann die Adresse darauf sehen: Chester Gillette, 17 1/2 Main Street, Cortland, New York.
Die Köchin schiebt mich aufgeregt von der Toten weg. »Mattie, zieh die Rollos runter, wie ich dir aufgetragen hab«, sagt sie. Sie faltet Grace Brown die Hände über der Brust und schließt ihr die Augen. »In der Küche gibt’s Kaffee und Sandwiches«, erklärt sie den Männern. »Möchten Sie etwas essen?«
»Wir nehmen uns was mit, Mrs. Hennessy, wenn’s recht ist«, antwortet Mr. Morrison. »Wir gehen wieder raus. Sobald Sperry den Sheriff erreicht hat. Er ruft auch bei Martin’s an, um ihnen zu sagen, daß sie die Augen aufhalten sollen. Und bei Higby’s und den anderen Hotels. Nur für den Fall, daß Grahm es ans Ufer geschafft und sich im Wald verirrt hat.«
»Sein Name ist nicht Carl Grahm. Sondern Chester. Chester Gillette«, platze ich heraus, bevor ich mich zurückhalten kann.
»Woher weißt du das, Mattie?« fragt die Köchin. Alle sehen mich plötzlich an – die Köchin, Mr. Morrison und Mr. Crabb.
»Ich … ich glaub, ich hab gehört, daß sie ihn so nannte«, stammle ich, mit einemmal verängstigt.
Die Köchin kneift die Augen zusammen. »Hast du was gesehen, Mattie? Weißt du etwas, das du uns sagen solltest?«
Was hatte ich gesehen? Zu viel. Was wußte ich? Nur so viel, daß man für Wissen einen verdammt hohen Preis bezahlen muß. Miss Wilcox, meine Lehrerin, hat mir so viel beigebracht. Warum nur hat sie mich das nicht gelehrt?
Reiz • bar
Meine jüngste Schwester, Beth, ist fünf und wird sicher eines Tages am Fluß arbeiten – flußaufwärts oben auf dem Damm stehen und die Männer unten lauthals warnen, daß Stämme runterkommen. Die Lunge dafür hat sie.
Es war ein Frühlingsmorgen Ende März, noch keine vier Monate her, obwohl es schon viel länger zurückzuliegen scheint. Wir waren zu spät dran für die Schule, und es gab noch einiges im Haushalt zu tun. bevor wir uns auf den Weg machten, was Beth aber nicht weiter kümmerte. Sie saß einfach da, ignorierte den Maisbrei, den ich ihr gemacht hatte, und sang aus voller Kehle wie eine der Opernsängerinnen aus Utica. die in den Hotels auftreten. Bloß daß keine Opernsängerin je »Los, Harry« zum besten gab. Jedenfalls meines Wissens nicht.
Los, Harry und Tom oder Dick oder Joe
Geht mir Wasser holen!
Sie nehmen den Eimer und trödeln herum
Und tun nicht wie befohlen.
Mitten in der Wasserschlacht ruft die Köchin
»Essen«!
Und schon geht das Gerenne los,
Aus Angst man wird vergessen.
»Beth, jetzt sei still und iß deinen Brei«, schimpfte ich und flocht ihr das Haar. Aber sie hörte nicht, denn sie sang ihr Lied nicht für mich oder jemand anderen von uns. Sie sang es für den leblosen Schaukelstuhl am Ofen und für den verbeulten Fischkorb an der Schuppentür. Sie sang es, um all die leeren Plätze in unserem Haus zu füllen, um die Stille zu vertreiben. Meistens machte mir ihre Krakeelerei am Morgen nichts aus, aber an diesem Morgen hatte ich mit Pa etwas zu besprechen, etwas sehr Wichtiges, und war furchtbar genervt. Wenigstens einmal wollte ich Ruhe haben. Ich wollte, daß alles in Ordnung war und alle sich gut benahmen, wenn Pa hereinkam, damit auch er in guter Stimmung wäre und sich wohlwollend anhörte, was ich zu sagen hatte.
Es gibt schwarzen Sirup und Hörnchen wie Stein,
Der Tee stinkt nach Socken, doch wir hauen rein.
Die Bohnen sind sauer, das Porridge eiskalt,
Es schmeckt wieder prima, ab geht’s in den Wald.
Die Küchentür flog auf, und Lou mit ihren elf Jahren ging mit einem Eimer Milch am Tisch vorbei. Sie hatte vergessen, ihre Stiefel auszuziehen, und hinterließ eine Spur aus Mist auf dem Boden.
»Wir ziehen unsre Träger hoch und binden unsre Schuh!«
»Beth, bitte!« sagte ich und band ihr eine Schleife um den Zopf. »Lou, deine Stiefel! Du hast noch deine Stiefel an!«
»Und nehmen unsre Äxte …«
»Was? Ich kann dich nicht verstehen, Matt«, sagte Lou. »Mann, jetzt halt doch mal die Klappe«, schrie sie und schlug Beth auf den Mund.
Beth kreischte auf, wand sich und warf sich gegen die Stuhllehne. Der Stuhl kippte um und prallte gegen Lous Eimer. Die Milch schwappte über, und Beth stürzte zu Boden. Sie begann zu brüllen, Lou schrie. und ich wünschte, meine Mutter wäre hier, wie ich es mir jeden Tag wünsche. Mindestens hundertmal am Tag.
Als Mama noch lebte, konnte sie für sieben Leute Frühstück machen, unsere Hausaufgaben abhören. Pas Hosen flicken, unsere Henkelmänner füllen, die Milch zum Sauerwerden ansetzen und Pastetenteig ausrollen. Alles gleichzeitig und ohne die Stimme zu heben. Ich kann von Glück reden, wenn mir der Brei nicht anbrennt und ich Lou und Beth davon abhalten kann, sich gegenseitig zu massakrieren.
Abby, die vierzehn ist, kam herein, und brachte in ihrer Schürze vier braune Eier mit. Vorsichtig legte sie sie in eine Schüssel in den Schrank und sah dann auf die Bescherung am Boden. »Pa muß bloß noch die Schweine füttern. Dann kommt er gleich«, sagte sie.
»Pa wird dir den Arsch versohlen, Beth«, sagte Lou.
»Er wird dir deinen versohlen, weil du Arsch gesagt hast«, antwortete Beth, noch immer schniefend.
»Jetzt hast du’s auch gesagt. Also kriegst du doppelt Dresche.«
Beth verzog das Gesicht und begann erneut zu heulen.
»Schluß jetzt! Alle beide!« rief ich, weil mir die Vorstellung, daß Pa seinen Gürtel nehmen und ich das Klatschen auf ihren Beinen hören müßte, angst machte. »Niemand kriegt Dresche. Geht und holt Barney!«
Beth und Lou liefen zum Ofen und zerrten den armen Barney hervor. Pas alter Jagdhund ist blind und lahm und pinkelt in sein Bett. Onkel Vernon sagt, Pa sollte ihn hinter den Stall führen und erschießen. Pa meint, er würde eher Onkel Vernon erschießen.
Lou führte Barney zu der Pfütze. Er konnte die Milch zwar nicht sehen, aber riechen, und leckte sie gierig auf. Seit Ewigkeiten hatte er keine Milch mehr bekommen. Wir genausowenig. Die Kühe geben im Winter keine Milch. Aber eine hatte gerade gekalbt. daher gab es zum erstenmal seit Monaten ein bißchen. Bald sollten noch mehr kalben. Ende Mai würde der Stall voller Kälber sein, und Pa würde früh losziehen. um in die Hotels und Sommerhäuser Milch, Sahne und Butter zu liefern. Doch an diesem Morgen war dieser eine Kübel alles, was wir für lange Zeit hätten, und zweifellos erwartete er, davon etwas auf seinen Brei zu kriegen.
Barney leckte den Großteil der Milch auf. Das Wenige, das er übrigließ, wischte Abby mit einem Lappen auf. Beth war ein wenig naß geworden, und das Linoleum unter ihrem Stuhl wirkte sauberer als überall sonst, aber ich hoffte, Pa würde es nicht bemerken. Im Eimer war noch ein Rest übriggeblieben. Ich fügte ein bißchen Wasser hinzu, goß dann alles in einen Krug und stellte ihn neben seine Schale. Zum Abendessen würde er eine schöne Milchsoße erwarten oder vielleicht einen Pudding, nachdem die Hühner vier Eier gelegt hatten, aber darüber würde ich mir später Gedanken machen.
»Pa wird’s merken«, sagte Lou.
»Wie denn? Wird’s Barney ihm sagen?«
»Wenn Barney Milch säuft, furzt er wie wild.«
»Lou, bloß weil du wie ein Junge rumstolzierst und dich so anziehst, mußt du noch lange nicht reden wie einer. Mama hätte das nicht gefallen«, antwortete ich.
»Mama ist nicht mehr da, also kann ich reden, wie’s mir paßt.«
Abby, die ihren Lappen an der Spüle auswusch, wirbelte herum und schrie: »Sei still, Lou!« Worauf wir zusammenfuhren, weil Abby sonst nie schreit. Selbst bei Mamas Beerdigung hat sie nicht geweint, obwohl ich sie ein paar Tage später in Pas Schlafzimmer fand. wo sie ein Blechbild unserer Mutter so fest umklammert hielt, daß ihr die Kanten die Hand zerschnitten hatten. Unsere Abby ist wie ein buntgemustertes Kleid, das nach dem Waschen mit der Innenseite nach außen aufgehängt wurde, so daß man keine Farben sieht. Unsere Lou ist das Gegenteil davon.
Während die beiden sich weiter stritten, hörten wir Schritte aus dem Schuppen, der sich hinten an die Küche anschließt. Das Gezänk hörte sofort auf. Wir dachten, es sei Pa, aber dann klopfte es, und wir wußten, daß es nur Tommy Hubbard, der Nachbarsjunge, sein konnte, der wieder mal Hunger hatte.
»Juckt’s dich, Tom?« rief ich.
»Nein, Matt.«
»Dann komm zum Frühstück rein. Aber wasch dir vorher die Hände.«
Das letzte Mal, als ich ihn reinließ, brachte er Flöhe mit. Tommy hat sechs Geschwister. Sie wohnen auf der Uncas Road wie wir, aber weiter oben in einem schäbigen Holzhaus. Ihr Land liegt an der Straße, zwischen dem der Loomis und unserem. Sie haben keinen Pa, oder viele Pas, je nachdem, wie man es sieht. Emmie, Tommys Mutter, tut ihr Bestes, indem sie in den Hotels Zimmer putzt und kleine selbstgemalte Bilder an Touristen verkauft, aber das reicht nicht aus. Ihre Kinder sind ständig hungrig, ihr Haus ist kalt, und sie kann ihre Steuern nicht zahlen.
Tommy kam herein und brachte eine seiner Schwestern mit. Mein Blick schoß zwischen den beiden hin und her. Pa hatte noch nicht gegessen, und im Topf war nicht mehr viel übrig. »Ich hab bloß Jenny dabei«, stieß er schnell hervor. »Ich selbst hab keinen Hunger.«
Jenny trug ein wollenes Männerhemd über ihrem dünnen Baumwollkleid. Die Hemdzipfel reichten bis zum Boden, das Kleid bedeckte kaum ihre Knie. Tommy hatte überhaupt keine richtige Oberkleidung an.
»Ist schon gut, Tom. Es ist genug da«, antwortete ich.
»Sie kann meinen haben. Mir hängt diese verdammte Pampe sowieso zum Hals raus«, sagte Lou und schob ihre Schale über den Tisch. Um ihre Freundlichkeit zu zeigen, ging sie oft die seltsamsten Wege.
»Ich hoffe, Pa kann dich hören. Du redest wie ein Fuhrknecht.«
Lou streckte die Zunge mit ihrem Frühstück darauf heraus. Abby sah aus, als hätte sie Lust, ihr eine runterzuhauen. Zum Glück war der Tisch zwischen ihnen.
Alle hatten den Maismehlbrei satt. Mich eingeschlossen. Schon seit Wochen aßen wir ihn mit Ahornzucker darüber zum Frühstück und Mittagessen. Zum Abendessen gab’s Buchweizenpfannkuchen mit Kompott aus Äpfeln vom letzten Herbst. Oder Erbsensuppe mit einem alten Schinkenknochen, der vom langen Kochen weiß geworden war. Wir hätten gern Rinderhack oder Hühnchen und weiche Brötchen gegessen, aber das meiste, was wir im September eingelagert hatten, war aufgebraucht. Im Januar hatten wir das letzte Wild gegessen sowie den Schinken und den Speck. Und obwohl wir zwei Fässer frisches Schweinefleisch eingepökelt hatten, war eines davon verdorben. Was mein Fehler war. Pa hatte gesagt. ich hätte nicht genug Salz in die Lake gegeben. Im Herbst schlachteten wir dann einen unserer Hähne und danach noch vier Hennen. Damit blieben uns nur noch zehn Hühner, von denen Pa keins mehr anrühren wollte, da sie uns jetzt frische Eier und im Sommer Küken und noch mehr Eier liefern würden.
Als Mama noch lebte, war alles anders. Irgendwie schaffte sie es, den ganzen Winter hindurch gutes Essen auf den Tisch zu bringen, und dennoch war im Frühling noch Fleisch im Keller übrig. Ich bin nicht mal ansatzweise so tüchtig, wie meine Mutter es war. und wenn ich dies vergessen sollte, gibt’s Lou, die mich daran erinnert. Oder Pa. Nicht daß er die gleichen Dinge sagen würde wie Lou, aber wenn er sich an den Tisch setzt, kann man an seinem Gesicht ablesen, daß es ihm keinen Spaß macht, tagein tagaus Maisbrei vorgesetzt zu bekommen.
Jenny Hubbard jedoch hatte nichts dagegen. Sie wartete geduldig mit großen und ernsten Augen, während ich über den Rest, den Lou übriggelassen hatte. Ahornzucker streute und ihr die Schale reichte. Tom gab ich etwas aus dem Topf, jedenfalls so viel, wie ich erübrigen konnte, damit noch genug für Pa blieb.
Abby nahm einen Schluck Tee, dann sah sie mich über den Rand ihrer Tasse hinweg an. »Hast du schon mit Pa geredet?«
Ich schüttelte den Kopf. Ich stand hinter Lou und versuchte, ihr Haar durchzukämmen. Für Zöpfe war es zu kurz, weil es nur bis zum Kinn reichte. Kurz nach Weihnachten hatte sie es sich mit Mamas Schneiderschere abgeschnitten, gleich nachdem unser Bruder Lawton uns verlassen hatte.
»Tust du’s noch?« fragte sie.
»Über was reden?« fragte Beth.
»Geht dich nichts an. Iß dein Frühstück auf«, antwortete ich.
»Was, Matt? Worüber willst du reden?«
»Beth, wenn Mattie es dich wissen lassen möchte. würde sie es dir sagen«, warf Lou ein.
»Du weißt es doch auch nicht.«
»Aber ich erfahr’s.«
»Mattie, warum erzählst du es Lou und mir nicht?« jammerte Beth.
»Weil du den Mund nie nicht halten kannst«, sagte Lou.
Damit ging die Streiterei von neuem los. Meine Nerven lagen blank. »Es heißt nicht nie nicht, Lou«, sagte ich. »Beth, hör auf zu quengeln.«
»Matt, hast du das Wort des Tages schon rausgesucht?« fragte Abby. Abby, unsere Friedensstifterin. Sanft und mild. Unserer Mutter viel ähnlicher als der Rest von uns.
»O Mattie! Darf ich’s raussuchen? Darf ich?« bettelte Beth. Sie kletterte von ihrem Stuhl und lief ins Wohnzimmer. Dort bewahrte ich mein kostbares Wörterbuch auf, gemeinsam mit den Büchern, die ich mir von Charlie Eckler und Miss Wilcox lieh, der Waverly Ausgabe der »Beliebtesten Amerikanischen Klassiker« meiner Mutter und ein paar alten Exemplaren des Petersons Magazins, die meine Tante Josie uns geschenkt hatte, weil in der Kolumne des Herausgebers behauptet wird, es sei »eine der wenigen tauglichen Zeitschriften für Familien mit Töchtern«.
»Beth, du bringst es, aber läßt Lou das Wort aussuchen«, rief ich ihr nach.
»Ich will aber nicht ein Wort für Babyspiele«, murrte Lou.
»Kein Wort, Lou. Kein Wort«, zischte ich. Ihre Nachlässigkeit beim Sprechen machte mich wütender als ihr verschmierter Mund, ihre schmutzigen Overalls und der Mist, den sie reingeschleppt hatte, zusammen.
Beth kam an den Küchentisch zurück und hielt das Wörterbuch, als wäre es aus purem Gold. Was gar nicht so abwegig war. Zumindest wog es so viel. »Such das Wort aus«, sagte ich zu ihr. »Lou hat keine Lust.« Vorsichtig blätterte sie ein paar Seiten vorwärts, dann rückwärts und legte dann den Zeigefinger auf die linke Seite. »Rei … reiss … reissbar?« sagte sie.
»Ich glaube nicht, daß das stimmt. Buchstabier es«, befahl ich ihr.
»R-e-i-z-b-a-r.«
»Reizbar«, sagte ich. »Tommy, was bedeutet das?«
Tommy sah ins Wörterbuch. »Mürrisch, zänkisch. widerspenstig«, las er vor.
»Paßt das nicht haargenau?« fragte ich. »Reizbar«, wiederholte ich und ließ mir das Wort auf der Zunge zergehen. Ein neues Wort. Voller Möglichkeiten. Eine makellose Perle, die man immer wieder zwischen den Fingern drehen und dann zum Aufbewahren wegschließen kann. »Jetzt bist du dran, Jenny. Kannst du einen Satz bilden mit diesem Wort?«
Jenny biß sich auf die Unterlippe. »Bedeutet es ärgerlich?« fragte sie.
Ich nickte.
Sie runzelte die Stirn und sagte dann: »Ma war reizbar, als sie mir mit der Bratpfanne eins übergezogen hat, weil ich ihre Whiskeyflasche umgestoßen hab.«
»Sie hat dir eine Bratpfanne übergezogen?« fragte Beth mit aufgerissenen Augen. »Warum hat sie das getan?«
»Weil sie außer sich war«, sagte Abby.
»Weil sie getrunken hat«, berichtigte Jenny und leckte Breireste von ihrem Löffel.
Jenny Hubbard ist erst sechs Jahre alt, aber in den North Woods wird man schnell erwachsen, und genau wie der Mais müssen die Kinder schnell groß werden. wenn sie es überhaupt schaffen wollen.
»Deine Mama trinkt Whiskey?« fragte Beth. »Mamas sollten keinen Whiskey trinken …«
»Komm, Beth, laß uns gehen. Sonst kommen wir zu spät«, sagte Lou drängend.
»Kommst du nicht mit, Matt?« fragte Beth.
»In ein paar Minuten.«
Bücher und Henkelmänner wurden genommen. und Abby kommandierte Lou und Beth, die Mäntel anzuziehen, während Tommy und Jenny schweigend weiteraßen. Die Schuppentür schlug zu, dann war es still. Zum erstenmal an diesen Morgen. Bis Lou rief: »Matt? Kannst du mal herkommen?«
»Was ist denn? Ich hab zu tun.«
»Komm doch mal!«
Ich ging hinaus zum Schuppen. Lou stand dort. bereit zum Abmarsch, und hielt Lawtons Angelrute in der Hand.
»Lou, was soll das?«
»Ich kann keinen Brei mehr essen«, antwortete sie. Dann packte sie mich am Ohr, zog meinen Kopf zu sich und küßte mich auf die Wange. Ein schneller Schmatz. Ich nahm ihren Geruch wahr – Holzrauch. Kuhstall und den Kaugummi, den sie ständig kaut. Erneut knallte die Tür zu, und sie war fort.
Meine anderen Schwestern gleichen meiner Mutter. wie ich auch. Braune Augen, braunes Haar. Lou gleicht unserem Pa. Lawton auch. Kohlrabenschwarzes Haar. blaue Augen. Lou verhält sich auch wie Pa. Ständig verärgert neuerdings. Seit Mama gestorben und Lawton fortgegangen ist.
Als ich wieder nach drinnen ging, kratzte Tommy so heftig seinen Napf aus, daß ich dachte, er wolle das Emaille mitessen. Ich hatte von meinem Brei nur ein paar Löffel abgekriegt. »Willst du meinen aufessen. Tom?« fragte ich und schob ihm meine Schale hin. »Ich hab keinen Hunger und möchte ihn nicht wegwerfen.« Dann steckte ich den Stöpsel ins Spülbecken. goß heißes Wasser aus dem Kessel hinein, fügte ein bißchen kaltes aus der Pumpe dazu und begann mit dem Abwasch. »Wo sind eure anderen Geschwister?«
»Susie und Billy sind zu Weaver gegangen. Myrton und Clara versuchen’s beim Hotel.«
»Wo ist das Baby?«
»Bei Susie.«
»Geht’s eurer Ma heute nicht gut?«
»Sie kommt nicht unterm Bett vor. Sie sagt, sie fürchtet sich vor dem Wind und kann ihn einfach nicht mehr hören.« Tommy sah auf seine Schüssel und dann auf mich. »Glaubst du, daß sie verrückt ist, Mattie. Glaubst du, daß sie in die Anstalt kommt?«
Emmie Hubbard war ganz bestimmt verrückt, und ich war überzeugt, daß sie eines Tages abgeholt werden würde. Zwei- oder dreimal stand sie auch schon kurz davor. Aber das konnte ich Tommy nicht sagen. Er war schließlich erst zwölf. Während ich überlegte und nach Worten suchte, die weder gelogen waren, noch ganz der Wahrheit entsprachen – dachte ich mir, daß Verrücktheit nicht so ist, wie sie in Büchern beschrieben wird. Es ist nicht so wie bei Miss Havisham, die böse und würdevoll in den Ruinen ihres Herrenhauses sitzt. Und auch nicht wie in Jane Eyre, wo Rochesters Ehefrau auf dem Dachboden rumpoltert, schreit und die junge Angestellte erschreckt. Wahnsinn heißt nicht automatisch Schlösser, Spinnweben und silberne Kandelaber sondern schmutzige Laken, saure Milch und ein Hund, der auf den Boden kackt. Emmie verkriecht sich unterm Bett, weint und singt, während ihre Kinder versuchen, aus Saatkartoffeln Suppe zu kochen.
»Weißt du, Tom«, sagte ich schließlich, »es gibt Zeiten, da möchte ich mich auch unterm Bett verkriechen.«
»Wann denn? Ich hab dich noch nie unters Bett kriechen sehen, Matt.«
»Ende Februar zum Beispiel. Da bekamen wir in zwei Tagen über einen Meter Neuschnee, erinnerst du dich? Zusätzlich zu dem Meter, den wir schon hatten. Er wehte auf die Veranda und blockierte die Vordertür. Die Schuppentür hab ich auch nicht aufgekriegt. Pa mußte durchs Küchenfenster raussteigen. Der Wind hat getobt und geheult, und ich wollte mich bloß noch irgendwo verkriechen und nie mehr vorkommen. Die meisten von uns fühlen sich manchmal so. Deine Ma verhält sich bloß so, wie sie sich fühlt. Das ist der einzige Unterschied. Ich schau vor der Schule bei ihr vorbei und bring ihr vielleicht ein Glas eingekochte Äpfel und ein bißchen Ahornzucker mit. Das mag sie doch. oder?«
»Bestimmt. Ich weiß, daß sie das mag. Danke, Mattie.«
Ich schickte Tommy und Jenny zur Schule und hoffte, daß Weavers Mama schon da war, wenn ich bei den Hubbards ankam. Sie schaffte es besser. Emmie unterm Bett vorzuholen als ich. Ich machte den Abwasch fertig und sah aus dem Fenster auf die kahlen Bäume und die braunen Felder, um zwischen dem Schnee vielleicht ein paar gelbe Flecken zu erspähen. Wenn man im April eine Natter sieht, gibt es bald Frühling. Den Schnee, die Kälte und jetzt den Regen und Schlamm hatte ich gründlich satt.
Die Leute nennen diese Zeit des Jahres – wenn der Keller fast leer und der Garten noch nicht angepflanzt ist – die Sechs-Wochen-Not. Früher hatten wir im März immer Geld, um Fleisch, Mehl, Kartoffeln und alles andere zu kaufen, was wir brauchten. Pa ging Ende November zum Indian oder Raquette Lake hinauf, um beim Holztransport zu helfen. Sobald das Heu eingebracht war, machte er sich auf und blieb den ganzen Winter fort. Er führte Pferdegespanne, die flache Schlitten mit großen Kufen zogen. Die Ladungen waren zwei Mann hoch aufgetürmt, und er brachte sie über vereiste Wege die Berge herunter, wobei er sich auf seine Geschicklichkeit verließ, damit die Schlitten nicht die Hügel hinabstürzten und die Pferde und alles andere erschlugen, was ihnen im Weg war.
Wenn es März wurde, schmolz der Schnee, die Wege wurden weich, und es war nicht mehr möglich. die schweren Lasten darauf zu transportieren. Gegen Ende des Monats hielten wir jeden Tag Ausschau nach Pa, weil wir nie genau wußten, wann er zurückkam. Oder wie. Auf der Ladefläche eines Wagens, wenn er Glück hatte, oder zu Fuß, wenn nicht. Oft hörten wir ihn schon, bevor wir ihn sahen, wenn er ein neues Lied trällerte, das er irgendwo aufgeschnappt hatte.
Wir Mädchen rannten ihm alle entgegen, Lawton ging gemessenen Schrittes auf ihn zu. Mama bemühte sich, gelassen auf der Veranda zu sitzen, was sie aber nie schaffte. Er lächelte sie an, und schon lief sie vor Glück weinend den Weg hinunter, weil sie so froh war. daß seine Knochen noch ganz waren. Er nahm ihr Gesicht in die Hände, hielt sie dann auf Armeslänge von sich weg und wischte mit seinen schmutzigen Daumen ihre Tränen fort. Wir alle wollten ihn berühren und umarmen, aber das ließ er nicht zu. »Kommt mir nicht zu nah. An mir wimmelt’s«, sagte er. Hinter dem Haus zog er seine Kleider aus, übergoß sie mit Kerosin und verbrannte sie. Auch über den Kopf goß er sich welches, und Lawton kämmte ihm die toten Läuse aus dem Haar.
Währenddessen machte Mama Wasser heiß und füllte es in unsere große Zinkbadewanne. Dann nahm Pa in der Mitte der Küche ein Bad, sein erstes seit Monaten. Nachdem er sauber war, gab es ein Festmahl. Schinkensteaks mit Soße. Kartoffelbrei mit ganzen Seen flüssiger Butter darin. Den letzten Mais und die letzten Bohnen. Warme weiche Brötchen. Und zum Dessert einen Blaubeerpudding mit den letzten eingeweckten Beeren. Danach gab’s für jeden von uns Geschenke. In den Wäldern gab es zwar keine Läden. aber wenn die Männer ihr Geld ausbezahlt bekamen. machten Hausierer die Runde in den Holzfällerlagern. Lawton etwa bekam ein Federmesser und wir Mädchen Bänder und Bonbons. Und Mama ein Glas Knöpfe und Stoff für ein neues Kleid. Vielleicht einen Baumwollsatin in genau derselben Farbe wie ein Rotkehlchenei. Oder ein kamelhaarfarbenes Schottenkaro. Einen smaragdgrünen Baumwollsamt oder starre gelbe Japanseide. Einmal brachte er ihr sogar Seidenrips mit. der genau die Farbe von Preiselbeeren hatte. Mama hielt ihn sich an die Wange und sah meinen Pa dabei an. dann legte sie ihn monatelang weg, weil sie es nicht über sich brachte, die Schere zu nehmen und ihn zu zerschneiden. Am Abend saßen wir alle dann am Kanonenofen, aßen Karamelbonbons und Schokolade, die Pa mitgebracht hatte, und lauschten seinen Geschichten. Er zeigte uns all die frischen Narben, die er sich zugezogen hatte, erzählte uns komische Geschichten von den wilden Holzfällern, wie gemein der Chef, wie schlecht das Essen gewesen war und welche Streiche sie dem Koch und dem armen Küchenjungen gespielt hatten. Die Abende, an denen Pa aus den Wäldern zurückkam, waren schöner als Weihnachten.
Dieses Jahr war er nicht in die Wälder gegangen. weil er uns nicht allein lassen wollte. Doch ohne das Geld, das er dort verdiente, war es schwer gewesen. Den Winter über hatte er beim Eisschneiden am Fourth Lake geholfen, aber die Bezahlung war nicht so gut wie beim Holztransport, und die jährliche Steuer auf unser Land verschlang ohnehin alles. Während ich dastand und das Geschirr abtrocknete, hoffte ich. daß die Tatsache, daß wir vollkommen pleite waren. ihn bewegen würde, mir zuzuhören und mir sein Einverständnis zu geben.
Schließlich hörte ich ihn in den Schuppen kommen. und dann stand er mit einem kleinen schnaufenden Bündel im Arm in der Küche. »Dieses Mistvieh von einer Sau hat vier ihrer Ferkel gefressen«, sagte er. »Alle. außer dem kleinsten. Ich werd es zu Barney legen. Die Wärme wird ihm guttun. Himmel, wie der Hund wieder stinkt! Was hat er denn gefressen?«
»Wahrscheinlich hat er irgendwas auf dem Hof gefunden. Hier, Pa.« Ich stellte eine Schale Maisbrei auf den Tisch und rührte Ahornzucker hinein. Dann goß ich verdünnte Milch darüber und betete zu Gott. daß er nicht mehr verlangte.
Wütend setzte er sich hin und rechnete sich wahrscheinlich aus, wieviel Geld er durch die toten Ferkel verloren hatte. »Hat deine Mutter gebraucht, einen ganzen Dollar gekostet, dieses Buch«, sagte er und machte mit dem Kopf ein Zeichen in Richtung des Lexikons, das noch immer aufgeschlagen auf dem Tisch lag. »Nie hat sie einen Penny für sich selbst verwendet und dann einen ganzen Dollar für das Ding rausgeworfen. Nimm’s weg, bevor Fett drauf kommt.«
Ich brachte es ins Wohnzimmer zurück und schenkte Pa eine Tasse heißen Tee ein. Schwarz und süß, genau wie er ihn mochte. Ich setzte mich ihm gegenüber an den Tisch und sah mich im Raum um. Sah auf die rotweiß karierten Vorhänge, die gewaschen werden mußten. Auf die verblichenen Kalenderbilder von Beckers Farm- und Futterhandlung, die Mama an die Wand gepinnt hatte. Auf die angeschlagenen Teller und gelben Rührschüsseln im Regal über dem Ausguß. Auf das zersprungene Linoleum und den schwarzen Ofen. Auf Barney, der das Ferkel ableckte. Ich sah auf alles, was zu sehen war, auf manches sogar zweimal. und legte mir meine Worte im Kopf zurecht. Doch gerade, als ich den Mut aufbrachte, um den Mund zu öffnen, ergriff Pa das Wort.
»Ich mach Zucker morgen. Der Saft fließt in Strömen im Moment. Ich hab schon an die hundert Gallonen. Wenn ich noch länger warte, wird alles schlecht bei dem ungewohnt warmen Wetter. Du mußt morgen daheim bleiben und mir beim Sieden helfen. Deine Schwestern auch.«
»Pa, ich kann nicht. Ich fall zurück, wenn ich einen Tag versäume, und meine Prüfungen stehen doch an.«
»Die Kühe werden nicht satt vom Lernen, Mattie. Ich muß Heu kaufen. Was ich letzten Herbst gemäht hab, ist fast schon aufgebraucht. Fred Becker gibt nichts auf Kredit, also muß ich Sirup verkaufen, um welches zu kriegen.«
Ich wollte widersprechen, aber Pa sah von seiner Schüssel auf, und ich wußte, daß es besser war, den Mund zu halten. Er wischte sich die Lippen am Ärmel ab. »Du kannst von Glück reden, daß du dieses Jahr überhaupt gehen konntest«, sagte er. »Und das auch nur, weil die Vorstellung, daß du dein Diplom kriegst. deiner Mutter so viel bedeutet hat. Nächstes Jahr kannst du nicht weitermachen. Ich kann hier schließlich nicht alles allein schaffen.«
Ich sah auf den Tisch und war wütend auf meinen Vater, weil er mich zu Hause festhielt, wenn auch nur für einen Tag, aber er hatte recht: Man kann eine vierundzwanzig Hektar große Farm nicht allein bewirtschaften. In dem Moment wünschte ich mir, es wäre immer noch Winter und würde Tag und Nacht schneien, und man müßte nicht pflügen und pflanzen, sondern könnte lange Abende mit Lesen und Schreiben verbringen, und Pa hätte nichts einzuwenden dagegen. Reizbar, dachte ich. Verärgert, mürrisch. übellaunig. Trifft haargenau auf meinen Vater zu. Es war sinnlos, ihn mit süßem Tee milde stimmen zu wollen. Genausogut könnte man versuchen, einen Stein zu erweichen. Ich holte tief Luft und setzte alles auf eine Karte.
»Pa, ich möchte dich was fragen«, begann ich, während ganz gegen meinen Willen Hoffnung in mir aufstieg wie der Saft in unseren Ahornbäumen.
»Hm?« Er zog eine Augenbraue hoch und aß weiter.
»Kann ich diese Saison in einem der Hotels arbeiten? Vielleicht im Glenmore? Abby ist alt genug zum Kochen und für alle zu sorgen. Ich hab sie gefragt, und sie hat gemeint, sie würde das schon schaffen, und ich hab mir gedacht, wenn ich …«
»Nein.«
»Aber Pa …«
»Du mußt dich nicht nach Arbeit umsehen. Hier gibt’s genug davon.«
Ich wußte, daß er nein sagen würde. Warum hatte ich bloß gefragt? Ich starrte auf meine Hände – rote. rissige Altweiberhände – und wußte, was mir bevorstand: ein ganzer Sommer voller Knochenarbeit, ohne Geld dafür zu kriegen. Kochen, putzen, waschen. nähen, Hühner füttern, Schweine füttern, Kühe melken, Butter machen, Butter salzen, Seife kochen, pflügen, pflanzen, hacken, jäten, ernten, Heu machen, dreschen, einwecken – alles, was der ältesten Tochter einer Familie mit vier Töchtern, einer toten Mutter und einem herumgammelnden Bruder zufällt, der abgehauen ist, um auf dem Erie Kanal Boote zu fahren, statt wieder nach Hause zu kommen und auf der Farm zu arbeiten, wie er es sollte.
Ich war aufgebracht und hatte deshalb mehr Mut. als gut für mich war. »Pa, sie bezahlen gut«, sagte ich. »Ich dachte, ich könnte ein bißchen Geld für mich zurücklegen und dir den Rest geben. Ich weiß doch. daß du es brauchst.«
»Du kannst nicht allein da oben in einem Hotel bleiben. Das gehört sich nicht.«
»Aber ich wäre ja nicht allein! Ada Bouchard und Frances Hill und Jane Miley gehen alle ins Glenmore arbeiten. Und die Morrisons, die das Hotel führen. sind anständige Leute. Ralph Simms geht auch. Und Mike Bouchard. Und Weaver auch.«
»Weaver Smith ist keine Empfehlung.«
»Bitte, Pa«, flüsterte ich.
»Nein, Mattie. Das ist mein letztes Wort. In diesen Touristenhotels treiben sich alle möglichen Leute rum.«
»Alle möglichen Leute« hieß Männer. Pa warnte mich immer vor Waldarbeitern, Trappern, Führern und Aufsehern. Vor Sportlern aus New York oder Montreal. Vor den Männern in den Theatertruppen aus Utica, den Zirkusleuten aus Albany und den Schaustellern, die in ihrem Schlepptau folgten. »Männer wollen immer nur das eine, Mathilda«, sagte er ständig. Als ich ihn einmal fragte, was das sei, bekam ich eine Ohrfeige und die Warnung, nicht vorlaut daherzureden.
Doch es war nicht die Angst vor fremden Männern. die Pa Sorgen bereitete. Das war nur eine Ausrede. Er kannte alle Leute in den Hotels und wußte, daß die meisten von ihnen anständige Häuser führten. Es war die Angst, daß ihn wieder jemand verlassen würde. Ich wollte ihm widersprechen, ihm den wahren Grund vor Augen führen, aber sein Kiefer war angespannt, und an seiner Wange sah ich einen kleinen Muskel zucken. Lawton hatte diesen Muskel oft zum Zucken gebracht. Das letzte Mal, als das geschah, holte Pa mit einem Flößerhaken gegen ihn aus, er rannte davon, und monatelang hatte niemand mehr etwas von ihm gehört. Bis eine Postkarte aus Albany kam.
Wortlos machte ich den Abwasch fertig und ging zu den Hubbards. Meine Füße waren so schwer wie Eisklötze. Ich wollte Geld verdienen. Unbedingt. Ich hatte einen Plan. Nun, eher einen Traum als einen Plan, und das Glenmore war nur ein Teil davon. Aber zum damaligen Zeitpunkt hatte ich nicht viel Hoffnung. Wenn Pa mir schon nicht erlaubte, ins Glenmore zu gehen, das sich nur ein paar Meilen weiter oben an der Straße befand, was würde er dann erst zu New York City sagen?
Ele • men • tar
Wenn der Frühling einen Geschmack hat, dann schmeckt er wie junge Farnsprossen. Grün, knackig und frisch. Mineralisch, wie der Boden, aus dem sie wachsen. Leuchtend wie die Sonne, die sie hervorgelockt hat. Ich sollte welche pflücken gehen, zusammen mit Weaver. Wir zogen los, um zwei Eimer zu füllen – einen für uns und einen für den Chefkoch im Eagle Bay Hotel –, aber ich war zu beschäftigt damit. sie selbst zu essen. Ich konnte einfach nicht anders. Ich sehnte mich nach etwas Frischem nach all den Monaten, in denen es nur alte Kartoffeln und eingemachte Bohnen gegeben hatte.
»Schuch …«, versuchte ich zu sagen, aber mein Mund war voll. »Wir müschen … ein Worb schuch’n …«
»Die Schweine von meiner Mama haben bessere Manieren. Warum schluckst du nicht erst runter?« fragte Weaver.
Das tat ich. Aber nicht bevor ich noch mehr in mich hineingestopft, meine Lippen abgeleckt, die Augen verdreht und gegrinst hatte. Farnsprossen sind einfach zu köstlich. Pa und Abby mögen sie am liebsten in Butter geröstet mit Salz und schwarzem Pfeffer. aber ich mag sie am liebsten frisch aus dem Boden.
»Such ein Wort aus, Weaver«, sagte ich schließlich. »Der Gewinner liest, der Verlierer pflückt.«
»Albert ihr zwei wieder rum?« fragte Minnie, die neben uns auf einem Felsblock saß. Wie alle in ihrer Familie war sie sehr dick und mißmutig.
»Wir duellieren uns, wir albern nicht herum, Mrs. Compeau«, erwiderte Weaver. »Das ist eine sehr ernste Angelegenheit, und wir würden es schätzen, wenn die Sekundanten Ruhe bewahrten.«
»Dann gib mir einen Kübel. Ich bin am Verhungern.«
»Nein, du ißt alles auf, was wir gepflückt haben«, antwortete Weaver.
Sie sah mich mit Armesündermiene an. »Bitte, Mattie?« sagte sie schmeichelnd.
Ich schüttelte den Kopf. »Dr. Wallace hat gesagt, du sollst dich bewegen, Min. Das würde dir guttun. Steh auf und pflück dir selbst welche.«
»Aber Matt, ich hab mich doch schon bewegt. Ich bin den ganzen Weg vom See hier raufgelaufen. Ich bin müde …«
»Minnie, wir tragen hier ein Duell aus, wenn’s recht ist«, fuhr Weaver sie an.
Minnie brummte und seufzte auf. Schwerfällig ließ sie sich von dem Felsbrocken herunter, kauerte sich zwischen die Farnsprossen, pflückte einen nach dem anderen ab, schob sie sich mit dem Handrücken in den Mund und schlang sie hinunter, ohne sich Zeit zu nehmen, sie wirklich zu genießen. Während ich sie beobachtete, hatte ich das merkwürdige Gefühl, sie würde mich anknurren, wenn ich ihr zu nahe käme. Eigentlich mochte sie gar keine Farnsprossen, aber das war. bevor sie schwanger wurde und alles in ihrer Reichweite in sich hineinstopfte. Einmal erzählte sie mir, sie habe an einem Kohlestück geleckt, als niemand hersah. Und an einem Nagel gesaugt.
Weaver schlug das Buch in seiner Hand auf. Sein Blick blieb bei einem Wort hängen. »Frevelhaft«, sagte er und schlug das Buch zu. Wir standen Rücken an Rücken, hoben den Daumen unserer rechten Hand und streckten den Zeigefinger aus, als wäre er eine Pistole.
»Bis auf den Tod, Miss Gokey«, sagte er ernst.
»Bis auf den Tod, Mr. Smith.«
»Minnie, du gibst das Signal.«
»Nein, das ist albern.«
»Na komm schon. Mach’s einfach.«
»Also zählt«, sagte Minnie seufzend.
Wir gingen los und zählten die Schritte. Bei zehn drehten wir uns um.
»Zieht«, befahl sie gähnend.
»Es soll so lange gehen, bis einer tot ist, verstehst du, Minnie. Du könntest dich etwas anstrengen«, sagte Weaver.
Minnie verdrehte die Augen. »Ziehen!« rief sie.
Das taten wir.
»Feuer!«
»Gottlos!« rief Weaver.
»Unmoralisch!« erwiderte ich.
»Sündhaft!«
»Falsch!«
»Ungerecht!«
»Nicht rechtschaffen!«
»Verrucht!«
»Verdorben!«
»Ruchlos!«
»›Ruchlos‹? Jesus, Weaver! Ähm … ähm … warte … ich hab eins …«
»Zu spät, Matt. Du bist tot«, sagte Minnie.
Weaver grinste mich an, steckte die Finger in den Mund und pfiff. »Fang an zu pflücken«, sagte er. Er selbst machte sich ein Kissen aus seiner Jacke, setzte sich mit »Der Graf von Monte Christo« darauf und zog seine spindeldürren Beine an. Schon einen Eimer zu füllen, war ein Menge Arbeit, geschweige denn zwei. Und Minnie war keine Hilfe. Sie war bereits zu ihrem Felsbrocken zurückgewatschelt. Ich hätte es besser wissen müssen und Weaver nicht zu einem Wortduell herausfordern dürfen. Er gewann immer.
Farnsprossen pflücken war nur eine unserer Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Außerdem sammelten wir wilde Himbeeren, Blaubeeren oder Fichtenharz. Damit verdienten wir mal zehn Pennies, mal einen Vierteldollar. Fünfundzwanzig Cents kamen mir wie ein Vermögen vor, als ich mich noch mit einer Tüte Schokolinsen oder Lakritze zufriedengab, aber das war einmal. Jetzt brauchte ich Geld. Eine ganze Menge sogar. In New York City sei es ziemlich teuer, sagen die Leute. Letzten November hatte ich ganze fünf Dollar beisammen, was hieß, daß mir nur noch ein Dollar und neunzig Cent für eine Fahrkarte zur Grand Central Station fehlten. Miss Wilcox reichte ein Gedicht von mir bei einem Wettbewerb ein, der vom Utica Observer gefördert wurde. Mein Name kam in die Zeitung und mein Gedicht auch, und ich war um fünf Dollar reicher.
Konnte mich nicht lange über das Geld freuen. Wir brauchten es, um Mamas Grabstein zu bezahlen.
»›Am 24. Februar 1810 signalisierte die Wache von Notre Dame de la Garde dem Dreimaster Pharao. der von Smyrna, Triest und Neapel kam. Wie gewöhnlich wimmelte es auf der Plattform von Saint Jean von Neugierigen, denn die Ankunft eines Schiffes ist in Marseille immer etwas Großes …‹«, begann Weaver. Während er las, stocherte ich mit einem Stock herum und suchte nach den winzigen grünen Sprossen, die durch die nassen, verfaulten Blätter drangen, jedes eingerollt wie das obere Ende einer Fidel. Sie kommen an feuchten, schattigen Stellen heraus, und obwohl sie anfangs noch ganz winzig sind, haben sie eine Menge Kraft. Ich habe gesehen, wie sie in ihrem Wachstumsdrang schwere Felsen beiseite geschoben haben. Die Stelle hier oben, auf einem mit Ahorn und Fichten bewachsenen Hügel eine Viertelmeile westlich von Weavers Haus, ist ein guter Platz. Niemand kennt ihn außer uns. Hier gibt es genug Farnsprossen, um heute zwei und morgen noch einmal zwei Kübel zu füllen. Wir sammeln nie alle, sondern lassen genügend übrig. damit sie zu Farnen heranwachsen.
Ich hatte meinen Kübel vielleicht zu einem Drittel gefüllt, als die Erlebnisse von Dantes und Danglars das Pflücken immer mehr in den Hintergrund treten ließen und ich vollkommen gefangengenommen wurde, wie es mir bei einer guten Geschichte immer passiert.
»›…Als er sich umwandte, erblickte der Reeder Danglars hinter sich, der seine Befehle zu erwarten schien, in Wirklichkeit aber dem jungen Seemann mit haßerfülltem Blick folgte‹ . Hey! Weiterpflücken. Matt! Mattie, hörst du mich?«
»Hm?« Ich stand da wie in Trance, den Kübel neben mir, und lauschte, wie aus den Worten Sätze und aus den Sätzen Seiten und aus den Seiten Gefühle, Stimmen, Orte und Menschen wurden.
»Du sollst pflücken und nicht wie bekloppt dastehen.«
»Na schön«, seufzte ich.
Weaver schloß das Buch. »Vergiß es. Ich helf dir. sonst werden wir nie fertig. Gib mir die Hand.«
Ich streckte die Hand aus, er zog sich hoch und riß mich dabei fast um. Ich kenne Weaver Smith nun schon seit über zehn Jahren. Er ist mein bester Freund. Er und Minnie. Aber immer noch muß ich lächeln. wenn wir uns bei der Hand nehmen. Meine Haut ist so blaß, fast durchsichtig, und seine so braun wie Tabak. Dennoch gibt es zwischen mir und Weaver mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede. Seine Handflächen sind rosa wie meine, seine Augen braun wie meine, und im Innern ist er ganz genauso wie ich. Auch er liebt Wörter und tut nichts lieber, als ein Buch zu lesen.
Weaver war der einzige schwarze Junge in Eagle Bay. Dasselbe galt für Inlet, Big Moose Lake, Big Moose Station, Minnowbrook, Clearwater, Moulin. McKeever und die ganzen North Woods. Nie habe ich einen anderen gesehen. Vor ein paar Jahren kamen schwarze Männer, um bei Webb’s die neue Eisenbahnstrecke zu bauen, die von Mohawk nach Malone und direkt nach Montreal hinaufführt. Sie wohnten in Buckley’s Hotel in Big Moose Station – einer Siedlung ein paar Meilen westlich von Big Moose Lake –, aber sie gingen wieder, sobald die letzte Schiene gelegt war. Einer von ihnen erzählte meinem Pa, daß die Bowery. die übelste Straße in New York City, nichts sei im Vergleich zu Big Moose Station am Samstagabend. Er sagte, die Kriebelmücken hätten es nicht geschafft, ihn umzubringen, genausowenig Jerry Buckley’s Whiskey oder die rauflustigen Holzfäller, aber Mrs. Buckleys Kochkünsten würde dies gelingen, und er gehe fort, bevor es soweit komme.
Weavers Mama ist mit Weaver aus Mississippi hier raufgezogen, nachdem Weavers Vater vor ihren Augen von drei Weißen getötet worden war, und zwar aus dem einzigen Grund, weil er nicht vom Gehsteig trat. als sie vorbeigingen. Sie entschied, je weiter nach Norden sie gingen, um so besser. »Hitze macht die Weißen böse«, sagte sie zu Weaver, und nachdem sie von einem Ort namens Great North Woods hörte, ein Ort, der sich kühl und sicher anhörte, beschloß sie, mit ihrem Sohn dort hinzuziehen. Sie wohnten etwa eine Meile weiter oben an der Uncas Road, gleich südlich von den Hubbards, in einem alten Blockhaus, das jemand vor Jahren aufgegeben hatte.
Weavers Mama nahm Wäsche an und bekam eine Menge Arbeit von den Hotels und Holzfällerlagern. Im Sommer wusch sie Tisch- und Bettwäsche und im Herbst, Winter und Frühling Wollhemden, Hosen und lange Unterhosen, die mehrere Monate hintereinander getragen worden waren. Weavers Mama kochte sie in einem riesigen Eisentopf in ihrem Hinterhof. Sie sorgte auch für die Reinigung der Holzfäller selbst. die sie in eine Blechwanne steigen ließ, wo sie sich abschrubbten, bevor sie ihre Kluft wieder anzogen. Wenn eine ganze Mannschaft gleichzeitig eintraf, stand man besser nicht in ihrer Windrichtung. »Weavers Mama kocht heute Unterhosensuppe«, sagte Lawton immer.
Sie zog auch Küken auf. Dutzende. Während der warmen Monate briet sie jeden Abend vier oder fünf, buk auch Brötchen und Pasteten und schaffte am nächsten Tag alles auf ihrem Karren zur Bahnstation in Eagle Bay, wo sie ihre Waren an den Zugführer, die Schaffner und all die hungrigen Touristen verkaufte.
Jeder Penny, den sie verdiente, kam in eine alte Zigarrenkiste, die sie unter ihrem Bett aufbewahrte. Weavers Mama arbeitete so hart sie konnte, um Weaver aufs College schicken zu können. Auf die Columbia Universität in New York City. Miss Wilcox, unsere Lehrerin, ermutigte ihn, sich zu bewerben. Er hatte ein Stipendium bekommen und plante, Geschichte und Politikwissenschaft zu studieren, um dann eines Tages an die juristische Fakultät zu wechseln. Er war der erste frei geborene Junge in seiner Familie. Seine Großeltern waren Sklaven gewesen, und sogar seine Eltern waren noch als Sklaven geboren worden. obwohl Mr. Lincoln sie im Kleinkindalter befreite.
Weaver sagt, daß Freiheit wie Sloan’s Heilsalbe sei: verspreche immer mehr, als sie halte. Tatsächlich bedeute es nur, daß man zwischen den schlechtesten Jobs in Holzfällerlagern, Hotels und Gerbereien wählen könne. Solange seine Leute nicht überall die gleiche Arbeit wie die Weißen bekämen, offen ihre Meinung sagen, Bücher schreiben und veröffentlichen könnten und weiße Männer für das Verprügeln von Schwarzen nicht bestraft würden, solange sei kein Schwarzer wirklich frei.
Manchmal hatte ich Angst um Weaver. In den North Woods gab es Hinterwäldler genauso wie in Mississippi – dumme Leute, die nichts anderes im Sinn hatten, als die Verantwortung für ihr schäbiges Leben jemand anderem zuzuschieben –, und Weaver machte nie Platz auf dem Gehsteig oder zog seine Mütze. Er legte sich mit jedem an, der ihn als Nigger bezeichnete. und hatte nie Angst um sich. »Wenn du den Schwanz einziehst, wie ein Hund, Matt«, sagte er, »behandeln dich die Leute auch so. Wenn du aufrecht stehst, wie ein Mann, wirst du wie ein Mann behandelt.« Das mochte auf Weaver zutreffen, aber manchmal fragte ich mich, wie man seinen Mann stehen sollte, wenn man ein Mädchen war?
»Der Graf von Monte Christo klingt schon jetzt nach einem guten Buch, nicht wahr, Mattie? Obwohl wir erst beim zweiten Kapitel sind«, sagte Weaver.
»Das stimmt«, antwortete ich und beugte mich neben einem dichtbewachsenen Fleck mit Farnsprossen hinunter.
»Schreibst du immer noch deine Geschichten?« fragte mich Minnie.
»Ich hab keine Zeit. Und auch kein Papier. Ich hab schon alle Blätter in meinem Aufsatzheft verbraucht. Aber ich lese viel. Und lerne mein Wort des Tages.«
»Du solltest deine Wörter anwenden, nicht sammeln. Du solltest sie beim Schreiben anwenden. Dafür sind sie da«, sagte Weaver.
»Ich hab dir doch gesagt, daß das nicht geht. Hörst du nicht zu? Und abgesehen davon gibt’s in Eagle Bay nichts, worüber man schreiben könnte. Vielleicht in Paris, wo Mr. Dumas lebt.«
»Dü-mah.«
»Was?«
»Dü-mah. Nicht Dumm-aas. Bist du nicht selbst zur Hälfte Französin?«
».wo Mr. Dü-mahhh lebt, wo’s Könige und Musketiere gibt, aber nicht hier«, antwortete ich, vielleicht ein wenig gereizter, als ich eigentlich wollte. »Hier gibt’s nichts als Zuckersieden, Melken, Kochen und Farnsprossen sammeln, und wer möchte darüber schon was lesen?«
»Du brauchst uns nicht so anzufahren, du Giftnatter«, sagte Minnie.
»Ich hab euch nicht angefahren«, erwiderte ich gereizt.
»Die Geschichten, die Miss Wilcox nach New York geschickt hat, waren nicht über Könige und Musketiere«, sagte Weaver. »Die eine über den Eremiten Alvah Dunning und sein einsames Weihnachten war die beste Geschichte, die ich je gelesen hab.«
»Und wie der alte Sam Dunnigan seine arme tote Nichte eingewickelt und sie den ganzen Winter über in sein Eishaus gelegt hat, bis sie beerdigt werden konnte«, fügte Minnie hinzu.
»Und wie Otis Arnold einen Mann erschossen und sich dann in Nick’s Lake ertränkt hat, bevor der Sheriff ihn aus den Wäldern holen konnte«, sagte Weaver.
Ich zuckte mit den Achseln und stocherte in den Blättern herum.
»Was ist mit dem Glenmore?« fragte Minnie.
»Ich geh nicht hin.«
»Wie steht’s mit New York? Schon irgendwas gehört?« fragte Weaver.
»Nein.«
»Hat Miss Wilcox denn keine Post gekriegt?« bohrte er nach.
»Nein.«
Auch Weaver stocherte ein wenig herum und sagte dann: »Der Brief wird schon kommen, Matt. Das weiß ich. Und in der Zwischenzeit kannst du trotzdem schreiben, weißt du. Nichts kann dich vom Schreiben abhalten, wenn du es wirklich willst.«
»Das mag vielleicht für dich zutreffen, Weaver«, gab ich ärgerlich zurück. »Deine Mama läßt dich in Frieden. Aber was wäre, wenn du drei Schwestern, einen Vater und eine große beschissene Farm zu versorgen hättest, die nichts als endlose beschissene Arbeit bedeutet? Was wär dann? Glaubst du, daß du dann noch Geschichten schreiben würdest?« Ich spürte, wie es mir die Kehle zuschnürte, und ich schluckte ein paarmal, um den Kloß im Hals loszuwerden. Ich weine nicht oft. Pa rutscht schnell die Hand aus, und er hat wenig Geduld mit flennenden Mädchen.
Weavers und mein Blick trafen sich. »Es ist doch nicht die Arbeit, die dich abhält, Matt? Oder die mangelnde Zeit? Von der einen hast du immer zu viel und von der anderen immer zu wenig gehabt. Es ist dieses Versprechen. Sie hätte dich nicht dazu zwingen dürfen. Dazu hatte sie kein Recht.«
Minnie weiß, wann man aufhören muß, Weaver nicht. Wie eine Hornisse schwirrte er um einen herum und suchte nach einer Öffnung oder einem wunden Punkt, um dann so fest zuzubeißen, daß es weh tat.
»Sie lag im Sterben. Du hättest für deine Mutter das gleiche getan«, antwortete ich und sah zu Boden. Ich spürte, daß mir die Tränen kamen, und wollte nicht. daß er es sah.
»Gott hat ihr ihr Leben genommen und sie dir deins.«
»Halt den Mund, Weaver! Du weißt gar nichts davon!« rief ich, und Tränen liefen übers Gesicht.
»Du hast wirklich eine große Klappe, Weaver Smith«, sagte Minne tadelnd. »Sieh dir an, was du getan hast. Du solltest dich entschuldigen.«
»Ich entschuldige mich nicht, weil es stimmt.«
»Vieles stimmt. Das heißt aber noch lange nicht, daß du mit allem herausplatzen kannst«, sagte Minnie.
Darauf herrschte eine Weile Schweigen zwischen uns, das von nichts unterbrochen wurde, als dem leisen Geraschel der Farnsprossen, die in unsere Eimer fielen.
Vor ein paar Monaten tat Weaver etwas – etwas, das er seiner Ansicht nach für mich getan hatte, meiner Meinung nach jedoch hatte er es mir angetan. Er nahm mein Aufsatzheft – das ich über die Bahngleise in den Wald geworfen hatte – und gab es Miss Wilcox.
In dieses Aufsatzheft schrieb ich meine Geschichten und Gedichte. Die hatte ich nur drei Leuten gezeigt. meiner Mama, Minnie und Weaver. Mama sagte, sie brächten sie zum Weinen, und Minnie sagte, sie seien unglaublich gut. Weaver sagte, sie seien besser als gut. und riet mir, sie Miss Parrish zu zeigen, der Vorgängerin von Miss Wilcox. Er sagte, sie würde wissen. was man mit ihnen machen solle. Vielleicht bei einem Magazin einreichen.
Ende der Leseprobe