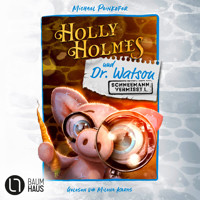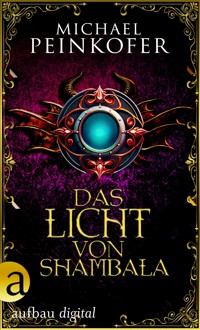
8,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sarah Kincaid ermittelt
- Sprache: Deutsch
Auf den Gipfeln Tibets lauert der Tod. Dort, wo alle Weisheit ihren Ursprung haben soll, droht tief im Innern der Erde eine dunkle Gefahr für die gesamte Menschheit. Noch ahnt die junge Archäologin Sarah Kincaid nichts davon. Ihre größte Sorge gilt ihrem Geliebten Kamal, den sie mit aller Macht aus den Fängen ihrer Feinde zu retten versucht.
Die Spur führt sie und ihre Gefährten nach Istanbul und immer weiter nach Osten, bis sie schließlich an Bord eines Luftschiffs, einer unglaublichen, neuartigen Konstruktion, nach Shambala gelangen. An diesem fernen Ort, den die Bruderschaft der Zyklopen bewacht und an den schon Alexander der Große zu gelangen suchte, erfüllt sich schließlich auch Sarahs Schicksal ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 732
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Auf den Gipfeln Tibets lauert der Tod. Dort, wo alle Weisheit ihren Ursprung haben soll, droht tief im Innern der Erde eine dunkle Gefahr für die gesamte Menschheit. Noch ahnt die junge Archäologin Sarah Kincaid nichts davon. Ihre größte Sorge gilt ihrem Geliebten Kamal, den sie mit aller Macht aus den Fängen ihrer Feinde zu retten versucht.
Die Spur führt sie und ihre Gefährten nach Istanbul und immer weiter nach Osten, bis sie schließlich an Bord eines Luftschiffs, einer unglaublichen, neuartigen Konstruktion, nach Shambala gelangen. An diesem fernen Ort, den die Bruderschaft der Zyklopen bewacht und an den schon Alexander der Große zu gelangen suchte, erfüllt sich schließlich auch Sarahs Schicksal ...
Über Michael Peinkofer
Michael Peinkofer studierte in München Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft. Seit 1995 arbeitet er als freier Autor, Filmjournalist und Übersetzer. Unter diversen Pseudonymen hat er bereits zahlreiche Romane verschiedener Genres verfasst. Bekannt wurde er durch den Bestseller »Die Bruderschaft der Runen«. Michael Peinkofer lebt mit seiner Familie im Allgäu.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michael Peinkofer
Das Licht von Shambala
Nach den Aufzeichnungen von Lady Kincaid
Historischer Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
PROLOG
1. BUCH — KONSTANTINOPEL
1.
2.
3.
4
5
6.
7.
8.
2. BUCH — SKYTHENLAND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ZWISCHENBERICHT — IN DEN LÜFTEN
ANMERKUNG:
1.
2.
3.
4.
5.
3. BUCH — TIBET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
EPILOG
NACHWORT DES VERFASSERS
Anmerkungen
Impressum
Buchtipps, die Ihnen ebenfalls gefallen könnten!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
FÜR MARKUS, NIKLAS UND SUSANNE
WEIL SIE IHREN TRÄUMEN FOLGEN
PROLOG
NEW ORLEANS
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
JULI 1853
Er konnte die grässlichen Laute hören, die durch die schwüle Nacht hallten.
Die Schreie der Sterbenden.
Das Wehklagen der Trauernden.
Und den dumpfen Klang der Totenglocke.
Keine Stunde verging, in der sie nicht geläutet wurde. Ihr schauriger Ton war zum ständigen Begleiter geworden, der die Bewohner von New Orleans unablässig daran erinnerte, dass das Ende nahe war.
Lemont setzte einen Schritt vor den anderen. Er achtete weder auf die Schreie, die aus den Häusern drangen, noch auf die dunklen Gestalten, die hin und wieder an ihm vorüberhuschten und sich feuchte Tücher vor die Gesichter geschlagen hatten, um sich vor dem allgegenwärtigen, durchdringenden Gestank zu schützen, der wie ein Leichentuch über der Stadt lag.
Das Gelbfieber grassierte.
Und es schlug unbarmherzig zu.
Als es Anfang Juli die ersten Todesopfer zu beklagen gegeben hatte, war man in New Orleans noch guter Dinge gewesen und hatte gehofft, dass »Yellow Jack« die Stadt diesmal weitgehend verschonen würde. Schon Mitte des Monats war die Zahl der Todesopfer jedoch auf über tausend angewachsen – und bereits wenige Tage später war zur grausigen Gewissheit geworden, dass die Geißel des Südens New Orleans einmal mehr in den Klauen hatte.
Lemont kannte die Symptome nur zu gut.
Es fing immer mit heftigem Kopfschmerz und Fieber an, dem oftmals eine Rötung des Gesichts folgte. Der Ausfluss von Sekret und das darauf folgende Delirium sowie die gelblichen Flecken, die den Körper des Befallenen übersäten und der Seuche ihren Namen gaben, ließen innerhalb weniger Tage keinen Zweifel mehr daran, dass Yellow Jack zugeschlagen hatte. Trat in diesem Stadium keine Besserung ein, so war jede Hoffnung verloren. Die Haut wurde fahl, die Lippen wirkten blutleer, Verzweiflung sprach aus den Augen. Wenn schließlich blutiger Schaum aus den Mundwinkeln der Opfer trat, war der Tod nur noch eine Frage von Stunden …
Dunkelheit herrschte in den Straßen.
Die Laternen wurden nicht mehr entfacht, aus den Häusern drang kein Licht. Die Läden und Jalousien waren geschlossen, manche Fenster gar mit Holzbrettern verbarrikadiert worden, damit niemand hineinsehen konnte. In diesen Tagen genügte oftmals schon der Anblick einer warmen Mahlzeit, um einen Raub zu provozieren. Und da sich die Gesetzeshüter vor Ansteckung fürchteten, herrschte Anarchie in der Stadt. Nur jene, die Hunger und Not aus ihren Häusern trieben, waren auf den finsteren Gassen anzutreffen – bis zur Unkenntlichkeit vermummte Schatten, die an Lemont vorüberhuschten. Jene, die ihr Vermögen mit Baumwolle und Zuckerrohr gemacht und sich kleine Königreiche erworben hatten, verschanzten sich in ihren vier Wänden, gaben sich rauschenden Festen und ausgiebigen Gelagen hin und betrogen sich mit der Illusion, sich von der Seuche loskaufen zu können. Die Wahrheit – dass die Stadt am Abgrund stand und dass die prunkvollen Bälle der Totentanz eines zu Ende gehenden Zeitalters waren – wollte niemand sehen.
Lemont hingegen war genau aus diesem Grund nach New Orleans gekommen: um der Wahrheit willen.
Just an dem Tag, da er von Bord gegangen war, hatte das Gelbfieber das erste Opfer gefordert. Während in den beiden darauf folgenden Wochen die Zahl der Erkrankten sprunghaft angestiegen war und jene, die es sich leisten konnten, panisch die Flucht ergriffen, war Lemont geblieben. Inzwischen lag die Stadt unter Quarantäne; Schiffe aus Übersee machten kehrt, noch ehe sie den Hafen erreichten. Der Schiffsverkehr auf dem Fluss war zum Erliegen gekommen, und in den Sümpfen lauerte der Tod durch Hunger und Durst oder das gefräßige Maul eines Krokodils.
Doch Lemont hatte nicht vor zu fliehen; er war überzeugt davon, dass es nicht sein Schicksal war, an diesem verkommenen und bis ins Mark verdorbenen Ort einen ebenso grausamen wie sinnlosen Tod zu sterben. Seine Ambitionen gingen weiter.
Viel weiter …
Er folgte dem Weg, den man ihm beschrieben hatte, und nahm eine der schmalen Gassen, die sich durch schmutzige Hinterhöfe zum Armenviertel wanden. Wo Sklaven und Tagelöhner hausten, hoffte er zu finden, was er an keinem anderen Ort dieser Welt gefunden hatte.
Inmitten der engen Backsteinwände war die Schwüle noch drückender und der Odem des Todes noch beißender. Lemont zog das Halstuch enger, das er um Mund und Nase trug. Von den bis zu vierhundert Menschen, die Yellow Jack täglich zum Opfer fielen, wurden die wenigsten beigesetzt. Aus Furcht wurden sie einfach liegen gelassen oder nur mit wenigen Schaufeln Erde bedeckt, die der Regen der Sommermonate jedoch sogleich wieder abtrug. Mehr als zweitausend Tote häuften sich inzwischen auf den Friedhöfen der Stadt und sorgten für einen unerträglichen Geruch, der sich in der sengenden Julihitze ausbreitete und bis in den letzten Winkel kroch. Mancher Wohlhabende suchte ihn mit Unmengen von Parfum und anderen duftenden Essenzen zu vertreiben, aber dieses Ansinnen war ebenso lächerlich wie die Versprechungen, mit denen Wunderheiler und Wahrsager in diesen Tagen aus der Not der Menschen Profit zu schlagen suchten. In einer Stadt, die dem Untergang ins Auge blickte, war es nicht schwierig, ein Medium zu finden – die Herausforderung bestand darin, unter all den Scharlatanen jene auszusieben, die tatsächlich die Gabe besaßen und bereit waren, ihr Wissen mit einem blanc, mit einem Weißen zu teilen …
Prag.
Alexandria.
Konstantinopel.
Basra.
Singapur.
Kanton.
Die Namen der Städte, die Lemont in den vergangenen Jahren bereist hatte, reihten sich beinahe endlos aneinander. Universitäten und Schulen, Bibliotheken und Klöster – an zahllosen Orten, an denen altes Wissen bewahrt und gelehrt wurde, hatte er nach Erleuchtung gesucht, jedoch ohne sie zu finden; bis ihm irgendwann die Erkenntnis aufgegangen war, dass es nicht die Wissenschaft, nicht die Schärfe des menschlichen Verstandes war, die ihm verborgenes Wissen erschließen würden, sondern dass nur übernatürliche Kräfte dazu in der Lage waren; jene Dinge, die außerhalb rationalen Begreifens lagen.
Lemont glaubte fest daran, aufgrund seiner Herkunft und des Gegenstands, der sich in seinem Besitz befand, von der Geschichte zu Höherem ausersehen zu sein, aber sein Glaube allein war wertlos. Es hatte ihn wertvolle Jahre seines Lebens gekostet, die Zusammenhänge zu rekonstruieren. Nun wollte er Gewissheit, und um dieser Gewissheit willen war er nach New Orleans gekommen. Die Stadt am Mississippi, seit zwei Generationen Inbegriff des Fortschritts, des Überflusses, aber auch des Lasters, war die letzte Station seiner Reise und gleichzeitig die letzte Hoffnung auf Erkenntnis, und keine Seuche der Welt würde ihn aufhalten.
Vor der grob gezimmerten Holztür, die mit einem rätselhaften Zeichen bemalt war, blieb er stehen. Wieder drang ein gellender Schrei durch die Nacht, wieder läutete die Totenglocke. Doch Lemont nahm es kaum noch wahr. Er war am Ziel seiner Reise angelangt.
Mit bebenden Händen klopfte er an die Tür.
Zweimal, wie es vereinbart worden war.
»Herein«, tönte es von drinnen.
Er drückte die rostige Klinke. Knarrend schwang die Tür auf, und unter dem niederen Sturz hindurch trat Lemont ein.
Das Haus, dessen Wände windschief und brüchig waren, bestand nur aus einem einzigen Raum. Über einem Kamin, in dem ein Feuer prasselte und flackernden Schein verbreitete, hing ein eiserner Kessel. Die Mitte der Kammer nahm ein einfacher Tisch ein. Dahinter saß eine junge Frau mit langem schwarzem Haar, deren buntes, nach karibischer Mode geschneidertes Kleid angesichts des allgegenwärtigen Todes fremd und deplatziert wirkte.
Lemont löste das Gesichtstuch. »Bist du die Seherin?«, fragte er.
Die junge Frau schaute wortlos zu ihm auf. Sie war Kreolin, und auch wenn er es sich nicht gerne eingestand, war sie eine Schönheit. Große schwarze Augen blickten aus einem ebenmäßigen Gesicht, dessen Teint die Farbe von dunklem Honig hatte, und die vollen Lippen weckten in ihm Gefühle, die er lange nicht empfunden hatte. Französische Frauen mochten anmutig sein und ihre Haut die Farbe von Porzellan haben – nicht eine von ihnen jedoch verströmte jene Aura animalischer Wildheit, die von der Kreolin ausging. Lemont ertappte sich dabei, dass sein Blick immer wieder an ihrem bunten, rüschenbesetzten Kleid emporwanderte, in den Ausschnitt kroch und sich an den Ansätzen ihrer vollen Brüste festsog. Französische Frauen hätten ihre Reize niemals auf derart schamlose Weise offen gelegt und so die Begehrlichkeit eines rechtschaffenen Monsieurs geweckt.
Aber dies war die Neue Welt.
Eine neue Zeit.
Mit neuen Gesetzen …
Lemont hatte nicht vor, sich mit Vorreden aufzuhalten. Viel zu lange hatte er schon gewartet. »Man hat dir gesagt, warum ich hier bin«, kam er direkt zur Sache. »Wirst du tun, was ich von dir verlange? Verstehst du überhaupt, was ich sage?«
Die Kreolin musterte ihn nicht weniger unverwandt. Wenn sie eingeschüchtert war, so verbarg sie es gut. Es war kaum zu glauben, wie rasch die Standesunterschiede in diesen Tagen schwanden. Im Angesicht des Gelben Todes waren alle Menschen gleich, unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft und ihrem Besitz. Gleichwohl hielt sich unter den Weißen das hartnäckige Gerücht, Yellow Jack würde die Farbigen und Mischlinge verschonen …
»Ich verstehe Sie gut«, versicherte die Kreolin und strich eine Strähne ihres blauschwarzen Haars zurück. Ihr Französisch war flüssig und nahezu akzentfrei, ihre Stimme tiefer und rauer, als er es erwartet hatte. »Und ich weiß, warum Sie hier sind.«
»Man hat mir gesagt, du verfügst über das zweite Gesicht«, erwiderte er. »Kannst du wirklich in die Zukunft sehen?«
»Ich sehe Dinge«, verbesserte sie. »Manchmal die Zukunft, manchmal auch die Vergangenheit.«
»Ich bin an beidem interessiert«, stellte Lemont klar.
»Was wollen Sie wissen?« Spott schwang in ihrer Stimme mit. »Ob Sie die Seuche überleben werden? Die meisten fragen mich das.«
»Ich nicht.« Lemont schüttelte den Kopf. »Vielmehr bin ich an diesem hier interessiert.« Er griff unter seinen Umhang und zog einen Gegenstand hervor, den er vor der Kreolin auf den Tisch stellte. Es war ein metallener Würfel, dessen Kantenlänge etwa eine halbe Handspanne betrug. Die Oberfläche war von leichtem Rost überzogen. In die Seitenflächen des Kubus waren griechische Schriftzeichen eingraviert; in die Oberfläche ein stilisiertes Symbol, das ein Auge darstellte.
»Was ist das?«, fragte sie und berührte das Gebilde zaghaft mit dem Finger. »Es ist sehr alt.«
»In der Tat«, bestätigte Lemont. »Dieser Würfel hatte schon viele Besitzer und ebenso viele Namen. Einer davon lautet Codicubus.«
»Codicubus«, echote sie und legte vorsichtig ihre Handfläche darauf. Ein leichtes Beben schien ihren Körper daraufhin zu durchlaufen, wie Lemont irritiert feststellte.
»Woher haben Sie diesen Gegenstand?«, wollte sie wissen.
»Das braucht dich nicht zu interessieren.« Er schüttelte den Kopf, während von draußen erneut das schaurige Läuten der Totenglocke zu hören war, zum ungezählten Mal in dieser Nacht. »Wirst du mir das Geheimnis dieses Gegenstands offenbaren? Ja oder nein?«
»Wer sagt Ihnen, dass es ein Geheimnis gibt?«
»Du solltest nicht versuchen, Spiele mit mir zu treiben«, warnte er. »Bei feisten Plantagenbesitzern, die um ihr jämmerliches Leben bangen, mag dies verfangen, aber nicht bei mir. Wirst du mir helfen oder nicht?«
»Warum sollte ich?«
»Wer weiß? Vielleicht, weil ich dich reich dafür belohnen werde.«
»Ich habe, was ich brauche«, erwiderte sie. »Sie können mir nichts geben, was ich nicht schon habe.«
»Dann eben nicht«, konterte er. »Aber wenn du das bist, was die Leute behaupten, wirst du diesen Gegenstand ganz von selbst untersuchen wollen. Denn dieser Würfel ist ein echtes Mysterium, die Pforte zu einer anderen Welt.«
Die Kreolin blickte überrascht zu ihm auf, und einmal mehr war er gebannt von ihrer Schönheit. Er musste auf der Hut sein, durfte sich nicht einnehmen lassen von den Reizen eines Weibes, dessen Blut so unrein war wie das Brackwasser unten im Hafen. Dennoch konnte er den Blick nicht von ihr wenden, und auch sie schien auf eigenartige Weise fasziniert zu sein.
»Sie wissen es«, stellte sie fest.
»Was?«, fragte er ungehalten.
»Dass dies kein gewöhnlicher Gegenstand ist«, erwiderte sie vorsichtig. »Er ist sehr alt.«
»Das habe ich dir gesagt«, erwiderte er unbeeindruckt.
»Er wurde weitergegeben über Generationen«, fuhr die Kreolin in ihrem rauen Alt fort, »und er gehört Ihnen nicht.«
»Was fällt dir ein, Weib?«, fauchte Lemont.
»Er stammt von jemandem, der ihn widerrechtlich in seinen Besitz gebracht hat«, beharrte die Kreolin unbeirrt – und Lemont wusste, dass seine Wahl richtig gewesen war.
Die junge Frau konnte unmöglich wissen, wie er an den Würfel gelangt war, denn er hatte noch nie jemandem davon erzählt. Also verfügte sie tatsächlich über die Gabe. Lemonts Neugier erwachte. Nun würde sich zeigen, ob die Kreolin ihren Vorgängern überlegen war, die wie sie versucht hatten, dem Geheimnis des Würfels auf die Spur zu kommen, dabei jedoch allesamt den Verstand verloren hatten.
»Mehr«, verlangte er ungerührt, »ich will mehr wissen, hörst du? Ich will alles erfahren!«
Sie schien sich zu besinnen. Mit geschlossenen Augen wandte sie sich erneut dem Würfel zu und berührte ihn, worauf sie wiederum ein Beben durchlief, als hätte sie ihre Hand nicht an ein kaltes Stück Metall gelegt, sondern an einen feurigen Liebhaber. Schweißperlen traten ihr auf die Stirn, so sehr schien sie sich anzustrengen, und ihre Brust, die sich unter tiefen Atemzügen hob und senkte, zog einmal mehr Lemonts Aufmerksamkeit auf sich. Die Beleuchtung war gedämpft, nur das Feuer verbreitete lodernden Schein. Die Stille im Raum wog zentnerschwer, nur hin und wieder drang ein entsetzter Schrei durch die Nacht.
Plötzlich begannen sich die Lippen der Kreolin zu bewegen. Sie formten lautlose Worte – eine Beschwörungsformel, eine Verwünschung, vielleicht auch ein Gebet.
»Ist das alles?«, fragte Lemont fast enttäuscht. »Keine Tarot-Karten? Keine Federn? Keine Knochen?«
Ihre Antwort fiel anders aus, als er es erwartet hatte. Jäh öffnete sie ihre Augen wieder, aber die Pupillen waren nicht zu sehen. Nur das Weiße starrte Lemont entgegen, sodass er erschrocken zurückfuhr. »Verflucht, was tust du da?«, rief er aus, aber die junge Frau reagierte nicht, so, als wäre sie in tiefe Trance versunken.
»Der Würfel«, verkündete sie mit monotoner, fast leiernder Stimme, »gibt sein Geheimnis nicht freiwillig preis. Viele starben, um es zu hüten. Wächter mit nur einem Auge.«
»Mit nur einem Auge?«, fragte Lemont. »Was faselst du da?«
»Nur die Erbin«, fuhr die Seherin fort, »darf den Inhalt des Codicubus kennen.«
»Erbin? Was für eine Erbin?«
»Auf ihren Schultern ruht die Verantwortung … Aber sie ist alt und schwach … Erneuerung … In der Einsamkeit soll sie leben, verborgen vor den Augen der Welt, bis sie stark genug ist, den Schatten zu trotzen … Schatten … die Schatten …«
Ihre Stimme war lauter geworden. Die Kreolin bewegte sich auf ihrem Stuhl, als wiege sie sich zum Rhythmus einer Musik, die nur sie zu hören vermochte. »Sie kommen«, fuhr sie flüsternd fort. »An einem weit entfernten Ort … durch Schnee und Eis … zu ergründen, was verborgen bleiben muss …«
»Wer?«, wollte Lemont wissen. »Von wem sprichst du, Weib?«
»Ihr Anführer ist ein Mann, der Wissen sucht, aber er weiß es noch nicht … stattdessen wird er den Pfad des Krieges beschreiten, schon sehr bald … Ich sehe Blut, viel Blut … einen Acker des Todes …«
»Und die Schatten?«, verlangte Lemont zu erfahren. »Was ist mit ihnen? Und wer sind die Einäugigen, von denen du gesprochen hast? Hat es etwas mit dem Symbol auf dem Würfel zu tun?«
»Ein Vermächtnis, Jahrtausende alt … Es wird Verderben über die Menschheit bringen, Verderben, hörst du …?« Zu Lemonts Entsetzen richtete sich der Blick ihrer pupillenlosen Augen direkt auf ihn. »Die Schatz und Gold begehren, auf den fernen Gipfeln, wo alles begann. Die Diener, die Arimaspen, im Zeichen des Einen Auges …«
»Was?« Lemont verstand kein Wort. Nicht nur, dass ihre Stimme immer leiernder wurde, es schienen auch nicht ihre Worte zu sein, die sie sprach. Erlaubte sie sich einen Scherz mit ihm? Oder hatte sich ihr Geist tatsächlich für eine Ebene geöffnet, die anderen Menschen verschlossen blieb? Lemont fühlte spontane Eifersucht. Er war kein Medium, dabei hätte er in diesem Moment alles dafür gegeben, zu sehen, was sie sah.
Im nächsten Moment jedoch veränderten sich ihre Züge. Falten gruben sich in ihre Miene und ließen sie um Jahre altern, Furcht verzerrte plötzlich ihre Mundwinkel.
»Was ist?«, fragte Lemont. »Was hast du?«
»Das Auge«, stieß die Kreolin hervor. »Das Eine Auge! Es beobachtet uns! Das Eine Auge …«
Sie begann am ganzen Leib zu zittern. Panik hatte von ihr Besitz ergriffen, aber sie schien nicht in der Lage zu sein, sich aus dem Sog des Entsetzens zu lösen. Lemont wusste, was das bedeutete – so war es auch bei den anderen gewesen, die versucht hatten, das Geheimnis des Würfels zu ergründen, und die letztendlich im Wahnsinn versunken waren. Keiner von ihnen war auch nur annähernd so weit gekommen wie die Kreolin – nun jedoch schienen auch ihre Fähigkeiten zu versagen.
Sie gab einen heiseren Schrei von sich und warf den Kopf hin und her, sodass ihre wilde Mähne ihr Gesicht wie dunkles Feuer umloderte. Lemont war wie gebannt von ihrem Anblick. Was immer mit ihr vorging, schien sie zu enthemmen und ihr animalisches Wesen vollends zu entfesseln. Ihr Haar stand wirr vom Kopf ab, die Ärmel ihres Kleides rutschten herab und entblößten ihre Schultern. Schweiß rann über ihre Schläfen, ihr Atem ging rasch und stoßweise wie beim Liebesakt – und auch Lemont fühlte plötzlich die sengende Hitze.
Immer schneller atmete sie, immer lauter wurden ihre Schreie, und mit einem Mal erfüllte ihn der Wunsch, sie ganz zu besitzen. Nicht nur ihr Wissen, nicht nur ihre Gabe, sondern auch ihren Körper. Es war, als begehrte das Leben gegen den Tod auf, der draußen regierte, und als mündete alles, was Lemont je getan, jede Anstrengung, die er je unternommen hatte, in diesen einen Augenblick.
»Genug!«, rief er aus, griff nach ihren Händen und riss sie vom Codicubus los. Die Schreie der Kreolin verstummten, ihr Blick schien ins Hier und Jetzt zurückzukehren, während sie staunend zu ihm emporblickte – und in diesem Moment erkannte er die roten Adern, die ihre weißen Augäpfel durchzogen.
Das Fieber!
Auffallend geäderte Augen waren eines der Erkennungszeichen, die Yellow Jack zu hinterlassen pflegte. War die Kreolin auch befallen? Hatte sich Lemont, ohne es zu ahnen, ins Haus des Todes begeben? Wenn ja, so war es ihm einerlei. Sein Verlangen war erwacht, und noch war weder sein Drang nach Wissen befriedigt noch die Begierde, die die Kreolin in ihm geweckt hatte.
Die junge Frau, deren Namen er noch nicht einmal kannte, saß vor ihm und starrte ihn an. »Schnee und Eis«, versuchte sie in Worte zu fassen, was sie gesehen hatte, »eine ferne Bedrohung auf den Gipfeln der Welt«, und immer wieder: »Das Eine Auge! Es folgt uns! Es kann uns sehen!«
Lemont triumphierte innerlich.
Es stimmte also.
Das Geheimnis, das ihm sein Vater auf dem Sterbebett anvertraut hatte, schien tatsächlich zu bestehen, ein kosmisches Rätsel, eingebettet in die Mysterien der Vergangenheit!
Die Euphorie des Augenblicks beflügelte sein Verlangen. Sein Pulsschlag beschleunigte sich. Er ergriff die junge Frau und riss sie zu sich empor. Schon auf die Distanz hatte die Kreolin eine eigenartige Faszination auf ihn ausgeübt. Sie jedoch zu spüren, ihre grazilen Formen und weiblichen Rundungen, ihren Herzschlag zu fühlen und ihren bebenden Körper, den Duft von Schweiß und Magnolien zu riechen, raubte ihm fast den Verstand.
Sich seiner überlegenen Körperkraft bedienend, warf er sie rücklings auf den Tisch, und noch ehe sie richtig zu sich finden konnte, waren seine Hände bereits dabei, sich unter die bunten Rüschen ihres Kleides zu wühlen und das Ziel seiner Begierde zu suchen. Sie wehrte sich nicht dagegen, schien noch zu sehr unter dem Eindruck dessen zu stehen, was sie gesehen hatte. Lemont gedachte es in seinen Besitz zu nehmen, zusammen mit ihrem grazilen Körper.
Es war sein beherrschender Wunsch.
Das Ziel, das er verfolgte.
Fieberhaft …
Weder der Gedanke an ihre Hautfarbe noch an die Gefahr der Ansteckung vermochten ihn abzuschrecken. Oder war es in Wahrheit bereits zu spät? Hatte das Fieber, dem täglich Hunderte zum Opfer fielen, auch von ihm Besitz ergriffen? War das, was er erlebte, nicht die Wirklichkeit, sondern nur ein Fiebertraum? War er in Wahrheit gar nicht hier, sondern lag in seinem Bett, und die Ärzte hatten schon alle Hoffnung aufgegeben?
Nein!
Noch lebte er, und er hatte sich selten so überlegen und mächtig gefühlt. Auch die Kreolin schien es zu spüren, denn sie leistete ihm keinen Widerstand. Schweigend ließ sie alles über sich ergehen, während ihre Augen durch ihn hindurch und in weite Ferne blickten. Und in dem Moment, als ihre Körper eins wurden, ein Fanal des Lebens in der Dämmerung des Todes, wiederholte sie mit heiserer Stimme ihre Worte:
Die Schatz und Gold begehren,
auf den fernen Gipfeln,
wo alles begann.
Die Diener, die Arimaspen,
im Zeichen des Einen Auges.
1. BUCH
KONSTANTINOPEL
1.
32 JAHRE SPÄTER
Schatten …
Verschwommene Gestalten, die ihr nach dem Leben trachteten; Nachtmahre, die sich aus der Vergangenheit erhoben, um ihren Schlaf zu verfinstern; dunkle Stimmen, die zu ihr sprachen, die sie jedoch nicht verstand. Und über allem die finstere Vermutung, dass all diese Stimmen und Gestalten, diese verschwommenen Bilder einen tieferen Sinn ergaben, dass sie auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden sein mussten. Es war, als würde man ein Bühnenstück durch den geschlossenen Vorhang betrachten. Man konnte Geräusche hören und schemenhaft die Silhouetten der Darsteller durch den Samt erkennen – der Inhalt des Stücks jedoch blieb verborgen.
Solange Sarah Kincaid zurückdenken konnte, hatte das Rätsel sie begleitet. Früher, als sie noch ein Kind gewesen war, hatte sie fast jede Nacht von jenen Schatten geträumt, war schweißgebadet erwacht und hatte bei ihrem Vater Gardiner Schutz gesucht. Später dann, als sie eine junge Frau wurde, waren die Träume seltener geworden, und schließlich hatte Sarah sie fast vergessen.
Bis sie zurückgekehrt waren …
Seit dem Tag, da Gardiner Kincaid in den Katakomben der versunkenen Bibliothek von Alexandria gestorben war, hinterrücks ermordet von Verräterhand, waren die Träume wieder da – dunkler, erschreckender und bedrohlicher als je zuvor. Noch vor einiger Zeit hatte Sarah geglaubt, dass dies mit dem Tod Gardiner Kincaids zusammenhinge, dass der Schock über sein gewaltsames Ableben die Ängste ihrer Kindheit wieder ans Licht gebracht hätte.
Inzwischen wusste sie es jedoch besser.
Denn was Sarah in ihren Träumen sah, waren keine Trugbilder. Es waren Spiegelungen der Vergangenheit, ihrer Vergangenheit, die aus ihrem Gedächtnis gelöscht worden war, als sie im Alter von acht Jahren das aqua vitae zu sich genommen hatte, das Wasser des Lebens. Alles, was sie davor gesehen und erlebt hatte, die ersten acht Jahre ihres Daseins, waren wie ausgelöscht. Nur jene verschwommenen Eindrücke waren geblieben, die sie wieder und wieder vor Augen sah, jede Nacht – und das Wissen, dass es kein anderer als Gardiner Kincaid gewesen war, der ihr jenen Trunk verabreicht hatte.
Tempora atra hatte er die Zeit genannt, die vor jenen Tagen lag, vor dem Fieber und der totenähnlichen Starre, in die Sarah damals verfallen war und aus der sie nur die erneute Einnahme des Lebenswassers hatte retten können.
Die Dunkelzeit …
Wie sehr wünschte sich Sarah, die Hand auszustrecken, um jenen Schleier des Vergessens zu zerreißen und zu sehen, was sich dahinter verbarg! Nur ein einziges Mal war es ihr gelungen, und auch nur für einen kurzen Augenblick – aber das Bild einer fernen, von verschneiten Gipfeln umgebenen Festung ergab keinen Sinn. Sarah dürstete danach, mehr zu erfahren, denn es stand längst außer Frage, dass ein Zusammenhang bestand zwischen der Dunkelzeit und dem, was ihrem Geliebten Kamal widerfahren war.
Auch ihm war das Wasser des Lebens eingeflößt worden, auch er war in jenem Niemandsland zwischen Leben und Tod gefangen gewesen. Vom fernen England aus war Sarah aufgebrochen, um ihren Geliebten den Klauen des Jenseits zu entreißen. Von Prag aus hatte ihre Reise sie über den Balkan nach Griechenland geführt, wo sie auf den Spuren Alexanders des Großen gewandelt war und den Totenfluss Styx gesucht hatte. Das Wasser des Lebens hatte sie gefunden, alles andere jedoch, das je von Bedeutung für sie gewesen war, hatte sie dabei eingebüßt.
Zuerst hatte sie ihren Vater verloren – in mehr als einer Hinsicht. Der Mann, der ihn in den Katakomben von Alexandrien hinterrücks ermordet hatte, hatte nämlich später auch noch die Behauptung aufgestellt, Gardiner Kincaid wäre nicht Sarahs leiblicher Vater gewesen. Nun hatte Sarah gewiss keinen Anlass, Mortimer Laydon Glauben zu schenken, der sich sowohl ihr Vertrauen als auch das ihres Vaters erschlichen und sich in Wahrheit als Agent der Gegenseite erwiesen hatte. Aber etwas tief in ihrem Innern sagte ihr, dass Laydon zumindest in dieser einen Hinsicht nicht gelogen hatte, und sie ahnte, dass auch die Antwort auf dieses Rätsel in der Dunkelzeit verborgen lag.
Der nächste Verlust, den Sarah erlitt, hatte ihren treuen Freund Maurice du Gard betroffen. Nicht nur seine hellseherische Gabe war ihr auf ihren Reisen von Vorteil gewesen, sondern auch sein freundschaftlicher Rat und seine Unterstützung, und als er in ihren Armen starb, war es Sarah vorgekommen, als würde ein Teil von ihr mit ihm gehen.
Was ihr danach noch geblieben war, Sarahs weltlicher Besitz, der sich im Wesentlichen aus dem ländlichen Anwesen in Yorkshire sowie aus der umfassenden Bibliothek zusammensetzte, die Gardiner Kincaid ihr hinterlassen hatte, war ihr ebenfalls genommen worden. Ein verheerendes Feuer hatte in Kincaid Manor gewütet und den Hausverwalter das Leben gekostet – ein Feuer freilich, das nicht von einer Laune des Schicksals, sondern von der Hand ruchloser Brandstifter gelegt worden war, damit Sarah in England keine Zufluchtsstätte mehr haben sollte.
Verzweifelt darum bemüht, nicht auch noch ihren geliebten Kamal zu verlieren, hatte Sarah alles darangesetzt, das Wasser des Lebens zu beschaffen, das sein rätselhaftes Fieber heilen und ihn ins Dasein zurückholen sollte – doch einmal mehr hatte sie feststellen müssen, dass sie manipuliert und hintergangen worden war. Zwar war es ihr gelungen, das Elixier zu beschaffen, das Kamal den Klauen des Todes entrissen hatte, jedoch hatten andere daraus Nutzen gezogen. Denn auch die Gräfin Ludmilla von Czerny, mit deren Hilfe Sarah ursprünglich auf die Spur des aqua vitae gelangt war, hatte sich als Verräterin erwiesen, die im Dienst jener ebenso mächtigen wie geheimnisvollen Organisation stand, deren Umtriebe Sarah seit geraumer Zeit zu entwirren suchte. Die Ermordung ihres Vaters, der Tod Maurice du Gards, die Zerstörung von Kincaid Manor – die Fäden liefen hier zusammen, bei jener verschwörerischen Gruppierung, die sich »Bruderschaft des Einen Auges« nannte und deren erklärtes Ziel es zu sein schien, sich der Vergangenheit zu bedienen, um die Gegenwart zu beherrschen.
Auch die Vergiftung Kamals hatte letztlich diesem Ziel gedient, wenngleich Sarah die wahren Gründe noch immer schleierhaft waren. Warum hatten die Gräfin Czerny und ihre Spießgesellen den letzten Rest des Lebenswassers aufgebraucht, um Kamal zu vergiften? Wieso hatten sie um jeden Preis gewollt, dass sich Sarah auf die Suche nach dem Elixier machte? Hoch über den Ebenen Nordgriechenlands, auf dem einsamen Felsen eines meteorons, hatte sich Kamals Schicksal entschieden. Man hatte ihm das Lebenswasser verabreicht, und er war zu sich gekommen – doch genau wie Sarah, die die Schleier der Dunkelzeit nicht zu lüften vermochte, hatte auch er sich nicht an das erinnern können, was vor seinem Fieber gewesen war, und so war es der Verräterin Czerny ein Leichtes gewesen, sich sein Vertrauen zu erschleichen. Zuletzt hatte Sarah ihn an Bord eines Fesselballons gesehen, der vor ihren Augen aufgestiegen und gen Osten entschwunden war. Mit dabei war auch die Czerny gewesen, in der Sarah eine Schwester gesucht und ihre Nemesis gefunden hatte.
Und als wäre all dies noch nicht Verlust genug, hatte Sarah noch eine weitere Niederlage erlitten, die beinahe noch schwerer wog als alle anderen zusammen – auch wenn sie lange ahnungslos gewesen war.
Sie war schwanger gewesen …
Nach den glücklichen Monaten, die Kamal und sie in Yorkshire verbracht hatten, hatte Sarah, ohne es zu wissen, das Kind ihres Geliebten unter dem Herzen getragen. Doch auch dieses Leben war ihr brutal genommen worden. Infolge der Strapazen, denen sie im Zuge ihrer Abenteuer ausgesetzt gewesen war, hatte sie eine Fehlgeburt erlitten.
Zuerst hatte sie es nicht glauben mögen, als ein jovialer Schiffsarzt namens Garribaldi ihr davon berichtet hatte, aber schon sehr bald hatte sie die Wahrheit mit jeder einzelnen Pore ihres Körpers gespürt. Denn auch wenn ihre Mutterschaft ihr nicht bewusst gewesen war – der Verlust war so wirklich, wie er es nur sein konnte, und obwohl jene Ereignisse inzwischen mehr als vier Monate zurücklagen, fühlte Sarah noch immer eine erschreckende Leere.
Ihr erster Impuls war es gewesen aufzugeben.
Sie war geschlagen und besiegt, ihre Feinde hatten in jeder nur erdenklichen Hinsicht triumphiert. Welchen Sinn hatte es noch, gegen diese Einsicht anzugehen und sich selbst zu betrügen? Sarah hatte gekämpft und verloren. Wie der alte Gardiner hatte auch sie versucht, dem Einen Auge Widerstand zu leisten – aber genau wie er war auch sie am Ende gescheitert.
Oder?
Dass sie nicht verzweifelt war und sich in Venedig, wohin die Schiffspassage geführt hatte, von einer der unzähligen Brücken gestürzt hatte, hatte nur einen einzigen Grund – und dieser Grund war würfelförmig, hatte eine Kantenlänge von etwa vier Inches und war ganz aus Metall. »Codicuben« wurden diese eigentümlichen Gebilde genannt, die auf ihren sechs Seiten die Buchstaben des Siegels Alexanders des Großen sowie das Zeichen des Einen Auges eingraviert trugen und deren einziger Daseinszweck darin bestand, abdere, quod omnia tempora manendum – zu verbergen, was alle Zeiten überdauern sollte. Im Grunde handelte es sich dabei um winzige Panzerschränke, die aus antiker Zeit datierten und von einem geheimnisvollen magnetischen Mechanismus zusammengehalten wurden. Wer nicht wusste, wie sie sich öffnen ließen, dem gelang es nicht, ohne dabei deren Inhalt zu zerstören – Notizen, Zeichnungen, Auszüge alter Handschriften oder auch verschollen geglaubte Pinakes1.
Ein Codicubus war es gewesen, der Sarah auf die Spur der versunkenen Bibliothek von Alexandrien geführt hatte. Damals hatte sie geglaubt, dass dieser Würfel der einzige seiner Art wäre, war später aber eines Besseren belehrt worden. Denn auf höchst sonderbare Weise war sie in den Besitz eines weiteren Würfels gelangt, und hätte sie nicht allen Grund zu der Annahme gehabt, dass ihr der Inhalt dieses Würfels über Kamals Verbleib Aufschluss geben könnte, hätte sie ihre Suche schon längst aufgegeben. So jedoch bestand noch immer Hoffnung, wenn auch nur ein winziger Funke …
Sarah schwang sich aus dem Bett. Auch wenn es noch früher Morgen war – die Nacht war für sie zu Ende. Sobald sie den Klauen ihrer Albträume entronnen war, ergriff tiefe Unruhe von ihr Besitz, und ihre Gedanken begannen einander zu jagen. Wieder und wieder grübelte sie über das, was geschehen war und fragte sich, ob sie es hätte verhindern können. Eine Antwort jedoch fand sie an diesem Morgen ebenso wenig wie an allen anderen.
Barfuß schlich sie über den kalten Marmorboden des Hotelzimmers zum Sekretär. Noch herrschte Ruhe draußen auf dem Gang; erst in einer guten Stunde würden die Zimmerkellner mit ihren Servierwagen erscheinen, um den Gästen ihr Frühstück zu bringen. Dann würde der Geruch von Mokka und frischem Backwerk das Hotel durchdringen, und Sarah würde sich dazu zwingen, ein wenig zu essen. Ohnehin hatte sie in den letzten Wochen abgenommen. Sie aß ebenso wenig wie sie schlief, und wenn, dann nur, weil sie sich mit aller Macht dazu überwand. Sarah wusste, dass sie bei Kräften bleiben musste, wenn sie sich erneut auf die Suche nach Kamal begeben wollte.
Auf dem Weg zum Sekretär passierte sie den Spiegel und erschrak fast über das, was sie darin sah: eine junge Frau mit blassen, ausgemergelten Zügen, die von langem dunklem Haar umrahmt wurden und aus denen ein stumpfes Augenpaar blickte. Einst hatten diese Augen vor Forscherdrang gebrannt, hatte Sarah es kaum abwarten können, sich von einem Abenteuer in das nächste zu stürzen und der Vergangenheit ihre Geheimnisse zu entreißen.
Das war lange vorbei.
Inzwischen wäre sie froh darüber gewesen, ein einfaches, durchschnittliches Leben zu führen, auch wenn es für eine Frau ihres Standes bedeutete, sich mit dem Platz zu begnügen, den eine von Männern beherrschte Gesellschaft ihr zuwies. Sarah hätte beinahe alles darum gegeben, ihr Kind zurückzubekommen und ihren Geliebten wieder in die Arme schließen zu können. Doch ihr war klar, dass das eine unmöglich und das andere in weite Ferne gerückt war. Und obwohl sich Sarah weigerte, die Hoffnung ganz fahren zu lassen, kam sie nicht umhin, sich einzugestehen, dass die letzten Monate an ihren Kräften gezehrt hatten. Der Verlust, die Trauer, die Schussverletzung, die sie davongetragen hatte – all das hatte Narben hinterlassen, und beim Blick in den Spiegel hatte Sarah das Gefühl, dass jede einzelne davon in ihrem Gesicht zu sehen war.
Sie fröstelte in ihrem Nachthemd und wandte sich ab. Die Morgendämmerung hatte inzwischen eingesetzt, und sanftes Licht sickerte durch die geschlossenen Fensterläden, während die Stadt draußen zum Leben erwachte. Der Muezzin auf dem Minarett der nahen Nusretiye-Moschee rief zum Gebet, und schon in Kürze würden die Straßen überquellen mit Fuhrwerken und Kulis, die nach Süden zum Basarviertel drängten, das auch Sarahs Ziel an diesem Tag war.
Auf der schmalen Tischfläche des Sekretärs lagen nur zwei Gegenstände. Das eine war ein Revolver der Marke Colt Frontier 1878, den Sarah in einem Laden unweit des Gewürzbasars erstanden hatte. Eine Waffe dieser Bauart hatte auch der alte Gardiner einst benutzt, und sie hatte Sarah stets gute Dienste geleistet. Der zweite Gegenstand war ein leicht rostiger Metallwürfel, dessen ungeheurer Wert auf den ersten Blick kaum zu erkennen war.
Der Codicubus.
Sarah setzte sich auf den mit dunkelgrünem Samt beschlagenen Stuhl und nahm den Würfel zur Hand, dessen Oberseite fehlte. Sie griff hinein und zog ein Stück Pergament hervor, das sie entrollte, um zum ungezählten Mal einen Blick darauf zu werfen.
Nachdem sie den Herbst in Italien verbracht und mehr oder weniger vergeblich versucht hatte, sich von den Strapazen der Balkanreise zu erholen, hatte Friedrich Hingis nach den Weihnachtstagen ein Schiff bestiegen, das von Venedig über Sizilien nach Malta gefahren war. Längst hatte Sarah den Schweizer gedrängt, in seine Heimat zurückzukehren und sich nicht länger um ihre Belange zu kümmern. Aber Hingis hatte betont, dass ein Eidgenosse ein Mann von Ehre sei, der seine Freunde nicht im Stich lasse, und darauf bestanden, bei ihr zu bleiben. Dass der Gelehrte aus Genf einst ihr erbitterter Gegner gewesen war und es eine Zeit gegeben hatte, da sie ihn am liebsten in einen Kanonenlauf gesteckt und in Vernescher Manier auf den Mond geschossen hätte, war inzwischen kaum noch vorstellbar. Genau wie sie selbst hatte auch Friedrich Hingis sich verändert, und wie bei ihr war es Verlust gewesen, der diese Veränderung bewirkt hatte – in seinem Fall der seiner linken Hand.
Als Sarahs Berater und Vertrauter hatte Hingis sie während ihres Aufenthalts in Prag begleitet; er war ihr auf den Balkan gefolgt und auf den Gipfel des meteorons, und auch danach war er bei ihr geblieben – vielleicht auch, weil er sich für das Geschehene mitverantwortlich fühlte. Kein anderer als er war es gewesen, der die Begegnung mit der Gräfin Czerny eingefädelt und sie Sarah als treue und zuverlässige Verbündete empfohlen hatte. Sarah war jedoch weit davon entfernt, ihm deswegen Vorhaltungen zu machen. Schließlich wusste sie selbst am besten, zu welchen Manipulationen die Bruderschaft fähig war.
Von Malta aus war Hingis zu jenem Ort aufgebrochen, der die einzige bekannte Möglichkeit barg, einen Codicubus zu öffnen: eine Burgruine auf der der Südküste Maltas vorgelagerten Felseninsel Fifla. Die Ritter des Johanniterordens, die über viele Jahrhunderte im Besitz eines Codicubus gewesen waren, hatten dort eine von magnetischer Kraft durchwirkte Stele errichtet, die den Würfel zu öffnen vermochte. Zusammen mit Maurice du Gard hatte Sarah dies einst herausgefunden, und zu gerne wäre sie selbst auf die Insel gereist. Hingis jedoch hatte sie überzeugt, dass es besser war, wenn sie in Venedig blieb und sich schonte. Enthielt der Codicubus das, was sie vermuteten, so würde sie ihre Kräfte noch dringend brauchen. So hatte Sarah also der Vernunft gehorcht und abgewartet – quälende Wochen lang, bis der Schweizer endlich zurückgekehrt war, im Gepäck den geöffneten Codicubus …
… und ein weiteres Rätsel.
Sarah vermochte nicht zu sagen, wie oft sie in den vergangenen Wochen auf jenes Stück Papier gestarrt hatte, das der Würfel preisgegeben hatte. Sie hatte erwartet, darin eine Landkarte oder eine wie auch immer geartete Beschreibung vorzufinden, in jedem Fall einen Hinweis auf Kamals Verbleib.
Aber sie war bitter enttäuscht worden.
Die alte Sarah Kincaid, jene unbekümmerte junge Frau, die nicht an die Kraft des Übernatürlichen geglaubt und das Prinzip der wissenschaftlichen Vernunft über alles andere gestellt hatte, hätte daraufhin wohl die Suche aufgegeben. Die dramatischen Ereignisse der Vergangenheit jedoch hatten Sarah erkennen lassen, dass außer der menschlichen ratio noch andere Kräfte am Wirken waren. Darauf hoffend, dass es so etwas wie Vorsehung tatsächlich gab, hatten sie und ihr Begleiter Venedig Mitte Februar den Rücken gekehrt und waren zum Bosporus aufgebrochen, um zu erfahren, was es mit dem rätselhaften Pergament auf sich hatte.
Darauf war eine einfache Zeichnung abgebildet: ein Dreieck mit einem Turm darüber, über dem wiederum ein Kreis zu sehen war, der ebenso gut ein Auge wie eine Sonne darstellen mochte.
Darunter vier Wellenlinien.
Wäre das nicht ausgeschlossen gewesen, hätte Sarah es für die ungelenke Zeichnung eines Kindes gehalten, in jedem Fall aber für einen schlechten Scherz, den sich jemand mit ihr erlaubte; denn die Darstellung unterschied sich grundlegend von allen anderen, die Sarah jemals gesehen hatte. Weder konnte sie darin einen griechischen noch sonst einen abendländischen Stil erkennen, und die Symbolik folgte auch nicht jener der altorientalischen Kulturen.
Dennoch war die Zeichnung echt, ebenso wie das Rätsel, das mit ihr verbunden war. Und dieses Rätsel zu ergründen war die einzige Hoffnung, die Sarah Kincaid geblieben war.
Hoffnung für sie … und für Kamal.
2.
TAGEBUCH SARAH KINCAID
Byzanz
Konstantinopel.
Stambul.
Schon viele Namen hatte die Stadt am Bosporus seit ihrer Gründung. Und noch mehr Herren. Und jeder von ihnen hat dort seine Spuren hinterlassen: in antiker Zeit die Griechen, später die Römer, die Ostgoten, die Seldschuken, die Genueser und schließlich die Osmanen. In jungen Jahren schien sie mir deshalb ein Spiegel der Geschichte zu sein, in dem Altertum, Mittelalter und Neuzeit gleichermaßen gegenwärtig sind. Während das Osmanenreich, in westlichen Kreisen oftmals abschätzig als ›kranker Mann vom Bosporus‹ bezeichnet, andernorts in seinen Todeszuckungen liegt, hat sich der Glanz der Sultane hier erhalten. Die Moscheen und Paläste sind vom Geist einer großen Vergangenheit durchdrungen, in den Gassen und auf den Basaren drängt sich das Leben. Doch während ich früher der Überzeugung war, dass es kaum einen abenteuerlicheren Ort auf Erden geben kann, habe ich in diesen Tagen keinen Blick für die orientalischen Wunder. Nur ein einziger Grund hat mich hierher geführt.
Die Suche nach meinem geliebten Kamal.
Unabhängig davon, ob Gardiner Kincaid mein leiblicher Vater gewesen ist oder nicht – als mein Lehrer hat er mir beigebracht, dass in der Hauptstadt des Osmanenreichs viele der alten Traditionen bis zum heutigen Tag bewahrt werden und es noch immer Gelehrte gibt, die die altpersischen Künste der Sterndeutung, der Weissagung und der Schriftkunde pflegen. Obwohl ich als Archäologin in erster Linie der ratio verpflichtet bin, habe ich in den vergangenen Monaten viele Dinge erlebt und erfahren, die mich an der reinen Wissenschaft haben zweifeln lassen. Wenn ich Kamal finden will, werde ich dazu mehr brauchen als die bloße Kraft des Verstandes.
Was ich brauche, ist ein Wunder …
GROSSER BASAR
KONSTANTINOPEL
18. MÄRZ 1885
Die Luft über dem Kapali Çarşi, dem Großen Basar, war erfüllt von fremdartigen Düften. Unterschiedlichste Gerüche drangen in die Nasen der Besucher und riefen Bilder und Vergleiche verschiedenster Art hervor – von Gewürzen wie Zimt und Anis, die an Weihnachten erinnerten, über den süßen Duft von Türkischem Honig, der das Morgenland erahnen ließ, über den strengen Geruch von frisch gegerbtem Leder bis hin zum lieblich-herben Geschmack erlesener Tabaksorten.
Die Nischen, die sich in nicht enden wollender Anzahl unter den bunt bemalten Dächern des Basars aneinander reihten, quollen über vor Waren, die von Händlern in bunten Seidengewändern feilgeboten wurden. Streng nach Zunftordnungen gegliedert, wie sie bis ins späte Mittelalter hinein auch in Europa gegolten hatten, buhlten die Handwerker um die Gunst der Kunden, die sich zu Hunderten in den Gassen drängten: Hier boten die Weber bunte Tuchwaren zum Kauf, in einer anderen Gasse konnte man von den Kerzenmachern gefertigte Wachslichter erstehen, wieder in einer anderen waren die Töpfer und Glasbläser zahlreich vertreten. Entsprechend groß war die Vielfalt an unterschiedlichen Farben und Formen, in der es Krüge und Töpfe, Becher und Kelche, Öllampen und Kerzenständer, Töpfe und Pfannen, Messer und Dolche, Polster und Kissen, Decken und Teppiche zu erstehen gab. Die türkische nargile2 wurde ebenso zum Kauf angeboten wie die klassische Tabakpfeife aus geschnitztem Meerschaum; orientalisch anmutende Schatullen mit Intarsien aus Rosenholz sowie Pantoffeln aus chinesischer Seide; Gürtel und Sättel aus feinem Leder und grüne Keramik aus Kale-Sultanie. An den Lebensmittelständen wurden Gewürze unterschiedlichster Art verkauft, dazu gedörrte Datteln und Aprikosen, Maulbeeren und Kichererbsen, süßer Honig, getrocknete Auberginen und Marmeladen aus Zitronen, Birnen und wilden Mohrrüben. Und hier und dort betätigte sich ein Derwisch vor staunenden Zuhörern als meddah3.
Der Lärm, der dabei die Luft erfüllte, war unbeschreiblich, ein Stimmengewirr, das von der gewölbten Überdachung des Basars zurückgeworfen und noch verstärkt wurde. Der Vergleich mit einem Bienenstock drängte sich förmlich auf. Allenthalben versuchten die Händler, die Kunden in ihre Läden zu locken, die oftmals wenig mehr waren als bis unter den Rand mit Gütern vollgestopfte Höhlen; und nicht selten kam es vor, dass arglose Basarbesucher, die sich vom Glanz der Waren blenden ließen, mit Dingen nach Hause kamen, für die sie keine Verwendung hatten.
Die meisten Menschen, die sich auf dem Basar drängten, waren Türken, die nach osmanischem Brauch gekleidet waren, aber es fanden sich auch viele Europäer darunter, die in der Osmanenhauptstadt zahlreich vertreten waren und von denen die meisten in den Hotels und Mietshäusern von Pera lebten; dazu kamen Inder, Perser, Menschen aus Pakistan und Chinesen. Der Toleranz entsprechend, die im Reich der Sultane eine lange Tradition hatte, waren Fremde stets willkommen und wurden bereitwillig geduldet, auch wenn es von Seiten der muslimischen Gastgeber immer wieder Versuche gab, als verloren angesehene christliche Seelen zum wahren Glauben zu bekehren. Diese Versuche waren aber durchweg gut gemeint und wurden in der Regel in aller Höflichkeit vorgetragen. Anders verhielt es sich, wenn jemand gegen geltende Regeln verstieß und sich beispielsweise nicht an den Grundsatz der Geschlechtertrennung hielt, der eine mindestens ebenso lange Tradition hatte. Vorwurfsvolle Blicke waren in diesem Fall das Mindeste, worauf sich der Besucher einstellen durfte – so wie jene, denen sich Sarah Kincaid und Friedrich Hingis ausgesetzt sahen, als sie das Kaffeehaus im Herzen des Basars betraten …
»O-oh«, machte der Gelehrte in seinem unnachahmlichen Schweizer Akzent. »Das ist nicht gut.«
»Was meinst du?«, fragte Sarah und gab sich ahnungslos, was in Anbetracht der Situation allerdings ziemlich unglaubwürdig wirkte. Denn kaum hatte sie ihren Fuß über die Schwelle des Kaffeehauses gesetzt, waren die Gespräche verstummt, und buchstäblich alle Augen hatten sich auf sie gerichtet.
Sarah ließ ihren Blick über die Männer gleiten, die auf großen Kissen um kleine Tische saßen und sich – jedenfalls noch bis vor wenigen Augenblicken – angeregt unterhalten hatten, während sie stark gesüßten Mokka aus kleinen Tässchen tranken. Aus dem Hintergrund des Lokals erhob sich eine groß gewachsene, vierschrötige Gestalt, die drohend näher kam, zweifellos der Besitzer.
»Ich habe dir gesagt, dass das Ärger geben wird«, raunte Hingis Sarah zu, wobei sich seine Lippen kaum bewegten. »Warum musstest du auch unbedingt mitkommen?«
»Weil ich es satt habe zu warten«, entgegnete Sarah schlicht und trat noch einen Schritt vor.
Schon in England hätte es einen Affront ohnegleichen bedeutet, hätte sich eine Frau ungebeten Zugang zu einem der exklusiven Herrenclubs verschafft, die sich an der Londoner Pall Mall aneinander reihten. Für die Männer im Kaffeehaus war es ein Tabubruch, der als Angriff auf die bestehende Gesellschaftsordnung angesehen werden musste, und dies umso mehr, da sich Sarah den lokalen Gepflogenheiten angepasst hatte und osmanische Kleidung trug, also nicht auf den ersten Blick als Europäerin zu erkennen war: Über einem weit geschnittenen Hemd, gömlek genannt, und den obligatorischen Pluderhosen trug sie den traditionellen entari, ein aus Samt geschneidertes Kleid, über das sie wiederum eine lange Jacke gezogen hatte, den dolaman. Schon der alte Gardiner hatte Sarah beigebracht, dass man gut daran tat, sich in fernen Ländern nach einheimischem Brauch zu kleiden, da die lokale Kleidung den klimatischen Erfordernissen stets am besten angepasst war.
Als Kopfbedeckung hatte Sarah einen Fes aus Filz gewählt, wie ihn auch viele einheimische Frauen trugen. Daran war ein zweiteiliger Schleier befestigt, der die Stirnpartie sowie die untere Hälfte ihres Gesichts bedeckte. Nur ein schmaler Sehschlitz blieb dazwischen frei, durch den Sarah in die ebenso staunenden wie vorwurfsvollen Gesichter blickte. Sie beendete das Versteckspiel, indem sie den Schleier lüftete und sich als Ausländerin zu erkennen gab.
Die allgemeine Entrüstung legte sich daraufhin ein wenig. Wenn europäische Frauen sich renitent und ungebührlich verhielten, so schienen die sich wieder entspannenden Mienen zu sagen, war das vorrangig das Problem der europäischen Männer …
»Wir suchen jemanden«, rief Sarah auf Arabisch, das sie fließend beherrschte, sicher, dass sie von vielen im Lokal verstanden wurde. Hingis, der neben ihr stand, trat von einem Bein auf das andere und knetete nervös die Krempe des Zylinders, den er beim Eintreten abgenommen hatte. Anders als Sarah hatte er es vorgezogen, bei seiner westlichen Kleidung zu bleiben. Den angespannten Zügen des drahtigen Schweizers war zu entnehmen, dass er am liebsten im Boden versunken wäre.
»Wen?«, fragte jemand mit rauer Stimme. Es war der Wirt, der jetzt unmittelbar vor ihnen stand und in seiner weiten Kleidung noch einmal so breit und eindrucksvoll wirkte. Seiner verkniffenen Miene war zu entnehmen, dass seine Geduld einer harten Prüfung ausgesetzt war.
»Einen jungen Turkmenen«, erklärte Sarah kurzerhand. »Sein Name ist Ufuk. Habt ihr von ihm gehört?«
Der Wirt reckte sein bärtiges Kinn vor. »Und wenn?«, erwiderte er angriffslustig.
»Er wollte uns treffen. Draußen vor dem Lokal. Vor einer halben Stunde«, sagte Sarah.
»Achtundzwanzig Minuten«, verbesserte Hingis, der eine Taschenuhr aus der Innentasche seines Gehrocks gezogen hatte und ein wenig verlegen auf das Zifferblatt deutete.
»Und?«, fragte der Wirt nur.
»Ich habe das Warten satt«, erklärte Sarah schlicht. »Wenn Sie Ufuk kennen, dann sagen Sie ihm, dass ich keine Lust mehr habe, Spiele zu spielen. Wenn er die Belohnung noch immer will, dann weiß er, wo er mich finden kann. Wenn nicht, soll er sich von mir aus in die djehenna scheren.«
Der Blick, mit dem sie den Wirt aus ihren tiefblauen Augen anstarrte, war kalt und ließ keine Gefühlsregung erkennen. Dann schloss sie den Schleier vor ihrem Gesicht wieder und wandte sich zum Gehen. Wie sie jedoch feststellen musste, wurde der Weg nach draußen versperrt. Ein breitschultriger Hüne stand ihr im Weg, in dessen Augen es begehrlich blitzte. Seiner Kleidung und Hautfarbe nach war er kein Türke, sondern stammte wohl eher aus Pakistan. Als Kopfbedeckung trug er einen schmutzigen Turban, der auf Paschtunenart gebunden war.
»Belohnung?«, hakte er nach.
»Ganz recht.« Sarah nickte ungerührt. »Kennst du Ufuk? Weißt du, wo wir ihn finden?«
»Naram4«, erklärte der Paschtune, und ein Grinsen breitete sich auf seinen Zügen aus. »Ich bin Ufuk.«
»Wohl kaum«, entgegnete Sarah, und noch ehe der Koloss oder einer der anderen Anwesenden auch nur reagieren konnte, hatte sie unter die Falten ihres dolaman gegriffen und den Colt Frontier gezückt, dessen langer Lauf geradewegs auf die Brust des Paschtunen zielte.
»Wie, Weib?«, schrie dieser. »Bist du von Sinnen?«
»Du hast nicht richtig aufgepasst«, beschied sie ihm schlicht. »Ich sagte, Ufuk stamme aus Turkestan. Also verschone uns mit deinen Späßen und geh uns aus dem Weg.«
Einige der Türken, die im Kaffeehaus zu Gast waren, lachten. Zwar waren sie nicht unbedingt erfreut darüber, von einer Engländerin in ihrer Ruhe gestört zu werden, aber deren kaltschnäuzige Art nötigte dem einen oder anderen doch Respekt ab. Für den Paschtunen hingegen kam es einer schallenden Ohrfeige gleich, vor seinen Geschlechtsgenossen verspottet zu werden. Seine Züge verkrampften sich, und er fletschte die Zähne, während seine rechte Hand in Richtung des Dolchs zuckte, der in seiner Schärpe steckte.
»Das ist nicht zu empfehlen«, sagte Hingis auf Englisch. »Ich versichere Ihnen, werter Herr, dass Lady Kincaid nicht nur eine hervorragende Schützin ist, sondern dass sie auch keinen Augenblick zögern wird, den Abzug zu betätigen.«
Der Mann aus Pakistan schien genug Englisch zu verstehen, um zu begreifen, was Hingis meinte. Resignierend ließ er die Hand wieder sinken, die Ablehnung in seinem Gesicht jedoch blieb bestehen. Und er machte auch keine Anstalten, den Ausgang freizugeben.
Entschlossen trat Sarah auf ihn zu, den Revolver noch immer in ihrer Rechten. Sie wusste, dass in diesem Teil der Welt großer Wert auf Duktus und Gesten gelegt wurde, auf die Art, wie sich jemand nach außen präsentierte. Deshalb bemühte sie sich, nicht einen Hauch von Furcht oder Unruhe zu zeigen – obwohl sie ahnte, dass ein geladener Revolver das Problem nicht lösen würde. Sie hatte die izzat, die Ehre des Mannes beleidigt, was bedeutete, dass er den Weg nicht freimachen konnte, ohne vor den anderen das Gesicht zu verlieren; und Sarah wiederum wusste genau, dass sie einen Menschen nicht erschießen würde, nur weil ihn sein Schöpfer mit der Sturheit eines Kamelbullen in der Brunftzeit ausgestattet hatte. Eine andere Lösung musste gefunden werden, und zwar rasch. Sie hatte das Warten satt.
Unendlich satt!
Noch einen Augenblick stand sie unbewegt vor dem Mann, der sie um einen ganzen Kopf überragte und mindestens doppelt so breit und kräftig war wie sie. Dann handelte sie, und zwar so blitzschnell, dass weder der Paschtune noch Hingis oder sonst jemand genau mitbekam, was geschah. Mit einem Trick, den ihr der alte Gardiner beigebracht hatte, ließ sie den Colt Frontier in ihrer Hand wirbeln, sodass nicht mehr der Lauf, sondern der perlmuttbesetzte Griff auf den Koloss zeigte – und schlug mit aller Kraft zu.
Die Nase des Mannes, die ohnehin schon ziemlich unansehnlich gewesen war, brach mit einem hässlichen Geräusch. Blut stürzte hervor, das den Bart und das Hemd des Paschtunen besudelte. Der jähe Schmerz ließ Tränen in seine Augen schießen, zu einer Gegenwehr war er nicht mehr fähig. Jammernd ging er nieder, beide Hände auf den Fleischberg gepresst, zu dem sein Riechorgan umgestaltet worden war.
Ohne erkennbare Regung blickte Sarah auf ihn herab. Zwar war wegen des Schleiers ohnehin nicht zu erkennen, was in ihrem Gesicht vor sich ging, aber sie empfand tatsächlich weder Genugtuung noch Reue. Der Mann war nur ein Hindernis gewesen. Ein weiteres Hemmnis, das es auszuräumen galt auf dem Weg zu Kamal …
Die Reaktionen der anderen Kaffeehausbesucher fielen unterschiedlich aus. Einige lachten, andere schüttelten verständnislos den Kopf, wieder andere schienen keineswegs einverstanden, hielten sich jedoch bedeckt, aus Furcht, die offenbar verrückte Britin könnte auch ihnen alafranga5 die Nase zertrümmern. Friedrich Hingis hingegen machte kein Hehl aus seinem Missfallen.
»Liebe Freundin«, entrüstete er sich, »ich muss doch sehr bitten! Was hat der Mann dir getan, das einen solchen Gewaltausbruch rechtfertigt?«
»Er war mir im Weg«, erklärte sie schlicht.
»Was du nicht sagst. Und gedenkst du, alle Hindernisse auf diese Weise zu beseitigen?«
»Wenn es sein muss«, bestätigte sie nickend. Sie wollte endlich zur Tür hinaus, aber der sich noch immer am Boden windende Paschtune hinderte sie daran, jetzt nicht weniger als zu dem Zeitpunkt, da er noch auf beiden Beinen gestanden hatte. Ein hagerer junger Mann, der sich bislang unauffällig im Hintergrund gehalten hatte, eilte zu dem gefällten Koloss und untersuchte ihn.
»Seine Nase ist gebrochen«, sagte er auf Englisch mit leichtem türkischem Akzent, während der Blick seiner dunklen Augen Sarah mit unverhohlenem Vorwurf taxierte. »Er braucht dringend einen Arzt.«
»Dann geben Sie ihm etwas Geld, damit er sich verbinden lassen kann, Friedrich«, wies Sarah ihren Begleiter an. »Und dann lassen Sie uns endlich weitergehen, wir haben hier ohnehin schon zu viel Zeit verschwendet. Wir müssen diesen Ufuk finden, sonst …«
»Geben Sie sich keine Mühe, Lady Kincaid«, sagte der Junge, der, wie Sarah jetzt feststellte, höchstens fünfzehn oder sechzehn Jahre alt war. Er trug osmanische Kleidung. Seinem dunklen Teint, dem blauschwarzen Haar und dem singenden Akzent nach stammte er aus Turkestan. »Ich bin Ufuk.«
»Du?«
Sarah musterte den Jungen von Kopf bis Fuß – und war enttäuscht.
Seit rund einem Monat hielten Hingis und sie sich nunmehr in Konstantinopel auf, und während dieser ganzen Zeit war es ihr einziges Bestreben gewesen, jemanden zu finden, der beschlagen genug war, ihnen die Zeichnung auf dem Pergament zu deuten. Ein ganzes Dutzend selbsternannter Seher und Gelehrter hatten sich bereits die Zähne daran ausgebissen, ohne dass sie einen wirklich brauchbaren Hinweis bekommen hätten. Die wahren Weisen, so hieß es, gingen mit ihrem Wissen nicht hausieren; sie biederten sich nicht bei reichen Ausländern an und buhlten um deren Gunst, sondern hatten ihr Leben in den Dienst der Studien und der Wahrung alter Mysterien gestellt. Entsprechend schwierig war es, an einen jener hakim6 heranzukommen. Über einen türkischen Gelehrten, der an der Universität von Konstantinopel altorientalische Geschichte unterrichtete (und damit dasselbe Fach, das auch Gardiner Kincaids Fachgebiet gewesen war), waren sie schließlich an einen der Kuratoren der erst im vergangenen Jahr in Betrieb genommenen Kutuphanei Osmaniye gelangt, der ersten türkischen Staatsbibliothek, der ihnen wiederum die Adresse eines gewissen Mehmed Alcut gegeben hatte, eines Antiquitätenhändlers in Galata, der auf dem Bücherbasar altarabische Handschriften zum Kauf anbot. Nach mehreren Besuchen hatte sich ein freundschaftliches Verhältnis zwischen Friedrich Hingis und Alcut entwickelt, der ein leidenschaftlicher »Rauchtrinker« war und die Empfehlungen des Schweizers, guten Tabak betreffend, überaus zu schätzen wusste; und über einen Schwager Alcuts, der sich für seine Dienste großzügig hatte entlohnen lassen, waren Sarah und Hingis schließlich auf den Namen Ufuk gestoßen.
Fortan hatten sie alles darangesetzt, den Mann zu treffen, der angeblich in alten Mysterien beschlagen war, freilich in der Annahme, es mit einem Menschen zu tun zu haben, der deutlich mehr als sechzehn Lenze zählte. Nicht nur, dass ihre Erwartung ins Leere lief; Sarah fühlte sich schlechterdings verhöhnt bei der Vorstellung, wertvolle Zeit damit vergeudet zu haben, einem Halbwüchsigen nachzuspüren, der vermutlich nichts als ein Scharlatan war.
Wenn auch ein sehr gewitzter … »Du bist Ufuk«, wiederholte sie.
»Allerdings.« Der Junge erhob sich und nickte. Der Blick seiner ebenso dunklen wie schmalen Augen war unverfälscht und ehrlich, sodass Sarah, anders als bei dem Paschtunen, nicht umhinkam, ihm zu glauben. »Warum hast du dich nicht gleich gemeldet?«, fragte sie. »Und warum hast du uns so lange warten lassen?«
»Ich wollte Sie beobachten«, erklärte der Junge mit entwaffnendem Lächeln. »Du wolltest – uns beobachten?«
»Nein, Lady Kincaid.« Er schüttelte den Kopf. »Ich wollte Sie beobachten. Bisweilen verraten die Menschen mehr durch ihr Handeln als durch ihre Worte.«



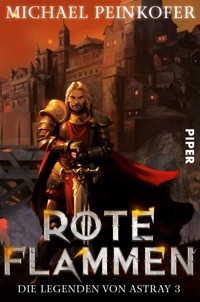
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)