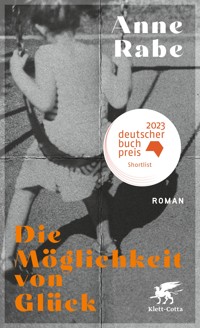17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Können wir uns eine Welt ohne Moral überhaupt leisten? In einer Zeit, in der Moral im gesellschaftspolitischen Diskurs bereits zum Unwort verkommen scheint, stellt Anne Rabe die entscheidende Frage: Können wir uns eine Welt ohne »M-Wort«, ohne Moral leisten? Anhand konkreter Beispiele – wie dem Umgang mit Armut, Migrations- und Klimapolitik, steigender Radikalisierung – beleuchtet sie auf persönliche Weise die gefährlichen Folgen der Verächtlichmachung von Moral in Deutschland. Im Januar 2025 erlebt Deutschland einen Tabubruch: Zum ersten Mal seit Gründung der Bunderepublik sind es Rechtsextreme, die in einer Abstimmung im Bundestag für die entscheidende Mehrheit sorgen. Das ist nur der vorläufige Höhepunkt einer schon lange zu beobachtenden Verschiebung im politischen Diskurs. Die neuen Weichenstellungen des 21. Jahrhunderts haben die Demokratien weltweit unter Druck gesetzt. Autokratien und Imperialismus sind wieder auf dem Vormarsch. Moralische Beweggründe sind nicht mehr an oberster Stelle der Tagesordnung. Welch verführerischer Sog darin liegt, kann man überall dort beobachten, wo auch Demokraten ihm nachgeben. Erhellend erläutert Anne Rabe, wie Moral schrittweise aus dem gesellschaftspolitischen Diskurs verdrängt wird, warum dies so bedrohlich ist und wie moralisches Denken und Handeln Teil der Problemlösungen unserer Zeit sein kann. Eine brillante Analyse, die in einer pessimistisch stimmenden Weltlage Anlass zur Hoffnung gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anne Rabe
Das M Wort
Klett-Cotta
Impressum
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-96693-0
E-Book ISBN 978-3-608-12472-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorbemerkung
Anfangen
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Weitermachen
Dank
Zitatnachweis
Auswahlbibliografie
Anmerkungen
Vorbemerkung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Weitermachen
Für Hedda, Ingmar, Mika und Martha
Was einmal gedacht ward, kann unterdrückt, vergessen werden, verwehen. Aber es läßt sich nicht ausreden, daß etwas davon überlebt.
Theodor W. Adorno, »Resignation«, 1973
Vorbemerkung
Wir wissen ja alle nicht, wo das enden wird.
Das ist ein Satz, der mir in politischen Diskussionen der letzten Wochen und Monate häufig begegnet. In ihm schwingen die Angst vor dem, was noch kommen könnte, genauso mit, wie die Hoffnung, dass es vielleicht nicht so schlimm kommen wird, wie befürchtet. Manchmal vernehme ich jedoch auch einen Zynismus, der seine Untätigkeit, seinen Rückzug ins Private damit zu begründen versucht, dass man ohnehin ausgeschlossen sei, von den Entscheidungen, die gerade die Welt verändern; oder auch, dass als Tatsache postuliert wird, was in demokratischen Gesellschaften keine Tatsache ist, sondern der Veränderbarkeit obliegt – der Zeitgeist hat sich schlicht gedreht. Die Gesellschaft ist politisch nach rechts gerückt. Das sehen wir im Wahlverhalten, das höre ich aber auch von meinen Kindern, die Teenager sind und davon erzählen, dass Queerfeindlichkeit, konservative Familienbilder, Islamfeindlichkeit und die Verteidigung von Privilegien gegen Minderheiten ganz selbstverständlich auch in ihrem Umfeld wieder präsent sind.
Die Leute hätten auf dieses oder jenes keine Lust mehr, heißt es auch. Die Leute wollten sich eben nicht mehr alles vorschreiben lassen. Die Welt sei nun einmal nicht Bullerbü. Es ist natürlich kein Zufall, dass ausgerechnet dieses Buch von Astrid Lindgren als Gegenentwurf zu dem behaupteten Realismus herangezogen wird, wenn es etwa darum geht, moderne Verkehrskonzepte abzulehnen, deren Zentrum nicht länger das Auto sein soll. »Ich mach mir die Welt, wiedewiedewie sie mir gefällt«, schwingt als Vorwurf der selbsternannten Realapostel mit, das Leitmotiv, der wohl berühmtesten Lindgren-Figur, Pippi Langstrumpf.
Wer jedoch einmal im echten Bullerbü, Sevedstorp, dem kleinen Dreihäuserdorf in der schwedischen Provinz Småland war, weiß, dass dieser Ort für jeglichen politischen Vergleich ungeeignet ist. Bei aller Lust an der Zuspitzung, das Bild ist schief, wenn man seinem politischen Gegner unterstellt, er wolle die Welt irrsinnigerweise zu Bullerbü machen. Drei rote Häuser irgendwo im schwedischen Nirgendwo stehen für gar nichts. In dem Bullerbü-Bild geht es in Wirklichkeit um etwas anderes. Es geht darum, dem politischen Gegner einen Realitätsverlust zu unterstellen und gesellschaftliche Verhältnisse als unverrückbare Parameter zu definieren. So ist sie nun einmal, diese Welt, findet euch damit ab. Die Leute wollen das so.
Die Romanwelt Astrid Lindgrens ist voller kindlicher Figuren, die in eine unwägbare Welt geworfen sind, in der sie nicht selten von den Erwachsenen allein gelassen werden. Auch ihrer berühmten Romanheldin Pippi geht es so. Ihre Mutter ist gestorben, der Vater vergnügt sich in der Südsee, während Pippi mit einem Koffer voller Gold auf sich allein gestellt ist. Ihre körperliche Stärke ist nicht nur eine Superkraft, sie ist eine Notwendigkeit. Sich die Welt so zu machen, wie sie ihr gefällt, ist keine Realitätsverweigerung, es ist ein überlebenswichtiges Mantra. Pippi erschafft sich eine Wirklichkeit, in der weder ihre mangelhafte Bildung noch die verweigerte Hilfe ihr etwas anhaben können. Sie gestaltet und verändert die Welt, in die sie geworfen ist, so, dass sie darin überleben kann.
Die Realitätsverweigerung findet auf anderer Seite statt. Es ist die Erwachsenenwelt um sie herum, die sich nicht verantwortlich für das Kind fühlt. Besonders deutlich wird dies in der wohl anrührendsten Episode des Pippi-Universums. Sie spielt am Weihnachtsabend. Pippi muss das Fest ganz allein gestalten, was sie mit großer Emsigkeit auch tut. Sie behängt beispielsweise einen Baum in ihrem Garten mit Geschenken für alle Kinder aus der kleinen Stadt, in der sie lebt. Dann wird es still. Die Kinder sind bei ihren Familien und feiern dort das Weihnachtsfest. Pippi jedoch sieht aus dem Fenster in den Himmel. Sie denkt an ihre Mutter und führt ein Gespräch mit ihr. Sie denkt auch an ihren Vater, der weit weg in der Südsee ist, und dann überfällt sie auf einmal die Angst, dass vielleicht niemand zu ihr kommen könnte, um die Geschenke auszupacken. Ihre Befürchtung ist glücklicherweise unbegründet.
Der Aufwand, den Pippi betreiben muss, um die Einsamkeit zu überwinden, ist jedoch enorm. Sie schafft es allein, es gibt niemanden, der ihr hilft. Nicht, weil sie die Realität verweigert, sondern weil sie diese sehr genau kennt. Sie lässt sich bloß nicht von ihr entmutigen.
Als Astrid Lindgren 1978 der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen wurde, hielt sie eine Rede, die wohl zu den wichtigsten Texten der Schriftstellerin gehört. Unter dem Titel »Niemals Gewalt« plädierte sie für die gewaltfreie Erziehung als einen Schritt zu einer friedlicheren Welt. Sie verwies dabei eindrücklich auf die Tatsache, dass in keinem Menschen bei seiner Geburt die Saat der Gewalt angelegt ist, dass diese vielmehr häufig von eben jenen gepflanzt würde, die das Kind lieben sollten.[1]
Zu dieser Rede wäre es beinahe nicht gekommen. Denn die Stiftung, die den Preis verleihen wollte, bat die Autorin, die vorab eingereichte Rede nicht zu halten. Sie sei zu provokativ. Zu dieser Zeit war sowohl in der schwedischen Heimat Lindgrens als auch in Deutschland und wohl auch im Rest der Welt das Prügeln von Kindern nicht nur erzieherischer Alltag, es war auch legal.
Lindgren ließ sich von der Aufforderung, den Preis bloß schweigend entgegenzunehmen, nicht beeindrucken. Sie bestand auf die Rede, ansonsten würde sie auf den Preis verzichten.
Ihre Worte hatten Wirkung. Nicht nur, dass sie in der Frankfurter Paulskirche unter großem Beifall aufgenommen wurden, auch die Politik kam an der einmal ausgesprochenen Offensichtlichkeit nicht mehr vorbei. In Schweden löste sie eine Debatte um das Recht auf gewaltfreie Erziehung aus. 1979 wurde in dem skandinavischen Land als erstem auf der Welt das Schlagen von Kindern gesetzlich verboten. Andere Länder folgten diesem Beispiel, und auch Deutschland schaffte es schließlich im Jahr 2001, das Recht auf gewaltfreie Erziehung in Gesetzesform zu bringen.
Lindgren hatte es gewagt, einen moralischen Anspruch in einer Welt zu formulieren, deren Zeitgeist, wie sie es selbst erklärte, nach mehr Strenge, Disziplin und Härte gegenüber Kindern rief. In einer Welt, in der die gewalttätige Erziehung auch bittere Realität für die überwiegende Mehrheit der Kinder war. Die Idee der gewaltfreien Erziehung war nichts weiter als die Vorstellung einer Welt, wie sie ihr gefallen würde. Aber diese Vorstellung war so klar und richtig, dass sie zur Wirklichkeit werden konnte. Der Gedanke war so tragend, dass er sich erfüllte.
Aus diesem und vielen anderen Beispielen entsteht für mich die Frage, ob wir uns in einer sich rasant verändernden Welt das Zurücktreten von moralischen Ansprüchen und Ideen tatsächlich leisten können. Ob wir uns einschüchtern lassen sollten von den Versuchen, die Moral unter Verdacht zu stellen? Unter den Verdacht der Realitätsferne oder gar der Ideologie.
Die Verachtung der Moral ist nicht neu. Sie ist immer wieder Motor reaktionärer und auch gewalttätiger Bewegungen. Sie ist aber auch Teil der Überlegenheitsbehauptung derjenigen, die mit zynischem Schulterzucken andeuten wollen, dass sie sich keine Illusionen mehr machen: Es ist, wie es ist. Finde dich damit ab. Oder auch Teil derer, die unter dem Deckmantel des Realismus ihre Privilegien verteidigen.
Warum sollten wir uns dem ergeben? Wer moralische Ansprüche daran misst, ob sie bereits Wirklichkeit sind, verkennt die Kraft dieser Ideen und auch das Potenzial unserer Fantasie. Wir haben die Möglichkeit, die Welt mit unseren Gedanken zu verändern. Nichts war einfach, wie es war. Nichts muss bleiben, wie es ist. Das macht Angst, aber darin liegt auch Hoffnung.
2. Mai 2025
Der Verfassungsschutz stuft die AfD bundesweit als rechtsextrem ein. Captain Obvious flattert mit wehendem Mantel durch die Republik. Get the fuck up again, Rocky. Go get ’em!
Dieser Essay ist ein Versuch. Ein Versuch zu verstehen, welche Welt uns droht abhanden zu kommen. Was genau wir drohen zu verlieren. Wann wir begonnen haben, es uns nehmen zu lassen. Oder haben wir es hergegeben?
Anfangen
3. Januar 2025
Es ist, als würde man an einem Schießstand auf dem Rummel stehen. Man nimmt das Gewehr, und das Ziel ist nur zwei Meter entfernt, da gleich über dem Tresen. Ich atme dreimal ein und aus, bevor ich die Luft anhalte. Ich bringe Kimme und Korn auf die Linie, über die ich die Hasen nun gleichmäßig laufen lasse. Der Schuss. Ich bin mir sicher, ich müsste getroffen haben. Ich bin eine gute Schützin. Schon immer. Aber der Lauf der Waffe ist schief. So gut kann keiner zielen, als dass er mit dieser Flinte treffen könnte. In der Nacht laufen die Hasen hinter meinen geschlossenen Lidern weiter, wie über eine Leinwand. Im Hintergrund rattert der Projektor. »Schieß«, sagt einer, »schieß doch endlich!« Ich halte im Schlaf die Luft an.
Ich bin nicht gläubig. Dennoch gehe ich jedes Jahr an Weihnachten in die Kirche. Damit habe ich schon in meinen Teenagerjahren begonnen. Während sich die heimische Weihnachtsfeier an der MDR-Sendung »Weihnachten in Familie« ausrichtete, in der der einstige Schlagerkönig der DDR, Frank Schöbel, eine familiengerechte Weihnachtsshow bereitete, stapfte ich vor Festmahl und Bescherung in den Nachmittagsgottesdienst einer der großen Kirchen meiner Heimatstadt, um der Weihnachtsgeschichte zu lauschen.
Bis heute rührt mich die Vorstellung, dass sich Menschen ungefähr zur gleichen Zeit überall auf der Welt seit bald zweitausend Jahren die immer gleiche Geschichte erzählen, um einen kollektiven Moment der Hoffnung zu erleben. Das ist natürlich kitschig und blendet nicht nur die Tatsache aus, dass das Weihnachtsfest lediglich für einen Teil der Menschheit diese Bedeutung hat. Diese eingeschränkte Sicht auf den christlichen Mythos lässt auch außer Acht, dass viele Menschen durch all das Leid, das im Namen der Religion verübt wurde, in ihr wohl eher kein Symbol der Hoffnung sehen.
All das wissend, ist das Erzählen der Weihnachtsgeschichte für mich dennoch im Jahresverlauf der einzige zuverlässige Moment des Innehaltens – nicht in Einsamkeit, sondern in Gemeinschaft. Das liegt nicht nur an der jährlichen Wiederholung, es liegt vor allem an den Liedern, die während eines Gottesdienstes gesungen werden. Es sind die vertrauten Melodien, besonders aber zwei Zeilen, die mich jedes Mal derart ins Mark treffen, als hörte ich sie zum ersten Mal.
In »Stille Nacht« ist es das kurze »alles schläft« und im »O du fröhliche«, das beim Auszug aus der Kirche gesungen wird und zu den Festlichkeiten überleitet, das »Welt ging verloren«, in dem ihr Abgrund mitschwingt.
Alles schläft. Welt ging verloren.
Kaum etwas könnte die Veränderung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, besser beschreiben.
Welt ging verloren.
Ich kann mich nicht dagegen wehren zu weinen. Auch im letzten Jahr nicht. Und das, obwohl der Gottesdienst so absurd schlecht war, dass meine Kinder und ich uns kaum anschauen konnten, um nicht in Lachen auszubrechen. Auf eine lieblose Predigt, deren einziger Inhalt die Verkündung war, dass Jesus unter armen Leuten und nicht unter Königen geboren wurde, folgte eine Fürbitte für wahllos zusammengestellte Benachteiligte: Einsame, Kranke, Obdachlose und Syrer. Wer weiß, vielleicht waren in der nächsten Runde dann die Ukrainer dran. Nach dem Vaterunser wird vermeldet, dass gleich der nächste Gottesdienst beginnen würde, weshalb die Gemeinde bitte zur Hintertür hinausschreiten möge, um alles schneller über die Bühne zu bringen.
Die Pastorin hatte wirklich allen Weihnachtszauber verfliegen lassen, doch als die Orgel in das »O du fröhliche« stolperte, spürte ich die Tränen in meinen Augen aufsteigen. Peinlich berührt, drehten sich meine Kinder weg. Sie kennen das schon. Mir ist an Weihnachten nicht zu helfen.
Alles schläft. Welt ging verloren.
So ist es. Jedes Jahr wird es wahrer.
Inzwischen ist es schwer zu sagen, wann es angefangen hat, dass Zukunft nicht mehr gleichbedeutend mit vorne, höher, weiter und besser war. Dass aus Wünschen auf Verbesserung, Ahnungen von Stillstand und schließlich die Angst vor Rückschritt wurde. War die Pandemie der Ausgangspunkt? Der Kriegsausbruch in der Ukraine? Oder doch schon die Finanzkrise? Der 11. September?
Wann wurde das Undenkbare möglich, dass ausgerechnet im Deutschen Bundestag einmal wieder Mehrheiten mit Rechtsextremisten hergestellt würden? Hat das etwas verändert? Oder geht einfach alles weiter wie bisher? Ist Moral ein Adjektiv oder ein Verb?
Ich weiß: Besser wird’s nicht. Besser wird es nicht mehr werden. Dieses Gefühl treibt mich um. Warum zucken wir so oft nur noch zynisch mit den Schultern? Warum sagen wir, lass uns nicht über Politik reden, wir wollen doch einen schönen Abend haben? Warum haben wir Angst, dass der Streit zu grundsätzlich werden könnte, weil die Gemeinsamkeit der Werte nicht mehr selbstverständlich ist? Stehen wir noch auf dem gleichen Grund? Wissen wir noch, wo oben und unten, hinten und vorn ist?
Die Welt ging verloren.
Warum und wohin?
Ich will verstehen und bin auch auf der Suche nach Hoffnung. Nach einem Gedanken, der tragen könnte. Einer Perspektive auf die sich immer schneller verändernde Welt, die sie einen Moment lang anhält und die mich nicht mehr nur zu einer ängstlichen Zuschauerin macht, sondern mir das Gefühl gibt, ein Teil von ihr zu sein.
Ich öffne den Verschluss und lasse eine Kugel in den Lauf rollen. Mit schiefem Waffenlauf und ungeeichtem Korn will ich auf die Hasen schießen, während ein Betrunkener mich von der Seite anrempelt. Ich setze meinen linken Ellenbogen auf die Ablage und lege die Waffe in meine Hand. Ihr Schaft ruht in meiner rechten Schulter. Mit dem Finger am Abzug atme ich dreimal tief ein. Warte.
Eins
12. Februar 2025
Die Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP und der FPÖ, an deren Ende der Rechtsextremist Herbert Kickl Kanzler der Alpenrepublik werden sollte, sind gescheitert. Kraft schöpfen aus der Unfähigkeit der manchmal übermächtig wirkenden Gegner.
»Es fällt mir schwer, hier heute zu sprechen. Die Rede, die ich eigentlich für diesen Tag geschrieben habe, musste ich verwerfen. Und ich bitte um Nachsicht, dass manche Sätze ungeschliffen, manche Worte zu grob gewählt sein könnten. Mir geht die Poesie abhanden, angesichts dessen, was in der letzten Nacht geschehen ist.«
So begann ich die Festrede am 6. November 2024 bei der Preisverleihung des Sächsischen Förderpreises für Demokratie. Dort wurden Initiativen ausgezeichnet, die sich in dem Bundesland, das seit Jahrzehnten als Hort des Rechtsextremismus gilt, für die Demokratie stark machen.
Die Rede, die ich für diesen Anlass bereits geschrieben hatte, habe ich am Morgen in die Ablage geschoben, denn in der Nacht hatte sich alles verändert. Auch wenn das Ergebnis der amerikanischen Präsidentschaftswahl nicht gänzlich überraschend kam, es gibt doch immer einen Unterschied zwischen einer beängstigenden Möglichkeit und der erschlagenden Heftigkeit der Realität: Donald Trump war nun zum zweiten Mal von den US-Amerikanern zu ihrem Präsidenten gewählt worden.
Früh am Morgen hatte ich mich an den Schreibtisch gesetzt und bis zu meiner Abreise nach Dresden alles neu geschrieben. Was sollte man nun noch sagen? Wie sollte ich den Schock in Worte fassen? Wie könnte ich Zuversicht und Hoffnung vermitteln? Was äußern, sodass es den Preisträgerinnen und Preisträgern gerecht würde, die besonders deshalb gewürdigt wurden, weil sie dort, wo nur wenige Menschen sich engagieren, mit einem hohen Maß an Idealismus aktiv sind?
Die Geschichte der Gewinner des Hauptpreises, die Initiative »Bunte Perlen Waldheim«, steht symbolhaft für das, was das zivilgesellschaftliche Engagement in Ostdeutschland ausmacht. In Waldheim, einer Kleinstadt mit etwa 9000 Einwohnern, mittig gelegen zwischen Dresden, Leipzig und Chemnitz, gibt es wie in vielen ostdeutschen Städten auch im Jahr 2024 wöchentlich noch sogenannte »Montagsdemonstrationen« oder »Montagsspaziergänge«. Zu diesen rufen als besorgte Bürger getarnte rechtsextreme Akteure auf und untermalen ihre Wut auf »die da oben« mit dem, was inzwischen zur Folklore der neuen Rechten gehört: Russlandfahnen neben Deutschlandfahnen, Bekenntnissen zum Reichsbürgertum und jede Menge Hass auf Links und Grüne, Flaggen von auf hellblauem Grund flatternden Friedenstauben.
In Sachsen gibt es neben einer sehr radikalen AfD inzwischen auch eine Reichsbürgerpartei, die Freien Sachsen, die es bei den Kommunalwahlen 2024 überall dort in die Parlamente geschafft hat, wo sie angetreten ist. Zwar stehen die Freien Sachsen auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD, jedoch stört das vor Ort niemanden mehr. Man kennt sich, man arbeitet zusammen, nicht heimlich, sondern ganz öffentlich. In den ländlichen Regionen Sachsens hat die AfD es längst aufgegeben, ihr bürgerliches Image zu pflegen. Das gemeinsame Hauptziel, die Zivilgesellschaft zum Schweigen zu bringen, indem man sie verängstigt, schweißt zusammen.
Im Sommer 2024 tauchen beim CSD in Bautzen 700 Neonazis auf und skandieren lauthals ihren Hass gegen die fröhliche Demonstration. Das machte bundesweit Schlagzeilen. Angeführt wurde der Gegenprotest von den Freien Sachsen. Aber auch AfD-Politiker zeigten sich offen auf der Gegendemo. Einer von ihnen filmte die CSD-Teilnehmer systematisch ab. Als der bunte Demonstrationszug durch die Fußgängerzone geleitet wird, sitzt dort auch die verrentete, gutbürgerliche Mitte der Stadt bei Eisbecher und Kuchen und deutet mit Gesten an, dass sie den Demonstrierenden gern die Kehle durchschneiden würde. »Ihr gehört alle weggesperrt«, zischen sie. Wenige Tage zuvor waren in Bautzen Jugendliche vor ihrem selbstverwalteten Jugendclub »Kurti« zusammengeschlagen worden.
Die Vorfälle häufen sich, überall. Nicht nur im Osten, aber dort sind sie besonders brutal. Sie richten sich gegen alle, die sich für eine offene Gesellschaft einsetzen. In der Mehrheit wähnen sich die Rechtsextremen ohnehin. In den öffentlich zugänglichen Telegramchats, in denen seit der Corona-Pandemie sogenannte »Montagsspaziergänge« organisiert werden, schwadronieren die Teilnehmenden auch schon mal selbstbewusst von einer Zukunft, in der man die Verantwortlichen aus Berlin, aber auch demokratische Akteure vor Ort, einmal für alles »zur Verantwortung« ziehen würde, beispielsweise, wenn in einem Stadtparlament der Bau neuer Windkrafträder beschlossen wurde. Manche Gewerbetreibende in Städten wie Bautzen und Görlitz schicken ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesen Montagen früher nach Hause, damit sie nicht in die Demos geraten.
Im Januar 2024 beschließt eine Handvoll Waldheimerinnen, dass sie dem braunen Treiben etwas entgegensetzen wollen. Es ist jedoch gar nicht so leicht, eine Initiative zu gründen. Denn die Gemeinde ist nicht bereit, dafür Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Einen Jugendclub oder ein Kulturheim gibt es ohnehin nicht mehr. Also geht man in den Nachbarort und schafft es auf Anhieb, beinahe zwanzig Menschen für das Anliegen zu begeistern.
Es dürfte eigentlich kein Problem sein, den Rechtsextremen durch die nächste Demo einen Strich zu machen, denn bisher fanden all diese »Spaziergänge« ohne vorherige Anmeldung statt. Warum die Stadt das geduldet hat, ist unklar. Vielleicht aus Sympathie oder weil es eine Demo, die nicht angemeldet ist, zumindest offiziell gar nicht gibt.
Eigentlich hätte die frisch gegründete Initiative »Bunte Perlen Waldheim« ihre Demonstration nur anmelden müssen, um die Rechtsextremen zum Ausweichen zu zwingen. Aber die Stadt war damit nicht einverstanden. Man bat die Initiative, einen anderen Ort zu wählen. Es könnte schließlich sein, dass auch die Rechten eine Demo anmelden wollen. Es hörte sich so an, als hätten die in Waldheim Vorrang.
Doch die Initiative blieb standhaft und setzte sich durch. Auch wenn sie deutlich kleiner war als die Gruppe der Rechtsextremen, die, angestachelt durch den Gegenprotest, auch noch einmal kräftig mobilisieren konnten. Sie zwangen die Rechtsextremen dazu, sich ebenfalls anzumelden. So ist dann zumindest auch offiziell dokumentiert, dass Rechtsextreme regelmäßig in der Stadt demonstrieren. Auch das ist wichtig.
Die Stadt reagierte mit so empfundenen Einschüchterungsversuchen, indem man den »Bunten Perlen« die Extremisten direkt vor die Nase setzte, und sie somit als mögliche Ziele markierte. Aber die couragierten Demokratinnen und Demokraten ignorierten dies mutig und fanden immer neue, kreative Formen, mehr Bürgerinnen und Bürger von sich und einem friedlichen, lebensbejahenden Miteinander zu überzeugen.
Ich bewundere diese Menschen. In den letzten Jahren durfte ich viele von ihnen kennenlernen und gelegentlich unterstützen. Das hat mich auch mit meiner eigenen Herkunft aus Ostdeutschland versöhnt.
Der Rechtsextremismus, der Hass auf den Westen, die Queerfeindlichkeit und die Gewalt, die aus all dem resultierte, hatten mein Aufwachsen in den 90er- und 00er-Jahren in Mecklenburg-Vorpommern geprägt. Dass sich so viele in Ostdeutschland damit abfanden, darüber schwiegen und im Zweifelsfall noch die als Nestbeschmutzer beschimpften, die etwas verändern wollten, hatte mich Mitte der 00er-Jahre nach Berlin getrieben.
Ich wollte den spießigen Kleinstadtmief loswerden. Die Atmosphäre, in der alle über alles Bescheid wissen, sich aber niemand für etwas verantwortlich fühlte, was vor dem eigenen Gartenzaun stattfand. In dem lieber einmal zu viel weggeschaut wurde, als sich in fremde Angelegenheiten einzumischen, und in der jeder und jede, der und die anders war, als Bedrohung für die Gemeinschaft erlebt und von ihr so lang ausgeschlossen oder bekämpft wurde, bis sie sich fügten oder wegliefen.
Die ostdeutsche Provinz kann eine Kleinbürgerhölle sein, wie es sie vielerorts gibt. Nur hat sie eben eine sehr spezielle Geschichte, vor und nach der friedlichen Revolution, die bis heute dafür sorgt, dass auf den Schaubildern nach Wahlen die Grenze der ehemaligen DDR erscheint.
Diejenigen, die sich dem trotzig entgegenstellen, stimmen mich immer wieder hoffnungsvoll. Demokratisches Engagement in Ostdeutschland wird mit jedem neuen Umfrage- und Wahlrekord der AfD gefährlicher. Zahlreiche verbale und auch tätliche Übergriffe während der zurückliegenden Wahlkämpfe legen darüber Zeugnis ab. Am eindrücklichsten war sicher der Überfall auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden, bei dem ihm vier Jugendliche das Jochbein gebrochen haben, als er Wahlkampfplakate aufhängte. Für den juristischen Beistand einer der mutmaßlichen Täter werden auch im Telegram-Chat der Waldheimer Montagsdemonstranten Spenden gesammelt.
Demokratische Aktivistinnen und Aktivisten sind in Ostdeutschland außerhalb der Großstädte in der Minderheit. Aber es gibt sie, und man kommt an ihnen nicht mehr einfach vorbei: von Fridays for Future über Queers, die CSD-Paraden organisieren, und die OMAS GEGEN RECHTS.
Es kann schon sein, dass aus der schweigenden Mehrheit in Ostdeutschland längst eine zustimmende geworden ist, aber unwidersprochen bleibt das, was harte Rechtsextreme tun, nicht mehr. Das Problem wird von diesen Aktiven nicht nach Berlin delegiert, an »die da oben«, nicht dem fiesen Westen in die Schuhe geschoben, sondern immer wieder, immer neu und immer mutig vor Ort angegangen.
Dennoch fiel es mir schwer vor diesen Menschen an diesem Tag in Dresden, die sich nicht entmutigen lassen, in meiner Rede zuversichtlich zu bleiben. Also entschied ich mich dagegen. Es gab keinen Grund zu Optimismus. Keinen Anlass für ein einfaches »Weiter so« oder »Das wird schon«. Und ich ahnte, dass auch die Leute, vor denen ich sprach, genug von den aufgesetzten »Bravo, nur weiter so!«-Parolen hatten. Und genug von der Schönfärberei. Sie wissen, dass es bei ihnen längst fünf nach zwölf ist. Aber, und das ist nicht Nichts, sie haben einen Optimismus des Trotzdem entwickelt: Es ist schlimm. Die Lage ist ernst. Besonders in Ostdeutschland. Aber, das war an diesem 6. November mit der Trump-Wahl schon zu ahnen, auch im Rest der Welt. Dennoch beweisen all jene, die sich den demokratiefeindlichen Bestrebungen entgegensetzen, dass es schlimmer sein könnte. Ohne sie wäre es schlimmer. Denn wenn es auch nur ein Mensch schafft zu widersprechen, dann ist die Möglichkeit da. Dann könnte alles auch anders sein.
In Sachsen hatte wenige Wochen zuvor die CDU mit 31,9 Prozent der Stimmen denkbar knapp die Landtagswahlen gewonnen. Die rechtsextreme AfD war ihr mit 30,6 Prozent dicht auf den Fersen. Auch wenn sie ihr Wahlziel, Michael Kretschmer abzulösen, noch knapp verfehlt hatte, setzte dieses Ergebnis den Amtsinhaber mächtig unter Druck. Die Mehrheit der sechzig Wahlkreise im Freistaat war an die Rechtsextremen gegangen, und auch das beste Erststimmenergebnis hatte mit fast 50 Prozent der Stimmen ein AfD-Kandidat bekommen.[1] In Sachsen ist der Rechtsextremismus außerhalb der großen Städte vielerorts längst zur bestimmenden Mainstreamkultur geworden.