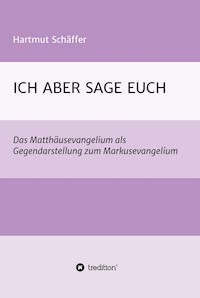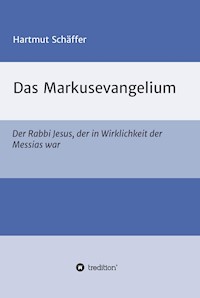
19,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Markusevangelium als Jüngerunterweisung - Markus schreibt keine historische Biographie, sondern eine literarische Biographie, um seine Täuflinge mit den wichtigsten christlichen Glaubensinhalten vertraut zu machen. Die Glaubensinhalte werden hergeleitet aus den jüdischen heiligen Schriften und finden ihre Vergegenwärtigung nicht in der Zeit Jesu, sondern in der Zeit des Markus. Sein Evangelium spricht in Bildern und muss deshalb entschlüsselt und erklärt werden. Das Verständnis für die allegorische Natur des Markusevangeliums ist uns heute zu einem großen Teil verloren gegangen. Das Buch möchte einen Beitrag dazu leisten, die Bilderschlüssel wiederzuentdecken. Zielgruppe sind nicht nur Theologen, sondern vor allem interessierte Laien. Sie werden entdecken, dass schon Markus selber die Austreibung von Dämonen, das Gehen auf den Wassern des Sees Genezareth oder das wundersame Vermehren von fünf Broten und zwei Fischen metaphorisch gemeint hat. So wird das Markusevangelium auf einmal zu einem Glaubensbuch, das auch der aufgeklärte Mensch unserer Zeit mit Gewinn lesen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Hartmut Schäffer
DAS MARKUSEVANGELIUM
Der Rabbi Jesus, der in Wirklichkeit der Messias war
© 2017 Hartmut Schäffer
Umschlaggestaltung: tredition GmbH, Hamburg
Illustrationen und Tabellen: Hartmut Schäffer
Bibelübersetzung: Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe,
© 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Taschenbuch: 978-3-7439-4897-6
ISBN Hardcover: 978-3-7439-4898-3
ISBN e-Book: 978-3-7439-4899-0
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
INHALTSVERZEICHNIS
0 Einleitung
0.1 Die Erzählungen des Markus
0.2 Pseudepigraphie
0.3 Christus oder Vespasian?
0.4 Aufbau und Struktur des Markusevangeliums
0.5 Das Markusevangelium als Jüngerunterweisung
0.6 Sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht hören
TEIL I: GALILÄA
1 Die Zeit ist reif – in Galiläa kommt Gottes Messias zu den Menschen
1.1 Johannes der Täufer und sein Verhältnis zu Jesus, dem Christus
1.2 Jesu Taufe (Johannestaufe und Geisttaufe)
1.3 Versuchung (Wüstenwanderung), neuer Adam
1.4 Herleitung und Vergegenwärtigung
1.5 Der Rabbi Jesus, der in Wirklichkeit der Messias war
2 Dämonen und unreine Geister (1): richtiges und falsches Denken
2.1 Beginn des öffentlichen Wirkens, Jüngerberufung
2.2 Dämonenaustreibungen (rechte vs. falsche Lehre)
2.3 Exkurs: Jesus Christus – Heiler oder Heiland? Heilungswunder im Neuen Testament
3 Dämonen und unreine Geister (2): Annahme der Ausgeschlossenen und Sünder
3.1 Die Heilung des Aussätzigen
3.2 Die Heilung des Gelähmten
3.3 Das Mahl mit den Zöllnern und Sündern
3.4 Drinnen oder draußen: der Umgang mit dem Kult
3.5 Die Heilung der behinderten Hand
3.6 Zweiter Sammelbericht: Austreibung unreiner Geister
4 Schaffung eines neuen Israels
4.1 Überblick
4.2 Berufung der Zwölf zum Zweck der Lehre und Mission
4.3 Ablehnung durch Familie und kirchliches Establishment
4.4 Das wahre Israel
4.5 Erfolg und Misserfolg in der Mission (Gleichnis vom Sämann, Sinnsprüche zur Mission)
4.6 Missionserfahrungen mit Jesus (1): Sturmstillung / Der Besessene von Gerasa
4.7 Missionserfahrungen mit Jesus (2): Die blutflüssige Frau, Jaïrus und Totenerweckung
4.8 Missionserfahrungen mit Jesus (3): Ablehnung in der Vaterstadt
4.9 Aussendung und Rückkehr der Zwölf
4.10 Speisung der Fünftausend
4.11 Jesu Erscheinung auf dem See
4.12 Die Quasten
5 Eingliederung der Heiden in das Reich Gottes
5.1 Einleitung
5.2 Reinheit und Unreinheit
5.3 Heilung der Tochter der Syrophönizierin / Heilung des Taubstummen
5.4 Speisung der Viertausend
5.5 Pharisäer: Zeichenforderung / Sauerteig (Warnung vor Rückfall in den alten Bund)
5.6 Den Messias erkennen und doch nicht verstehen / Heilung des Blinden
TEIL II: AUF DEM WEG
6 „Anhänger des neuen Weges“ – Preis und Lohn der Nachfolge
6.1 Messiasbekenntnis des Petrus
6.2 Erste Leidensankündigung: Nachfolge und Rangfolge
6.3 Verklärung auf dem Berg: Auf wen hören?
6.4 Heilung des besessenen Sohnes: Was ist das, Auferstehung von den Toten?
7 Grundwerte in der Nachfolge
7.1 Zweite Leidensankündigung
7.2 Erster Rangstreit der Jünger
7.3 Umgang mit Andersglaubenden
7.4 Keinen Anstoß geben / Frieden halten
7.5 Ehe halten
7.6 Niedriger Stehende respektieren
7.7 Weltlichen Wohlstand und Anerkennung loslassen / Lohn der Nachfolge
8 Dienen, nicht herrschen
8.1 Dritte Leidensankündigung / Zweiter Rangstreit der Jünger
8.2 Heilung des Blinden und Aufruf zur Nachfolge
TEIL III: JERUSALEM
9 Einzug in Jerusalem
9.1 „Chronologie“ der Passion Jesu bei Markus
9.2 Zwischen Ölberg und Tempel – der König der Juden
9.3 Reitend auf einem Esel
10 Der fruchtlose Tempel
10.1 Die Tempelreinigung und die Verfluchung des Feigenbaums
10.2 Glaube ohne Tempel / Glaube, Gebet, Vergebung: Drei Logien
11 Christus und die Tempelaristokratie
11.1 Jesu Vollmacht
11.2 Die bösen Weingärtner
11.3 Die Steuermünze („Der Zinsgroschen“)
11.4 Frage nach der Auferstehung
11.5 Das höchste Gebot
11.6 Exkurs: Der Biblische Begriff „Liebe“
11.7 Davids Sohn oder Davids König?
11.8 Die scheinheiligen Schriftgelehrten und die arme Witwe
12 Die Apokalypse des Markus
13 Hinwendung und Abwendung
13.1 Das Deutungsbild vom Passafest
13.2 Die Salbung in Bethanien
13.3 Der Verrat des Judas
14 Hinwendung und Verleugnung
14.1 Das Abendmahl
14.2 Gethsemane und Gefangennahme
14.3 Standhaft oder kleinmütig? Jesus und Petrus im Palast des Hohenpriesters
15 Verurteilung und Kreuzigung
15.1 Jesus vor Pilatus
15.2 Verspottung und „Krönung“
16 Grablegung und Auferstehung
16.1 Der messianische Sabbat
16.2 Auferstanden „am dritten Tag“
16.3 Die Erscheinung
16.4 Der ursprüngliche Markusschluss
16.5 Exkurs: Das leere Grab
Teil IV: ANHANG
17 Lehre im Markusevangelium
17.1 Lehre über Jesus im Markusevangelium
17.2 Lehre Jesu im Markusevangelium
17.3 Das Markusevangelium als Jüngerunterweisung
17.4 Das Markusevangelium als Mnemotechnik
18 Exkurs: Der historische Jesus
18.1 Herkunft aus Nazareth
18.2 Taufe durch Johannes
18.3 Konflikt mit seiner Familie
18.4 Lehrtätigkeit
18.5 Zuwendung zu den Randgruppen
18.6 Konflikt mit dem römischen und jüdischen Establishment und Kreuzigung
19 Literaturverzeichnis / Abkürzungen biblischer Bücher
0 Einleitung
0.1 Die Erzählungen des Markus
Um 75 n. Chr. tauchen mit dem Markusevangelium zum ersten Mal Erzählungen auf, dieJesu Lebenzum Gegenstand haben. Bis dahin war schon vieles über Jesus berichtet worden, und zwar in den Briefen des Paulus ca. 50-60 n. Chr., in den Paulinischen Pseudepigraphien (ab 70 n. Chr.; zu den Pseudepigraphien s. nächstes Kapitel), dem Hebräerbrief (70-90 n. Chr.), den Johannesbriefen (65-110 n. Chr.) und der Offenbarung (70-95 n. Chr.). Alle erwähnten Schriften berichten über Jesu Sterben und Auferstehen sowie über Jesu Botschaft und Lehre, jedoch ausnahmslosnicht über Jesu Leben. Das ist umso erstaunlicher, als das Markusevangelium ganz unglaubliche Dinge erzählt: Jesus heilt Kranke, Besessene, macht Blinde sehend, Lahme gehend, weckt Tote auf, geht selber auf dem Wasser des Galiläischen Meeres, stillt einen Meeressturm durch sein mündliches Geheiß. Auch nicht die kleinste Spur davon findet sich in den vormarkinischen Schriften!
Dass die Christen vor Markus davon nichts gewusst hätten oder dass sie diese sensationellen Taten bewusst verschwiegen hätten, ist ebenso undenkbar wie die Annahme, diese Taten und Wunder seien ihnen so unwichtig gewesen, dass sie sie mit keiner Silbe erwähnt haben. Dieser Tatbestand führt zu der Folgerung, dass es diese Erzählungen vor Markus nicht gab. Alle anderen Evangelisten (Matthäus, Lukas, Johannes) kannten Markus. Sie haben seine Erzählungen kopiert, bearbeitet, in seinem Stil weitergeführt, um neue Erzählungen angereichert. Das gilt auch für die Apostelgeschichte, die ja den zweiten Teil des Lukasevangeliums bildet.
Anmerkung:
Redaktionsgeschichtlich ist der Fall komplizierter. Das Markusevangelium, wie wir es kennen, setzt sich bereits aus unterschiedlichen Einheiten zusammen. So muss man von einem „Urmarkus“ ausgehen, dessen Erzählungen unser Markus bereits vielfältig bearbeitet hat. Die Annahme jedoch, dass sich mündliches Erzählgut von Jesu Lebenszeiten an bis Markus fortgepflanzt hat, ohne in denvormarkinischen Schriften Niederschlag zu finden, erscheint mehr als unwahrscheinlich. – Im Übrigen sind uns weder Schriften des Markus noch eines „Urmarkus“ erhalten geblieben. Unser Wissen basiert auf Abschriften, die älteste davon, die wir physisch in den Händen halten können, datiert aus dem 3. Jh. nach Christus.
Aber warum sollte Markus das tun – Geschichten erzählen, die nicht historisch sind? Diese für uns so naheliegende Frage hätten Zeitgenossen des Markus gar nicht gestellt. Sie hätten ja gewusst: Diese Geschichten gab es bisher nicht, also hat Markus sie zum ersten Mal erzählt. Nehmen wir als heutiges Beispiel die Weihnachtserzählungen von Karl Heinrich Waggerl (1897-1973). Er berichtet hier von dem schwarzen König Melchior, der bei der Anbetung des Christuskinds die Hände vors Gesicht schlägt, weil er Angst hat, Jesus würde sich ob seiner schwarzen Hautfarbe vor ihm fürchten. Aber Jesus lächelt ihn an und streckt die Hände nach seinem schwarzen Kraushaar aus. Dann heißt es wörtlich: „Als er aber die Hände wieder löste, sah er das Wunder – sie waren innen weiß geworden. Und seitdem haben alle Mohren helle Handflächen, geht nur hin und seht es und grüßt sie brüderlich.“ – Der Leser stellt sich hier nicht die Frage, warum Waggerl eine Geschichte erzählt, die nicht historisch ist (auch wenn sie einen historischen Kern hat, denn tatsächlich sind die Handflächen von Farbigen immer weiß…). Der Leser setzt voraus, dass das Eigentliche der Geschichte nicht ihr historischer Gehalt ist, sondern „die Predigt von der Nächstenliebe“: „Habt bei farbigen Menschen keine Berührungsängste – geht nur hin und grüßt sie brüderlich.“
Genauso ging es den Menschen, denen Markus seine Geschichten erzählte: Nachdem sich die Frage nach der Historizität nicht stellte, konnte man offen sein für das Eigentliche, für das, was Markus seinen Lesern vermitteln wollte. Was das im Einzelnen war, soll im Folgenden bedacht werden.
Es gibt noch einen anderen Grund, warum die Zeitgenossen des Markus die Frage nach der Historizität nicht gestellt hätten: Es gab nämlich viele solche Erzählungen. Es war ein Stilmittel der Zeit, tiefe Wahrheiten in Bilder zu kleiden. Und die Erzählungen des Markus sind genau das: Bilder in Worten.
Dazu ein weiteres Beispiel: In der „Schatzhöhle“ (eine ursprünglich jüdische Schrift zur Geschichte Israels, die von Christen fortgeschrieben wurde) wird berichtet, dass „die Juden“ Christus nicht kreuzigen konnten, weil in ganz Jerusalem kein Holz mehr aufzutreiben war. So beschlossen sie, die Bundeslade im Tempel auseinanderzunehmen und daraus ein Kreuz zu zimmern. Mehr noch: Unter dem Hügel Golgatha befand sich das Grab Adams. Als nun Jesus starb, floss sein Blut in die Grabeshöhle, benetzte Adam und erweckte ihn dadurch zu neuem Leben.
Niemand hat jemals den Autor der Schatzhöhle Lügner genannt, auch wenn jeder wusste: Die Bundeslade war zur Zeit Jesu längst verschollen. Man hat die „Wahrheit“ hinter der „erfundenen“ Geschichte verstanden: Die Bundeslade stand für den „alten“ Bund Gottes mit seinem Volk. Aus dem alten Bund erwächst durch das Kreuz der „neue“ Bund (>Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen)So wird das Kreuz zur „neuen“ Bundeslade für das „neue“ Volk Israel. So haben sich die Christen damals verstanden. Und dieser Bund wird durch Christi Blut (= durch sein Opfer) besiegelt und gleichzeitig „aktiviert“, zum Leben erweckt. Das Blut Christi erweckt den Menschen („Adam“) zum neuen Leben unter einem neuen Bund.
Diese lange Predigt ist in den wenigen dürren Worten der Schatzhöhle enthalten. Das konnte der damalige Leser verstehen: Nichtdas Gesagteist die Botschaft (kein Holz in Jerusalem – Adams Grab unter Golgatha), sonderndas durch das Bild Gemeinte(vom alten zum neuen Bund, vom „toten“ Adam zum neuen Menschen in Christus).
So wie dieses Bild in der „Schatzhöhle“ funktioniert das ganze Markusevangelium. Unser Blick darauf ist verstellt, weil diese Bildersprache schon sehr bald in einen griechisch-römischen Kulturkreis Einzug hielt, der diese Geschichten nicht mehr allegorisch (bildhaft), sondern wörtlich nahm. Und so wurden sie uns bis heute überliefert. Das wörtliche Fürwahrhalten der Erzählungen im Markusevangelium erschwert den Zugang zu ihrer im Bild enthaltenen Botschaft.
Anmerkung:
Wenn wir Markus allegorisch deuten, gehen wir davon aus, dass er es selber schon so beabsichtigt und gemeint hat. Er hat Lehre und Heilsgeschichte in Bilder gekleidet. Wenn Jesus auf dem Wasser geht, dann ist das für Markus kein geschichtliches Ereignis. Das Meer ist für ihn vielmehr ein Bild für die lebensbedrohlichen Mächte, die uns hinabziehen wollen in die Tiefen. Jesus geht auf dem Wasser, das heißt: Er steht über diesen Mächten. Wer an ihn glaubt, den zieht Jesus aus dem Wasser. Wer Jesus aus den Augen verliert, der versinkt (Petrus). Wenn es sich um ein historisches Ereignis gehandelt hätte, dann müsste die Kirche Matrosen in Seenot den Rat geben, nur ganz fest an Jesus zu glauben, dann gingen sie nicht unter. Die Kirche aber machte es zu allen Zeiten richtig und predigte: Richte dein Leben (damit ist nicht die konkrete Seenot gemeint) auf Jesus aus, glaube an ihn, dann gehst du (geistlich gesprochen) nicht unter. Lebe dein Leben an der Hand Jesu1, dann bestehst du die Stürme des Lebens. Diese Predigt ist keinenachträglicheInterpretation eines historischen Geschehens (das wäre formliterarisch eine Allegorese), sondern eine von Markusbewusst in ein Bild gekleidete Botschaft(formliterarisch eine Allegorie).
Schon bei den uns überlieferten Bearbeitungen von Matthäus und Lukas gibt es kleine Hinweise darauf, dass sie Markus an manchen Stellen wörtlicher nahmen als er selbst. Nachkommende Generationen haben die Frage, ob eine Schrift in die „Bibel“ aufgenommen werden sollte, nicht zuletzt davon abhängig gemacht, wie wahrscheinlich der Text aus historischer Sicht war. Damit hat man die allegorische Ebene dieser Erzählungen schon nicht mehr verstanden.
0.2 Pseudepigraphie
Wir tun uns sehr schwer damit, dass Markus Geschichten schreibt und dabei „so tut, als ob“ das alles tatsächlich so geschehen sei. Ein solches Vorgehen empfinden wir als unwahrhaftig und das umso mehr, als wir von Kindheit an diese Erzählungen als historisch aufgefasst haben. Es ist etwa dieselbe Enttäuschung, die ein Kind empfinden muss, wenn es herausfindet, dass es keinen Osterhasen gibt oder dass die Kinder nicht vom Storch gebracht werden: Jesus ist also nie wirklich auf dem See Genezareth gewandelt? Er hat keine Toten auferweckt, kein Wasser in Wein verwandelt?
Dazu kommt, dass wir auch nicht sicher sein können, ob die überlieferten Jesusworte wirklich von Jesus selber stammen. Zwar benutzt Markus eine sogenannte Spruchquelle mit überlieferten Sprüchen Jesu, diese ist aber leider nicht mehr erhalten. So sind vermutlich viele Jesusworte von Markus oder anderen formuliert worden. Man denke nur an die Szene im Garten Gethsemane2: Wer hätte die dort gesprochenen Worte Jesu hören oder überliefern können? Die Jünger haben ja, nach Darstellung des Markusevangeliums, jene Stunde verschlafen.
In unserer Zeit würden wir es als unredlich empfinden, einen Brief zu schreiben und ihn mit einem bekannten, berühmten Namen zu unterzeichnen. Ebenso empfinden wir es als unwahrhaftig, Begebenheiten über Jesus zu erzählen und so zu tun, als ob dies alles wirklich so geschehen sei. Das war in Jesu Zeiten ganz anders. Damals empfand man es als eine Ehre. Denn mit diesem Vorgehen signalisierte der Verfasser, dass er nichts Eigenes sagen wollte, das über den (vermuteten) Willen des Zitierten hinausging.
Markus bedient sich dabei einer Kompositionsform, die uns an anderer Stelle des Neuen Testaments als „Pseudepigraphie“ bekannt ist. Zu diesem Stichwort zunächst Wikipedia:
Als Pseudepigraphie (griechisch ψευδεπιγραφία – wörtlich etwa „die Falschzuschreibung“, Zusammensetzung von ψευδής pseudēs ,unecht, unwahr’und ἐπιγραφή epigraphē ‚Name, Inschrift, Zuschreibung‘) bezeichnet man das Phänomen, dass ein Text bewusst im Namen einer bekannten Persönlichkeit abgefasst oder fälschlicherweise einer solchen zugeschrieben wird. Eine Schrift mit falscher Verfasserangabe nennt man dementsprechend das Pseudepigraph.
Pseudepigraphie war bereits in der Antike verbreitet. Sowohl im Namen klassischer Autoren als auch im Namen biblischer Gestalten oder Verfasser wurden Schriften verfasst und in Umlauf gesetzt. Die Pseudepigraphie erklärt sich aus dem Bestreben, in einer Schultradition die Gedanken einer Autoritätsperson der Vergangenheit zu tradieren. Dabei kann sowohl der Wunsch, dem eigenen Text eine höhere Autorität zu verleihen, im Vordergrund stehen, als auch die Bescheidenheit, die niedergeschriebenen Gedanken demjenigen zuzuschreiben, von dem man sie sachlich übernommen hat oder von dem man dazu inspiriert worden ist.
Wenn also z.B. der Verfasser des Epheserbriefs seinen Brief (lange nach dem Tod des Paulus) mit „Paulus“ unterschreibt („Ich, Paulus, grüße die Gemeinde in Ephesus…“), dann will er damit ausdrücken, dass er kein neues oder anderes Evangelium verkünden will als Paulus. Er schreibt „im Geiste des Paulus“. Er sagt: Paulus und seine Predigt sind mein Maßstab. Er möchte also nicht die Gemeinde betrügen, indem er sich für Paulus ausgibt. Vielmehr weiß die angesprochene Gemeinde ja, dass Paulus längst gestorben ist. Sie versteht, dass der Verfasser sich Paulus und seiner Botschaft unterordnen will.
In ähnlicher Form lässt Markus in seinem Evangelium Jesus sprechen und handeln. Markus könnte zu seiner Gemeinde sagen: „Wenn ihr Angst habt, dann macht euch bewusst, dass Jesus bei euch ist. Er kann den Sturm eurer Herzen stillen.“ Stattdessen kleidet Markus die Aussage in eine Geschichte: Jesus fährt mit seinen Jüngern übers Galiläische Meer – ein Sturm kommt auf – die ängstlichen Jünger flehen zu Jesus – Jesus stillt den Sturm. Die Gemeinde des Markus weiß, dass Jesus längst gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Deshalb nehmen sie das Bild nicht wörtlich. Sie verstehen, was Markus ihnen mit dem Bild sagen will. Ein tröstendes Bild ist eindrücklicher als ein tröstenderSatz. Wenn Markus Jesus sprechen und handeln lässt, dann will auch er damit ausdrücken: Nicht ich tröste, sondern Jesus. Nicht ich stille die Stürme eurer Herzen, sondern der Auferstandene.
Unser größtes Problem bei der Beurteilung des Markusevangeliums liegt in unserem zeitlichen Abstand zu diesen Texten. Während die Leser und Hörer des Markus ja wussten, dass die erzählten Geschichten neu waren, dass es nicht um die historische Wahrheit ging, sondern um die spirituelle Wahrheit, änderte sich das Verständnis mit der Zeit. Aber bis ins Mittelalter gab es Menschen, die wussten, dass die allegorische Deutung die ursprüngliche war, dass der „Literalsinn“, also die wörtliche Auslegung, in die Irre führt. Es ist eineBibelabschrift überliefert, in der ein Mönch die Worte an den Rand geschrieben hat: „Der Wissende versteht“. Damit war ausgedrückt, dass die wörtliche Auslegung nicht die eigentliche war.
Ein schönes Beispiel für dieses mittelalterliche Bibelverständnis findet sich über dem Nordportal der gotischen Marienkapelle in Würzburg (s. Abb.).
Die Szene zeigt die Verkündigung der Empfängnis Mariä aus dem Lukasevangelium. Wie wird die Zeugung dargestellt? Wir sehen einen „Schlauch“, der von Gottes Mund zu Marias Ohr reicht. Auf diesem Schlauch oder Trichter „rutscht“ das Christuskind von Gottes Mund in Marias Ohr. Das, was mit dem Begriff „empfangen vom Heiligen Geist“ ausgedrückt werden soll, wird hierganz dinglich dargestellt. Es geht also nicht um eine geschlechtliche Zeugung, sondern um eine geistliche Zeugung, die der Kolosserbrief so ausdrückt:Denn in ihm(Christus)wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig(Kol 2,9). Johannes beschreibt es so:…und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns(Joh 1,14). Das Portal in Würzburg zeigt, dass man diese bildhafte Sprache zum Teil noch verstanden hat.
Wenn es stimmt, dass die bildhafte Auslegung die ursprünglich von Markus beabsichtigte ist, dann müsste dieses Prinzip durchgängig auf das Evangelium anwendbar sein. Genau das soll mit dieser Auslegung dargestellt werden.
0.3 Christus oder Vespasian?
Das Markusevangelium leitet, wie wir noch sehen werden, seine theologischen Aussagen fortwährend aus den biblischen Schriften des Judentums her. Daneben gibt es aber auch einen nach vorne gerichteten Bezug, wobei mit „nach vorne gerichtet“ die Zeit und Situation des Markus gemeint ist. Ihm geht es nicht darum, wer Jesus einmal war, sondern wer der Auferstandene für ihn und seine Zeit ist. Diese Frage stellte sich Markus umso drängender, als ein neuer „Messias“ aufgetreten war, der die Gemeinde des Markus (und vor allem die Täuflinge, die noch nicht im Glauben gefestigt waren) tief verunsichern musste. Dieser Messias hieß Vespasian und war der neue Kaiser in Rom.
Eine jüdische oder judenchristliche Gemeinde hätte sich von einem römischen Kaiser wohl kaum verunsichern lassen. Anders stand es um die heidenchristlichen Gemeinden und um „Heiden“ (Römer, Griechen, Ägypter, Syrer…), die vor der Frage standen, Jesus als ihren Christus anzuerkennen. Zu einer solchen heidenchristlichen Gemeinde gehörte Markus.
Was war das Besondere dieses neuen römischen Kaisers Vespasian, dass ihn die nichtchristliche römisch-griechische Welt als Messias verehrte? Vespasian wurde 9 n. Chr. geboren, also etwa zeitgleich mit Jesus. Er war bürgerlicher Herkunft, sein Aufstieg zum Kaiser kam äußerst überraschend. Er verdankte die Kaiserwürde einem Machtvakuum in Rom nach dem Tode Neros. Mehrererömische Feldherren kämpften um die Vorherrschaft, letztlich setzte sich Vespasian durch. Anfang 67 hatte ihn Nero zum Statthalter von Judäa ernannt. Einen Aufstand der Juden konnte er niederwerfen und Judäa unter römischer Kontrolle halten. Im Jahr 70 zog er mit seinem Sohn Titus von Cäsarea Philippi aus nach Jerusalem und von dort weiter nach Ägypten. Noch im selben Jahr wurde er in Rom zum Kaiser gekrönt, während Titus kurz zuvor den Tempel in Jerusalem zerstören ließ. Vespasians Aufstieg und Judäas Niedergang standen also in engem Verhältnis.
Vespasian war ein äußerst erfolgreicher Kaiser. Nachdem Rom durch Neros Verschwendungssucht vor dem wirtschaftlichen Bankrott stand, betrieb Vespasian eine rigorose Steuerpolitik und reorganisierte und verkleinerte das Heer. Trotzdem gelang es ihm, das Römische Reich weiter auszudehnen, u. a. im Norden Englands und in Wales. Durch die Intensivierung der Bautätigkeit kurbelte Vespasian die Wirtschaft des Römischen Reiches an. Auf einem von Nero zu Privatzwecken enteigneten Gelände im Zentrum Roms ließ er für öffentliche Spiele das heute noch zu bestaunende Kolosseum erbauen. Auch das Kapitol, das sakrale Zentrum Roms, das in den Kriegswirren vor seiner Krönung stark beschädigt worden war, ließ er wieder aufbauen.
Vespasian bekämpfte die Korruption. Schon vor seinem Herrschaftsantritt war er bekannt dafür, sich nicht (wie üblich) auf Kosten des Volkes zu bereichern. Als Prokonsul von Afrika geriet er deswegen sogar in große finanzielle Schwierigkeiten, aus denen ihn sein Bruder befreien musste. Wie nur wenige seiner Vorgänger starb Vespasian 79 n. Chr. eines natürlichen Todes. Nachfolger und würdiger Erbe wurde sein Sohn Titus.
Vespasian wurde, wen wundert es, aufgrund seiner Fähigkeiten als Feldherr und Staatsmann sowie seiner Integrität und natürlich nicht zuletzt wegen seines großen Erfolges (die Götter waren mit ihm…) verehrt, ja angebetet. Rom sah in ihm nach den maßlosen Exzessen Neros, dem wirtschaftlichen Niedergang Roms und den Kriegswirren nach Neros Tod den Heilsbringer schlechthin. Sein Titel zu Lebzeiten war „ein Sohn eines Gottes“. Seine Kaiserherrschaft bringt der Welt Frieden und Ordnung. Diese „Freudennachrichten“ nennt der jüdische (in römischen Diensten stehende) Geschichtsschreiber Flavius Josephus „Evangelien“.
Wer also war zu verehren: Vespasian oder Jesus, der Christus? Diese Frage stellte sich den Täuflingen des Markus ganz real und drängend. Hier der erfolgreiche, beliebte Kaiser – dort der „Niemand“, schmählich von römischer Hand zum Tode verurteilt und hingerichtet. Hier das aufblühende Rom – dort das besiegte Jerusalem. Hier das wiederaufgebaute Kapitol als sakraler Mittelpunkt – dort der Tempel, sakraler Mittelpunkt der Juden, in Schutt und Asche. Es gab für die Täuflinge keinen Kompromiss: Als Christ (wie als Jude) verehrte man als Gott Jahwe allein.
Markus beantwortet die Frage auf faszinierende Weise. So wie Vespasian im Jüdischen Krieg in Galiläa seine Truppen sammelt, um von Cäsarea Philippi nach Jerusalem aufzubrechen, so sammelt Jesus seine Jünger in Galiläa, um dann (ebenfalls von Cäsarea Philippi!) nach Jerusalem aufzubrechen. Rein äußerlich führt der Weg des einen zum Triumph, der Weg des anderen endet in einer Niederlage. Aber an drei entscheidenden Stellen, nämlich am Anfang, in der Mitte und am Ende des Evangeliums, lässt Markus keinen Zweifel, wer der eigentliche Sohn Gottes ist:
■ Nach Jesu Taufe blitzt plötzlich eine andere Wirklichkeit auf. Der Himmel öffnet sich und wir hören die Stimme des Allerhöchsten:Dies ist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen(Mk 1,11). Damit sind die Täuflinge des Markus von Anfang an eingeweiht: Jesus, nicht Vespasian, ist der geliebte Sohn Gottes.
■ Am Ende des Evangeliums tut sich noch einmal der Himmel auf, symbolhaft beschrieben durch den Vorhang vor dem Allerheiligsten, dervon oben an bis unten auszerreißt. Diesmal (und das ist der Höhepunkt) ist es nicht die Stimme Gottes, die wir hören, sondern die Stimme des römischen Hauptmanns:Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!(Mk 15,39). Man muss sich das einmal vorstellen: Auf die Frage „Vespasian oder Jesus?“ antwortet ausgerechnet ein römischer Hauptmann mit: „Dieser Mensch ist wahrlich Gottes Sohn.“
Der Gegensatz zwischen Vespasian und Jesus zieht sich durch das ganze Evangelium. Wir werden ihm auf Schritt und Tritt begegnen. Einen Überblick gibt die folgende Gegenüberstellung. Sie wird in der Einzelauslegung der Markustexte näher erhellt werden.
0.4 Aufbau und Struktur des Markusevangeliums
Markus inszeniert seine Christuserzählung wie ein Drama in drei Akten. Hauptschauplatz des ersten Aktes ist der See Genezareth, insbesondere Kapernaum. Dort hat der Rabbi Jesus (und heimliche Messias) sein Lehrhaus (vgl. Mt 4,13). Hier lehrt er im Haus (Mk 2,1f.), vor dem Haus (Mk 1,33), in der Synagoge (Mk 1,21) und unten am See (Mk 3,7). Hier am See beruft er seineersten Jünger (= Schüler). Von hier aus unternimmt er Lehrexkursionen in umliegende Orte (Mk 1,38f.). Seine Lehre bringt Menschen zurecht: (Geistlich) Blinde werden sehend, (geistlich) Taube verstehen plötzlich. Besessene (= von falschem Denken befangen) werden „vernünftig“ (Mk 5,15) und beginnen ihrerseits, das Evangelium weiterzutragen (Mk 5,19f.). Aussätzige (= aus der Glaubensgemeinschaft ausgestoßene Sünder) erfahren durch Jesus Vergebung und neue Teilhabe am Volk Gottes (Mk 1,40ff.).
Neben Kapernaum und dem See taucht schon hier im ersten Bild „der Berg“ als wiederkehrendes Thema („Topos“) auf. Jesus besteigt ihn nach der Speisung der 5000, um zu beten (Mk 6,46). Damit beschreibt Markus seine besondere Nähe zu Gott. Die Jünger sind schon längst mit dem Boot unterwegs. „Von oben“, wie Gott selber, sieht Jesus die Seinen. Im Nu ist er bei ihnen, tröstet und ermutigt sie und stillt den Sturm.
Erwähnenswert für diesen ersten Akt sind Jesu Exkursionen in das heidnische Umfeld. Das würde beim irdischen Jesus überraschen, der sich nur zu den Kindern Israels gesandt fühlte. Der auferstandene Christus dagegen gehört bereits zu einer Zeit nach den ersten Heidenbekehrungen und nach der großen Auseinandersetzung im Jüngerkreis, ob Heiden beschnitten werden sollten, um Christen sein zu können. Der Auferstandene bewegt sich deshalb zwanglos zwischen jüdischem und heidnischem Gebiet. Die große Frage nach Reinheit/Unreinheit im jüdischen Kultus lässt Markus den Auferstandenen kurz und bündig beantworten:Seid ihr auch so unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. – Damit erklärte er alle Speisen für rein(Mk 7,18-19).
Der zweite Akt könnte betitelt werden „Auf dem Weg“. Es ist, wie wir sahen, ein Weg von Cäsarea Philippi nach Jerusalem, der den Siegeszug Kaiser Vespasians nachbildet. Auf einer anderen Ebene ist es der Weg vom Berg der Verklärung zum Garten Gethsemane, von der höchsten Machtdemonstration zum Tiefpunkt großer Einsamkeit und Todesfurcht. Es ist ein Leidensweg. Und im Sinne der Jüngerunterweisung ist es ein Lehrstück. Jesus (der Auferstandene) erklärt den Täuflingen des Markus, warum der Messias leiden undsterben musste, und warum der Weg der Nachfolge immer auch ein von Verfolgung und Anfeindung geprägter Leidensweg ist. Und ein Weg des Dienens, nicht des Herrschens (Mk 12,28-34).
Während im ersten Bild Gott selber Jesus als seinen Sohn proklamiert, kommen im zweiten Bild die himmlischen Autoritäten Mose und Elia dazu (Mk 9,4) und (stellvertretend für die Jünger und alle Christen) Petrus. Es klingt tatsächlich wie eine Tauffrage, die Jesus seinen Jüngern stellt:Wer, sagt ihr, dass ich sei?–Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus(Mk 8,29).
Das dritte dramaturgische Bild bewegt sich zwischen zwei Bergen: dem Ölberg und dem Tempelberg. Dazwischen, im tiefem Kidrontal, liegt der Garten Gethsemane. Den Ölberg nannte man zu biblischen Zeiten den „messianischen Berg“. Von hier aus sollte der Messias nach Jerusalem einziehen und vorher im Kidrontal Gericht halten (Sach 14,4). Markus erzählt diese Geschichte folgerichtig so, dass Jesus vom Ölberg her in Jerusalem einzieht.
Die (erfolglose) „Einnahme“ Jerusalems durch Christus beschreibt Markus in drei Wellen. Beim ersten Versuch (Mk 11,1-11) wird Jesus von einem Teil der Bevölkerung willkommen geheißen. Die geistliche Elite (Sadduzäer, Priester) schweigt. – Beim zweiten Versuch reinigt er den Tempel, um aus ihm ein „Bethaus für alle Völker“ zu machen. Die geistliche Elite fasst daraufhin den Beschluss, Jesus zu töten (wie schon die Pharisäer und Schriftgelehrten in Galiläa). Mit dem Gleichnis vom verdorrten Feigenbaum beschreibt Markus den Tempel als „frucht-los“, als geistlich tot. Darin war er sich mit vielen Zeitgenossen Jesu einig – u. a. mit der Qumran-Sekte, die den Tempel ablehnte und in Qumran eine eigene Kultstätte betrieb. Der dritte Versuch ist geprägt von Reden Jesu und damit von der theologischen Auseinandersetzung mit dem religiösen Establishment, das Jesu Vollmacht nicht anerkennt (Mk 11,27ff.), das verantwortungslos mit dem ihm Anvertrauten umgeht (Mk 12,1ff.), das Frömmigkeit nur heuchelt (Mk 12,13ff.), das nicht an die Auferstehung glaubt (Mk 12,18ff.), das zwar das Gebot Gottes gut kennt (Mk 12,28ff.), aber sich nicht daran hält (Mk 12,38ff.) und das sich vomGlauben einer armen Witwe beschämen lassen muss. Dreimal zieht der Messias vom Ölberg zum Tempel, dreimal kehrt er unverrichteter Dinge zurück. Der vierte Gang ist ohne Wiederkehr.
Vor dem Ende Jesu, das wie eine Kaiserkrönung beschrieben wird (wieder in Parallelität zu Kaiser Vespasian), folgt mit dem 13. Kapitel eine umfangreiche Rede über das Ende des Tempels. Dieser war zur Zeit des Markus ja schon zerstört, so dass er die näheren Umstände gut und relativ genau beschreiben kann. Er erwähnt sogardas Gräuelbild der Verwüstung,ein Bild, das das Buch Daniel im Alten Testament gebraucht (Dan 9,24-27) und das Markus auf ein Fahnenheiligtum bezieht, das die Römer nach der Zerstörung des Tempels im ehemaligen heiligen Bezirk errichtet hatten.
Nun waren seit der Zerstörung des Tempels wieder einige Jahre ins Land gegangen und der Messias der Endzeit war immer noch nicht gekommen. Deshalb führt Markus in Kap. 13 seine Vision über die Zerstörung des Tempels hinaus, beschreibt sie jetzt aber mit den üblichen allgemeinen, vagen Bildern solcher Visionen (Sonnenfinsternis, ins Wanken kommende Himmelskräfte …). Seine Botschaft wird ganz offensichtlich von der geschichtlichen Realität gedeckt: Die Zerstörung des Tempels ist noch nicht das Ende dieser Welt. Es gilt, weiterhin zu warten und wachsam zu sein.
Jesu Kreuzigung beschreibt Markus in Ermangelung historischer Fakten ausschließlich mit Bildern, die er dem Alten Testament entnimmt. Dazu gehört auch das Psalmwort (Ps 16,10), das in Bezug auf David sagt, dass Gott seinen Heiligen nicht die Grube sehen lassen wird. Dieses Wort dürfte für Markus den Anstoß gegeben haben für das Bild vom leeren Grab. Auch dieses Bild ist vor Markus unbekannt. In der Christenheit ist es das Bild für Jesu Auferstehung schlechthin geworden (vgl. den Beitrag „Das leere Grab“, 16.5).
Hier eine tabellarische Gegenüberstellung der drei Teile der markinischen Erzählung:
GALILÄA
Auf dem WEG
JERUSALEM
Mk1,14-8,26
Mk 8,27-10,52
Mk 11,1-16,8
← Prolog: Johannes und Christus Mk 1,1-13
sekundärer Markusschluss Mk 16,9-20 →
Taufe Jesu und Gottesproklamation
Christusproklamation durch Petrus
"Taufe” am Kreuz und Proklamation des römischen Hauptmanns
Berg der Jüngerberufung ( Mk 6,46) /
Sturmstillung (Mk 6,48)
Berg der Verklärung Jüngerversagen (Mk 9,14ff.) Proklamation Jesu (Mk 10,38)
Zwischen Ölberg („messianischer“ Berg) und Tempelberg Gethsemane + Verrat Jüngerflucht
See Genezareth Jüdische Seite – Heidnische Seite
Von Cäsarea Philippi nach Jerusalem „Bereitet den Weg des Herrn“
Zwischen Bethanien und Tempel
Zwischen dem Haus Simons des Aussätzigen (Aufnahme) und dem Hohepriester (Ablehnung)
Offenbarwerden des Herrscheranspruchs Jesu durch Lehre und Mission (Sammlung von Nachfolgern/Jüngern) Offenbarwerden des Herrscheranspruchs Vespasians durch Taten u. Wunder (Sammlung der unterstützenden Truppen und Befürworter im Senat und im römischen Reich
Leidensweg Jesu vs. Siegeszug Vespasians
Eroberung Jerusalems und Zerstörung des Tempels durch Vespasian (bzw. seinen Sohn Titus) „Eroberung“ Jerusalems und „Niederreissen des Tempels“ durch Christus
Kreuzigung / Krönung zum „König der Juden“ Todessalbung vs. Königssalbung
Schädelstätte (göttliches Machtfeld) vs. Kapitol (weltliches Machtfeld)
Vespasian: Erbeutung des Tempelvorhangs Christus: Eroberung des Weltalls (auf dem „zerissenen“ Vorhang aufgestickt)
Dramaturgisches Bild: See – Lehrhaus – Synagoge – Berg
Dramaturgisches Bild: Auf dem Weg (vom Berg der Verklärung zum Tiefpunkt Gethsemane)
Dramaturgisches Bild: Ölberg – Garten Gethsemane – Tempelberg
Blindenheilung 1 Sehen lernen (ein Prozess), Mk 8, 22ff.
Jüngerunterweisung auf dem Leidensweg
Blindenheilung 2
…folgte ihm auf seinem Weg nach,Mk 10ff.
0.5 Das Markusevangelium als Jüngerunterweisung
Das Markusevangelium ist kein Brief an eine einzelne Gemeinde, auch kein Rundschreiben an mehrere Gemeinden. Da seine Bildsprache (wie in noch extremerer Form die Offenbarung) der Entschlüsselung bedarf, muss eine Situation vorausgesetzt werden, in der ein Lehrer seinen Schülern die Bildsprache des Markus näherbringt und sie ihnen gleichzeitig entschlüsselt. Diese Weise des Vorgehens wird im Markusevangelium selber beschrieben, nämlich in Mk 4,10-12, wo Jesus (das ist, wie wir noch sehen werden, immer der Auferstandene) seinen Jüngern seine Allegorien entschlüsselt. Zusammenfassend heißt es in Mk 4,34: „Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen; aber wenn sie allein waren, legte er seinen Jüngern alles aus.“
Es gibt gute Gründe dafür, das Markusevangelium als Jüngerunterweisung zu verstehen, als eine pädagogisch besonders wirkungsvolle Katechese, vermutlich eine Taufunterweisung für Menschen, die entweder kurz vor der Taufe standen oder nach der Taufe in der christlichen Lehre unterwiesen wurden. Einen Hinweis darauf gibt uns Lukas, der sein Evangelium an einen gewissen „Theophilus“ richtet. Das heißt zu Deutsch nichts anderes als „Gottesfreund“. Lukas schreibt also an einen noch unerfahrenen „Bruder in Christus“, oder allgemeiner: an Menschen, die Christus lieb gewonnen haben und in der christlichen Lehre unterwiesen werden möchten.
Die Fixierung dieser Jüngerunterweisung um die Zeit ihrer Taufe lässt sich davon ableiten, dass das Markusevangelium auf drei Säulen ruht, die alle mit der Taufe im Zusammenhang stehen.
(1) Da ist zunächst die Taufe Jesu, mit der das Evangelium beginnt: Hier wird Jesus von Gott selber als sein geliebter Sohn proklamiert.
(2) Eine zentrale Frage der Jünger zur Zeit des Markus wird genau in der Mitte des Evangeliums beantwortet: Welche Jünger dürfen zur Rechten und Linken Jesu sitzen? In anderen Worten: Gibt es unter den Jüngern ein Primat, gibt es Präferenzen? Die Frage war deshalb so wichtig, weil sich zur Zeit des Markus bereits Folgegemeinschaften um einzelne Apostel gebildet hatten (vgl. 1. Kor. 3,5-8). Gibt es also Lieblingsjünger, wie das Johannesevangelium andeutet? (Vgl. Joh 13,23ff., Joh 19,26ff. u. a.) Auf den diesbezüglichen Wunsch der Jünger (Mk 10,37) fragt Jesus:Könnt ihr euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde?– und meint damit seinen Kreuzestod, sein Martyrium. Bedenken wir, dass zur Zeit des Markus die Apostel bereits verstorben waren und dass Philippus, Stephanus, Petrus, Paulus, Johannes und andere bereits als Märtyrer verehrt wurden, und hören wir dann die Antwort Jesu:Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist.Damit lehnt Markus eine Bevorzugung eines Jüngers ab: eine deutliche Lehraussage.
(3) Schließlich, am Ende des Evangeliums, wiederholt sich das Taufgeschehen in der Kreuzigung. Diesmal ist es nicht Gottes Stimme, sondern die des heidnischen römischen Hauptmanns, die ausruft:Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen(Mk 15,39). Das Thema Taufe durchzieht, wie wir noch sehen werden, das ganze Markusevangelium. Äußerlich ist Jesu Weg von der Taufe des Johannes bis zur „Taufe“ am Kreuz ein Niedergang. Innerlich ist es ein Triumphzug, der in der Auferstehung seinen Höhepunkt findet.
Das Markusevangelium stellt als Jüngerunterweisung wichtige Fragen:
■ Waswillst du von uns, Jesus von Nazareth?(Mk 1,24 – Antwort im gleichen Vers:Du bringst den Menschen das Heil.)
■ Was bringt uns Jesus? (Mk 1,27 – Antwort im gleichen Vers: eine neue Lehre in Vollmacht)
■ Lästert Jesus nicht Gott?Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?(Mk 2,7 – Antwort in V.10:Der Menschensohn hat Vollmacht, Sünden zu vergeben auf Erden.)
■ Wie kann Jesus Tischgemeinschaft haben mit Sündern? (Mk 2,16 ff. – Antwort in V. 17: Jesus ist gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.)
■ Warum brauchen die Christen nicht zu fasten? (Mk 2,18, Antwort in V. 19: Weil sie bereits in der Gemeinschaft mit dem Messias leben)
■ Warum stellen sich Christen über den Sabbat? (Mk 2,24, Antwort in V. 28:Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat.)
Diese sechs Beispiele finden sich bereits in den ersten zwei Kapiteln des Markusevangeliums. Sie ließen sich um viele vermehren. Dazu kommen noch die Antworten, die das Markusevangelium auf Fragen gibt, die nicht ausdrücklich gestellt werden (vgl. die tabellarische Zusammenstellung im Anhang, 17.1).
Viele dieser Fragen entspringen offensichtlich eher der Jüngersituation zur Zeit des Markus als der zur Zeit Jesu. Insbesondere Fragen wie „Wer soll Jesus Christus verkündigen und wie?“ oder „Warum müssen wir das jüdische Gesetz nicht mehr halten?“ deuten auf die Situation der Christen zur Zeit des Markus. Er beantwortet sie in der Vollmacht des Heiligen Geistes – so wie der lebendige Herr es ihm mitteilt.
0.6 Sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht hören
Das Markusevangelium ist also eine verschlüsselte Jüngerunterweisung. Das, was Täuflingen über Glaubensfragen nahegebracht werden musste, wird so verklausuliert, dass der Außenstehende zwar Geschichten liest, ihre wahre Bedeutung aber nicht verstehen konnte – es sei denn, die Geschichten wurden durch Lehrer entschlüsselt und so verständlich gemacht. Dieses Vorgehenhatte einen aktuellen, nach vorne gerichteten Bezug und gleichzeitig einen theologischen, auf das Alte Testament bezogenen Sinn. Um mit Letzterem zu beginnen: Markus lässt Jesus sagen (Mk 4,11-12 und 33-34):
Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben; denen aber draußen widerfährt es alles in Gleichnissen, damit sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. […] Und durch viele solche Gleichnisse sagte er ihnen das Wort so, wie sie es zu hören vermochten. Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen; aber wenn sie allein waren, legte er seinen Jüngern alles aus.
Jesus zitiert hier Jes 6,9f.:
Und er sprach(Gott zu Jesaja):Geh hin und sprich zu diesem Volk: Höret und verstehet’s nicht; sehet und merket’s nicht! Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen noch hören mit ihren Ohren noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen.
Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der HERR wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehrverlassen sein wird.
Dieser Text aus Jesaja vermittelt den Eindruck, es ist Gott selber, der die Herzen verstockt. Das ist aber nur bedingt richtig. Man konnte einen solchen Satz erst rückblickend so sagen. Wenn die Tatsache des Verstocktseins einmal gegeben war, muss es Gott selber sein, der die Verstocktheit zulässt. Wir haben heute noch ähnliche Ausdrucksweisen. Wenn z. B. jemand ein Haus kaufen möchte, aber ein anderer den Zuschlag erhält, können wir sagen: „Es hat nicht sollen sein.Gott hat es nicht gewollt." Wir hätten es ja gerne anders gehabt, aber Gottes Willen müssen wir akzeptieren: Er hat es nicht zugelassen. – Ähnlich können wir diesen Jesajatext verstehen: Einem Volk wird die Umkehr gepredigt, aber es verweigert sich der Botschaft. Im Rückblick kann Jesaja sagen: Es hat nicht sollen sein. Gott hat es (noch) nicht gewollt. Er hat das Herz des Volkes verstockt.
Jesaja schließt an diese Klage über die (geistliche) Blindheit und Taubheit eine prophetische Vision an: Die Zeit wird kommen, wenn das Volk umkehrt, wenn es gesund wird, wenn es wieder auf Gott schaut und hört. Wann? Wenn die Städte verwüstet werden, wenn Gott die Menschen weit wegtut, wenn das Land verlassen sein wird.
Markus zieht hier eine Parallele zu seiner Situation: Der Tempel ist nach den jüdischen Aufständen gegen Rom (wie damals bei Jesaja) zerstört, das Volk Israel aus Jerusalem vertrieben. Markus denkt an die Missionsbemühungen eines Paulus: Wie er in den Synagogen gepredigt hat, wie seine Botschaft auf taube Ohren stieß. Wie er in den Synagogen immer wieder angefeindet wurde. Das Jesajawort schien ganz auf ihn zu passen: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Aber es wird verstockt und taub und blind sein. Vielleicht hat ja auch Paulus dieselbe Frage gestellt wie Jesaja: Herr, wie lange? Und nun, zur Zeit des Markus, nach dem verlorenen Krieg gegen Rom, sind die Städte Israels wüst und die Häuser ohne Menschen. Vielleicht bezieht sich die Vision des Jesaja auf seine Zeit? Hatte Israel Jesus nicht verstoßen? War es nicht ihm gegenüber taub und blind gewesen? Vielleicht kommt jetzt nach der neuerlichen Zerstörung des Tempels die Zeit, in der Israel neu erwacht und umkehrt zu seinem Gott?
Markus hätte diese Gedanken nun aufschreiben können. Dann wären Sätze entstanden ähnlich denen im letzten Absatz. Aber Markus kleidet diese Gedanken in Geschichten.Er lässt Jesus, jetzt der Auferstandene, der Allmächtige, nochmals durch Galiläa wandern.Wie Paulus wird er von den Pharisäern in den Synagogen angefeindet, ja mit dem Tode bedroht (Lk 4,29).Und Jesus sah sie an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz(Mk 3,5).
Das also ist der Blickwinkel, aus dem heraus das Markusevangelium gesehen werden muss. Markus geht es nicht darum, das reale Leben des irdischen Jesus nachzuerzählen. Davon weiß er sehr wenig (vgl. den Beitrag „Der historische Jesus“, Kap. 18 im Anhang) und es ist ihm nicht wichtig (hier folgt er Paulus:Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr(2Kor 5,16). – Markus entwickelt vielmehr eineTheologie des auferstandenen Christus. Dadurch dass er Christus noch einmalin Galiläa lehren, seine Jünger auf dem Weg nach Jerusalem unterweisen und seine Heilsbedeutung in Kreuz und Auferstehung kommentieren lässt, vermittelt er seinen Täuflingen (vgl. den Abschnitt „Das Markusevangelium als Jüngerunterweisung“), wer dieser „unbedeutende“ galiläische Rabbi (Joh 1,46) in Wirklichkeit war.
Gleichzeitig setzt sich Markus mit der Frage auseinander, warum diese Herrlichkeit Gottes in Christus zu Lebzeiten Jesu nicht erkannt werden konnte. Seine Antwort: Weil es Gott nicht wollte. Denn: Nach außen ist ja nur ein Rabbi aus Kapernaum zu sehen, der lehrt und Umkehr predigt. Der Anspruch, der Messias zu sein, wird erst nach Jesu Auferstehung öffentlich. Die beschriebenen Wunder, Dämonenaustreibungen und Totenauferweckungen sind literarische Bilder, mit denen erst Markus rückblickend beschreibt, wer sich hinter der Fassade des Rabbis in Wahrheit verbirgt. Das Herz der Pharisäer und der Schriftgelehrten aber bleibt „verstockt“, weil sie die Lehre und Ernsthaftigkeit dieses Rabbis als Bedrohung ihrer Identität verstehen. Auch das Herz der Jünger bleibt „verstockt“, denn auch sie begreifen erst im Rückblick die wahre Natur Jesu.
Hier liegt die tiefere Begründung des sogenannten „Christusgeheimnisses“ bei Markus. Das Schweigegebot ist sein literarisches Mittel zu erklären, warum der Rabbi nicht als Messias erkannt werden wollte. Wenn der historische Jesus die Zeichen und Wunder getan hätte, von denen Markus berichtet, dann wäre die Forderung der Pharisäer nach einem Zeichen (Mk 8,11ff.) völlig unverständlich: Wie viele Zeichen hätte er denn noch tun sollen neben den Krankenheilungen, Dämonenaustreibungen, Brotvermehrungen, Sturmstillungen, Aussätzigenreinigungen und Totenerweckungen? Das alles geschieht aber erst zwei Generationen später in den Erzählungen des Markus. Und so verbietet sein Christus den „sehenden“ und „hörenden“ Menschen und Mächten, also denen, die ahnen, hoffen oder sicher sind, dass er der Messias ist, die Proklamation seiner Gottesherrlichkeit bis nach seiner Auferstehung.
TEIL I: GALILÄA
1Die Zeit ist reif – in Galiläa kommt Gottes Messias zu den Menschen
Markus 1, 1-13
1 Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes.
2 Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: »Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll.« 3 »Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben!« (Mal 3,1; Jes 40,3): 4 Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. 5 Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. 6 Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig 7 und predigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich; und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. 8 Ich taufe euch mit Wasser; aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
9 Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. 10 Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. 11 Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. 12 Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste; 13 und er war in der Wüste vierzig Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm.
1.1 Johannes der Täufer und sein Verhältnis zu Jesus dem Christus
Jesu Taufe und Kreuzigung gehören zu den ganz wenigen historisch gesicherten Ereignissen im Leben des Rabbi Jesus von Nazareth. Diese Ereignissebilden Anfang und Ende des Markusevangeliums. Wie wir schon gesehen haben (Einleitung 0.5), hat Markus auch die Kreuzigung als „Taufe“ verstanden: So wie im Untertauchen in der Taufe der alte Adam (der alte Mensch) stirbt und im Auftauchen in einen neuen Adam verwandelt wird, so wird nach Jesu Tod am Kreuz in seiner Auferstehung seine wahre Natur als Sohn Gottes erkennbar. Taufe und Kreuzigung also sind die Eckpfeiler, zwischen die Markus sein Evangelium spannt.
Warum können wir so sicher sein, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde? Weil es keinen Grund gab, ein solches Ereignis zu erfinden. Im Gegenteil: Die Taufe Jesu brachte die urchristliche Gemeinde in große Erklärungsnöte.
Erste Problematik für die ersten Christen (die an Jesus als den Messias glaubten): Warum musste der Messias eine „Taufe zur Vergebung der Sünden“ durchlaufen? Hätte er nicht schon sündlos zur Welt kommen müssen?
Zweite Problematik: Warum musste der Messias überhaupt getauft werden? Es sollte doch direkt vom Himmel gesandt werden?
Dritte Problematik: Wenn Jesus der Messias war – warum ist ihm Johannes nicht sofort nach seinem Auftreten nachgefolgt? (Nach Mt 11,2 schickt er sogar einige seiner Jünger zu Jesus, um ihn zu fragen, ob er wirklich der Messias sei. Nach Mt 9,14 ff. diskutieren Jünger des Johannes mit Jesus. Die Bewegung bestand also über die Enthauptung des Johannes hinaus.)
Vierte Problematik: Johannes wurde von einigen seiner eigenen Jünger als Messias gesehen. Es gibt eine „Kindheitsgeschichte“ des Johannes, die kunstvoll in das Lukasevangelium eingewoben worden ist. Danach hat Johannes den Heiligen Geist bereits im Mutterleib und nicht erst bei einem Bekehrungserlebnis erhalten3. Macht ihn das nicht Jesus überlegen?
Jesu Taufe war also für die ersten Christen ein „Ärgernis“, mit dem sie sich auseinandersetzen mussten. Ihre Antwort war eine zweifache:
(a) Jesus war nicht erst seit seiner Taufe von Gott berufen. Gott hatte ihn nicht erst bei der Taufe „gezeugt“, sondern schon bei seiner Geburt4.
Anmerkung:
Darum änderte man konsequenterweise das BibelwortDu bist mein lieber Sohn, heute habe ich dich gezeugt“zuDu bist mein lieber Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe.(Lk 3,22) – Später, unter griechischem Einfluss, als man unter „Sohn“ nicht mehr „Israel“ verstand, sondern einen Gottessohn nach dem Vorbild griechischer Mythologie, wurde die Frage nach dem Zeitpunkt der „Geisteinwohnung“(in ihm wohnte Gottes Fülle leibhaftig,(Kol. 2,9) gegenstandslos, weil er ja als ewiger Sohn Gottes schon immer und von Anfang an eins war mit dem Vater und dem Geist.
(b) Johannes war also trotz „Geistbegabung“ vom Mutterleib an nicht der Messias, sondern dessen Wegbereiter. Dazu konnte man anschaulich die Bibelstellen im Alten Testament verwenden, die von Gott und von seinem Messias, seinem Wegbereiter, handelten. Denn wenn Jesus immer schon Gott war, konnte Johannes Wegbereiter seines irdischen Auftretens sein, konnte man die zentrale alttestamentliche Bibelstelle Jes. 40,3 umdeuten und Johannes zuordnen (s.u.).
Alle vier Evangelien investieren von Anfang an viel Energie in die Frage nach dem Verhältnis zwischen Johannes und Jesus. Offensichtlich bestand an dieser Stelle noch viel Klärungsbedarf, der seinen Widerhall auch in der Apostelgeschichte findet (Apg 1,22; 10,37-38; 18,25; 19,1 ff.) (vgl. auch Mt 11,11-15). Jedenfalls war es so, dass die Johannes-Bewegung und die Jesus-Bewegung viele Jahre nebeneinander bestanden (vgl. dazu auch Joh 4,1-2).
Auch das konnte man nicht erfinden, weil es dem Versuch widerspricht, Johannes „nur“ zum Vorläufer Jesu zu machen. Mit der Hinrichtung des Johannes nahm sein Einfluss ab, der von Jesus, der ab dieser Zeit zu lehren begann, nahm zu. Mehrere Jünger des Johannes wechselten zu Jesus über, andere versuchten die Tradition des Johannes hochzuhalten (vgl. nochmals Apg 19,1 ff.). Weil Jesus „aus der Schule“ des Johannes kam, von ihm getauft wurde und Jünger des Johannes zu ihm wechselten, musste das Verhältnis dieser beiden Lehrer grundsätzlich (und vor allem positiv) bedacht werden. Die Antwort der Christen: Johannes war groß, Jesus war größer. Die Taufe Jesu wurde heruntergespielt (bei Mt sagt Johannes der Täufer:Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir?Worauf Jesusantwortet:Lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.(Mt 3,14-15); bei Johannes wird die Taufe Jesu bereits „verschwiegen“, sie kann aus Joh 1,31-34 nur indirekt und in Kenntnis der synoptischen Evangelien erschlossen werden.
Alle vier Evangelien beginnen mit dem Verhältnis zwischen Johannes dem Täufer und Jesus bzw. mit dem Verhältnis der beiden Täuferbewegungen. Alle Evangelien versuchen die Bewegungen zu harmonisieren, indem sie Johannes als Vorläufer Jesu einordnen und die Taufe Jesu herunterspielen. Sie benutzen in ihrer Argumentation vor allem Jes 40, wo Gott dem Volk im Exil seine neuerliche Zuwendung ankündigt.Er kommt gewaltigheißt es in Jes 40,10. Seine heilsame Gegenwart wird von einer nicht näher bestimmten „Stimme“ angekündigt:
Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott(Jes 40,3). Diese Stimme wird in den Evangelien Johannes dem Täufer zugeordnet (bei Jesaja wird man aus dem Zusammenhang eher Gottes Stimme annehmen). In Jes 42 wird dann folgender Vers auf Jesus bezogen:Siehe, das ist mein Knecht … an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird dasRecht unter die Heiden bringen(Jes 42,1). Aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass der „Knecht“ Israel ist, das Volk, das vor Gott neue Gnade gefunden hat (vgl. Jes 41,8-9). Der Umgang mit diesen Stellen aus Jesaja 40 ff. (ihre Gleichsetzung mit Johannes und Jesus) zeigt wieder einmal, wie wenigden Evangelisten an einer (nach unseren heutigen Maßstäben) „angemessenen“ Textinterpretation gelegen ist. Entscheidend ist wieder nicht das Gesagte, sondern das Gemeinte: Jes 40 ff. dient zum „Schriftbeweis“ für Jesus als Messias und für Johannes als seinen Wegbereiter.
1.2 Jesu Taufe (Johannestaufe und Geisttaufe)
Jesus wurde also von Johannes am Jordan getauft. Die Johannestaufe war etwas Besonderes. Sie war so besonders, dass der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius es für wert erachtete, sie zu beschreiben. Er lobt Johannes in höchsten Tönen („… sie fanden höchstes Gefallen am Hören seiner Worte“, Altertümer 18). Und die Taufe selber beschreibt er so: „… denn so werde die Taufe für Gott angenehm sein, wenn sie sie nicht gebrauchten zur Sühnung irgendwelcher Sünden, sondern zur Heiligung des Leibes.“ (ebda.)
Vor Johannes gab es Reinigungsbäder und Waschungen. Es war ein „Säubern“ von Unreinheit und Sünde. Diese Reinigungen wurden regelmäßig und immer wieder vollzogen. Die Taufe des Johannes dagegen war ein einmaliger Akt. Es ging nicht um das Abwaschen von Unreinheit und Sünde (begangene Verfehlungen), sondern um „Heiligung“, um grundsätzlichen Sinneswandel, um ein bewusstes Sich-Gott-zur-Verfügung-Stellen. In anderen Worten: Es wurden nicht schlechte Taten abgewaschen, sondern eine neue, unumkehrbare Haltung in der Hinwendung zu Gott proklamiert. Noch einfacher ausgedrückt: Mit dem Taufgebot lud Johannes Menschen ein, sich ab jetzt ganz in den Dienst und Willen Jahwes zu stellen.
Johannes hatte Jünger (= Schüler), war also ein Rabbi, ein Gelehrter. Wenn Markus ihn beschreibt alsgekleidet mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Hüfteund als jemand, der vonHeuschrecken und wildem Honiglebte, dann dürfen wir dies nicht allzu wörtlich nehmen (woher sollte Markus auch solche detaillierten Kenntnisse haben?). Er will schon hier, am Anfang seines Evangeliums, Johannes in Verbindung bringen mit Elia, dem Propheten (vgl. 2 Kö 1,8). Man glaubte nämlich, dass vor dem Messias Eliawiederkommen werde. So weist Jesus bei Markus immer wieder darauf hin: Johannes ist dieser erwartete Elia.
Johannes als Prophet oder Wüsteneremit? Es ist wahrscheinlicher, dass er, wie bei allen Rabbis üblich, ein Lehrhaus hatte. Sein Vater war nach dem im Lukasevangelium überlieferten Johannesbericht ein Priester. Johannes wird also die Tempelschule besucht haben und ein höchst gebildeter Gelehrter gewesen sein. So würde sich auch erklären, woher Jesus sein biblisches Wissen hatte, das es ihm erlaubte, mit Pharisäern und Schriftgelehrten auf Augenhöhe zu diskutieren: Als Täufling des Johannes wird er auch sein Schüler gewesen sein. Das würde auch den Respekt erklären, den Jesus Johannes gegenüber bringt: Erst nachdem Johannes gefangen genommen wird, beginnt Jesus sein öffentliches Wirken (Mk 1,14).
In Mk 1,7-8 lässt Markus Johannes sagen:Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich(= von Gott mit mehr Macht ausgestattet) …Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.Und schon in den nächsten Versen lässt Markus dieses Wort Wirklichkeit werden. Denn: „Es kommt einer …“ und dieser ist Jesus von Nazareth. Er wird von Johannes getauft, er gibt sich damit, wie wir gesehen haben, Gott ganz hin, er proklamiert öffentlich seine Zuwendung zu Gott.
Und nun geschieht etwas, was noch nie bei einer Johannestaufe geschah: Plötzlich öffnet sich der Himmel, und auf dieProklamationJesu hören wir als Antwort und gewissermaßen alsGegenproklamationdie Stimme Gottes:Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen(Mk 1,11). Gottes Geist5 kommt herab auf Jesus (wörtlich:herab in ihn6),und so geschieht an Jesus nicht nur die Johannestaufe, sondern die von Johannes vorhergesagte Geistestaufe. Jesus empfängt die Geistestaufe und wird so dazu legitimiert, seine Jünger mit Heiligem Geist zu taufen (vgl. Joh 20,22: „Er blies sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist“). Die Geistestaufe ist also nach markinischemVerständnisdie Antwort und Bestätigung Gottesauf die Entscheidung des Jüngers zur Haltungsänderung („Buße“) und dauerhaften Hingabe an Gott.
Es geht in der Geistestaufe deswegen nicht in erster Linie – vielleicht auch gar nicht – um das Empfangen geistlicher Gaben. Es geht umVergewisserung:Dein Geist gibt Zeugnis unserem Geist(Rö 8,16), schreibt Paulus. Wenn die Johannesjünger in Ephesus sagen:Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt(Apg 19,2), dann sagen sie damit: Wir haben zwar unser Leben Jahwe gewidmet und sindauf die Taufe des Johannes getauft(Apg 19,3), aber dass Gott uns antwortet und so unsere Entscheidung bestätigt, das haben wir nicht erlebt. Diese Vergewisserung und Bestätigung erfahren sie, nachdem ihnen Paulus die Hände auflegt. Die Geistestaufe ist so die Erfahrung der Annahme durch Gott, wie sie Jesus in Mk 1,11 erfährt.
1.3 Versuchung (Wüstenwanderung), neuer Adam
Wie wir noch an anderen Stellen sehen werden, hatte die Zeit Jesu und das aramäisch denkende Urchristentum eine andere Vorstellung des Begriffs „Sohn“ als wir heute. Der Sohn Gottes war (im biblischen Sprachgebrauch) das Volk Gottes. Wenn es in Jer 31,9 z. B. heißt:Ephraim ist mein erstgeborener Sohn,dann ist keine Einzelperson gemeint, sondern ein Stamm. Wenn Hosea (11,1) Jahwe sagen lässt,Ich rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten,dann ist wiederum kein Individuum gemeint, sondern das Volk, das Gott aus der Sklaverei ruft. In diesem Sinn versteht Markus Jesus den Christus als Sohn Gottes: Er ist das neue Volk, das sich Gott erwählt. Er (und seine geistlichen „Nachfahren“) bilden den neuen Stamm, das neue Israel, das wie ein Trieb (ein „Reis“, Jes 11,1) aus dem alten, todgeweihten Stamm hervorgeht. Deshalb kann Matthäus Gott über Jesus ausrufen lassen:Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen(Mt 2,15). Darum ist Jesus derErstlinggewordenunter denen, die entschlafen sind(1Kor 15,20):Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht.Jesus ist also der „neue Adam“, der Ursprung aller „neuen“ Menschen. Nicht das Volk Israel ist Gottes wahrer Sohn, sondern Christus und die Seinen.
Dieser Gedanke des neuen Adams findet sich in der Versuchungsgeschichte nach Jesu Taufe wieder. Gottes Geist führt ihn in die Wüste. So wie Gott das Volk Israel 40 Jahre lang in der Wüste versucht und erprobt hat, so durchläuft Jesus als Wurzel7 des neuen Volkes 40 Tage der Versuchung und Erprobung. Das Ergebnis ist der neue Adam. Nach jüdischer Anschauung waren die wilden Tiere vor dem Sündenfall noch zahm und die Engel dienten Adam8. In Jesus Christus als neuem Adam wird diese ursprüngliche Schöpfungsordnung wiederhergestellt (vgl. Jes 11, insbes. V. 6ff.). Der „alte“ Adam konnte der Versuchung nicht widerstehen, der „neue“ Adam widersteht in der Kraft des verliehenen Heiligen Geistes.
1.4 Herleitung und Vergegenwärtigung
In der Einleitung wurde schon deutlich, dass Markus in der Erzählung von Jesu Leben, Leiden und Sterben kontinuierlich zwei Ebenen im Blick hat. Die erste Ebene ist dieHerleitungdes (Heils-) Geschehens aus den jüdischen heiligen Schriften („Gesetz, Propheten, Schriften“ – das umfasst unser heutiges Altes Testament, sowie zusätzlich einige „apokryphe“ Schriften aus den ersten beiden Jahrhunderten vor Chr.). In diesen Schriften, so die Botschaft der Urchristenheit, ist das Geschehen zwischen Taufe und Kreuzigung/Auferstehung Jesu Christi bereits angelegt. In der Terminologie und Vorstellungswelt dieser Schriften wird Jesus als der Christus beschrieben. Nur im Lichte dieser Schriften erschließt sich für Markus und für die Christen vor ihm die Bedeutung seines Kommens, Lehrens, Leidens, Sterbens und Auferstehens. Vieles davon wird bereits in diesen ersten wenigen Versen am Anfang des Markusevangeliums thematisiert:
■ Jesus ist der Messias, der in den Schriften angekündigt wird (V.1).
■ Jesus ist der Sohn Gottes, das neue Israel, das sich Gott nach den prophetischen Schriften schaffen will (V. 1 und V. 12-13; vgl. Mal 3, Ps 2, Jes 53).