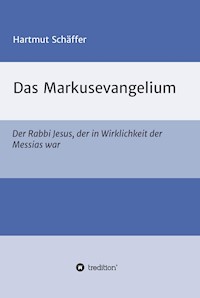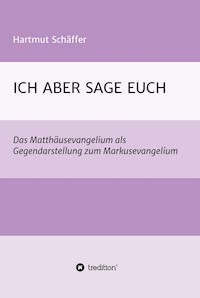
19,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Warum hat Matthäus eigentlich ein weiteres Evangelium geschrieben? Es gab ja schon eins. Und Matthäus "kopiert" es fast vollständig. Was bewegt ihn dazu, nur etwa zehn Jahre nach der Entstehung des Markusevangeliums eine eigene Version der Erzählung zu veröffentlichen? Der Petriner Matthäus und der Pauliner Markus haben grundverschiedene Anschauungen. Das können wir deshalb schlecht erkennen, weil wir (durch jahrhundertelange Konditionierung) gewohnt sind, die Evangelien in der Bibel zu harmonisieren. Wir sehen nicht mehr die Gegensätze, sondern ihre Harmonisierung durch die Partei, die sich durchgesetzt hat: die Pauliner. Ganz vieles von Markus übernimmt Matthäus unbeanstandet. Aber erst dort, wo er korrigiert und das markinische Profil verändert, erkennen wir beides: sowohl den Beweggrund für seine eigene Evangeliumsversion als auch, im Kontrast dazu, das Spezifische des Markusevangeliums.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hartmut Schäffer
„ICH ABER SAGE EUCH“
Das Matthäusevangelium als Gegendarstellung zum Markusevangelium
© 2021 Hartmut Schäffer
Umschlaggestaltung: tredition GmbH, Hamburg
Illustrationen und Tabellen: Hartmut Schäffer
Bibelübersetzung: Lutherbibel, revidiert 2017
© 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
978-3-347-38206-0 (Paperback)
978-3-347-38207-7 (Hardcover)
978-3-347-38208-4 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
SOLI DEO GLORIA
INHALTSVERZEICHNIS
0 Einleitung: „Ich aber sage euch“
1 Die Petriner und die Pauliner: „Und es entstand unter ihnen ein nicht geringer Streit“
1.1 Ebioniten, Nazarener, Äthiopier: ein Widerhall
1.2 Ein Mann wird bekehrt
1.3 Gottesfürchtige Menschen
1.4 Kultisches und ethisches Gesetz
1.5 Der Konflikt
1.6 Prüfsteine
2 Das Markusevangelium: „Ein Sohn eines Gottes“
2.1 Eine literarische Biographie
2.2 Die Erzählungen des Markus
2.3 Pseudepigraphie
2.4 Christus oder Vespasian
Tabellarische Gegenüberstellung
2.5 Aufbau und Struktur des Markusevangeliums
Struktur des Markusevangeliums (Überblick)
2.6 Das Markusevangelium als Jüngerunterweisung
2.7 Sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht hören
2.8 Jesus Christus – Heiler oder Heiland?
3 Das Matthäusevangelium: „Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet“
3.1 Die „Kindheitsgeschichten“ (Mt 1+2)
3.1.1 Abraham, David, Josef: Das Geschlechtsregister
Die Kindheitsgeschichten – struktureller Überblick
3.1.2 Schon bald werden Reiche fallen: Die Geburt Jesu
3.1.3 Großes wird klein und Kleines wird groß: Die Magier
Das Gesagte und das Gemeinte der Magiererzählung
3.1.4 Meine Barmherzigkeit ist entbrannt
3.1.5 Lass dein Schreien und Weinen: der Kindermord
3.1.6 Der Nazarener, Nazoräer, Nezeräer
3.2 Johannes der Täufer (Mt 3, 1-12)
Exkurs: Das Täuferevangelium des Lukas
3.3 Jesu Taufe und Versuchung (Mt 3,13 - 4,11)
3.3.1 Lass es geschehen
3.3.2 Einen Propheten wie mich
3.3.3 Brot aus Steinen
3.3.4 Wie wir wollen, nicht wie du willst!
3.3.5 Alle Reiche dieser Welt
Jesus – ein Prophet wie Mose (Überblick)
3.4 Das heidnische Galiläa (Mt 4,12-25)
3.4.1 Schauplatz
Galiläa in Mt 4,15 (Karte)
3.4.2 Berufung der „Gemeindeleitung“
3.4.3 Wirken Jesu (summarisch)
Matthäus bearbeitet Markus (Übersicht)
3.5 Die Bergpredigt (Mt 5-7)
3.5.1 Vollmächtige Lehre – aber welche?
3.5.2 Die Seligpreisungen
Die Wurzeln der Seligpreisungen im AT (Übersicht)
3.5.3 Gottes Weisungen ernst nehmen
Du sollst nicht töten
Du sollst nicht ehebrechen
Der Scheidebrief
Seid vollkommen wie Gott
Frömmigkeit, die Gott gilt
Das großzügige Auge
Ermahnungen
3.5.4 Exkurs: Die Bergpredigt „geerdet“ – Lukas‘ Feldpredigt
3.6 Zurück nach Kapernaum (Mt 8,1-8,17)
3.6.1 Heilung des Aussätzigen
3.6.2 Eine Fernheilung
3.6.3 Heilung der Schwiegermutter des Petrus
3.7 Zu den verlorenen Schafen Israels (Mt 8,1-9,35)
3.7.1 Ein Abstecher nach Gadara
3.7.2 „Sie brachten ihm einen Gelähmten“
3.7.3 Feiern mit Jesus
3.7.4 Israel, wach auf
3.7.5 Blind, stumm und besessen
3.7.6 Exkurs: „Sohn Davids“
3.8 Der Aposteldienst (Mt 9,36-11,24)
3.9 Die Weisheit spricht – ein Einschub (Mt 11,25-30)
3.10. Widerstand (Mt 12, 1-50)
3.10.1 Schaubrote und ein Kornfeld
3.10.2 Die verdorrte Hand
3.10.3 Siehe, das ist mein Knecht
3.10.4 Das Reich Gottes ist da
3.11 Maschal – Bildwort und Rätsel ( Mt 13)
3.11.1 Selig sind eure Augen
3.11.2 Taumel-Lolch
3.11.3 Senfkorn und Sauerteig
3.11.4 Abschluss und Anhang
3.12 Zurück bei Markus (Mt 13, 53-16,12)
3.12.1 Der Prophet im eigenen Vaterland
3.12.2 Das Martyrium des Täufers
3.12.3 Die Speisung der 5000
3.12.4 Jesus und der mutige Petrus auf dem Meer
3.12.5 Krankenheilungen in Genezareth
3.12.6 Gottes Wort und Menschenwort
3.12.7 Die kanaanäische Frau
3.12.8 Die Speisung der 4000
3.12.9 Welches Brot?
3.13 Leidensweg und Triumphzug (Mt 16,13-17,27)
3.13.1 Petrus, der Fels und erste Leidensankündigung
3.13.2 Verklärung auf dem Berg: Auf wen hören?
3.13.3 Heilung des mondsüchtigen Knaben
3.13.4 Zweite Leidensankündigung
3.13.5 Die Doppeldrachme
3.14 Grundwerte in der Nachfolge (Mt 18-20)
3.14.1 Erster Rangstreit der Jünger
3.14.2 Die Schwachen und das Himmelreich
3.14.3 Ewiges Leben
3.14.4 Gleicher Lohn für ungleiche Arbeit
3.14.5 Dritte Leidensankündigung und zweiter Rangstreit
3.14.6 Heilung der zwei blinden Bettler
3.15 Jerusalem: Willkommen beim Volk, abgelehnt von den Oberen (Mt 21-23)
3.15.1 Der triumphale Einzug
3.15.2 Die Tempelreinigung und der verdorrte Feigenbaum
3.15.3 Gleichnisse wider die Priester und Schriftgelehrten
3.15.4 Die Frage nach der Kopfsteuer
3.15.5 Die Sadduzäer und die Auferstehung
3.15.6 Das höchste Gebot
3.15.7 Messias und Urpriester
3.15.8 Scheltrede gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer
3.16 Die Apokalypse des Matthäus (Mt 24-25)
3.16.1 Missachtung des Gesetzes und Erkalten der Liebe
3.16.2 Dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht
3.16.3 Das Gleichnis vom getreuen und ungetreuen Knecht
3.16.4 Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen
3.16.5 Das Gleichnis von den Talenten
3.16.6 Das habt ihr mir getan
3.17 Passion und Auferstehung (Mt 26-28)
3.17.1 Was ist uns Jesus wert?
3.17.2 Das Abendmahl
3.17.3 Gethsemane
3.17.4 Jesus und Petrus im Palast des Hohenpriesters
3.17.5 Dreißig Silberlinge
3.17.6 Jesus vor Pilatus
3.17.7 Kreuzigung und Tod
3.17.8 Grab und Auferstehung
3.17.9 Exkurs: Das leere Grab
3.17.10 Zurück nach Galiläa
4 Nachwort: Mit bestem Wissen und Gewissen
5 Literaturverzeichnis
6 Abkürzungen biblischer Bücher
0 Einleitung: „Ich aber sage euch“
In der amerikanischen Komödie „Working Girl“ (1998) arbeitet Tess als ehrgeizige Assistentin ihrer Vorgesetzten Katherine in einem großen Wirtschaftsunternehmen. Tess sprüht von neuen Ideen und Plänen, die von Katherine regelmäßig abgelehnt werden. Während eines Krankenhausaufenthalts von Katherine muss Tess übernehmen. Dabei entdeckt sie, dass ihre Chefin ihre Idee vom Erwerb einer heruntergekommenen, aber vielversprechenden Radiostation heimlich kopiert hat und als ihre eigene ausgibt. Der Film hat seinen Höhepunkt in der Szene, in der Katherine, von Tess zur Rede gestellt, vor der gesamten Führungsriege gefragt wird, wie sie denn auf die Idee zu diesem Plan gekommen ist. Katherine muss passen, während Tess die Entstehung der Idee und die Entwicklung eines entsprechenden Wirtschaftsplans genau beschreiben kann. Katherine, die Tess als Lügnerin hingestellt hatte, ist nun selber des geistigen Diebstahls überführt.
Pläne und Aktionen schweben nicht im luftleeren Raum. Sie haben einen Hintergrund, und in der Regel wissen wir genau, welche Motive oder Probleme (oder Zufälle oder Geistesblitze) zu ihrer Entstehung geführt haben. Deshalb ist die Frage nicht so abwegig: Warum hat Matthäus eigentlich ein weiteres Evangelium geschrieben? Es gab ja schon eins. Und Matthäus „kopiert“ es fast vollständig. Er übernimmt die Grundstruktur des Markusevangeliums. Er erzählt das meiste fast wortwörtlich wie Markus. Er ergänzt einige Redekompositionen, er lässt Teilsätze aus, er stellt seinem Evangelium einige Kindheitsgeschichten Jesu voran. Was ist seine zugrundeliegende Absicht? Was bewegt ihn dazu, nur etwa zehn Jahre nach der Entstehung des Markusevangeliums eine eigene Version der Erzählung zu veröffentlichen?
Natürlich lässt sich die Frage noch in zwei Richtungen erweitern. Zum einen entstehen ja noch das Lukasevangelium, das Johannesevangelium sowie spätere Evangelien, die es nicht in den offiziellen Kanon der christlichen Bibel geschafft haben. Auch hier stellt sich die gleiche Frage: Was hat diese Autoren bewogen, über Markus und Matthäus hinaus eine Evangeliumsversion zu veröffentlichen?
Zum anderen ist die vielleicht noch spannendere Frage: Warum hat Markus ein Evangelium geschrieben? Vierzig Jahre nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung erscheint plötzlich in Rom (oder zumindest im westlichen Teil des römischen Reiches) zum ersten Mal eine Erzählung, die über Jesus ganz Unglaubliches, bis dahin nicht Vernommenes berichtet. Diese Erzählungen werden von Matthäus, Lukas, Johannes und anderen wie selbstverständlich übernommen, obwohl die lange vorher geschriebenen Briefe des Paulus und anderer Christen kein Wort über die sensationellen Berichte des Markus enthalten: Jesus heilt Schwerkranke, eigentlich unheilbare Menschen, ja, er weckt Tote auf, er geht über dem Wasser des Galiläischen Meeres1, er stillt einen Seesturm – das sind ja keine Kleinigkeiten. Trotzdem erfahren wir aus diesen früheren Briefen, die ja Jesus Christus zum Hauptthema haben, kein Wort über diese Wunder. Paulus kannte ja immerhin noch Petrus, Jakobus und Johannes persönlich. Aber von diesen Wundern weiß er offensichtlich nichts.
Unser Buch möchte diese Fragen beantworten. Und zwar so, wie in dem Film „Working Girl“: Es sollen einleuchtende Antworten sein. Antworten, die wir nachvollziehen können. Antworten, die sich keiner Kirchendogmatik, egal welcher Richtung, verpflichtet fühlen. Antworten, die wir als rationale, aufgeklärte Menschen nachvollziehen können.
Dass dieser Anspruch einlösbar ist, weiß ich, weil ich bereits die Beweggründe des Markus dargelegt habe. Sie fügen sich zu einem klaren, einleuchtenden Bild.2 Sie sollen im 2. Hauptabschnitt ausführlich rekapituliert werden. Denn einerseits ist das Matthäusevangelium ohne Markus nicht verständlich, andererseits kann ich nicht erwarten, dass der Leser (so nützlich es erscheint) das im Markuskommentar Gesagte nachliest.
Diese sind meine Hauptthesen:
1. Das Markusevangelium ist als Gegendarstellung zu den Berichten über den römischen Kaiser Vespasian entstanden. Dessen Erfolge werden von dem Geschichtsschreiber Josephus Flavius an mehreren Stellen als „Evangelium“, als „gute Kunde“ bezeichnet. Seine Krönung als Kaiser (und damit nach römischem Verständnis als „Sohn eines Gottes“) muss die Gemeinde des Markus tief verunsichert haben; war es doch ausgerechnet dieser Vespasian, der zusammen mit seinem Sohn Titus den römisch-jüdischen Krieg für Rom entschieden und Jerusalem (und vor allem den Tempel) in Schutt und Asche gelegt hatte. Markus‘ Botschaft an seine Gemeinde: Vespasian mag ein großer Feldherr und Kaiser sein. Ich aber sage euch: Jesus Christus ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Er kommandiert ein himmlisches Heer. Er ist der wahre Herrscher der Welt.
2. Das Matthäusevangelium ist eine Gegendarstellung zum Markusevangelium. Matthäus geht es nicht mehr um das Verhältnis Vespasians zu Christus. Vespasian ist zur Zeit der Abfassung des Matthäusevangeliums schon seit einigen Jahren gestorben. Der Konflikt zwischen Markus und Matthäus entzündet sich vielmehr an einer anderen Thematik: Während Markus zu einer heidenchristlichen Gemeinde gehörte, vertritt Matthäus eine judenchristliche Gemeinde. Hier bestand ein massiver Konflikt, der bis auf die Anfänge der christlichen Missionsbewegung zurückging. Während sich die Heidenchristen zur Zeit des Markus längst von der Jerusalemer „Mutterkirche“ abgekoppelt haben und ein universelles Christentum propagieren, beharren die Judenchristen auf dem Primat Israels: Nur über die Einbindung in das Volk Israel gewinnen die Heiden das Heil. Die Heidenchristen dagegen: Über Jesus Christus sind wir alle unmittelbar Glieder an seinem Leib. Die Gemeinde, die Christus als Herrn und Heiland anerkennt, ist das wahre Israel. Die Tora, das Gesetz der Juden, kommt in Christus zu seinem Ende. Er selber ist das neue Gebot, die neue Tora. Matthäus widerspricht, indem er seinen Jesus Christus sagen lässt: Ich aber sage euch: Ich bin nicht gekommen, das Gesetz (die Tora) aufzulösen, sondern zu erfüllen (= zu halten). Die Kernfrage war damit ausgesprochen: Gibt es durch Christus einen direkten Zugang zu Gott, oder führt der Weg nur über die Einhaltung der Tora (Beschneidung, Sabbathaltung, Reinigungsvorschriften)? Diesen Konflikt beschreiben wir ausführlich unter dem Gegensatz „Petriner-Pauliner“. Das sind zwar nur Schlagwörter. Sie beschreiben aber einen christologischen und theologischen Gegensatz, der uns bis heute beschäftigt, ja, der in den letzten 150 Jahren wieder in besonderer Weise ausgebrochen ist.3
Matthäus und Markus haben grundverschiedene Anschauungen. Das können wir deshalb schlecht erkennen, weil wir (durch jahrhundertelange Konditionierung) gewohnt sind, die Evangelien in der Bibel zu harmonisieren. Wir sehen nicht mehr die Gegensätze, sondern ihre Harmonisierung durch die Partei, die sich durchgesetzt hat: die Pauliner. Für sie war es von Interesse, die Legitimation durch Petrus und die Apostel nicht zu verlieren, aber andererseits die Distanz zu den ihnen feindlich gesinnten judenchristlichen Fundamentalisten zu wahren.
Ganz vieles von Markus übernimmt Matthäus unbeanstandet. Aber erst dort, wo er korrigiert und das markinische Profil verändert, erkennen wir beides: sowohl den Beweggrund für seine eigene Evangeliumsversion als auch, im Kontrast dazu, das Spezifische des Markusevangeliums.
Hoffentlich ohne dieses Buch zu überfrachten, werden wir gelegentlich Lukas und Johannes zu Wort kommen lassen. Lukas kannte sowohl Markus als auch Matthäus. Er trägt wenig Neues bei. Er ist, wie er selber sagt, ein Sammler und Bearbeiter. Er scheut Konflikte und versucht, zwischen Petrinern und Paulinern zu vermitteln. Allerdings kontert er die schroffe Ablehnung der Heidenchristen durch Matthäus mit zwei Gleichnissen, die zu den einflußreichsten des Neuen Testamentes gehören: „Der barmherzige Samariter“ und „Der verlorene Sohn“. Johannes schreibt noch später. Zu seiner Zeit war der Konflikt zwischen Petrinern und Paulinern bereits entschieden. Sein Evangelium hat jüdisch-heilsgeschichtliches Denken hinter sich gelassen und propagiert eher eine griechisch-durchgeistigte Sicht von Jesus Christus. Sowohl Lukas und Johannes (als auch Matthäus) helfen uns durch ihre Reaktionen, das ursprüngliche und revolutionäre Markusevangelium besser einzuordnen.
Der „Quelle Q“, die in der deutschsprachigen Theologie eine beherrschende Rolle spielt, wird hier nicht nachgegangen. Das würde in der Tat ein weiteres Buch füllen. Die These besagt, dass Matthäus und Lukas zwar beide Markus kannten, aber nicht einander. Sie hätten ihre über Markus hinausgehenden gemeinsamen Informationen/Texte aus der ihnen beiden bekannten Quelle Q. Diese Theorie ist entbehrlich, wenn wir annehmen, dass Markus und Matthäus ihre Evangelien größtenteils selber geschrieben und sich nicht auf ältere Quellen bezogen haben. Markus schrieb das erste Evangelium, Matthäus hat Markus kopiert, redigiert und mit eigenen Texten ergänzt. Lukas kannte Markus und Matthäus und hat seinerseits aus beiden kopiert und redigiert und ebenfalls eigene Texte ergänzt. Da uns hier außerdem nicht in erster Linie der Entstehungsprozess der Evangelien interessiert, sondern das, was sie als „Endprodukte“ repräsentieren und aussagen wollen, überlassen wir die Diskussion um Qanderen.
Die Fokussierung auf den petrinisch-paulinischen Streit hat zur Folge, dass wir dem Matthäusevangelium in seiner Ganzheit nicht vollständig gerecht werden können. Das ist mir bewusst. Die Perspektive beeinflusst das Ergebnis. Aber weder Lukas noch Matthäus erreichen die Genialität des markinischen Entwurfes. Sie agieren nicht, sie reagieren. Trotzdem haben sie Beiträge geschaffen, die aus der christlichen Tradition nicht wegzudenken sind: die Bergpredigt (Matthäus), das Vaterunser (Matthäus), das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas), das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lukas).
Wir werden also im 1. Hauptabschnitt den (nie gelösten) Konflikt zwischen Petrinern und Paulinern vorstellen. Im 2. Hauptabschnitt rekapitulieren wir das Markusevangelium. Im 3. Hauptabschnitt stellen wir das Matthäusevangelium dem Markusevangelium gegenüber. Zum Abschluss bleibt noch eine wichtige Frage zu beantworten: Inwiefern und inwieweit berühren die Gegendarstellungen und Bearbeitungen der verschiedenen Evangelien unser Christusverständnis heute? Hat es Konsequenzen für uns heute, wenn wir mehr zu den Paulinern oder mehr zu den Petrinern neigen? Hat es entscheidende Auswirkungen auf unseren Glauben heute?
1 Das „Chaosmeer“ ist der Ort der Bedrohung und es Todes (s.S. 37). Jesus geht deshalb nicht auf, sondern über dem Wasser.
2 Hartmut Schäffer: Das Markusevangelium. Der Rabbi Jesus, der in Wirklichkeit der Messias war. Hamburg 2017
3 Ausgelöst durch die einflussreichen Erkenntnisse des evangelischen Theologen F.C. Baur: Paulus, der Apostel Jesu Christi, Leipzig 1867
2 Das Markusevangelium: „Ein Sohn eines Gottes“8
2.1 Eine literarische Biographie
Mit dem beschriebenen Konflikt zwischen Petrinern und Paulinern im Hintergrund wenden wir uns also nun dem Markus- und Matthäusevangelium zu. Zwischen den beiden liegt ein Zeitsprung von zwei Generationen. Wir werden sehen: Der Konflikt ist immer noch nicht ausgestanden. Zunächst jedoch „parken“ wir diese schwelende Auseinandersetzung und konzentrieren uns auf das Markusevangelium. Wie kommt es zu dieser neuen Literaturgattung „Evangelium“? Was ist das Anliegen des Markus?
Zu unserer Überraschung werden wir feststellen, dass Markus keine historische, sondern eine literarische Biographie schreibt. Seine „erfundenen“ allegorischen Berichte sollen seine Täuflinge mit den wichtigsten christlichen Glaubensinhalten vertraut machen. Die Glaubensinhalte werden hergeleitet aus den jüdischen heiligen Schriften und finden ihre Vergegenwärtigung nicht in der Zeit Jesu, sondern in der Zeit des Markus. Sein Evangelium spricht in Bildern und muss deshalb entschlüsselt und erklärt werden. Wir werden entdecken, dass schon Markus selber die Austreibung von Dämonen, das Gehen auf dem See Genezareth oder das wundersame Vermehren von fünf Broten und zwei Fischen metaphorisch gemeint hat.
2.2 Die Erzählungen des Markus
Ca. 75 n. Chr. tauchen mit dem Markusevangelium zum ersten Mal Erzählungen auf, die Jesu Leben zum Gegenstand haben. Bis dahin war schon vieles über Jesus berichtet worden, und zwar in den Briefen des Paulus ca. 50-60 n. Chr., in den paulinischen Pseudepigraphien (ab 70 n. Chr.; zu den Pseudepigraphien s. nächstes Kapitel), dem Hebräerbrief (70-90 n. Chr.), den Johannesbriefen (65-110 n. Chr.) und der Offenbarung (70-95 n. Chr.). Alle erwähnten Schriften berichten über Jesu Sterben und Auferstehen sowie über Jesu Botschaft und Lehre, jedoch ausnahmslos nicht über Jesu Leben. Das ist umso erstaunlicher, als das Markusevangelium ganz unglaubliche Dinge erzählt: Jesus heilt Kranke, Besessene, macht Blinde sehend, Lahme gehend, weckt Tote auf, geht selber auf dem Wasser des Galiläischen Meeres, stillt einen Meeressturm durch sein mündliches Geheiß. Auch nicht die kleinste Spur davon findet sich in den vormarkinischen Schriften!
Dass die Christen vor Markus davon nichts gewusst hätten oder dass sie diese sensationellen Taten bewusst verschwiegen hätten, ist ebenso undenkbar wie die Annahme, diese Taten und Wunder seien ihnen so unwichtig gewesen, dass sie sie mit keiner Silbe erwähnt haben. Dieser Tatbestand führt zu der Folgerung, dass es diese Erzählungen vor Markus nicht gab. Alle anderen Evangelisten (Matthäus, Lukas, Johannes) kannten Markus. Sie haben seine Erzählungen kopiert, bearbeitet, in seinem Stil weitergeführt, um neue Erzählungen angereichert. Das gilt auch für die Apostelgeschichte, die ja den zweiten Teil des Lukasevangeliums bildet.
Aber warum sollte Markus das tun – Geschichten erzählen, die nicht historisch sind? Diese für uns so naheliegende Frage hätten Zeitgenossen des Markus gar nicht gestellt. Sie hätten ja gewusst: Diese Geschichten gab es bisher nicht, also hat Markus sie zum ersten Mal erzählt. Nehmen wir als heutiges Beispiel die Weihnachtserzählungen von Karl Heinrich Waggerl (1897-1973). Er berichtet hier von dem schwarzen König Melchior, der bei der Anbetung des Christuskinds die Hände vors Gesicht schlägt, weil er Angst hat, Jesus würde sich ob seiner schwarzen Hautfarbe vor ihm fürchten. Aber Jesus lächelt ihn an und streckt die Hände nach seinem schwarzen Kraushaar aus. Dann heißt es wörtlich: „Als er aber die Hände wieder löste, sah er das Wunder – sie waren innen weiß geworden. Und seitdem haben alle Mohren helle Handflächen, geht nur hin und seht es und grüßt sie brüderlich.“
Der Leser stellt sich hier nicht die Frage, warum Waggerl eine Geschichte erzählt, die nicht historisch ist (auch wenn sie einen historischen Kern hat, denn tatsächlich sind die Handflächen von Farbigen immer weiß…). Der Leser setzt voraus, dass das Eigentliche der Geschichte nicht ihr historischer Gehalt ist, sondern „die Predigt von der Nächstenliebe“: „Habt bei farbigen Menschen keine Berührungsängste – geht nur hin und grüßt sie brüderlich.“
Genauso ging es den Menschen, denen Markus seine Geschichten erzählte: Nachdem sich die Frage nach der Historizität nicht stellte, konnte man offen sein für das Eigentliche, für das, was Markus seinen Lesern vermitteln wollte. Was das im Einzelnen war, soll im Folgenden bedacht werden.
Es gibt noch einen anderen Grund, warum die Zeitgenossen des Markus die Frage nach der Historizität nicht gestellt hätten: Es gab nämlich viele solche Erzählungen. Es war ein Stilmittel der Zeit, tiefe Wahrheiten in Bilder zu kleiden. Und die Erzählungen des Markus sind genau das: Bilder in Worten.
Dazu ein weiteres Beispiel: In der „Schatzhöhle“ (eine ursprünglich jüdische Schrift zur Geschichte Israels, die von Christen fortgeschrieben wurde) wird berichtet, dass „die Juden“ Christus nicht kreuzigen konnten, weil in ganz Jerusalem kein Holz mehr aufzutreiben war. So beschlossen sie, die Bundeslade im Tempel auseinanderzunehmen und daraus ein Kreuz zu zimmern. Mehr noch: Unter dem Hügel Golgatha befand sich das Grab Adams. Als nun Jesus starb, floss sein Blut in die Grabeshöhle, benetzte Adam und erweckte ihn dadurch zu neuem Leben.
Niemand hat jemals den Autor der Schatzhöhle Lügner genannt, auch wenn jeder wusste: Die Bundeslade war zur Zeit Jesu längst verschollen. Man hat die „Wahrheit“ hinter der „erfundenen“ Geschichte verstanden: Die Bundeslade stand für den „alten“ Bund Gottes mit seinem Volk. Aus dem alten Bund erwächst durch das Kreuz der „neue“ Bund. (Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen.) Damit wird das Kreuz zur „neuen“ Bundeslade für das „neue“ Volk Israel. So haben sich die Christen damals verstanden. Und dieser Bund wird durch Christi Blut (= durch sein Opfer) besiegelt und gleichzeitig „aktiviert“ zum Leben erweckt. Das Blut Christi erweckt den Menschen („Adam“) zum neuen Leben unter einem neuen Bund. Diese lange Predigt ist in den wenigen dürren Worten der Schatzhöhle enthalten. Das konnte der damalige Leser verstehen: Nicht das Gesagte ist die Botschaft (kein Holz in Jerusalem – Adams Grab unter Golgatha), sondern das durch das Bild Gemeinte (vom alten zum neuen Bund, vom „toten“ Adam zum neuen Menschen in Christus).
So wie dieses Bild in der „Schatzhöhle“ funktioniert das ganze Markusevangelium. Unser Blick darauf ist verstellt, weil diese Bildersprache schon sehr bald in einen griechisch-römischen Kulturkreis Einzug hielt, der diese Geschichten nicht mehr allegorisch (bildhaft), sondern wörtlich nahm. Und so wurden sie uns bis heute überliefert. Das wörtliche Fürwahrhalten der Erzählungen im Markusevangelium erschwert den Zugang zu ihrer im Bild enthaltenen Botschaft.
Wenn wir Markus allegorisch deuten, gehen wir davon aus, dass er es selber schon so beabsichtigt und gemeint hat. Er hat Lehre und Heilsgeschichte in Bilder gekleidet. Wenn Jesus über dem Wasser geht, dann ist das für Markus kein geschichtliches Ereignis. Das Meer ist für ihn vielmehr ein Bild für die lebensbedrohlichen Mächte, die uns hinabziehen wollen in die Tiefen. Jesus geht über dem Wasser, das heißt: Er steht über diesen Mächten. Wer an ihn glaubt, den zieht Jesus aus dem Wasser. Wer Jesus aus den Augen verliert, der versinkt (Petrus). Wenn es sich um ein historisches Ereignis gehandelt hätte, dann müsste die Kirche Matrosen in Seenot den Rat geben, nur ganz fest an Jesus zu glauben, dann gingen sie nicht unter. Die Kirche aber machte es zu allen Zeiten richtig und predigte: Richte dein Leben (damit ist nicht die konkrete Seenot gemeint) auf Jesus aus, glaube an ihn, dann gehst du (geistlich gesprochen) nicht unter. Lebe dein Leben an der Hand Jesu9, dann bestehst du die Stürme des Lebens. Diese Predigt ist keine nachträgliche Interpretation eines historischen Geschehens (das wäre formliterarisch eine Allegorese), sondern eine von Markus bewusst in ein Bild gekleidete Botschaft (formliterarisch eine Allegorie).
Schon bei den uns überlieferten Bearbeitungen von Matthäus und Lukas gibt es kleine Hinweise darauf, dass sie Markus an manchen Stellen wörtlicher nahmen als er selbst. Nachkommende Generationen haben die Frage, ob eine Schrift in die „Bibel“ aufgenommen werden sollte, nicht zuletzt davon abhängig gemacht, wie wahrscheinlich der Text aus historischer Sicht war. Damit hat man die allegorische Ebene dieser Erzählungen schon nicht mehr verstanden.
2.3 Pseudepigraphie
Wir tun uns sehr schwer damit, dass Markus Geschichten schreibt und dabei „so tut, als ob“ das alles tatsächlich so geschehen sei. Ein solches Vorgehen empfinden wir als unwahrhaftig und das umso mehr, als wir von Kindheit an diese Erzählungen als historisch aufgefasst haben. Es ist etwa dieselbe Enttäuschung, die ein Kind empfinden muss, wenn es herausfindet, dass es keinen Osterhasen gibt oder dass die Kinder nicht vom Storch gebracht werden: Jesus ist also nie wirklich auf dem See Genezareth gewandelt? Er hat keine Toten auferweckt, kein Wasser in Wein verwandelt?
Dazu kommt, dass wir auch nicht sicher sein können, ob die überlieferten Jesusworte wirklich von Jesus selber stammen. Zwar benutzt Markus eine sogenannte Spruchquelle mit überlieferten Sprüchen Jesu, diese ist aber leider nicht mehr erhalten. So sind vermutlich viele Jesusworte von Markus oder anderen formuliert worden. Man denke nur an die Szene im Garten Gethsemane10: Wer hätte die dort gesprochenen Worte Jesu hören oder überliefern können? Die Jünger haben ja, nach Darstellung des Markusevangeliums, jene Stunde verschlafen.
In unserer Zeit würden wir es als unredlich empfinden, einen Brief zu schreiben und ihn mit einem bekannten, berühmten Namen zu unterzeichnen. Ebenso empfinden wir es als unwahrhaftig, Begebenheiten über Jesus zu erzählen und so zu tun, als ob dies alles wirklich so geschehen sei. Das war in Jesu Zeiten ganz anders. Damals empfand man es als eine Ehre. Denn mit diesem Vorgehen signalisierte der Verfasser, dass er nichts Eigenes sagen wollte, was über den (vermuteten) Willen des Zitierten hinausging. Markus bedient sich dabei einer Kompositionsform, die uns an anderer Stelle des Neuen Testaments als „Pseudepigraphie“ bekannt ist. Zu diesem Stichwort zunächst Wikipedia:
Als Pseudepigraphie (griechisch ψευδεπιγραφία – wörtlich etwa „die Falschzuschreibung“, Zusammensetzung von ψευδής pseudēs ‚unecht, unwahr‘ und ἐπιγραφή epigraphē ‚Name, Inschrift, Zuschreibung‘) bezeichnet man das Phänomen, dass ein Text bewusst im Namen einer bekannten Persönlichkeit abgefasst oder fälschlicherweise einer solchen zugeschrieben wird. Eine Schrift mit falscher Verfasserangabe nennt man dementsprechend das Pseudepigraph.
Pseudepigraphie war bereits in der Antike verbreitet. Sowohl im Namen klassischer Autoren als auch im Namen biblischer Gestalten oder Verfasser wurden Schriften verfasst und in Umlauf gesetzt. Die Pseudepigraphie erklärt sich aus dem Bestreben, in einer Schultradition die Gedanken einer Autoritätsperson der Vergangenheit zu tradieren. Dabei kann sowohl der Wunsch, dem eigenen Text eine höhere Autorität zu verleihen, im Vordergrund stehen, als auch die Bescheidenheit, die niedergeschriebenen Gedanken demjenigen zuzuschreiben, von dem man sie sachlich übernommen hat oder von dem man dazu inspiriert worden ist.
Wenn also z.B. der Verfasser des Epheserbriefs seinen Brief (lange nach dem Tod des Paulus) mit „Paulus“ unterschreibt („Ich, Paulus, grüße die Gemeinde in Ephesus…“), dann will er damit ausdrücken, dass er kein neues oder anderes Evangelium verkünden will als Paulus. Er schreibt „im Geiste des Paulus“. Er sagt: Paulus und seine Predigt sind mein Maßstab. Er möchte also nicht die Gemeinde betrügen, indem er sich für Paulus ausgibt. Vielmehr weiß die angesprochene Gemeinde ja, dass Paulus längst gestorben ist. Sie versteht, dass der Verfasser sich Paulus und seiner Botschaft unterordnen will.
In ähnlicher Form lässt Markus in seinem Evangelium Jesus sprechen und handeln. Markus könnte zu seiner Gemeinde sagen: „Wenn ihr Angst habt, dann macht euch bewusst, dass Jesus bei euch ist. Er kann den Sturm eurer Herzen stillen.“ Stattdessen kleidet Markus die Aussage in eine Geschichte: Jesus fährt mit seinen Jüngern übers Galiläische Meer – ein Sturm kommt auf – die ängstlichen Jünger flehen zu Jesus – Jesus stillt den Sturm. Die Gemeinde des Markus weiß, dass Jesus längst gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Deshalb nehmen sie das Bild nicht wörtlich. Sie verstehen, was Markus ihnen mit dem Bild sagen will. Ein tröstendes Bild ist eindrücklicher als ein tröstender Satz. Wenn Markus Jesus sprechen und handeln lässt, dann will auch er damit ausdrücken: Nicht ich tröste, sondern Jesus. Nicht ich stille die Stürme eurer Herzen, sondern der Auferstandene.
Unser größtes Problem bei der Beurteilung des Markusevangeliums liegt in unserem zeitlichen Abstand zu diesen Texten. Während die Leser und Hörer des Markus ja wussten, dass die erzählten Geschichten neu waren, dass es nicht um die historische Wahrheit ging, sondern um die spirituelle Wahrheit, änderte sich das Verständnis mit der Zeit. Aber bis ins Mittelalter gab es Menschen, die wussten, dass die allegorische Deutung die ursprüngliche war, dass der „Literalsinn“, also die wörtliche Auslegung, in die Irre führt. Es ist eine Bibelabschrift überliefert, in der ein Mönch die Worte an den Rand geschrieben hat: „Der Wissende versteht“. Damit war ausgedrückt, dass die wörtliche Auslegung nicht die eigentliche war.
Ein schönes Beispiel für dieses mittelalterliche Bibelverständnis findet sich über dem Nordportal der gotischen Marienkapelle in Würzburg (s. Abb. S. 41).
Die Szene zeigt die Verkündigung der Empfängnis Mariä aus dem Lukasevangelium. Wie wird die Zeugung dargestellt? Wir sehen einen „Schlauch“, der von Gottes Mund zu Marias Ohr reicht. Auf diesem Schlauch oder Trichter „rutscht“ das Christuskind von Gottes Mund in Marias Ohr. Das, was mit dem Begriff „empfangen vom Heiligen Geist“ ausgedrückt werden soll, wird hier ganz dinglich dargestellt. Es geht also nicht um eine geschlechtliche Zeugung, sondern um eine geistliche Zeugung, die der Kolosserbrief so ausdrückt: Denn in ihm (Christus) wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig (Kol 2,9). Johannes beschreibt es so: … und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns (Joh
1,14) . Das Portal in Würzburg zeigt, dass man diese bildhafte Sprache zum Teil noch verstanden hat.
Wenn es stimmt, dass die bildhafte Auslegung die ursprünglich von Markus beabsichtigte ist, dann müsste dieses Prinzip durchgängig auf das Evangelium anwendbar sein. Genau das soll mit dieser Auslegung dargestellt werden.
2.4 Christus oder Vespasian?
Das Markusevangelium leitet, wie wir noch sehen werden, seine theologischen Aussagen fortwährend aus den biblischen Schriften des Judentums her. Daneben gibt es aber auch einen nach vorne gerichteten Bezug, wobei mit „nach vorne gerichtet“ die Zeit und Situation des Markus gemeint ist. Ihm geht es nicht darum, wer Jesus einmal war, sondern wer der Auferstandene für ihn und seine Zeit ist. Diese Frage stellte sich Markus umso drängender, als ein neuer „Messias“ aufgetreten war, der die Gemeinde des Markus (und vor allem die Täuflinge, die noch nicht im Glauben gefestigt waren) tief verunsichern musste. Dieser Messias hieß Vespasian und war der neue Kaiser in Rom.
Eine jüdische oder judenchristliche Gemeinde hätte sich von einem römischen Kaiser wohl kaum verunsichern lassen. Anders stand es um die heidenchristlichen Gemeinden und um „Heiden“ (Römer, Griechen, Ägypter, Syrer…), die vor der Frage standen, ob sie Jesus als ihren Messias anerkennen sollten. Zu einer solchen heidenchristlichen Gemeinde gehörte Markus.
Was war das Besondere dieses neuen römischen Kaisers Vespasian, dass ihn die nichtchristliche römisch-griechische Welt als Messias verehrte? Vespasian wurde 9 n. Chr. geboren, also etwa zeitgleich mit Jesus. Er war bürgerlicher Herkunft, sein Aufstieg zum Kaiser kam äußerst überraschend. Er verdankte die Kaiserwürde einem Machtvakuum in Rom nach dem Tode Neros. Mehrere römische Feldherren kämpften um die Vorherrschaft, letztlich setzte sich Vespasian durch. Anfang 67 hatte ihn Nero zum Statthalter von Judäa ernannt. Einen Aufstand der Juden konnte er niederwerfen und Judäa unter römischer Kontrolle halten. Im Jahr 70 zog er mit seinem Sohn Titus von Cäsarea Philippi aus nach Jerusalem und von dort weiter nach Ägypten. Noch im selben Jahr wurde er in Rom zum Kaiser gekrönt, während Titus kurz zuvor den Tempel in Jerusalem zerstören ließ. Vespasians Aufstieg und Judäas Niedergang standen also in engem Verhältnis.
Vespasian war ein äußerst erfolgreicher Kaiser. Nachdem Rom durch Neros Verschwendungssucht vor dem wirtschaftlichen Bankrott stand, betrieb Vespasian eine rigorose Steuerpolitik und reorganisierte und verkleinerte das Heer. Trotzdem gelang es ihm, das Römische Reich weiter auszudehnen, u. a. im Norden Englands und in Wales. Durch die Intensivierung der Bautätigkeit kurbelte Vespasian die Wirtschaft des Römischen Reiches an. Auf einem von Nero zu Privatzwecken enteigneten Gelände im Zentrum Roms ließ er für öffentliche Spiele das heute noch zu bestaunende Kolosseum erbauen. Auch das Kapitol, das sakrale Zentrum Roms, das in den Kriegswirren vor seiner Krönung stark beschädigt worden war, ließ er wieder aufbauen.
Vespasian bekämpfte die Korruption. Schon vor seinem Herrschaftsantritt war er bekannt dafür, sich nicht (wie üblich) auf Kosten des Volkes zu bereichern. Als Prokonsul von Afrika geriet er deswegen sogar in große finanzielle Schwierigkeiten, aus denen ihn sein Bruder befreien musste. Wie nur wenige seiner Vorgänger starb Vespasian 79 n. Chr. eines natürlichen Todes. Nachfolger und würdiger Erbe wurde sein Sohn Titus.
Vespasian wurde – wen wundert es? – aufgrund seiner Fähigkeiten als Feldherr und Staatsmann sowie seiner Integrität und natürlich nicht zuletzt wegen seines großen Erfolges (die Götter waren mit ihm…) verehrt, ja angebetet. Rom sah in ihm nach den maßlosen Exzessen Neros, dem wirtschaftlichen Niedergang Roms und den Kriegswirren nach Neros Tod den Heilsbringer schlechthin. Sein Titel zu Lebzeiten war „ein Sohn eines Gottes“. Seine Kaiserherrschaft bringt der Welt Frieden und Ordnung. Diese „Freudennachrichten“ nennt der jüdische (aber in römischen Diensten stehende) Geschichtsschreiber Flavius Josephus „Evangelien“.