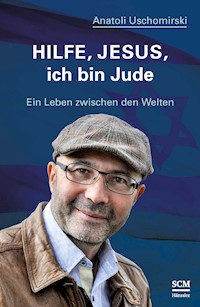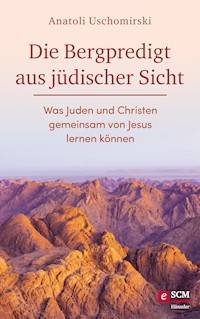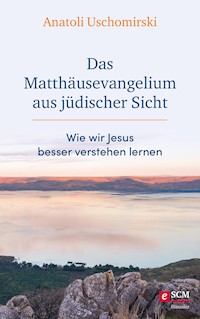
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Die Bibel aus jüdischer Sicht
- Sprache: Deutsch
Das Matthäusevangelium - ein verstaubter, alter Text? Sicher nicht! Was haben die Texte von damals mit unserem Leben zu tun? Wie können wir Jesu Worte heute besser verstehen? Anatoli Uschomirski tritt in die Fußspuren der ersten jüdischen Nachfolger des Messias und erweckt mit seinem jüdisch-messianischen Blick die altbekannten Texte neu zum Leben. Geschichtlicher Kontext, außerbiblische Quellen und jüdisches Insiderwissen öffnen uns die Augen für Jesus und seine Worte - und lassen sie neu lebendig für uns werden. Vielleicht so lebendig wie niemals zuvor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anatoli Uschomirski
DasMatthäusevangeliumaus jüdischer Sicht
Wie wir Jesusbesser verstehen lernen
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
ISBN 978-3-7751-7591-3 (E-Book)
ISBN 978-3-7751-6171-8 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: CPI books GmbH, Leck
© 2023 SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen
Internet: www.scm-haenssler.de · E-Mail: [email protected]
Hauptübersetzung:
Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen.
Weiter wurden verwendet:
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. (Luther 2017)
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen. (ELB)
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe
© 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. (EÜ)
Zürcher Bibel, © 2007 Verlag der Zürcher Bibel beim Theologischen Verlag Zürich. (ZÜR)
NeÜ bibel.heute, © 2010 Karl-Heinz Vanheiden, www.derbibelvertrauen.de und Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg, www.cv-dillenburg.de. (NEÜ)
David H. Stern: Das jüdische Neue Testament, Hänssler-Verlag,
Neuhausen-Stuttgart, 1994. (JNT)
Lektorat: Christiane Kathmann, www.lektorat-kathmann.de
Umschlaggestaltung: Erik Pabst, www.erikpabst.de
Titelbild: John Theodor/shutterstock.com
Satz: typoscript GmbH, Walddorfhäslach
INHALT
Über den Autor
Vorwort
Teil 1 | Einführung
Geschichtlicher Hintergrund
Das Evangelium nach Matthäus
Verborgene Schätze
Teil 2 | Der Messias
Geburt und frühe Kindheit
Johannes der Täufer
Die Taufe von Jesus
Die Versuchung von Jesus
Teil 3 | Worte und Taten
Ein Licht aus Galiläa
Die Bergpredigt
Zeichen und Wunder
Teil 4 | Unser Auftrag
Jesus nachfolgen
Die Zwölf
Jüngerschaft damals und heute
Die Leidenschaft der Jünger
Schlusswort
Anmerkungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
ÜBER DEN AUTOR
Anatoli Uschomirski (Jg. 1959) ist messianisch-jüdischer Pastor, Redner und Buchautor. Anatoli war Gründer der jüdisch-messianischen Gemeinde »Schma Israel« in Stuttgart, die er 17 Jahre leitete. Heute arbeitet er als theologischer Referent des Evangeliumsdienstes für Israel (EdI) und setzt sich für Versöhnung zwischen Deutschen und Juden ein.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
VORWORT
Schalom alechem – Friede sei mit euch! So ein Einstieg zu einem neutestamentlichen Buch ist eher ungewöhnlich, nicht wahr? Andererseits waren das die ersten Worte des auferstandenen Jesus, als er seinen Jüngern begegnete. Da ich mich als Jude mit den jüdischen Wurzeln von Jesus identifiziere, möchte ich Ihnen von Anfang an Schalom – Frieden – beim Lesen dieses Buchs wünschen.
Als ich zum ersten Mal in meinem Leben das Evangelium nach Matthäus gelesen habe, war ich völlig überrascht vom ersten Satz: »Dies ist der Stammbaum Jeschuas des Messias, des Sohnes Davids, des Sohnes Avrahams.«1 Die meisten Menschen sind der Meinung, die Bibel sei ein rein christliches Buch. Juden lesen das Neue Testament normalerweise nicht, einige meinen sogar, es sei ein antijüdisches Buch, das lehrt, wie man die Juden bekämpfen soll. In Anbetracht von 2 000 Jahren Verfolgung, Zwangstaufen, Pogromen, Vertreibung, hauptsächlich durch Christen, ist das nicht verwunderlich. Doch nun las ich im ersten Vers des Neuen Testaments: »Dies ist der Stammbaum Jeschuas des Messias, des Sohnes Davids, des Sohnes Avrahams.«
Jeschua, David, Avraham – das waren doch Juden, so wie ich? Was taten sie in diesem angeblich antijüdischen Buch? Neugierig las ich weiter. Und je mehr ich las, desto mehr stellte ich fest: Das ist ein typisch jüdisches Buch. Es wurde von einem jüdischen Autor für Juden geschrieben, doch nun lesen und studieren es Christen seit fast zwei Jahrtausenden, während es für die Mehrheit der Juden ein Tabu ist.
Das hat zur Folge, dass die jüdische Denkweise und die jüdischen Auslegungsmethoden bei der Deutung des Matthäusevangeliums kaum berücksichtigt werden. Dabei würde uns gerade die Berücksichtigung des historisch-jüdischen Kontextes dabei helfen, die Bibel und deren Bedeutung für unser Leben und unseren Glauben besser zu verstehen! Gott wirkt nicht an Raum, Zeit und Kultur vorbei. Es war sein Plan und seine Entscheidung, dass Jesus als Jude geboren wurde und aufwuchs. Er wirkte als Jude, starb als Jude und ist als Jude auferstanden, denn die Auferstehung ist ein jüdisches Konzept.
Wenn ich die Mona Lisa betrachte, möchte ich gerne wissen, was Leonardo da Vinci dazu gebracht hat, dieses weltberühmte Ölgemälde so zu malen, wie er es getan hat. Wenn ich »Den Messias« höre, dann ist es mir wichtig, das Leben und die Absichten Händels zu kennen, um die Tiefe dieses Meisterwerks zu begreifen. Und wenn wir das Neue Testament aus jüdischer Perspektive lesen und studieren, dann werden wir das Wort Gottes tiefer verstehen. Wir lernen Jesus besser kennen und unser Glaube wird bereichert.
In diesem Buch werden Sie eine ganz neue Lesart des Evangeliums entdecken. Sie schlüpfen in die Schuhe der ersten jüdischen Nachfolger des Messias und lernen die altbekannten Texte aus jüdisch-messianischer Sicht kennen. Die Struktur, das Gedankengut des Autors und die Betonung besonderer Aspekte sind nämlich nicht nur für Theologen von Bedeutung, sondern auch für alle, die das Evangelium lesen. Dadurch wird der Glaube von Christen und messianischen Juden bereichert und nachvollziehbarer für Außenstehende.
Vieles von dem, was Matthäus in Bezug auf Jesus schreibt, hat einen messianischen Hintergrund. Beim ersten Lesen des Evangeliums fällt das nicht sofort ins Auge, aber für einen geübten Leser, der die Inhalte bereits kennt, lohnt es sich, das Evangelium einmal unter diesem Blickwinkel zu studieren.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich auf diese Buchreise begeben, und bete dafür, dass Sie viele neue, gute Erkenntnisse gewinnen und Ihr Glaube gestärkt wird. Ich weiß nicht, welche Erwartungen Sie haben. Doch ich möchte ehrlich zu Ihnen sein und Ihnen sagen, was Sie in diesem Buch nicht finden werden: Ich werde nicht das gesamte Matthäusevangelium Wort für Wort erklären. Dafür gibt es andere gute Bücher und Bibelkommentare und dann wäre dieses Buch auch bedeutend dicker.
Stattdessen werden wir in die Schuhe des Autors, Matthäus, hineinschlüpfen. Wir werden untersuchen, warum er so geschrieben hat, wie er geschrieben hat. Welche Gedanken aus jüdischem Wissen, hebräischer Exegese und Hermeneutik haben ihn beim Schreiben beeinflusst?2 Warum hat er sein Buch in erster Linie an ein jüdisches Publikum gerichtet? Und warum ist es für Christen so wichtig, gerade diesen Aspekt seines Werkes zu begreifen? Dafür werden wir besonders die ersten zehn Kapitel des Matthäusevangeliums betrachten, weil diese Punkte daran sehr gut deutlich werden.
Die Einführung im ersten Teil beschäftigt sich mit dem Autor, dem Kontext, in dem er geschrieben hat, und den Besonderheiten und verborgenen Schätzen des Evangeliums und dem Stammbaum von Jesus. Der zweite Teil widmet sich der Geburt von Jesus, seiner Taufe und der Versuchung. In diesen Kapiteln stellt Matthäus den Lesern Jesus immer wieder als Messias vor und belegt damit seine Autorität. Teil drei beschäftigt sich mit der Lehre und den Taten des Messias. Der vierte Teil befasst sich mit Nachfolge damals und heute.
In meinem Buch »Die Bergpredigt aus jüdischer Sicht«3 habe ich mich bereits einmal mit einigen Aspekten des Evangeliums befasst, sodass ich in diesem Buch nur Auszüge aus der Bergpredigt behandeln werde. In der Einführung werde ich jedoch auf einen Ausschnitt aus diesem Buch zurückgreifen, da er ein wichtiges Puzzleteil darstellt, um die Struktur des Evangeliums zu verstehen. Auch wenn Sie »Die Bergpredigt aus jüdischer Sicht« bereits gelesen haben, hilft die Wiederholung dabei, die besondere Struktur des Matthäusevangeliums immer vor Augen zu haben.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude auf Ihrer Expedition in die Welt des Evangelisten Matthäus!
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
GESCHICHTLICHER HINTERGRUND
Wenn wir das Neue Testament lesen, müssen wir uns bewusst machen, dass wir in eine Zeit eintauchen, die 2 000 Jahre zurückliegt. Wir können diese Zeit nicht umfassend verstehen, denn die Welt und vor allem die Menschen haben sich seitdem sehr verändert.
Das möchte ich mit einem modernen Beispiel veranschaulichen. Ich schreibe dieses Buch, während ein heftiger Krieg mitten in Europa ausgebrochen ist. Das Land, in dem ich aufgewachsen bin, die Ukraine, wird von Russland angegriffen. Es ist einer der schlimmsten Kriege in Europa seit 80 Jahren. Ich hoffe und bete, dass der Krieg zu Ende ist, wenn Sie dieses Buch in der Hand halten. Doch ich weiß, dass beide Länder, Russland und die Ukraine, aber vor allem die nächsten Generationen, die in der Region leben, eine ganz andere Geschichte ihrer Länder kennenlernen werden als ich vor dreißig Jahren. Ihr Bewusstsein und ihre gegenseitige Wahrnehmung werden durch die Ereignisse von 2022 geprägt werden. Ich kenne zwei Völker, die in gegenseitiger Achtung und Verständnis gelebt haben. Das gibt es nicht mehr. Und in den nächsten zwei bis drei Generationen wird es dies vermutlich auch nicht mehr geben.
Umso weniger können wir die Zeit aufschließen, in der Jesus und seine Jünger gelebt haben. Dennoch erscheint es mir unabdingbar, alles zu berücksichtigen, was wir über diese Zeit wissen, um uns den Menschen damals so weit wie möglich anzunähern und ein möglichst tiefes Verständnis zu erlangen. Deswegen beginne ich dieses Buch mit der Einordnung in den geschichtlichen Kontext. Dies hilft uns, zu verstehen, in welcher Zeit Matthäus gelebt und gewirkt hat und warum er sein Evangelium in diese Zeit hineingeschrieben hat.
Insbesondere ist es von Bedeutung, wie damals die Beziehungen zwischen den verschiedenen religiösen Strömungen waren, denn nur so können wir begreifen, auf welchem religiös-historischen Hintergrund die ersten jesusgläubigen Gemeinden entstanden sind.
Religiöse Gruppen in Israel zur Zeit des Zweiten Tempels
Zur Zeit von Jesus gab es in Israel mehrere politisch-religiöse Gruppierungen: Pharisäer, Sadduzäer, Essener und Zeloten. Die Evangelien erzählen sehr wenig bis gar nichts über das Gedankengut und die Glaubensvorstellungen dieser Gruppen, denn die damaligen Leser kannten sie gut und brauchten keine zusätzlichen Erklärungen. Wir dagegen benötigen diese Erklärung sehr wohl. Daher beschreibe ich diese Gruppen im Folgenden kurz. Dies hilft uns, zu begreifen, auf welchem religiösen Hintergrund die Jesus-Bewegung aufkam und wie sie von diesen Gruppen beeinflusst wurde.
Die Sadduzäer
Der Name Sadduzäer (hebr. Zdukkim) wurde wahrscheinlich vom Hohenpriester Sadduk bzw. Zadok abgeleitet, einem wichtigen Priester zur Zeit von König David.4 Die Nachkommen Zadoks spielten beim Aufbau der nachexilischen Gemeinde eine maßgebliche Rolle und versahen als die legitimen Priester in Jerusalem den Tempeldienst. Die Sadduzäer waren sehr konservativ. Sie bauten ihre Theologie und ihren Lebensstil auf ihrem Verständnis der Thora auf, andere Auslegungen lehnten sie ab. Die Bücher der Propheten und besonders die prophetische Kritik an den Leitern des Volkes wollten sie nicht akzeptieren. Sie waren gegen jegliche Reformen. Sie glaubten, die Heiligkeit Israels werde am ehesten durch den Tempel und die gültigen Opfer gewahrt. Für sie war allein Israel heilig und hatte das Recht, die Thora zu studieren, während andere Gruppierungen dies auch interessierten Menschen aus anderen Kulturen erlaubten.
Die Sadduzäer teilten die allgemein anerkannten apokalyptisch-eschatologischen Hoffnungen der Pharisäer nicht. Ihrer Lehre nach gab es weder ein Leben nach dem Tod noch eine Auferstehung. Das Heil verwirklichte sich nach Auffassung der Sadduzäer nur auf der Erde, sie glaubten, der Mensch werde von Gott nur in diesem Leben für seine Taten belohnt oder bestraft.
Die Sadduzäer waren sowohl Gegner der Zeloten als auch der Pharisäer. Die Sadduzäer wollten den Status quo auf religiöser, gesellschaftlicher und politischer Ebene aufrechterhalten, während die anderen Parteien nach einer Erneuerung strebten.
Da sie mit den Römern kooperierten, sorgten sich die Sadduzäer besonders um die politische Stabilität im Land. Das Aufkommen einer messianischen Bewegung war für sie gefährlich, deswegen suchten sie alle möglichen Wege, um Jesus und seine Nachfolger mundtot zu machen.
Als im Jahre 66 n. Chr. der bewaffnete Aufstand gegen die Römer ausbrach, versuchten die Sadduzäer vergeblich, dies zu verhindern. Mit dem Untergang Jerusalems im Jahre 70 n. Chr. kam auch das Ende der Sadduzäer.
Die Zeloten
Die Zeloten gehörten ursprünglich zum Kreis der Pharisäer. Allerdings trennten sie sich aus politischen und religiösen Motiven von ihnen und riefen zu aktivem politischem Handeln gegen die Römer auf.
Ihr Eifer um das Gesetz brachte ihnen den Beinamen »Eiferer« (griech. Zeloten) ein. Josephus, selbst ein ehemaliger Zelot, beschreibt sie als die »vierte Philosophie«, also die Gruppe, die damals neben den Sadduzäern, Pharisäern und Essenern den größten Einfluss in Israel ausübte.5
Die Zeloten propagierten ein starkes jüdisches Nationalbewusstsein und forderten den bewaffneten Widerstand. Sie weigerten sich zudem, die Herrschaft des römischen Kaisers anzuerkennen, sich ihm zu beugen und ihn »Herr« zu nennen.
Die Essener
Die Essener waren eine religiöse Gruppe, die etwa ab Mitte des ersten Jahrhunderts v. Chr. in Israel anzutreffen war. Sie sind vor allem durch die klosterähnliche Anlage Qumran am Ufer des Toten Meeres bekannt geworden, die vermutlich den Essenern gehörte.
Die Essener versuchten, besonders glaubenstreu zu sein. Sie verzichteten auf ein genussreiches Leben und unterwarfen sich strengen Regeln. Unter anderem bauten sie ein Heiligungssystem auf, das Absonderung, Waschungen, eine sehr strenge Sabbatfeier und einige Verbote umfasste: Verboten waren – abgesehen vom Eintrittsgelöbnis – Schwüre, blutige Opfer, Sklaverei und Luxus. Sie lebten insgesamt nach einer streng fixierten Ordensregel.6 Die Essener glaubten, Gott habe das ewige Schicksal der Menschheit vorbestimmt, und waren somit sozusagen Urcalvinisten.
Die Qumranleute nannten sich »Söhne des Lichts« und alle anderen Menschen, auch die Juden, »Söhne der Finsternis«. Diese geistliche Trennung galt nach ihrem Verständnis für immer und ewig.
Die Pharisäer
Die Pharisäer waren hauptsächlich in Jerusalem anzutreffen. Sie mussten hart arbeiten, weil sie im Gegensatz zu den Priestern keinen Zehnten bekamen. Laut Josephus gab es zur Zeit von Jesus etwa 6 0007 von ihnen.
Sie hatten zu Beginn des ersten Jahrhunderts keinen großen Einfluss auf die politische Entwicklung, aber im Laufe der ersten Hälfte wuchs ihr Einfluss auf das einfache Volk rasant, weil sie als Gruppe dem Volk am nächsten standen. Die Pharisäer nutzten fünf Jahrzehnte, um ein gutes Fundament für die Zukunft zu legen. Ihr Aufstieg zu einer politischen und religiösen Macht folgte erst viele Jahre später, nach der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahr 70 n. Chr.
Es gab damals zwei »Bibelakademien« in Jerusalem, die das sozial-religiöse Leben des jüdischen Volkes prägten: Beit Hillel und Beit Schammai.
Beim Lesen des Matthäus-Evangeliums fällt auf, dass Jesus seine Diskussionen am häufigsten mit Pharisäern führt. Er stand dieser Gruppe theologisch nah, weil die meisten Lehren der Pharisäer den Menschen helfen sollten, nach der Thora Gottes zu leben. Als Grundsatz dafür diente 5. Mose 30,16:
Ich fordere euch heute auf, den Herrn, euren Gott, zu lieben und seine Gebote, Gesetze und Vorschriften zu halten, indem ihr nach seinem Willen lebt. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land segnen, in das ihr nun zieht, um es zu erobern.
Die Pharisäer waren daher der Ansicht, dass der Sinn der Gebote Gottes der ist, die Menschen in ein Leben voller Segen zu führen.
Da die Pharisäer, mit wenigen Ausnahmen, aus bescheidenen Verhältnissen kamen, waren ihnen die praktischen Bedürfnisse des einfachen Volkes sehr nah. Ihre Auslegungen waren deshalb für die Menschen leicht verständlich.
Die Pharisäer versuchten, die Thora so zu interpretieren, dass es zu ihrer Zeit passte, denn sie gingen davon aus, dass Gebote und Regeln ein gewisses Update, eine Aktualisierung brauchen, wenn sich die Gegebenheiten ändern. Sie Pharisäer lehrten hauptsächlich über Barmherzigkeit, Liebe und Fairness, das waren die Säulen des Pharisäertums. Sie glaubten außerdem an eine kommende Welt und eine Belohnung für die Gerechten.
Heutzutage ist das Wort Pharisäer unter Christen negativ belegt. Von den meisten christlichen Theologen werden die Pharisäer benutzt, um sie Jesus und seiner Lehre als Kontrast gegenüberzustellen. Das Neue Testament zeigt uns jedoch ein anderes Bild. Jesus sagte: »Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet« (Matthäus 23,2-3; LUT). Jesus bekräftigt seine Worte durch die Verwendung von zwei Verben: »Das tut und haltet!« Damit unterstreicht er, dass die pharisäische Lehre im Wesentlichen gut ist.
Die Jesusbewegung und die Pharisäer
Die Juden, die Jesus nachfolgten, und die Pharisäer verkörperten vom religiösen Standpunkt her eine Art »pietistische« Erweckung. Beide strebten nach Gerechtigkeit, sie suchten nach dem Willen Gottes und wollten nach seinen Weisungen leben. Sie glaubten jedoch nicht nur an die Gerechtigkeit, sondern auch an die Gnade.
Außerdem hatten beide Bewegungen die gleiche Zielgruppe: Sie wandten sich hauptsächlich an das Am HaAretz, das einfache Volk. Auch die Botschaft war fast dieselbe: »Das Reich Gottes ist nahe.« Deswegen riefen sie das Volk in die Nachfolge.
Der wesentliche Unterschied zwischen ihnen lag darin, dass seine Nachfolger Jesus als Messias proklamierten und die meisten Pharisäer dies ablehnten.
Die Auseinandersetzungen zwischen ihnen waren jedoch anders als beispielsweise die Konfrontationen zwischen Christen und Muslimen. Es waren innerjüdische Streitgespräche, die für das Judentum typisch sind.
Ist Ihnen beim Lesen der Evangelien aufgefallen, dass Jesus von Pharisäern zu rituellen Mahlzeiten eingeladen wurde? Rituelle Mahlzeiten waren etwas Heiliges, man wählte sorgfältig aus, wen man dabeihaben wollte. Dies zeigt, dass Jesus als Ausleger geschätzt wurde.
Die meisten Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern im Lukasevangelium geschehen im Rahmen einer Zusammenkunft, wo sie über theologische Themen sprechen. In den Streitgesprächen kritisiert Jesus nicht die Lehre der Pharisäer allgemein, sondern nur einige Lehren mancher Pharisäer.8
Ein Begriff, der für die Pharisäer sehr wichtig war, ist Barmherzigkeit. In der Mischna9 steht:
Ein Sanhedrin, der einmal in einer Jahrwoche tötet, wird »Verderber« genannt. Rabbi El’azar ben Azaria sagt: Einmal in siebzig Jahren. Rabbi Tarfon und Rabbi Akiba sagen: Wenn wir im Sanhedrin gewesen wären, würde nie ein Mensch getötet werden.10
Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass für die Pharisäer Barmherzigkeit Priorität vor Gerechtigkeit hatte.
Die Schattenseiten der Pharisäer erfährt man am besten aus ihrer eigenen Feder. So steht im Talmud:
Der König Jannaj sprach zu seiner Frau: Fürchte weder die Pharisäer noch die Nichtpharisäer, sondern die Heuchler, die sich als Pharisäer ausgeben; sie begehen Handlungen wie die des Simri und verlangen Belohnung wie Pinhas.11
So etwas hätte auch Jesus sagen können, denn er übte scharfe Kritik an Heuchelei. Aber ist Heuchelei eine typisch pharisäische oder jüdische Eigenschaft? Ist es nicht eher ein Klischee und eine Form vom Antijudaismus, wenn man Pharisäer als Heuchler schlechthin darstellt? Ich denke, dass Jesus die Pharisäer für die Dinge tadelte, für die er heute auch viele Christen tadeln würde. Er kritisierte, dass sie nicht das lebten, was sie lehrten. Doch dies war ein Punkt, in dem die Pharisäer auch eine sehr scharfe Selbstkritik ausübten.12
Der große Bruch
Die Belagerung der Stadt Jerusalem und ihr Fall waren eine schreckliche Katastrophe für das jüdische Volk. Die Zeloten führten einen erbitterten Kampf sowohl gegen die Römer als auch gegen einige Gruppierungen aus dem eigenen Volk.
Nur zwei der oben genannten religiösen Gruppen überlebten die Katastrophe: die jesusgläubigen Juden und die Pharisäer.
Die Jesusnachfolger nutzten die Pause in der Belagerung und flohen nach Osten, genauer gesagt: in die Stadt Pella in Ostjordanien.13 Wahrscheinlich flohen sie nicht in erster Linie aus Angst, sondern folgten damit einem Befehl ihres Meisters:
Wenn ihr Jerusalem von Feinden umringt seht, dann wisst ihr, dass der Zeitpunkt seiner Zerstörung gekommen ist. Dann müssen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer in Jerusalem ist, soll flüchten, und wer sich außerhalb der Stadt befindet, soll nicht in ihr Schutz suchen.
Lukas 21,20-21
Weil sie keinen Widerstand gegen die Römer leisteten, wurden sie zu Volksverrätern erklärt – so wie auch Josephus Flavius14, allerdings passierte ihm das schon etwa drei Jahre früher, um 67 n. Chr.
Exkurs: Rabbi Jochanan ben Sakkai und die Etablierung des pharisäischen Judentums in Jawne
Im Neuen Testament gerät Jesus oftmals mit jüdischen Gelehrten aneinander. Seiner Auffassung nach sollte man behutsam mit der Wahl seiner Vorbilder umgehen, dies betrifft auch den Titel Lehrer. So gibt Jesus seinen Jüngern folgende Anweisung: »Lasst euch auch nicht ›Lehrer‹ nennen, denn es gibt nur einen Lehrer, und das ist der Christus« (Matthäus 23,10).
Warum tat er das?
Jesus wollte, dass seine Jünger Lernende bleiben und sich selbst als solche begreifen. Und so sehen wir in der Apostelgeschichte, dass keiner von ihnen als ein großer Rabbi oder Lehrer auftritt, sondern alle Jünger bleiben. Aber hinter der Aussage von Jesus steckt auch eine historische Begebenheit.
Um zu begreifen, welche Bedeutung ein jüdischer Lehrer oder Rabbi damals hatte, müssen wir kurz in die Geschichte zurückgreifen. Nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil und dem Aufbau des Zweiten Tempels (ca. 516 v. Chr.) begannen die Leiter des Volks, das Judentum neu zu begreifen. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Treue zu Gott und das Kennen und Tun seiner Worte die Voraussetzungen für einen Neubeginn seien.15 Zunächst war es die Aufgabe der Priester, das Volk zu lehren. Später übernahmen diese Aufgabe jedoch Lehrer, die man Rabbis nannte, zur Zeit von Jesus waren dies größtenteils Pharisäer.
David Bivin schreibt über den Begriff:
Rabbi ist Hebräisch und stammt von rav, was im biblischen Hebräisch viel, viele, große Anzahl, groß bedeutet. Selbst Regierungsbeamte und Armeeoffiziere wurden so angeredet. Zur Zeit Jesu war rav Titel für den Meister eines Sklaven oder Jüngers. Rabbi heißt wörtlich mein Meister, ein Terminus, mit dem Sklaven oder Jünger ihren Lehrer grüßten.16
Aber das war nicht immer so, beispielsweise ließen sich die bereits erwähnten Leiter Hillel und Schammai Anfang des ersten Jahrhunderts n. Chr. nicht Rabbi nennen. Das änderte sich nach der Zerstörung des Tempels. Einer, der diesen Wandel mitbewirkt hat, war Rabbi Jochanan ben Sakkai.
Ich mache diesen Exkurs zur Etablierung des pharisäischen Judentums in Jawne aus verschiedenen Gründen. Erstens liefert er eines meiner Hauptargumente dafür, wann das Matthäusevangelium geschrieben wurde. Zweitens zeigt diese Geschichte den historischen Hintergrund, auf dem sich die Jesusbewegung entwickelt hat. Und drittens ist es meiner Ansicht nach von Bedeutung, dass Gläubige etwas über die Menschen erfahren, die das Judentum im Wesentlichen geprägt haben. Einer von ihnen war Jochanan ben Sakkai, ein Schüler Hillels und Schammais. Er war ein wichtiger Leiter und einer der wenigen Gelehrten, die den Titel Rabban, das heißt der größte unter den anderen Rabbis,17 trugen. Sein Motto lautete: »Rühme dich nicht, wenn du viel im Gesetz geforscht hast, denn dazu wurdest du ja erschaffen.«18
Während der Belagerung der Stadt ließen die Kanaim (d. h. Eiferer, Zeloten) niemanden aus Jerusalem hinaus. Falls es doch jemandem gelang, die Stadt zu verlassen, wurde er draußen von den Römern getötet. Mit einer Ausnahme: Wer einen Toten begraben wollte, durfte die Stadttore passieren. Dies nutzte Rabban Jochanan ben Sakkai für einen genialen Fluchtplan. Er bat seine Schüler, das Gerücht zu verbreiten, er sei gestorben. Anschließend legten sie ihn in einen Sarg und brachten diesen bei Sonnenuntergang zu einem der Stadttore. Die Kanaim waren von Anfang an misstrauisch und wollten den Leichnam mit dem Schwert überprüfen. Aber die Jünger konnten sie überreden, dies nicht zu tun, und die Kanaim erlaubten ihnen, die Stadt zu verlassen. So entkam Rabban Jochanan aus Jerusalem, ein lebender Mann in einem hölzernen Sarg.
Rabban Jochanan ben Sakkai bat nun um ein Gespräch mit dem römischen General Vespasian. Er wurde vorgelassen und nannte ihn überraschend »Kaiser«. Zuerst wollte Vespasian ihn dafür töten, da dies einem Hochverrat gleichkam. Doch mitten in der Unterredung kam ein Bote und verkündigte: »Der Kaiser ist gestorben! Nun bist du der Kaiser!« Vespasian nahm daher die Worte von Rabban Jochanan ben Sakkai als Prophetie an und fragte, was er wolle.
Jochanan ben Sakkai bat um drei Dinge: »Ich bitte um die Verschonung der Nachkommen Hillels, um einen Arzt für meinen kranken Freund Gamliel und darum, das Städtchen Jawne und seine Gelehrten zu verschonen.«19
Die Wünsche wurden ihm erfüllt. Die Hochschule in Jawne wurde zu einem neuen Zentrum der Thora, des Lernens und des Lehrens und zu dem Ort, wo später der neue Sanhedrin20 entstand. Dadurch wurden die Thora und das ganze Wissen der jüdischen Weisen bewahrt.
Dank der Fürbitte von Jochanan ben Sakkai wurden außerdem viele Pharisäer vom Tod und von der Gefangenschaft verschont. Denn die meisten Pharisäer waren der Ansicht, dass es besser sei, für das Vaterland zu leben, als für es zu sterben.
Vor der Zerstörung des Tempels regierten die Priester das Volk. Nach der Zerstörung verschwanden sie jedoch aus der Geschichte und etwas später auch die Essener. Die Pharisäer waren die einzige Gruppe, die weiterhin auf das Volk Einfluss hatte. So verschob sich das Zentrum des geistlichen Lebens automatisch nach Galiläa. Dort wurde zum ersten Mal die jüdische mündliche Tradition schriftlich fixiert (Mischna Jehuda Ha Nassi) und dort entstand später der Jerusalemer Talmud, eines der bedeutendsten Schriftwerke, das die Gesetze der Thora auslegt. Dort in Jawne wurde Rabbi oder Rabbiner zu einem Titel für jüdische Gelehrte, während Rabbi vorher einfach eine Anrede war, vergleichbar vielleicht mit dem Begriff »Master«, der früher sowohl einen Meister als auch einen Leibesherrn bezeichnete, heute aber vor allem ein akademischer Titel ist. Wenn Jesus als Rabbi bezeichnet wurde, ist somit kein Funktionsträger in der Synagoge gemeint, da der Begriff zu seiner Zeit noch nicht auf diese Weise verwendet wurde.
Nachdem wir die verschiedenen religiösen Gruppen und ihre Prägung bis zum Jahr 90 n. Chr. betrachtet haben, können wir die Zeit, in der Matthäus sein Evangelium geschrieben hat, besser verstehen. Doch wann war das?
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
DAS EVANGELIUM NACH MATTHÄUS
Der Autor
Wenn wir ein Buch lesen, dann möchten wir gerne etwas über den Autor wissen: Was für ein Mensch war er? Woher kam er? Für wen schrieb er seinen Text ursprünglich? Das hilft uns, den Text tiefer zu verstehen.
Im Matthäusevangelium werden keine Angaben zum Verfasser gemacht, die traditionelle Theologie betrachtet jedoch Matthäus, den Jünger von Jesus, als Autor des Evangeliums, und ich schließe mich dieser Ansicht an.
Matthäus war ein Jude und der Sohn eines Mannes namens Alphäus. »Matthäus« ist die griechische Form des hebräischen Mattathias oder Mattitjahu, und bedeutet: »Gabe des Herrn« oder »Der Herr ist meine Gabe«.
Matthäus gehörte zum Kreis der zwölf Jünger. Die Evangelien beschreiben ihn als einen Zöllner und man geht davon aus, dass er mit Levi identisch ist.21 Zöllner waren zur Zeit von Jesus beim einfachen Volk nicht sehr beliebt, weil sie mit den Römern kooperierten und von den Überschüssen der Einnahmen lebten. Die Evangelien berichten, wie Jesus Matthäus direkt von der Arbeit im Zollhaus als Jünger beruft.22
In der Liste der Apostel wird Matthäus »der Zöllner« genannt. Dieser Beruf ging sicherlich mit gewissen Sprachkenntnissen einher, sodass ich annehme, dass er gebildet war. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass tatsächlich Matthäus derjenige ist, der die Reden von Jesus aufgeschrieben hat, die im Evangelium »Aussprüche des Herrn« genannt werden.
Seine Motivation
Was waren die Beweggründe von Matthäus, dieses Buch zu schreiben? Warum verfassen Menschen überhaupt Bücher?
Im Jahre 2014 begann ich, meine Biografie »Hilfe Jesus, ich bin Jude« zu schreiben. In diesem Buch erzähle ich unter anderem von meinem Briefwechsel mit einer älteren Frau, die mich bezüglich ihrer Geschichte im Dritten Reich angeschrieben hatte. Ihr letzter Brief gab mir den entscheidenden Impuls, mein Buch zu verfassen.
So schrieb sie unter anderem:
Ich hoffe, dass mein Bericht Sie angeregt hat, eventuell auch Ihren Lebensbericht »Meine Geschichte im Lichte des Holocaust« zu schreiben. Ich wünsche und hoffe, dass Sie das wirklich realisieren können. Denn solche Lebensgeschichten regen andere an, über ihr eigenes Leben nachzudenken.
Ich habe selbst öfter erlebt, dass durch Lebensberichte von anderen Gott zu mir gesprochen hat. Es können einfach lebendige Zeugnisse sein, durch die Gott spricht und handelt. Darum möchte ich Sie fast bitten: Tun Sie es, wenn Sie es irgend möglich machen können. Ich denke, es wäre für so manch einen wichtig, solch einen Lebensweg zu kennen. …
Ich bin aber auch gewiss, dass Sie selbst durch Ihren Bericht freigesetzt würden zu Neuem, zu neuen Erkenntnissen, neuen Schritten. Ja, ich bete darum, dass Sie es im Laufe der Zeit schaffen, Ihre Geschichte zu schreiben. Ich denke, es könnte eine wesentliche Aufgabe sein.23
Acht Jahre später, nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, bekam ich nun mehrere Impulse, das Buch »Hilfe Jesus, ich bin Jude« auf Russisch zu übersetzen. Im Angesicht der momentanen Situation, wo sehr viele Russisch bzw. Ukrainisch sprechende Flüchtlinge nach Deutschland kommen, glaube ich, dass ein solches Buch ihnen den Weg zur Integration und vor allem den Weg zu Jesus ebnen kann.
Ich denke, bei gläubigen Menschen ist es ein göttlicher Funke, der sie motiviert, das Erlebte zu reflektieren und aufzuschreiben. Doch was war der entscheidende Impuls für Matthäus? Was hat ihn dazu bewegt, sein Buch an sein Volk, in erster Linie an die Menschen in seiner Gemeinde zu richten?
Lassen Sie uns versuchen, in die Schuhe des Evangelisten zu schlüpfen und seine Absichten kennenzulernen. Die wichtigsten Gründe dafür, dass Matthäus sein einzigartiges Evangelium schreibt, sind meiner Meinung nach die folgenden:
• Um Israel und vor allem seiner Gemeinde Jesus als jüdischen Messias zu zeigen. Jesus als der verheißene Sohn Davids!
• Um das Dilemma zu lösen: Wie kann ein Jude an Jesus glauben und sein Volk nicht verraten? Wie kann er gleichzeitig Mose treu bleiben und Jesus nachfolgen?
• Um seine jüdischen Leser zu überzeugen, dass sie berufen sind, die Frohe Botschaft allen Völkern zu verkünden.
• Um nicht jüdische Leser mit dem jüdischen Hintergrund des Evangeliums vertraut zu machen.
Bevor ich diese vier wegweisenden Aspekte unter die Lupe nehme, möchte ich kurz auf die Unterschiede zum Markusevangelium eingehen, da diese ebenfalls Hinweise auf die Beweggründe von Matthäus liefern.
Matthäus konnte beim Verfassen seines Evangeliums höchstwahrscheinlich auf das Markusevangelium zurückgreifen, doch sein Text ist deutlich länger. Papias, Bischof von Hierapolis (60 bis etwa 160 n. Chr.) und ein Jünger des Apostels Johannes, erklärt, dass Markus zwar die Worte und Taten von Jesus anhand der Predigten von Petrus notiert hat, ihm aber die chronologische Abfolge fehlte:
Markus hat die Worte und Taten des Herrn, an die er sich als Dolmetscher des Petrus erinnerte, genau, allerdings nicht ordnungsgemäß, aufgeschrieben. Denn nicht hatte er den Herrn gehört und begleitet; wohl aber folgte er später, wie gesagt, dem Petrus, welcher seine Lehrvorträge nach den Bedürfnissen einrichtete, nicht aber so, dass er eine zusammenhängende Darstellung der Reden des Herrn gegeben hätte. Es ist daher keineswegs ein Fehler des Markus, wenn er einiges so aufzeichnete, wie es ihm das Gedächtnis eingab. Denn für eines trug er Sorge: nichts von dem, was er gehört hatte, auszulassen oder sich im Berichte keiner Lüge schuldig zu machen.24
Aus diesen und anderen Zeugnissen von Kirchenvätern lässt sich wie mit einzelnen Puzzlestücken rekonstruieren, wie das Evangelium von Matthäus entstanden ist: Markus schrieb sein Evangelium zuerst. Als Matthäus es las, merkte er wohl, dass es ein von Gott inspiriertes Dokument war, aber, salopp gesagt, fehlte ihm etwas.
Nach dem Zeugnis von Papias war Markus kein Apostel, sondern eine Art Sekretär von Petrus. Er verfasste sein Evangelium vermutlich in Rom. Wie in allen vier Evangelien liegt ein Schwerpunkt auf dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Doch es sind auch große Unterschiede zu den anderen Synoptikern erkennen. Beispielsweise erwähnt er ein wichtiges Thema nicht, das wir im Matthäusevangelium und in Auszügen im Lukasevangelium finden: die Lehre von Jesus, von der die Bergpredigt einen sehr großen Teil ausmacht.
Aufgrund der inhaltlichen Schwerpunkte kann man davon ausgehen, dass Markus sein Evangelium in erster Linie für Nichtjuden schrieb. Das zeigen Stellen wie die folgende:
Er (Jesus) sagte ihnen: »Wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt und wieder heiratet, begeht sie ebenfalls Ehebruch.«
Markus 10,11-12
Der erste Vers klingt ähnlich wie die entsprechenden Aussagen in Matthäus 5,32 und Lukas 16,18 und ist typisch für rabbinisch-halachische Anweisungen.25 Das heißt, Jesus legt an dieser Stelle keinen Bibelabschnitt aus, sondern gibt eine praktische Anweisung. Der zweite Vers, der bei Matthäus und Lukas fehlt, drückt dagegen den Gedanken aus, dass sich eine Frau auch von ihrem Mann scheiden lassen könnte. Nach römischem Recht war das damals möglich, aber nicht nach dem jüdischen. Das zeigt, dass das Markusevangelium sich nicht in erster Linie an Juden richtete. Somit gab es Bedarf für ein Evangelium, das den jüdischen Kontext berücksichtigt.
Folgende Merkmale weisen darauf hin, dass Matthäus bei seinem Evangelium genau darauf einen Schwerpunkt gelegt hat:
Die Geschlechtsregister und die Thoraauslegung
Das Geschlechtsregister und die Thoraauslegung von Jesus sind wichtige Elemente bei Matthäus. Für die damaligen Heiden hatten die jüdische Abstammung und die jüdischen Gesetze jedoch keine große Bedeutung.
Begriffe der jüdischen Theologie
Matthäus verwendet Begriffe, die nur für fromme Juden verständlich sind. Wenn er über Jerusalem spricht, sagt er beispielsweise »die Heilige Stadt« (Matthäus 4,5; LUT). Ir HaKodesch ist eine typisch jüdische Bezeichnung für Jerusalem und jeder Jude weiß, welche Stadt gemeint ist. Außerdem verwendet er den Ausdruck »Königreich« bzw. »Königsherrschaft des Himmels« (Matthäus 8,11; 20,1). Dieses Himmelreich wird unter dem Namen Malchut HaSchamaim26 unzählige Male in der jüdischen Literatur und Liturgie erwähnt und wurde von frommen Juden herbeigesehnt. Bei den anderen Evangelisten findet man diesen Ausdruck gar nicht, bei Matthäus im griechischen Neuen Testament dagegen 55-mal.
Hebraismen
Das Evangelium nach Matthäus enthält viele hebräische Ausdrücke, die nicht immer korrekt ins Griechische übersetzt wurden, sogenannte Hebraismen.27 Z. B. lesen wir in Matthäus 5,3 (LUT): »Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.« Meiner Meinung nach ist dieser Satz für uns Westeuropäer heute total missverständlich. Zum einen werden unter »geistlich Armen« oft Menschen verstanden, die irgendwie »nicht von dieser Welt« sind, und zum anderen versucht man, einen Spagat zu machen, indem man solchen Menschen das Himmelreich als Besitz zuordnet.
Der hebräische Ausdruck »Anjej Ruach« muss jedoch vor allem vor dem Hintergrund der Qumranschriften und der rabbinischen Literatur erklärt werden. Dort sind »geistlich Arme« Menschen, die demütig auf den Tag des Herrn warten und ständig auf das Kommen des Messias harren. Doch auch solche Menschen können das Reich des Himmels nicht besitzen, denn es gehört nicht den Menschen, sondern dem Schöpfer! Besser verstehen wir diese Aussage, wenn wir sie gemäß dem hebräischen Denken übersetzen, als »das Himmelreich besteht aus solchen wie diesen«. Es sind die Menschen, die Gottes Nähe suchen und darunter leiden, dass sie im Moment noch relativ fern von Gott sind (mehr dazu im Kapitel »Die Seligpreisungen« in Teil 3).28
Die Bedeutung des Schabbats
Die Gemeinde von Matthäus war sehr jüdisch-traditionell geprägt und legte einen großen Wert auf die Bedeutung des Schabbats. Auch hier wird ein Unterschied zwischen Matthäus und Markus deutlich. Bei Markus, der für Nichtjuden schreibt, lesen wir:
Es wird die Zeit kommen, da werdet ihr das abscheuliche Götzenbild, das den heiligen Ort entweiht, an dem Platz stehen sehen, an dem es nicht stehen darf. – Wer dies liest, der horche auf! – Dann müssen alle, die in Judäa leben, in die Berge fliehen. Wer draußen vor dem Haus ist, darf nicht ins Haus zurückgehen, um etwas mitzunehmen. Wer auf dem Feld ist, darf nicht mehr heimgehen, und sei es nur, um einen Mantel zu holen. Am schlimmsten wird es für die schwangeren Frauen und stillenden Mütter sein. Und betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht.
Markus 13,14-18
Die gleiche Aussage findet sich auch bei Matthäus. Aber er fügt noch etwas Wichtiges hinzu:
Betet darum, dass ihr nicht im Winter oder an einem Sabbat fliehen müsst.
Matthäus 24,20
Warum ist dieser Zusatz »oder an einem Sabbat« wichtig für Juden? Weil sie den Schabbat heiligen! Nach dem jüdischen Gesetz darf sich ein frommer Jude am Schabbat nicht mehr als einen Kilometer von seinem Wohnort entfernen. Als Grundlage dafür gilt 2. Mose 16,29:
Ich habe euch den siebten Tag, den Sabbat, als Ruhetag gegeben. Deshalb gebe ich euch am sechsten Tag Nahrung für zwei Tage. Am Sabbat sollt ihr zu Hause bleiben. Niemand soll an diesem Tag das Lager verlassen.
Wir lesen im Neuen Testament, dass diese Regel auch für Jesus und seine Jünger wichtig war:
Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt.
Apostelgeschichte 1,12; LUT
Die Leser von Matthäus, die jüdischen Jünger von Jesus, sollen dafür beten, dass sie nicht am Schabbat fliehen müssen, weil sie dann das Schabbatgebot brechen würden und zusätzlich ein schlechtes Zeugnis für andere Juden wären.
Diese Merkmale weisen unmissverständlich darauf hin, dass Matthäus die Juden ganz besonders im Blick hatte. Die Ergänzung bezüglich des Schabbats soll zeigen, dass Juden, die an Jesus glauben, auch Thoraobservant sind, das heißt, sich streng an die Regeln der Thora halten und keinen Wechsel zu einer anderen Religion vollzogen haben.
Gleichzeitig ist es eine wichtige Information an die Heidenchristen, die zeigt: Es gibt Gebote, die für die jüdischen Nachfolger sehr wichtig sind. Die nicht jüdischen Geschwister dürfen lernen, dass Juden und Nichtjuden in Gottes Plan unterschiedliche Berufungen haben und sich trotzdem als Geschwister annehmen sollen. Diese wertvolle Idee verdeutlicht Paulus sehr gut, wenn er schreibt: