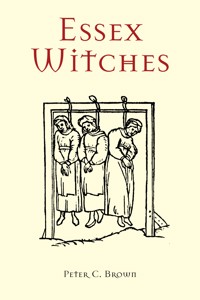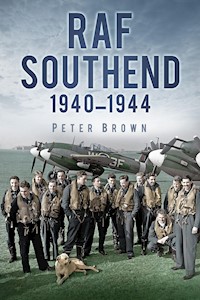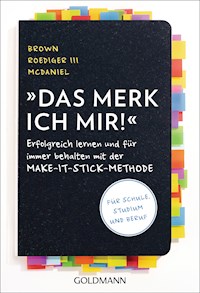
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das Standardwerk zum Thema Lernen.
Ohne es zu wissen, vertrauen die meisten von uns auf Lernstrategien, die alles andere als effektiv oder sogar kontraproduktiv sind.
Peter Brown, Henry Roediger und Mark McDaniel bieten ein völlig neues Verständnis davon, wie Lernen und Erinnerung funktionieren. Anhand neuester Erkenntnisse der kognitiven Psychologie zeigen sie konkrete Techniken, um Dinge wirklich zu verinnerlichen.
»Das merk ich mir« ist das unentbehrliche Werkzeug für Schüler, Studenten, Lehrer und alle, die nachhaltig lernen möchten. Einmal Erlerntes endlich für immer behalten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Ohne es zu wissen, vertrauen die meisten von uns auf Lernstrategien, die alles andere als effektiv oder sogar kontraproduktiv sind. Peter Brown, Henry Roediger und Mark McDaniel bieten ein völlig neues Verständnis davon, wie Lernen und Erinnerung funktionieren. Anhand neuester Erkenntnisse der kognitiven Psychologie zeigen sie konkrete Techniken, um Dinge wirklich zu verinnerlichen. »Das merk ich mir!« ist das unentbehrliche Werkzeug für Schüler, Studenten, Lehrer und alle, die nachhaltig lernen und lehren möchten. Einmal Erlerntes endlich für immer behalten!
Autoren
Peter C. Brown ist Autor und lebt in St. Paul, Minnesota.
Henry L. Roediger III ist Professor für Psychologie an der Washington University in St. Louis.
Mark A. McDaniel ist Professor für Psychologie und Direktor des Center for Integrative Research on Cognition, Learning, and Education (CIRCLE) an der Washington University, St. Louis.
Peter C. Brown; Prof. Dr. Henry L. Roediger III; Prof. Dr. Mark A. McDaniel
Das merk ich mir!
Erfolgreich lernen und für immer behalten mit der Make-it-stick-Methode
Aus dem Amerikanischen von Imke Brodersen
Die englische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Make it stick: The science of successful learning« bei The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA.Alle Ratschläge in diesem Buch wurden von den Autoren und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autoren beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Deutsche Erstausgabe Dezember 2019Copyright © 2014 der Originalausgabe: Peter C. Brown; Henry L. Roediger III; Mark A. McDaniel Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlag: Uno Werbeagentur, München · Umschlagmotiv: getty images/MirageC
Satz: Fotosatz Amann, Memmingen
ISBN 978-3-641-24674-7V001Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Erinnerung ist die Mutter aller Weisheit.
Aischylos
Der gefesselte Prometheus
Inhalt
Vorwort
1. Lernen geht anders
2. Und … Zugriff!
3. Wie üben künftige Meister?
4. An Schwierigkeiten wachsen
5. Ich glaube, das weiß ich
6. Alles eine Frage des Lernstils?
7. Besser lernen
8. Das merke ich mir!
Quellen und Anmerkungen
Zum Weiterlesen
Danksagung
Schlagwortverzeichnis
Vorwort
Beim Lernen gehen die meisten Menschen intuitiv vor – und damit oftmals auf die falsche Weise. Empirische Untersuchungen zur Frage, wie wir lernen und uns erinnern, belegen, dass viele angeblich bewährte Vorgehensweisen verschenkte Liebesmüh sind. Selbst im Studium, wo das Lernen im Mittelpunkt steht, bauen sogar Medizinstudenten auf längst überholte Lerntechniken. Gleichzeitig hat dieses Forschungsgebiet – das schon 125 Jahre alt ist – in neuerer Zeit erhebliche Fortschritte gemacht und eine Vielzahl neuer Erkenntnisse hervorgebracht, auf denen die Lernwissenschaft heute fußt. Dabei handelt es sich um höchst effektive, evidenzbasierte Strategien, die weniger effektive, aber weithin etablierte Praktiken ablösen sollen, die auf Theorie, Überlieferung und Intuition fußen. Der Haken daran: Die effektivsten Lernstrategien sind nicht intuitiv.
Zwei Autoren unseres Teams, Henry Roediger und Mark McDaniel, sind Kognitionswissenschaftler, die sich ständig mit Fragen zum Lernen und zum Gedächtnis befassen. Der Dritte im Bunde, Peter Brown, kann Geschichten erzählen. Gemeinsam wollen wir erklären, wie Lernen und Gedächtnis funktionieren, und dazu wollen wir nicht unbedingt Studien zitieren, sondern vor allem Geschichten erzählen – von Menschen, die gelernt haben, wie man sich komplexes Wissen und die dazugehörenden Fähigkeiten aneignet. Anhand dieser Beispiele arbeiten wir die Lernprinzipien heraus, die sich in Untersuchungen als hocheffektiv erwiesen haben. Teile dieses Buch entstanden durch die Zusammenarbeit von elf Kognitionspsychologen. 2002 vergab die James S. McDonnell Foundation aus St. Louis, Missouri, eine Reihe Forschungsstipendien für die Frage, wie man mithilfe der Erkenntnisse aus der kognitiven Psychologie ganz konkret Lernprozesse verbessern kann. Diese Gelder, mit denen die Kluft zwischen Wissenschaft und praktischer Umsetzung geschlossen werden sollte, wurden Roediger, McDaniel und neun weiteren Wissenschaftlern zuerkannt, wobei Roediger der federführende Kopf war. Zehn Jahre lang widmete sich das Team der Übertragung von Ergebnissen aus der Kognitionswissenschaft in die Unterrichtswissenschaft, und in vielerlei Hinsicht stützt sich dieses Buch unmittelbar auf diese Arbeit. Die Beteiligten und viele ihrer Studien werden im Buch, den Anmerkungen und unserer Danksagung erwähnt. Roedigers und McDaniels Arbeit wird auch von diversen anderen Geldgebern unterstützt, und McDaniel ist Co-Director am Zentrum für Integrative Lern- und Gedächtnisforschung der Washington University.
Bücher sind normalerweise thematisch gegliedert, das heißt, sie befassen sich erst mit dem einen Thema, dann mit dem nächsten und so weiter. Auch wir sprechen in jedem Kapitel neue Themen an, setzen aber zugleich zwei Grundprinzipien der Lerntheorie praktisch um: Kernpunkte werden in gewissen Abständen wiederholt, und wir betrachten unterschiedliche Aspekte, die jedoch miteinander zusammenhängen. Wer sich beim Lernen gründlich mit einem Thema befasst und in bestimmten Abständen darauf zurückkommt, erinnert sich später besser daran. Dies gilt auch, wenn sich verschiedene Themen beim Lernen abwechseln – am Ende beherrscht man jedes einzelne besser, als wenn man die Themen nacheinander lernt. Daher sprechen wir die Kernpunkte mehrfach an und wiederholen die Prinzipien im gesamten Buch in unterschiedlichen Zusammenhängen. Auf diese Weise prägt sich das Gelesene besser ein und lässt sich leichter umsetzen.
Es geht in diesem Buch darum, was man persönlich tun kann, um besser zu lernen und sich länger an das Gelernte zu erinnern. Denn letztlich liegt die Lernmethode in der eigenen Verantwortung. Aber auch Lehrer, Trainer und Berater können erfolgreicher arbeiten, indem sie diese Prinzipien im Unterricht, im Training oder in der Beratung vermitteln und bei der Wahl der Lehrmethode berücksichtigen. Es geht in diesem Buch nicht um Reformen der Bildungspolitik oder des Schulsystems, auch wenn sich natürlich einiges dazu ableiten ließe. Zum Beispiel experimentieren College-Professoren ausgesprochen erfolgreich mit der Umsetzung dieser Strategien in ihrem Unterricht, um Wissenslücken in den Naturwissenschaften zu schließen.
Natürlich schreiben wir für Studierende und Lehrkräfte, aber auch für alle, denen viel an effektiven Lernprozessen liegt: Berater in Industrie, Wirtschaft und Militär, Vorstände von Berufsverbänden, die ihren Mitgliedern berufsbegleitende Weiterbildung anbieten, und Coaches. Ebenso schreiben wir für Lernwillige mittleren Alters oder ältere Semester, die ihre Fähigkeiten ausbauen möchten, um am Ball zu bleiben.
Auch wenn in Bezug auf das Lernen und seine neuronalen Grundlagen noch viel Forschungsbedarf besteht, schälen sich aus diversen bisherigen Studien doch bestimmte Prinzipien und Strategien heraus, die sich ohne Zusatzkosten sofort und sehr wirkungsvoll in die Tat umsetzen lassen.
I.
Lernen geht anders
Matt Brown besaß seinen Pilotenschein noch nicht allzu lange, als er eine zweimotorige Cessna jenseits von Harlingen, Texas, nach Nordosten flog und plötzlich bemerkte, dass am rechten Motor der Öldruck abfiel. Es war Nacht, und er war in 11 000 Fuß Höhe allein unterwegs, um dringend benötigte Fertigungsteile nach Kentucky zu liefern, wo in einer Fabrik die Produktion stillstand.
Matt ging tiefer, behielt die Anzeige im Auge und hoffte, auf diese Weise bis zum geplanten Zwischenstopp in Louisiana durchzuhalten. Dort wollte er ohnehin nachtanken und könnte der Sache auf den Grund gehen. Aber der Druck fiel weiter ab. An Kolbenmotoren hatte Matt herumhantiert, seit er alt genug war, um einen Schraubenschlüssel zu halten. Daher wusste er, dass er ein Problem hatte. Innerlich ging er seine Checkliste durch. Was konnte er tun? Wenn der Öldruck zu weit absank, riskierte Matt einen Kolbenfresser. Wie weit durfte er noch fliegen, ehe er diesen Motor abschalten musste? Und was würde dann geschehen? Ihm würde rechts der Auftrieb fehlen, aber konnte er damit weiterfliegen? Er rief sich die Toleranzen ins Gedächtnis, die er für die Cessna 401 auswendig gelernt hatte. Mit Ladung konnte man mit nur einem Motor bestenfalls das Absinken verlangsamen. Andererseits hatte er nur eine leichte Ladung und auch schon einen Großteil seines Kraftstoffs verbrannt. Daher stellte er den gefährdeten rechten Motor ab, stellte den Propeller auf Segelstellung, um den Luftwiderstand zu verringern, gab links mehr Gas, flog mit dem gegenüberliegenden Ruder und schleppte sich noch die zehn Meilen zu seinem Zwischenstopp. Dort wählte er für den Landeanflug eine weite Linkskurve – aus dem einfachen, aber entscheidenden Grund, dass er ohne den rechten Motor nur über eine Linkskurve noch den nötigen Auftrieb hatte, um seine Maschine beim Landen sauber aufsetzen zu lassen.
Wir müssen nicht jeden einzelnen Punkt verstehen, den Matt damals umsetzte – wichtig war, dass er es verstand. Wie er sich in dieser prekären Lage zu helfen wusste, beschreibt, was wir in diesem Buch meinen, wenn wir von »Lernen« sprechen: Für uns bedeutet Lernen, dass man sich Wissen und Kenntnisse aneignet, die das Gedächtnis bereitwillig wieder abspult, um künftig auftretende Probleme oder Möglichkeiten zu verstehen.
Auf gewisse unveränderliche Aspekte des Lernens können wir uns vermutlich alle verständigen:
Erstens ist Lernen nur von Nutzen, wenn wir das Gelernte so abspeichern, dass es bei Bedarf abrufbar ist.
Zweitens müssen wir unser Leben lang weiterlernen und uns erinnern. Ohne ein gewisses Grundwissen in Sprachen, Musik, Kunst, Mathematik, den Naturwissenschaften und den Gesellschaftswissenschaften kommen wir in der Mittelstufe nicht weiter. Um beruflich voranzukommen, gilt es, die Anforderungen des eigenen Jobs zu bewältigen und mit Konflikten im Kollegenkreis fertigzuwerden. Im Ruhestand wenden wir uns neuen Interessensgebieten zu. Auf die alten Tage ziehen viele in eine seniorengerechte Umgebung um, solange sie noch anpassungsfähig genug sind. Lernfähigkeit zahlt sich somit lebenslang aus.
Und drittens ist Lernen eine erworbene Fähigkeit, und die optimalen Lernstrategien sind vielfach kontraintuitiv.
Unsere Grundthesen in diesem Buch
Mit dem eben genannten dritten Punkt sind Sie vielleicht spontan nicht einverstanden, doch wir hoffen, dass wir Sie noch überzeugen können. An dieser Stelle möchten wir kurz und knapp einige grundlegende Thesen auflisten, auf die sich diese Aussage stützt und auf die wir in den nachfolgenden Kapiteln ausführlicher eingehen werden.
Der Lernprozess verläuft gründlicher und nachhaltiger, wenn er Mühe macht. Müheloses Lernen ist, wie in den Sand zu schreiben – heute ist es da, morgen verschwunden.
Wir können schlecht beurteilen, wann wir gut lernen und wann nicht. Wenn es schwieriger und langsamer wird und wir das Gefühl haben, nicht voranzukommen, fühlen wir uns zu Strategien hingezogen, die uns ergiebiger erscheinen, ohne zu ahnen, dass sie häufig nur vorübergehend von Nutzen sind.
Wiederholtes Lesenundintensives Trainieren von bestimmten Fähigkeiten oder neuem Wissen zählen bei Lernenden aller Couleur zu den bevorzugten Lernstrategien, sind aber leider auch ausgesprochen unproduktiv. Unter intensivem Üben verstehen wir das schnelle, sture Wiederholen von etwas, das man sich unbedingt einprägen möchte, also der klassische Grundsatz »Üben, Üben, Üben«. Ein Beispiel dafür ist das klassische Pauken vor einer Prüfung. Wenn man etwas immer wieder liest und übt, erscheint einem der Stoff bald geläufig, und das wird leicht mit Können verwechselt. Doch für echtes, dauerhaftes Wissen sind solche Strategien weitgehend Zeitverschwendung.
Effektiver als nochmaliges Durchlesen ist bewusstes Abrufen, mit dem wir Fakten, Konzepte oder Ereignisse aus dem Gedächtnis kramen. Ein gutes Beispiel hierfür sind Lernkarten. Bewusstes Abrufen unterstützt das Gedächtnis und unterbricht das Vergessen. Schon ein einziges einfaches Lernquiz nach dem Lesen eines Textes oder dem Anhören eines Vortrags verstärkt den Lernerfolg und die Erinnerung mehr, als den Text noch einmal zu lesen oder die eigenen Notizen durchzugehen. Unser Gehirn ist zwar kein Muskel, der durch Üben mehr Kraft aufbaut, aber die neuronalen Verknüpfungen, in denen die Lernerfahrung gespeichert ist, werden stabiler, wenn die Erinnerung angezapft und das Gelernte angewendet wird. Regelmäßiges Abrufen stärkt die Signalwege für diese Erinnerung, und das ist entscheidend, um das gewünschte Wissen langfristig zu behalten.
Durch zeitlich verteilte Übungseinheiten gerät das Gelernte etwas in Vergessenheit, und wenn man zwei oder mehr Fächer abwechselnd übt, fällt das Abrufen schwerer und erscheint weniger produktiv, aber am Ende sitzt der Stoff auf Dauer und lässt sich später vielseitiger umsetzen.
Die Suche nach eigenen Lösungsansätzen, bevor einem die Lösung erklärt wird, erleichtert das Lernen, selbst wenn einem beim eigenständigen Vorgehen Fehler unterlaufen.
Die verbreitete Vorstellung, dass wir besser lernen, wenn die Präsentation des Stoffs unserem bevorzugten Lernstil entspricht – zum Beispiel dem auditiven oder visuellen Lerntyp –, ist empirisch nicht belegt. Vielmehr greifen Menschen beim Lernen auf unterschiedliche Intelligenzformen zu, und man lernt am besten, wenn man in einem breiten Ansatz alle eigenen Fähigkeiten und Stärken einbezieht, statt sich nur in der Form unterweisen zu lassen, die einem am angenehmsten erscheint.
Wenn Sie in der Lage sind, die Grundprinzipien oder »Regeln« unterschiedlicher Problemstellungen zu erfassen, können Sie in ungewohnten Situationen erfolgreicher die passende Lösung wählen. Diese Fähigkeit lässt sich durch Themenwechsel leichter erwerben als durch intensives Pauken. Zum Beispiel unterstützen abwechselnde Übungen zur Volumenberechnung unterschiedlicher geometrischer Körper die Fähigkeit, später bei einem beliebigen Körper den passenden Lösungsansatz zu wählen. Abwechselnd verschiedene Vogelarten oder die Werke verschiedener Maler zu identifizieren, verbessert nicht nur die Fähigkeit, gleiche Eigenschaften innerhalb einer Art zu erfassen und unterschiedliche Arten zu unterscheiden, sondern auch die Fähigkeit, später neue Exemplare zu kategorisieren.
Menschen sind anfällig für Illusionen, die unser Urteilsvermögen über das, was wir wissen oder wozu wir in der Lage sind, trüben können. Tests tragen dazu bei, das tatsächlich Gelernte genauer einzuschätzen. Ein Pilot, der im Flugsimulator auf einen Fehler im hydraulischen System reagieren muss, merkt schnell, ob er die entsprechenden Maßnahmen beherrscht oder nicht. Bei praktisch allen Lernprozessen werden wir besser, wenn wir anhand von Probedurchläufen unsere Schwächen ermitteln und beheben können.
Neue Lernerfahrungen fußen immer auf vorhandenem Grundwissen. Man lernt zuerst, wie man eine zweimotorige Maschine regulär auf den Boden bringt, ehe man lernt, wie das auch mit nur einem Motor klappt. Um Trigonometrie zu lernen, brauchen wir gewisse Grundlagen aus Algebra und Geometrie. Wer einen Schrank bauen will, muss die Eigenschaften von Holz und Holzleim kennen und wissen, wie man Bretter zusammenfügt, Leisten setzt, Kanten abschmirgelt und mit Gehrungen umgeht.
In einem Cartoon des Far-Side-Zeichners Gary Larson fragt ein Junge mit hervorquellenden Augen seinen Lehrer: »Mister Osborne, darf ich kurz raus? Mein Hirn ist voll!« Bei rein mechanischem Pauken stößt das Gehirn tatsächlich schnell an die Grenze seines Fassungsvermögens. Wenn man jedoch die Methode der Elaboration wählt, gibt es für das Lernen praktisch kein Limit. Elaboration bedeutet, dass man neuem Stoff Bedeutung zuweist, indem man ihn mit eigenen Worten ausdrückt und mit dem verknüpft, was man bereits weiß. Je besser Sie den Zusammenhang zwischen dem neu Gelernten und dem vorhandenen Wissen erklären können, desto klarer begreifen Sie den neuen Stoff, und je mehr Querverbindungen Sie erkennen, desto leichter können Sie sich später daran erinnern. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Um dies mit der eigenen Erfahrung zu verknüpfen, können Sie daran denken, wie das Wasser aus einer Klimaanlage tropft oder wie ein brütend heißer Sommertag sich nach einem kurzen Gewitter abkühlt. Verdunstung hat eine kühlende Wirkung. Ein schwülwarmer Tag in Atlanta erscheint einem deshalb heißer als die trockene Hitze von Arizona, wo der Schweiß verdampft, noch ehe die Haut feucht wird. Das Prinzip der Wärmeübertragung lässt sich ebenfalls anhand von Erfahrungen nachvollziehen: Wärmeleitung (Diffusion) entspricht der heißen Tasse Kakao, die unsere Hände wärmt; Wärmestrahlung (Radiation) erlebt man, wenn die Sonne im Winter ins Wohnzimmer fällt; Wärmeströmung (Konvektion) stammt aus der lebensrettenden Klimaanlage, wenn unser Gastgeber in Atlanta uns gemächlich durch seine Lieblingsgassen lotst.
Neues Wissen in einen größeren Zusammenhang einzubetten unterstützt das Lernen. Je mehr historische Zusammenhänge jemand beispielsweise kennt, desto leichter lassen sich neue Einzelheiten lernen. Und je mehr Bedeutungen wir der einzelnen Geschichte zuordnen, indem wir sie beispielsweise mit unserem Verständnis von menschlichem Ehrgeiz oder den Zufällen des Schicksals verbinden, desto besser können wir sie uns merken. Auch der Versuch, etwas so Abstraktes wie das Prinzip des Drehimpulses zu verstehen, fällt leichter, wenn man es mit etwas Konkretem verbindet, das man bereits kennt, zum Beispiel der Art und Weise, wie eine Eiskunstläuferin sich immer schneller um die eigene Achse dreht, sobald sie die Arme vor die Brust legt.
Menschen, die gelernt haben, wie man neuem Stoff die Kernpunkte entnimmt und daraus ein mentales Modell erstellt, das man mit vorhandenem Wissen verknüpft, können beim Lernen leichter komplexe Themen meistern. Ein mentales Modell ist eine mentale Darstellung einer externen Realität.1 Denken Sie an einen Baseballspieler, der schlagbereit seinen Einsatz erwartet. Ihm bleibt nur ein winziger Moment, um zu erkennen, ob ein Curveball, ein Change-up oder ein anderer Wurf auf ihn zufliegt. Wie macht er das? Es gibt einige hilfreiche Signale, zum Beispiel, wie der Pitcher ausholt, wie er wirft oder wie sich die Nähte des Balls drehen. Ein guter Schlagmann blendet alle Ablenkungen aus, um nur noch diese Variationen wahrzunehmen, und erzeugt durch Üben für jede Art Wurf ein bestimmtes mentales Modell, das auf unterschiedlichen Hinweisreizen basiert. Diese Modelle verknüpft er mit dem, was er über seine Schlaghaltung, die Schlagzone und seine Schlagmöglichkeiten weiß, um den Ball optimal zu erwischen. Parallel dazu bezieht er mentale Modelle bei den Positionen der Spieler ein: Wenn er Teammitglieder auf Base 1 und 2 hat, opfert er den Schlag vielleicht, um seine Spieler weiterzuschicken. Hat er seine Leute auf Base 1 und 3, und dazwischen fehlt jemand, darf er keinen Double Play zulassen, muss aber dennoch so treffen, dass der Läufer punkten kann. Seine mentalen Modelle der Spielerpositionen verbinden sich mit seinen Modellen von der gegnerischen Mannschaft (spielen sie tief oder flach?) und mit den Signalen, die ihn von der Spielerbank aus über die Base Coaches erreichen. Bei einem hervorragenden Schlag fügen sich all diese Elemente nahtlos ineinander: Der Schlagmann trifft den Ball und platziert ihn so geschickt, dass ihm genug Zeit bleibt, die erste Base zu erreichen und seine Läufer vorrücken zu lassen. Ein gewiefter Spieler weiß, an welchen Elementen er die unterschiedlichen Wurfarten erkennt und wie er darauf reagieren muss, hat aus dieser Erfahrung heraus mentale Modelle entwickelt und kann diese Modelle mit seinen sonstigen unverzichtbaren Fähigkeiten für dieses komplexe Spiel verbinden. Das unterscheidet ihn von einem weniger erfahrenen Spieler, der die zahllosen, sich ständig verändernden Informationen, die bei jedem Betreten der Home Plate auf ihn einstürmen, nicht durchschaut.
Viele Menschen glauben, intellektuelle Fähigkeiten stünden von Geburt an fest. Wenn sie beim Lernen an einer Hürde scheitern, sehen sie darin einen Hinweis auf ihre angeborenen Fähigkeiten. Aber das Gehirn verändert sich, wann immer wir etwas Neues lernen, und wir speichern das, was wir unseren Erfahrungen entnehmen. Zu Beginn des Lebens müssen wir uns tatsächlich auf unsere Gene verlassen, aber erst das Lernen und die Entwicklung mentaler Modelle, die uns zu Schlussfolgerungen, Lösungsansätzen und neuen Ideen befähigen, machen uns kompetent. Die Elemente, die unsere intellektuellen Fähigkeiten formen, unterliegen somit in erstaunlichem Ausmaß der eigenen Kontrolle. Dies zu begreifen versetzt uns in die Lage, Scheitern als Zeichen für einen ernsthaften Versuch und als Quelle für nützliche Informationen zu betrachten: Wir müssen entweder tiefer schürfen oder zu einer anderen Strategie übergehen. Das heißt, wir müssen auch verstehen, dass wir wichtige Arbeit leisten, wenn uns das Lernen schwerfällt. Wer sein gegenwärtiges Leistungsniveau ausbauen und übertreffen will, muss erkennen, dass es ohne neue Anläufe und Rückschläge nicht geht – wie es jedes Video-Action-Game und jeder neue BMX-Rad-Stunt beweist. Über Fehler und Fehlerbehebung bauen wir die Brücken zu fortgeschrittenen Lernerfahrungen.
Empirische Daten versus Theorie, Überlieferung und Intuition
Lehre und Training basieren bis heute weitgehend auf tradierten Lerntheorien, die von dem beeinflusst werden, was uns persönlich offenbar geholfen hat, also unseren individuellen Erfahrungen im Unterricht oder im Training oder einfach als Menschen auf dieser Erde. Beim Lernen wie beim Lehren stützen wir uns auf eine Mischung aus Theorie, Überlieferung und Intuition. In den letzten vierzig Jahren hat die kognitive Psychologie jedoch viele Daten zu der Frage gesammelt, was wirklich funktioniert, und Strategien ermittelt, die tatsächlich helfen.
In der kognitiven Psychologie wird mit wissenschaftlichen Methoden erforscht, wie unser Verstand funktioniert, indem Daten zur menschlichen Wahrnehmung, zum Erinnern und zu Denkprozessen erhoben werden. Doch auch viele andere Sparten arbeiten am Rätsel des Lernens. Die Entwicklungs- und Erziehungspsychologie befasst sich mit Theorien zur menschlichen Entwicklung und der Frage, wie sie zu besseren Bildungsmaßnahmen beitragen kann, ob Testverfahren, Lernorganisation (zum Beispiel Übersichten und Schemata) oder Lernmaterial für bestimmte Schülergruppen wie Förderschüler oder Hochbegabte. Die Neurowissenschaft erweitert über neue Bildgebungsverfahren und andere Werkzeuge unser Verständnis für die Abläufe im Gehirn, die Lernprozessen zugrunde liegen, auch wenn wir noch längst nicht wissen, inwiefern wir durch diese Erkenntnisse die Ausbildung verbessern können.
Wonach sollte man also beurteilen, welche Ratschläge zum optimalen Lernerfolg verhelfen?
Am besten erhalten Sie sich eine gesunde Skepsis. Ratschläge sind immer nur wenige Mausklicks entfernt. Aber bei weitem nicht jeder Rat ist wissenschaftlich belegbar. Und nicht alles, was als Studie durchgeht, entspricht wissenschaftlichen Standards, denen zufolge die Ergebnisse unter entsprechenden Kontrollbedingungen tatsächlich objektiv und verallgemeinerbar sind. Die besten empirischen Studien sind experimenteller Natur: Das Team stellt eine Hypothese auf, die es anhand von Experimenten überprüft, an deren Design und Objektivität strenge Kriterien angelegt werden. In den folgenden Kapiteln haben wir die Ergebnisse einer großen Anzahl Studien zusammengefasst, die vor der Veröffentlichung in Wissenschaftsjournalen der Überprüfung durch andere Wissenschaftler standhalten konnten. An einigen dieser Studien (jedoch bei weitem nicht allen) haben wir mitgearbeitet. Wenn wir keine wissenschaftlich überprüften Ergebnisse anführen, sondern uns auf Theorien berufen, sagen wir dies dazu. Zur Veranschaulichung verwenden wir neben geprüften Daten Anekdoten von Personen wie Matt Brown, die beruflich komplexes Wissen und komplexe Fähigkeiten kombinieren müssen. Diese Geschichten illustrieren die Grundprinzipien unseres Lernens und unseres Erinnerungsvermögens. Diskussionen zu den Studien selbst beschränken wir auf ein Minimum. Viele sind jedoch in den Anmerkungen und Quellen im Anhang aufgeführt – für alle, die weiterlesen möchten.
Lernen wird missverstanden
Offenbar ist vieles von dem, was Menschen beim Lernen und Unterrichten seit jeher tun, keineswegs zweckdienlich, doch mitunter können schon vergleichsweise kleine Änderungen viel bewirken. Die meisten Menschen glauben, dass sich Wissen – also beispielsweise ein Abschnitt aus dem Lehrbuch oder bestimmte Fachbegriffe aus dem Biologieunterricht – in das Gedächtnis einbrennt, wenn man es nur oft genug wiederholt. Aber das stimmt nicht. Viele, die unterrichten, glauben, dass ihre Schüler und Schülerinnen besser lernen, wenn sie den Stoff in einfachen, gut verständlichen Häppchen darbieten. Doch die Forschung stellt diese Überzeugung auf den Kopf: Je mehr wir um das neue Wissen ringen, desto länger und fester bleibt es im Gedächtnis. Lehrer und Trainer sind häufig der Ansicht, dass man eine neue Fertigkeit am effektivsten meistert, indem man sich stur darauf konzentriert, sie so lange zu üben, bis man sie in- und auswendig kann. Diese Überzeugung ist tief in uns verankert, denn in der Lernphase des unablässigen Übens kommen die meisten schnell voran. Studien belegen jedoch, dass Fortschritte, die durch stures Pauken erzielt wurden, vorübergehend sind und rasch verpuffen.
Dass das wiederholte Lesen von Lehrbüchern häufig vergebliche Liebesmüh ist, sollte Ausbilder wie Lernwillige erschauern lassen, denn immerhin greifen die meisten Menschen (Umfragen zufolge über 80 Prozent der College-Studenten) zu dieser Methode. Wer Lernzeit einplant, denkt dabei normalerweise an das Lesen im Lehrbuch. Gegen mehrfaches Lesen sprechen drei Argumente: Es frisst Zeit. Das Gelesene geht nicht ins Langzeitgedächtnis über. Und häufig führt diese Methode zu einer unbewussten Selbsttäuschung, denn da der Text so vertraut klingt, hat man das Gefühl, den Inhalt zu beherrschen. Die Stunden, in denen man sich ins erneute Lesen vertieft, wirken wie wahrer Fleiß, doch die investierte Zeit ist kein Maßstab für echtes Können.2
Dabei gibt es längst Trainingsformen, die auf der Überzeugung fußen, dass Lernen unter möglichst realistischen Bedingungen erfolgen sollte. Denken Sie noch einmal an unseren Piloten, Matt Brown. Als Matt von Propellermaschinen zu Businessjets überging, musste er sich ein völlig neues Wissensgebiet und eine erweiterte Pilotenlizenz erarbeiten. Wir baten ihn, uns den Ablauf zu beschreiben. Sein Arbeitgeber schickte ihn auf einen 18-tägigen Intensivkurs mit zehn Stunden Ausbildung pro Tag, bei dem es sofort zur Sache ging. Die ersten sieben Tage wurden den Teilnehmern alle Systeme des neuen Fliegers »eingetrichtert«: Elektrik, Kraftstoff, Pneumatik und so weiter. Sie lernten, wie diese Systeme funktionieren und interagieren, und mussten sich die Sicherheitstoleranzen für Druck, Gewicht, Temperatur und Geschwindigkeit einprägen. In der Luft muss Matt rund 80 verschiedene Handgriffe beherrschen, die ohne Zögern oder Nachdenken automatisch ausgeführt werden müssen, um das Flugzeug zu stabilisieren, sobald eines von diversen denkbaren Ereignissen eintritt, ein plötzlicher Druckabfall, eine unerwartete Schubumkehr während des Fluges, ein Triebwerksausfall oder ein Brand in der Elektrik.
Viele Stunden starrten Matt und die anderen Piloten auf einschläfernde PowerPoint-Präsentationen zu den wichtigsten Systemen ihrer Maschine. Dann geschah etwas Interessantes.
»Ungefähr nach der Hälfte von Tag fünf«, sagte Matt, »blenden sie eine Darstellung des Kraftstoffsystems ein, mit den Drucksensoren, den Abstellventilen, den Wasserstrahlpumpen, den Bypassleitungen und so weiter. Es fällt einem schwer, sich da noch zu konzentrieren. Dann fragt uns der eine Ausbilder: ›Hat bei einem von euch schon einmal im Flug das Warnsignal für den Kraftstofffilter-Bypass aufgeleuchtet?‹ Und ein Pilot auf der anderen Seite hebt die Hand. Der Ausbilder sagt: ›Erzähl uns, was da passiert ist‹, und plötzlich denkst du: Verdammt, was würde ich da tun? Dieser Kerl also war auf 33 000 Fuß oder so und stand kurz davor, beide Triebwerke zu verlieren, weil sein Flugbenzin keinen Frostschutz hatte und seine Filter sich mit Eis zusetzten. Wer so etwas hört, für den erwacht das Schema zum Leben. Glaub mir, das merkt man sich! Flugbenzin kann einen geringen Wasseranteil haben, und wenn es in großer Höhe kalt wird, kondensiert dieses Wasser, kann gefrieren und den Schlauch blockieren. Ab da vergewisserst du dich bei jedem Tankvorgang garantiert, ob das Tankfahrzeug auch wirklich einen Hinweis trägt, dass dieser Treibstoff mit Frostschutz versetzt ist. Und wenn du unterwegs je dieses Signal bemerkst, siehst du zu, dass du schleunigst tiefer gehst und wärmere Luft findest.«3 Wir lernen besser, wenn der Stoff nicht abstrakt, sondern konkret und persönlich ist.
Danach veränderte sich Matts Lehrgang. Es folgten elf Tage mit ständigem Wechsel zwischen Frontalunterricht und Flugsimulatortraining. Damit beschrieb Matt genau jene aktive Beteiligung, die zu dauerhaftem Lernerfolg führt, denn die Piloten mussten sich mit ihrem Flugzeug auseinandersetzen, um zu beweisen, dass sie die Standardverfahren kannten, auf unerwartete Situationen reagieren konnten sowie die Reihenfolge und Ausführung der verschiedenen Handgriffe im Cockpit beherrschten. Ein Flugsimulator ermöglicht bewusstes Abrufen in gewissen zeitlichen Abständen. Die Lernerfahrung ist abwechslungsreich und bezieht weitestgehend dieselben Denkprozesse ein, die Matt auch oben in der Luft benötigt. In einem Simulator wird abstraktes Wissen konkret und persönlich. Gleichzeitig bietet ein Simulator diverse Tests, anhand derer Matt und seine Ausbilder erkennen können, worauf er sich konzentrieren muss, um seine Fähigkeiten weiter auszubauen.
Für manche Bereiche – wie bei Matt Browns Flugsimulator – haben Ausbilder und Lehrer hocheffektive Lehrmethoden entwickelt, aber auf fast jedem Gebiet sind diese Techniken die Ausnahme, und Pauken ist nach wie vor die Norm.
Was Lernenden geraten wird, ist oftmals schlichtweg falsch. Zum Beispiel empfiehlt eine Website der George Mason University den Studenten unter anderem Folgendes: »Um sich etwas gut einzuprägen, muss man es wiederholen. Je häufiger man den Stoff durchgeht, desto eher bleibt er dauerhaft gespeichert.«4 Eine andere Website (von einem College in Dartmouth) behauptet: »Wenn man sich etwas unbedingt merken will, klappt das meist.«5 Ein öffentlich geförderter Spot, der gelegentlich in St. Louis über dem Postschalter läuft, zeigt ein Kind, das sich in ein Buch vergraben hat. »Konzentriere dich«, verlangt der Text. »Konzentriere dich auf genau eine Sache. Wiederholen, wiederholen, wiederholen! Wiederhole, was du dir merken musst, damit es sich in dein Gedächtnis einbrennt.«6 Der Glaube an diese drei Vorgehensweisen – nachlesen, konzentrieren, wiederholen – ist allgegenwärtig, aber in Wahrheit kann man sich normalerweise nichts allein dadurch merken, dass man es ständig wiederholt. Das funktioniert vielleicht, wenn man eine Nummer nachschlägt und sie vor sich hin murmelt, solange man sie eintippt, aber für dauerhaftes Lernen ist diese Methode ungeeignet.
In einem einfachen Experiment (im Internet über die Suchbegriffe »penny memory test« zu finden) werden den Probanden zwölf verschiedene Bilder eines normalen Pennys vorgelegt. Nur ein Bild ist richtig. Obwohl die Beteiligten einen Penny schon unzählige Male in der Hand gehabt haben, sind sie unsicher, welches Bild das richtige ist. In einem vergleichbaren Experiment wurden Mitarbeiter und Studierende des Fachbereichs Psychologie der University of California (UCLA), Los Angeles, gebeten, den Standort des nächsten Feuerlöschers anzugeben. Die meisten tippten daneben. Ein Professor, der schon 25 Jahre an der UCLA arbeitete, verließ schnurstracks den Lehrgang über Sicherheitsmaßnahmen, um nachzusehen, wo in der Nähe seines Büros der nächste Feuerlöscher hing – es war unmittelbar neben seiner Bürotür, gleich neben dem Türknauf, den er drehte, wann immer er sein Büro betrat. In diesem Fall hatte er trotz jahrelanger Wiederholung nicht gewusst, wo der nächste Feuerlöscher wäre, falls sein Papierkorb einmal in Brand geriete.7
Erste Hinweise
Schon Mitte der 1960er Jahre belegte eine Untersuchungsreihe des Psychologen Endel Tulving von der University of Toronto, dass mehrfache Wiederholung nicht unbedingt das Gedächtnis schärft. Dazu legte Tulving seinen Probanden Listen mit ganz normalen Substantiven vor, die sie sich einprägen sollten. In der ersten Phase des Experiments lasen die Teilnehmer sechsmal eine Liste von Begriffspaaren (zum Beispiel »Stuhl – 9«), erwarteten aber keine Lernkontrolle. Der erste Teil jedes Paares war stets ein Hauptwort. Nach sechsmaligem Lesen der Paare sagte man den Teilnehmern, dass sie nun eine Wörterliste bekommen würden, die sie sich einprägen sollten. Bei der einen Hälfte der Gruppe waren die Wörter dieselben wie in der vorherigen Lesephase; die andere Hälfte erhielt abweichende Wortpaare. Interessanterweise war der Lernerfolg in beiden Gruppen gleich: Die Lernkurven wichen statistisch nicht voneinander ab. Intuitiv hätte man ein anderes Ergebnis erwartet, doch eine vorherige Wahrnehmung unterstützte das spätere Erinnerungsvermögen nicht. Blindes Wiederholen erleichtert nicht das Lernen. In Folgestudien haben sich viele Forscherteams mit der Frage befasst, inwiefern das Langzeitgedächtnis von Wiederholung oder längerer Beschäftigung mit einer Idee profitiert, und konnten bestätigen, dass stures Wiederholen allein langfristig keine guten Erfolge erzielt.8
Daraufhin wandte man sich der Frage zu, ob nochmaliges Lesen desselben Textes hilfreich wäre. In einem Artikel in Contemporary Educational Psychology berichtete ein Team der Washington University im Jahr 2008 von einer Studienreihe an ihrer eigenen Fakultät und an der University of New Mexico, die untersuchte, ob Lernende einen Prosatext durch mehrfaches Lesen besser verstehen und länger im Gedächtnis behalten. Wie üblich fußten auch diese Studien auf früheren Untersuchungen anderer. Ein Teil konnte zeigen, dass bei mehrfachem Lesen desselben Textes immer dieselben Schlüsse gezogen werden und dieselben Querverbindungen entstehen, wohingegen ein anderer Teil im erneuten Lesen gewisse Vorteile erkannte. Solche Vorteile ergaben sich in zwei unterschiedlichen Situationen. In der einen sollten die Studierenden das ihnen vorgelegte Material lesen und dann sofort ein zweites Mal durchlesen. Die Kontrollgruppe las das Material nur einmal. Beide Gruppen unterzogen sich unmittelbar darauf einem Test, in dem die Gruppe, die zweimal gelesen hatte, etwas besser abschnitt als die Gruppe, die nur einmal gelesen hatte. Bei einem späteren Test hatte sich der Effekt des nochmaligen Lesens allerdings verflüchtigt, und beide Gruppen erzielten vergleichbare Ergebnisse. In einem zweiten Ansatz lasen die Probanden das Material einmal und dann nach einigen Tagen ein zweites Mal. Die Gruppe, die den Stoff in einigem Abstand wiederholte, schnitt beim Test besser ab als die Gruppe, die ihn nicht wiederholt hatte.9
Spätere Experimente an der Washington University, die bestimmte Fragen klären sollten, die bei früheren Studien aufgekommen waren, prüften den Lernerfolg durch wiederholtes Lesen bei Lernenden mit unterschiedlichen Fähigkeiten in einer Lernsituation, die eher dem normalen Unterricht glich. Insgesamt 148 Studierende von zwei Universitäten bekamen fünf verschiedene Passagen aus Lehrbüchern und dem Journal Scientific American vorgelegt. Einige hatten exzellente Lesefähigkeiten, andere weniger ausgeprägte; manche lasen das Material nur einmal, andere zweimal nacheinander. Danach mussten alle Teilnehmer bestimmte Fragen beantworten, um zu testen, woran sie sich erinnern konnten.
Bei diesen Experimenten erwies sich mehrfaches Lesen in rascher Folge für keine der Gruppen als sinnvolle Studienmethode, unabhängig von der Universität und den sonstigen Testbedingungen. Tatsächlich ergab wiederholtes Durchlesen unter diesen Umständen keinerlei Vorteil.
Was schließen wir daraus? Das erneute Lesen eines Textes ist erst sinnvoll, wenn seit dem ersten Lesen eine längere Pause verstrichen ist. Mehrfaches Lesen in rascher Folge hingegen ist Zeitverschwendung, weil man mit sinnvolleren Strategien bei weniger Zeitaufwand rascher vorankäme. Dennoch bestätigen Umfragen unter College-Studenten, was Professoren schon lange wissen: Unterstreichungen, farbiges Hervorheben und ausgiebiges Brüten über Aufzeichnungen und Texten zählen zu den bei weitem häufigsten Lernstrategien.10
Die Illusion des Wissens
Wenn mehrfaches Lesen so ineffektiv ist, warum ist es dann eine so beliebte Lernmethode? Ein möglicher Grund sind falsche Ratschläge seitens der Lehrer. Ein weiterer, subtilerer Faktor, der zu dieser Fehleinschätzung animiert, ist das Phänomen, dass ein bereits vertrauter Text, den wir problemlos lesen können, die Illusion erzeugt, diesen Stoff zu beherrschen. Jeder Professor weiß, dass die Studierenden sich große Mühe geben, die Lehrsätze in der Vorlesung präzise aufzuschreiben, weil sie dem Trugschluss erliegen, sie hätten das Thema begriffen, wenn sie seine Beschreibung genau wiedergeben können. Einen Vortrag oder Text auswendig zu lernen oder das eigentliche Thema zu durchschauen, sind jedoch zwei Paar Schuhe. Mehrmaliges Lesen erzeugt die Illusion, die Inhalte zu beherrschen. Aber täuschen Sie sich nicht! Dass jemand bestimmte Lehrsätze oder die eigenen Notizen auswendig kennt, bedeutet nicht, dass er auch den eigentlichen Inhalt verstanden hat, geschweige denn, wie er das Thema umsetzen oder einen Bezug zu bereits vorhandenem Wissen herstellen kann.
Leider sehr typisch ist die Erfahrung einer College-Professorin in ihrer Sprechstunde: Es klopft, und herein kommt ein verlegener Student, der bei der ersten Klausur im Einführungskurs Psychologie schlecht abgeschnitten hat und hierzu Fragen hat. Denn wie ist das möglich? Er hat alle Vorlesungen besucht und akribisch mitgeschrieben. Er hat auch das gesamte Skript gelesen und die wichtigen Passagen hervorgehoben.
Auf die Frage der Professorin, wie er sich auf die Klausur vorbereitet habe, antwortet er, er sei seine Notizen noch einmal durchgegangen und habe das Wichtigste angestrichen. Dann habe er die markierten Sätze und die Hervorhebungen im Skript noch etliche Male geübt, bis er das Gefühl gehabt habe, alles gut zu beherrschen. Wie könne es also sein, dass er nur mit »Ausreichend« abgeschnitten habe?
Hatte er die Schlüsselbegriffe am Ende jedes Kapitels aufgegriffen und zu erklären versucht? Konnte er ein Konzept wie »konditionierter Reiz« selbst definieren und in einem Abschnitt verwenden? Hatte er beim Lesen zu den wichtigsten Punkten im Text Fragen formuliert und später bei der Vorbereitung versucht, diese zu beantworten? Hatte er beim Lesen zumindest die zentralen Aussagen mit eigenen Worten formuliert? Hatte er versucht, den Stoff mit dem zu verknüpfen, was er bereits wusste? Hatte er nach eigenen Beispielen jenseits des Skripts gesucht? Die Antwort lautete jedes Mal »Nein«.
Dieser junge Mann betrachtet sich als mustergültigen Studenten, gewissenhaft und fleißig, doch er weiß nicht genug über sinnvolle Lernstrategien.
Die Illusion, ein Thema zu beherrschen, ist ein gutes Beispiel für falsche Metakognition, also das Wissen über das, was wir wissen. Um eine kluge Entscheidung zu fällen, müssen wir beurteilen können, was wir wissen und was nicht. Bei einem Pressebriefing über die Erkenntnisse der amerikanischen Geheimdienste zu möglichen Massenvernichtungswaffen im Irak fasste US-Außenminister Donald Rumsfeld dieses Problem im Jahr 2002 in einer berühmt gewordenen (und prophetischen) Aussage zusammen: »Es gibt bekanntes Bekanntes; das heißt, es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Es gibt bekanntes Unbekanntes; das heißt, wir wissen, es gibt Dinge, von denen wir bisher nichts wissen. Aber es gibt auch unbekanntes Unbekanntes – Dinge also, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen.«
Die Hervorhebung stammt von uns Autoren, denn wir wollen unterstreichen, dass Studenten, die ihren Lernerfolg nicht hinterfragen (was die wenigsten tun), in Bezug auf die Stoffbeherrschung zur Selbstüberschätzung neigen. Wie kommt das? Wenn sie eine Vorlesung hören oder einen wunderbar klar formulierten Text lesen, können sie der Argumentation mit Leichtigkeit folgen. Das vermittelt ihnen das Gefühl, das Thema bereits zu beherrschen und sich nicht weiter damit befassen zu müssen. Das bedeutet, dass sie tendenziell nicht wissen, was sie nicht wissen. In der Prüfung können sie sich dann an die Kernpunkte nicht mehr erinnern oder sie nicht in einem neuen Kontext anwenden. Ähnlich ergeht es ihnen, wenn sie ihre Aufzeichnungen und Texte mehrfach lesen. Das läuft so gut, dass sie irrigerweise davon ausgehen, auch das zugrunde liegende Prinzip, den eigentlichen Inhalt und seine Bedeutung zu verstehen, und sicher sind, ihn bei Bedarf abrufen zu können. Letztendlich stellen sich damit auch die fleißigsten Studierenden oft gleich doppelt ein Bein: Sie erkennen nicht, an welchen Stellen sie mehr lernen müssen – wo sie ihr Wissen aktiv verbessern müssen –, und sie bevorzugen Lernmethoden, die ihnen vorgaukeln, den Stoff zu beherrschen.11
Wissen: Unzureichend, aber notwendig
Albert Einstein sagte einst: »Fantasie ist wichtiger als Wissen«, eine Einschätzung, die unter College-Studenten offenbar weit verbreitet ist (zumindest, wenn man ihre T-Shirt-Aufschriften als Anhaltspunkt hinzuzieht). Warum auch nicht? Immerhin liegt der wahre Kern dieser Aussage auf der Hand, denn ohne Fantasie würden wir in Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft auf der Stelle treten. Zudem kann der Wissenserwerb sehr mühselig erscheinen, wohingegen Fantasie Spaß verspricht. Allerdings liegt hier gar kein Gegensatz vor. Unsere Neurochirurgin oder der Pilot, der unser Flugzeug über den Pazifik fliegt, sollte so ein T-Shirt nämlich bitte nicht tragen. Als Reaktion auf standardisierte Testverfahren ist dieser Spruch jedoch durchaus aktuell, sobald zu befürchten steht, dass zum Beispiel Multiple-Choice-Prüfungen stures Auswendiglernen fördern und damit dem Erwerb erstklassiger Fähigkeiten eher im Weg stehen. Trotz der Tücken standardisierter Testverfahren sollten wir uns die Frage stellen, wie man Wissenserwerb und Kreativität erfolgreicher fördern kann, denn ohne Wissen fehlt uns die Basis für die darauf aufbauenden Fähigkeiten zu Analyse, Synthese und kreativer Problemlösung. Der Psychologe Robert Sternberg und zwei Kolleginnen formulierten dies sehr treffend: »Man kann das eigene Wissen nicht praktisch umsetzen, wenn man gar kein anwendbares Wissen besitzt.«12
Ob beim Kochen, beim Schachspielen oder in der Gehirnchirurgie, immer fußt Meisterschaft auf dem allmählichen Anwachsen von Wissen, gedanklicher Durchdringung, Urteilsvermögen und praktischer Umsetzung. Diese Elemente beruhen auf vielfältiger Anwendung neuer Fähigkeiten, aber auch auf Bemühen, Nachdenken und innerlichen Probeläufen. Fakten auswendig zu lernen ist, als würde man eine Baustelle mit dem nötigen Material für den Hausbau beliefern. Um dann jedoch das Haus zu errichten, muss man nicht nur über die unzähligen Materialien Bescheid wissen, sondern auch Aspekte wie zum Beispiel die statischen Eigenschaften eines Trägers oder des Dachstuhls durchschauen und zugleich die Grundprinzipien der Übertragung und Erhaltung der Energie kennen, damit das Haus warm bleibt, aber das Dach kalt, und nicht ein halbes Jahr später Probleme mit der Wärmedämmung auftreten. Ein wahrer Meister kann jederzeit auf seinen Wissensschatz zugreifen und weiß, wie er ihn anwenden kann.
Als Matt Brown vor der Entscheidung stand, das rechte Triebwerk abzustellen oder nicht, musste er ein Problem lösen. Dazu musste er auswendig wissen, wie man mit nur einem Triebwerk weiterfliegt, und er musste die Toleranzen seiner Maschine kennen, um abschätzen zu können, ob er wie ein Stein zu Boden gehen würde oder noch in der Lage wäre, die Maschine für die Landung auszurichten. Die künftige Neurochirurgin muss sich im ersten Studienjahr das komplette Nervensystem, aber auch alles über Skelettsystem, Muskelsystem und Hormonsystem einprägen. Wenn ihr das nicht gelingt, wird sie niemals Neurochirurgin. Somit beruht ihr Erfolg einerseits auf Fleiß, andererseits darauf, ob sie Lernstrategien entwickelt, mit denen sie in begrenzter Zeit große Mengen Lernstoff bewältigen kann.
Lernkontrollen: Lernstand messen, aber wie?
Sobald Lernkontrollen ins Spiel kommen, sträuben sich bei Schülern und Studenten (und Lehrkräften) die Nackenhaare. Insbesondere standardisierte Prüfungen avancieren rasch zum Reizthema, an dem sich der allgemeine Frust über die Frage, wie das jeweilige Lernziel zu erreichen ist, kristallisiert. Onlineforen und Zeitungsartikel werden mit Kommentaren und Leserbriefen bombardiert, welche die Meinung vertreten, dass Tests das Auswendiglernen forcieren, was wiederum auf Kosten von Kontextdurchdringung und Kreativität ginge. Außerdem bedeuteten Prüfungen zusätzlichen Stress für die Lernenden und vermittelten ein falsches Bild ihrer Fähigkeiten. Und so weiter. Sobald wir Prüfungen nicht mehr als Messinstrument für das Gelernte betrachten (mit dem abrufbares Wissen gemessen wird, anstatt die Umsetzung zu prüfen), stehen uns neue Möglichkeiten offen: Tests können eine Lernmethode darstellen.
Studien kamen zu dem verblüffenden Ergebnis, dass aktives Erinnern (durch Prüfungen) tatsächlich das Gedächtnis stärkt, und je mehr man sich dabei anstrengt, desto mehr profitiert man davon. Denken Sie an den Flugsimulator oder PowerPoint-Präsentationen. Denken Sie an ein Quiz oder erneutes Durchlesen. Aktiv auf Lerninhalte zuzugreifen hat zwei große Vorteile. Erstens stellen Sie dabei fest, was Sie tatsächlich wissen und was nicht. Damit wissen Sie, wo Ihre Schwächen liegen, und können an diesen Punkten gezielter arbeiten. Zweitens konsolidiert das Gehirn das Gedächtnis, wenn wir das Gelernte abrufen. Das wiederum stärkt die Verbindungen zu vorhandenem Wissen und erleichtert uns die spätere Erinnerung. Abrufen – durch Lernkontrollen – unterbricht den Prozess des Vergessens. Ein gutes Beispiel liefert eine Studie an Achtklässlern. Für diese Studie bekam eine Schulklasse in Columbia, Illinois, zu einem Teil des behandelten Stoffs im Verlauf des Halbjahrs dreimal einen nicht benoteten Test mit Feedback vorgelegt. Ein anderer Teil des Stoffs wurde nie abgefragt, aber dreimal wiederholt. Bei welchem Stoff schnitt die Klasse einen Monat später in der Prüfung besser ab? Nun, bei dem Material mit den Lernkontrollen erzielten die Schüler im Durchschnitt ein sehr erfreuliches A-; bei dem Material, das nur wiederholt, aber nicht abgefragt wurde, lediglich ein C+.13
Was Matt Brown angeht, so festigt sein Arbeitgeber sein Können auch nach zehn Jahren Erfahrung mit derselben Maschine alle sechs Monate mit diversen Testverfahren und Flugsimulatorübungen, die ihn zwingen, sich Informationen und Manöver ins Gedächtnis zu rufen, mit denen er seine Maschine voll beherrscht. Notfälle treten nur sehr selten auf, wie Matt betont. Wenn man also nicht übt, was zu tun ist, lässt sich dieses Wissen nicht frisch halten.
Beide Beispiele – die Studie mit der Klasse wie auch die Erfahrung von Matt Brown bei der Wissensauffrischung – deuten darauf hin, dass Wissen nur dann bei Bedarf zugänglich ist, wenn wir es in regelmäßigen Abständen bewusst abrufen. In Kapitel 2 befassen wir uns mit Methoden zum aktiven Abrufen von Gelerntem.14
Fazit
Gewohnheitsmäßig lernen wir meist auf die falsche Weise und geben denen, die von uns lernen, ebenfalls die falschen Ratschläge. Viele Binsenweisheiten über das Lernen beruhen auf dem blinden Festhalten an Traditionen oder auf unserer Intuition, halten der empirischen Forschung jedoch nicht stand. Hartnäckige Trugschlüsse über Wissen verleiten uns dazu, uns mit unproduktiven Strategien abzumühen. In Kapitel 3 schildern wir, wie dies sogar für Menschen gilt, die an empirischen Studien teilgenommen haben und die Ergebnisse aus erster Hand erlebt haben. Illusionen sind sehr überzeugend. Wer etwas lernen möchte, sollte sich regelmäßig selbst abfragen, um zu prüfen, was er tatsächlich schon weiß und was nicht. In Kapitel 8 wird von Second Lieutenant Kiley Hunkler die Rede sein, die 2013 die Militärakademie West Point absolvierte und der ein Rhodes-Stipendium zugesprochen wurde. Die Selbsttests, mit denen sie ihren Lernerfolg überprüft, vergleicht sie mit einer regelmäßigen Kurskorrektur anhand des Azimuts. Bei der Navigation über Land bestimmt man den Azimut, indem man einen hohen Punkt ersteigt, ein Objekt am Horizont als Marschziel festlegt und den Kompass entsprechend einnordet, um sicherzustellen, dass man dem Ziel auch unten im Wald Stück für Stück näher kommt.
Zum Glück kennen wir mittlerweile einfache, praktisch umsetzbare Strategien, mit denen jeder in jeder Lebensphase besser lernen und sich länger an das Gelernte erinnern kann. Hierzu zählen bestimmte Übungsmethoden wie stressarme Quizformen und Selbsttests, Lückentexte, das abwechselnde Üben unterschiedlicher Aspekte oder Fähigkeiten, der Versuch, ein Problem zu lösen, ohne den Lösungsansatz zu kennen, das Formulieren von Grundprinzipien oder Regeln, die bestimmte Probleme voneinander abgrenzen, und so weiter. In den folgenden Kapiteln gehen wir näher auf diese Verfahren ein. Und weil Lernen ein iterativer Vorgang ist, der darauf beruht, dass man regelmäßig auf das zuvor Gelernte zurückkommt, es kontinuierlich auf den neuesten Stand bringt und ausbaut, werden wir diese Aspekte dabei immer wieder ansprechen. In Kapitel 8 fassen wir das alles abschließend mit speziellen Tipps zusammen und erläutern anhand von Beispielen die Umsetzung.
II.
Und … Zugriff!
Ende 2011 wurde Mike Ebersold eines Nachmittags in die Notaufnahme gerufen, um einen Jäger aus Wisconsin zu untersuchen, den man bewusstlos in einem Maisfeld aufgefunden hatte. An seinem Hinterkopf klebte Blut, und die Männer, die ihn gefunden und in die Klinik gebracht hatten, gingen davon aus, dass er vielleicht gestolpert und unglücklich gestürzt war.
Ebersold ist Neurochirurg. Aus der klaffenden Wunde quoll Hirnmasse hervor, und er erkannte, dass sie von einem Schuss herrührte. In der Notaufnahme kam der Jäger wieder zu Bewusstsein, aber auf die Frage, wie es zu seiner Verletzung gekommen war, wusste er keine Antwort.
Später berichtete Ebersold über dieses Ereignis: »Offenbar hat jemand in einiger Entfernung eine Schrotflinte mit Kaliber 12 abgefeuert. Ein solches Geschoss muss den Jäger über eine Mordsdistanz in den Hinterkopf getroffen haben, durchschlug den Schädel und blieb in etwa einem Fingerbreit Tiefe in seinem Gehirn stecken. Es dürfte schon ziemlich am Ende seiner Reichweite gewesen sein, sonst wäre es tiefer eingedrungen.«1
Ebersold ist ein schlanker, hochgewachsener Mann. Unter seinen Vorfahren finden sich die Dakota-Häuptlinge Wapasha und die französische Pelzhändlerfamilie Rocque, die alle in jenem Teil des Mississippi-Tals lebten, wo später die Mayo-Brüder ihre berühmte Klinik gründeten. Seine Ausbildung umfasste vier Jahre College, vier Jahre an der Medical School und sieben Jahre Ausbildung zum Neurochirurgen. So konnte er ein umfassendes Wissen und Fähigkeiten aufbauen, die er über ständige Weiterbildung, das Hinzuziehen von Kollegen und seine praktische Erfahrung an der Mayo Clinic und anderswo weiter vertiefte. Sein bescheidenes Auftreten als Mann des Mittleren Westens lässt auf den ersten Blick nicht vermuten, wie viele bedeutende Patienten er schon behandelt hat. Als Präsident Ronald Reagan einst nach einem Sturz vom Pferd Hilfe brauchte, war Ebersold an der Operation wie auch an der anschließenden Nachsorge beteiligt. Als der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Zayid bin Sultan Al Nahyan, eine schwierige Rückenoperation benötigte, rückte er mit gefühlt der Hälfte seiner Minister und Sicherheitskräfte in Rochester an, wo Mike Ebersold ihn operierte und die Genesung überwachte. Nach einer langen Karriere an der Mayo Clinic war Mike zurückgekehrt, um in Wisconsin zu helfen, weil er sich seiner frühen Ausbildungsstätte verpflichtet fühlte. Der Jäger, der zu seinem Pech von einem irregeleiteten 12-Kaliber-Geschoss getroffen worden war, hatte unglaubliches Glück, dass Mike an diesem Tag Dienst hatte.
Denn das Geschoss war in einen Bereich des Schädels eingedrungen, unter dem ein großer venöser Blutleiter liegt, ein Bindegewebskanal, auch als Sinus bezeichnet, in dem sich das Blut aus der Schädelhöhle sammelt. Schon bei der Untersuchung des Jägers wusste Ebersold aus Erfahrung, dass er beim Öffnen der Wunde sehr wahrscheinlich einen zerrissenen Sinus vorfinden würde. Mit seinen Worten:
Du sagst dir: »Dieser Patient muss operiert werden. Aus der Wunde dringt Hirnmasse hervor. Wir müssen die Verletzung säubern und so gut wie möglich reparieren, aber dabei geraten wir vielleicht in diese große Vene, und das könnte sehr, sehr kritisch ausgehen.« Also gehst du deine innere Checkliste durch. Du sagst dir: »Für diesen Patienten brauche ich vielleicht eine Bluttransfusion«, und lässt Blutkonserven bereitlegen. Du führst dir die verschiedenen Schritte vor Augen, A, B, C und D. Du lässt den OP-Saal vorbereiten und erklärst dem Team vorab, womit zu rechnen sein mag. Das alles läuft nach einem bestimmten Schema ab, ganz ähnlich, wie wenn ein Polizist ein Auto herauswinkt. Du kennst das Standardverfahren und gehst deine Schritte noch einmal durch.
Dann kommst du in den OP-Saal, hast aber immer noch Zeit zum Überlegen. Du sagst dir: »Hm, wenn eine größere Blutung auftreten könnte, sollte ich nicht einfach nur das Geschoss rausholen. Ich arbeite mich lieber von der Seite heran und lege alles frei, damit ich auf alles reagieren kann, was schiefgehen könnte. Erst dann ziehe ich es raus.«
Wie sich herausstellte, steckten Geschoss und Knochen wie ein Pfropfen in dem Gefäß. Auch damit hatte der Jäger Glück gehabt. Wäre die Wunde in diesem Bereich nicht »verkorkt« gewesen, so wäre der Mann innerhalb von zwei bis drei Minuten gestorben. Als Ebersold das Geschoss entfernte, lösten sich auch die Knochensplitter, und sofort strömte das Blut heraus. »Innerhalb von fünf Minuten verlierst du locker zwei Einheiten Blut, und dabei schaltest du vom Nachdenkmodus in deine aktuellen Handlungsoptionen um. Ab jetzt läuft alles reflexartig und mechanisch. Du weißt, es wird sehr stark bluten. Also hast du sehr wenig Zeit. Du denkst nur noch: ›Ich muss eine Naht um die Stelle setzen, das habe ich schon einmal gemacht, also weiß ich, dass ich auf eine ganz bestimmte Weise vorgehen muss.‹«
Das fragliche Gefäß war so dick wie der kleine Finger eines Erwachsenen und über etwa vier Zentimeter hinweg mehrfach zerrissen. Man hätte es oberhalb und unterhalb der Verletzung abbinden müssen, aber es handelte sich um eine flache Gewebsstruktur, die Ebersold gut kannte: Hier darf man nicht einfach einen Faden drum herumziehen, denn wenn man diesen festzieht, reißt das Gewebe und der abgebundene Bereich leckt. Unter Hochdruck griff er automatisch zu einer Technik, die er bei früheren Eingriffen im Bereich dieser Vene aus der Not heraus entwickelt hatte. Aus dem Bereich, wo die Haut des Patienten für die Operation geöffnet worden war, trennte er zwei kleine Muskelfasern heraus, versetzte sie an die verletzte Stelle und nähte die Enden der zerrissenen Vene daran fest. Dieser Muskelpfropf diente als Verschluss, ohne die natürliche Form des Gefäßes zu verändern oder das Gewebe zu zerreißen. Diese Lösung hatte Mike selbst ausgetüftelt. Sie ist nirgendwo schriftlich beschrieben, war aber in diesem Moment sehr hilfreich. In der Minute, die er dafür brauchte, verlor der Patient zwar weitere 200 Milliliter Blut, aber sobald der Pfropfen saß, war die Blutung gestoppt. »Manche Menschen kommen mit einem solchen Sinusverschluss nicht zurecht. Bei ihnen steigt der Blutdruck an, weil das Blut nicht richtig abläuft. Aber dieser Patient zählte zu den Glückspilzen, bei denen es funktionierte.« Eine Woche später wurde der Jäger aus der Klinik entlassen. Er hat einen Teil seines peripheren Sehens eingebüßt, doch letztlich war er dem Tod um Haaresbreite entgangen.
Auch Reflexion ist Üben
Welche Schlussfolgerungen können wir aus dieser Geschichte bezüglich der Frage, wie wir lernen und uns erinnern, ziehen? In der Neurochirurgie (und vermutlich ab dem Augenblick der Geburt in jedem Lebensbereich) ist das Reflektieren persönlicher Erfahrungen ein unverzichtbarer Teil des Lernprozesses. Ebersold beschrieb dies folgendermaßen:
Bei meinen Operationen kommt es immer wieder zu schwierigen Situationen. Auf dem Heimweg denke ich dann darüber nach, was da geschehen ist und was ich zum Beispiel tun könnte, um eine Nahtmethode künftig zu verbessern. Wie kann ich mit der Nadel mehr oder weniger Gewebe erfassen? Oder sollten die Stiche vielleicht enger beieinandersitzen? Was wäre, wenn ich mein Vorgehen auf diese oder jene Weise anpasse? Am nächsten Tag probiere ich das dann aus und prüfe, ob es besser funktioniert hat. Vielleicht auch nicht gleich am nächsten Tag – aber immerhin habe ich darüber nachgedacht, und bei diesem Nachdenken bin ich nicht nur die Schritte durchgegangen, die ich aus Vorlesungen kenne oder mir als Assistent bei anderen abgeschaut habe, sondern ich habe sie um eine eigene Komponente erweitert, die mir während meiner Ausbildung nicht begegnet ist.
Reflexion kann diverse kognitive Schritte umfassen, die den Lernerfolg verstärken: Wissen und Ausbildungsinhalte aus dem Gedächtnis abrufen, das Gelernte mit neuen Erfahrungen verknüpfen, visualisieren, was man beim nächsten Mal anders machen könnte, und dies innerlich mehrfach durchspielen.
Dank dieser Vorgehensweise hatte Ebersold eine neue Technik entwickelt, um den Sinus am Hinterkopf zu reparieren, eine Technik, die er innerlich und im OP geübt hatte, bis sie für ihn so selbstverständlich geworden war, dass er sich in einem Moment, wo sein Patient minütlich 200 Milliliter Blut verlor, auf seine Kunst verlassen konnte.
Um sicherzustellen, dass neues Wissen bei Bedarf auch abrufbar ist, muss man laut Ebersold »die Punkte auswendig herbeten können, um die es jeweils geht: Schritt A, B, C und D«, und diese immer wieder üben. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es eng wird und man keine Zeit mehr hat, die einzelnen Schritte im Geiste durchzugehen. Jetzt muss man sie automatisch richtig machen. »Wenn man sich so ein Vorgehen nicht regelmäßig ins Bewusstsein ruft, läuft es nicht reflexartig ab. Wie bei einem Rennfahrer in einer gefährlichen Situation oder wie bei einem ausweichenden Quarterback muss die Handlung zum Reflex werden, über den man gar nicht mehr nachdenkt. Regelmäßig bewusst abrufen, regelmäßig üben. Das ist unerlässlich.«
Der Testing-Effekt
Wenn ein Kind Perlen auffädelt und dann die Schnur hochhebt, stellt es schnell fest, dass die Perlen am anderen Ende herunterrutschen. Ohne Knoten hält die Perlenschnur nicht. Ohne Knoten gibt es keine Kette, kein Armband, keine Perlenstickerei. Abrufen knüpft den Knoten im Gedächtnis. Wiederholtes Abrufen festigt das Gelernte und fügt zusätzliche Schlaufen hinzu, die es festzurren.