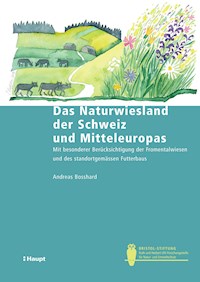
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haupt Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Bristol-Schriftenreihe
- Sprache: Deutsch
Wiesen und Weiden gehören zu den landwirtschaftlich produktivsten und zugleich artenreichsten Ökosystemen Mitteleuropas. Der Autor arbeitet die Grundlagen für eine standortgemäße und ressourcenschonende Nutzung des Wieslandes praxisnah und anhand vieler Beispiele auf. Einen wichtigen Stellenwert nimmt das gesamtbetriebliche Konzept eines standortgemäßen Futterbaus ein. Erstmals wird zudem die jüngere Geschichte des Wieslandes in der Schweiz und in Mitteleuropa detailliert nachgezeichnet. Ein quantitativer, reproduzierbar anwendbarer Bestimmungsschlüssel der wichtigsten Wiesentypen rundet den praxisorientierten Teil ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bristol-Schriftenreihe Band 50
Herausgeber
Ruth und Herbert Uhl-Forschungsstelle für Natur- und Umweltschutz,
Bristol-Stiftung, Zürich
www.bristol-stiftung.ch
Andreas Bosshard
Das Naturwiesland der Schweiz und Mitteleuropas
Mit besonderer Berücksichtigung der Fromentalwiesen und des standortgemässen Futterbaus
Haupt Verlag
Verantwortlich für die Herausgabe
Bristol-Stiftung. Stiftungsrat: Dr. René Schwarzenbach, Herrliberg;
Dr. Mario F. Broggi, Triesen; Prof. Dr. Klaus Ewald, Gerzensee; Martin Gehring, Zürich
Managing Editor
Dr. Ruth Landolt, WSL, Birmensdorf
Adresse des Autors
Dr. Andreas Bosshard, Ö+L GmbH, Hof Litzibuch, 8966 Oberwil-Lieli
e-mail: [email protected]
Layout
Jacqueline Annen, Maschwanden
Umschlag und Illustration
Atelier Silvia Ruppen, Vaduz
Fotos
Wo nicht anderes vermerkt © Andreas Bosshard
Zitierung
BOSSHARD, A., 2016: Das Naturwiesland der Schweiz und Mitteleuropas. Mit besonderer Berücksichtigung der Fromentalwiesen und des standortgemässen Futterbaus. Zürich, Bristol-Stiftung; Bern, Haupt. 265 S.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
ISBN 978-3-258-07973-8 (Buch); 978-3-258-47973-6 (EPUB)
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2016 Haupt Bern
Jede Art der Vervielfältigung ohne Genehmigung des Verlages ist unzulässig.
Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.haupt.ch
Abstract
Grasslands of Switzerland and Central Europe. With emphasis on Arrhenatheretum meadows and sustainable fodder production
In mountainous regions with a temperate climate, grasslands provide the most important ecosystem for agriculture and the production of milk and meat. At the same time, agriculturally used grasslands encompass a major part of Central Europe’s native biodiversity. Thus in natural grassland systems agricultural production and preservation of biodiversity are closely linked. This book shows, with a particular focus on Switzerland and Central Europe, fundamental synergies between ecology and economy, and between the production of food and landscape values of grasslands – but also considerable risks and challenges.
The first section of the book outlines the ecology, productivity, management and t ypology of Mid-European grasslands, with an emphasis on fertilised grasslands. The second section gives an encompassing overview of the genesis and history of grasslands, their use, composition and management in Central Europe. Meadows are revealed as a young ecosystem whose use was closely linked to the availability of excellent steel quality for the scythes.
Recent changes of management and botanical composition of intensively used meadows are described in detail. A new study comparing historical and current vegetation surveys in the Swiss lowlands reveals a dramatic decline of species diversity during the last six decades. In the 1950s, the most intensively managed meadows were Arrhenatherum hay meadows (Arrhenatheretum). More than 85 % of these achieved the QII standard defining meadows with “high biodiversity value”. According to a current inventory, these Arrhenatherum meadows have been almost completely replaced by species-poor, highly intensified grassland, and QII-Arrhenatherum meadows now make up less than 2 % of the permanent grassland area in the Swiss lowlands.
The third section of the book outlines perspectives, criteria, and actions for a resource-efficient, site-adapted grassland management. The actual intensity of grassland use often exceeds the optimum economically, ecologically and ethologically sustainable level. A main driving force is the aim to achieve a high output of milk per cow and unsustainably high cow densities based on huge fodder imports to the farm. In many cases, this production system generates high costs and low economic and ecological sustainability.
Based on examples, facts and figures, the book describes alternatives and gives clear prespectives for practioners, consultants and public authorities on how to achieve an economic and nature friendly grassland management adapted to the specific situation of the farm. A cost- and resource-effective milk and meat production based on natural grasslands is capable of generating more income with considerable added value with respect to the environment and biodiversity.
Keywords: agriculture, permanent grassland, productivity, resource-efficiency, economy, milk production, biodiversity decline, agricultural history, Arrhenatheretum meadow, grassland typology, sustainability, hay meadow.
Zum Geleit
Im Jahre 1987 veröffentlichte der Schweizerische Bund für Naturschutz (heute Pro Natura) ein Tagfalterbuch, worin er unter anderem festhielt, dass nur mehr 1 Prozent der Tagfalterpopulationen im Wiesland des Mittellandes im Vergleich zu den 1950er Jahren vorkommen. Diese dramatische Aussage fand erstaunlich wenig öffentliche Beachtung, obwohl sie eigentlich eine Konkursanzeige für die Schweizer Biodiversität darstellte. Ich wunderte mich auch, dass die Imker als stark Betroffene sich nicht kräftiger über solche Vielfalt-Verluste zu Wort meldeten. Der Film «More than honey» von Markus Imhoof zeigte dann im Jahre 2012 die ganze Misere weltweit auf.
Die Wiesen wurden sichtbar in den letzten Jahrzehnten immer sattgrüner, ein schweizweiter Güllegürtel löschte die bisherigen Farbtupfer mit allem was «kräucht und fleucht» aus. In diesem monokulturell genutzten Wiesland wurde es ruhig, man muss von einer beklemmenden Monotonie sprechen, die auch tierfeindlich ist. Selbst die einst häufigen Blumen wie der Wiesensalbei und die Margerite wurden auf marginale Restflächen wie zum Beispiel Wegränder reduziert. Einzig in Privatgärten sieht man manchmal noch liebevoll vom Rasenmäher verschonte «Margeriteninseln». Ein erbarmungsloses Schnitt- und ein massiv umweltschädliches Düngerregime mit hohen Ammoniakemissionen erzeugten diese «grünen Wüsten». Die schöne wie produktive traditionelle Kulturlandschaft, wurde von einer einseitigen «Produktions- und Verbrauchslandschaft» abgelöst. Auch weit über die Schweiz hinaus ist eine Verarmung, Entleerung und Vereinheitlich in grossen Produktions-Schlägen festzustellen. Das ist das Gegenteil eines an sich anzustrebenden Zustandes, weil die meisten Menschen sich eine vielfältige, strukturreiche Landschaft wünschen. Die Art und Weise der landwirtschaftlichen Produktion ist keinesfalls nur eine landwirtschaftliche Angelegenheit. Dieser getätigte Raubbau an der Biodiversität wird ja vom Steuerzahler massiv mit jährlichen Direktzahlungen im Milliardenbereich finanziert. Diese Mittel fliessen zudem unter dem Mantel der Landschaftspflege.
Andreas Bosshard greift nun die Wieslandfrage aus ökologischer und ökonomischer Sicht auf breiter Front auf. Die vorliegenden Erhebungen belegen mit Akribie oben Gesagtes und Beobachtetes. Wiederum ist analog zu den Tagfaltern von nur mehr einem Prozent der einstigen Vorkommen bunter Blumenwiesen die Rede. Auch die ökologischen Ausgleichsflächen erfüllen mehrheitlich nicht die Erwartungen bezüglich Artenvielfalt. Man muss in den landwirtschaftlichen Gunstlagen von einer Bankrotterklärung für die Naturanliegen sprechen, weil der verlangte ökologische Ausgleich die Erwartungen qualitativ und quantitativ nicht erfüllen kann.
Andreas Bosshard zeigt aber auch auf, dass sich diese Blumenwiesen nicht allein als Ökoflächen erhalten und fördern lassen. Sie müssen wieder Bestandteil einer produktiven, nutzungsorientierten, standortsgerechten Landwirtschaft sein. Das Erstaunliche dabei: Eine solche Landwirtschaft wäre offenbar auch wirtschaftlicher. Nur dank einem international einzigartig hohen Geldmittelfluss von der öffentlichen Hand konnte sich eine derart intensive, gleichzeitig zu teure wie naturfeindliche Landnutzung in der Schweiz überhaupt entwickeln und halten. Weniger wäre offenbar deutlich mehr.
Hierfür werden die Empfehlungen abgegeben, wie der Futterbau angegangen werden müsste. Diese Arbeit ist ein Weckruf, die Gier nach immer mehr zu hinterfragen und sich ökonomisch wie ökologisch wieder auf ein nachhaltiges Mass der Landnutzung zurückzubesinnen. Dies zum Wohl von uns allen, Mensch, Tier und Pflanze, und nicht zuletzt von den Bauernfamilien selber.
Mario F. Broggi
Stiftungsrat Bristol-Stiftung, Zürich
Das Grünland ist ein vom Menschen geschaffenes Ökosystem und unterliegt deshalb in besonderem Masse dem allgemeinen gesellschaftlichen Wandel. Das wird im Wiesenbuch von Andreas Bosshard in eindrücklicher Weise dargelegt. Besonders die historischen, pflanzensoziologischen und wiesenökologischen Kapitel stellen viel Wissen zusammen, das bisher nicht allgemein zugänglich war. Am Beispiel der Fromental-Wiesen wird aufgezeigt und naturwissenschaftlich begründet, wie sich die Artenvielfalt in den letzten Jahrzehnten verändert hat.
Im Wiesenbuch werden der starke Rückgang der Fromental-Wiesen und insbesondere deren Artenvielfalt beklagt und der Eindruck erweckt, dass dafür vor allem eine Fehlentwicklung in der Landwirtschaftspolitik verantwortlich ist. Diese Einschätzung ist eine etwas einseitige Sichtweise und wird der Realität zu wenig gerecht. Zwar ist der Artenrückgang im Grünland des schweizerischen Mittellands eine Tatsache, doch war, ist und bleibt die Hauptfunktion die Produktion von wertvoller Nahrung. Dies geschieht einerseits über die Veredelung von Wiesenfutter via Wiederkäuer zu Milch und Fleisch oder durch Steigerung der Bodenfruchtbarkeit im Wechsel mit dem Ackerbau. Die unumgängliche Steigerung der Produktion wäre ohne einen gewissen Verlust an Biodiversität und Strukturreichtum nicht möglich gewesen.
Die sogenannten Fruchtfolgeflächen, die sowohl als Wiesen und Acker genutzt werden, sind vor allem im Schweizer Mittelland konzentriert. Seit 1900 hat eine gewaltige Veränderung der Kulturlandschaft und ihrer Nutzung stattgefunden: das Bevölkerungswachstum hat um 253 Prozent zugenommen. Es ist eine Wohlstandsgesellschaft mit hohem Mobilitätsbedürfnis entstanden, die sich nicht gross um den masslosen Bodenverschleiss für den Siedlungs- und Strassenausbau gekümmert hat. Zum Opfer gefallen ist vor allem die produktive landwirtschaftliche Nutzfläche. Das Ackerland ist in den letzten dreissig Jahren pro Kopf um ein Drittel gesunken und liegt nur noch bei 500 m2 pro Einwohner – das ist ein Viertel des internationalen Durchschnitts. Mindestens so wichtig wie eine nachhaltige, standortgemässe, differenzierte Nutzung des Wieslandes ist deshalb der absolute Schutz der verbliebenen Flächen vor weiterer Überbauung, aber ebenso die weitere Flächenaufgabe im Berggebiet.
Weite Teile des Schweizer Mittellands gehören zu den privilegiertesten Grünland-Gunstlagen der Welt. Dank den sicheren und gut verteilten Sommerniederschlägen wächst hier bestes Gras in grossen Mengen, das sich hervorragend für die Milchproduktion eignet. Die Veredelung von Wiesenfutter zu Nahrung ist über die Milch um ein Mehrfaches effizienter als über Fleisch. Entsprechend ist es richtig, wenn im Wiesenbuch vor allem die Milchproduktion im Fokus der Betrachtungen steht. Es ist Andreas Bosshard gelungen, gerade hier wichtige Zusammenhänge aufzuzeigen und die aktuelle Entwicklung der Schweizer Milchproduktion und Viehzucht in ein kritisches Licht zu stellen. Das entsprechende Kapitel im Wiesenbuch ist besonders wertvoll und eine anerkennenswerte transdisziplinarische Leistung.
Möge das Wiesenbuch von Andreas Bosshard dazu beitragen, den richtigen Weg zur nachhaltigen Nutzung unserer vom Grünland geprägten Kulturlandschaft zu finden. Als Antithese zur heutigen Realität liefert es viele wertvolle Impulse und Denkansätze.
Peter Thomet
ehemaliger Professor für Grünlandlehre, Futterbau und Milchproduktion an der Hochschule für Agrar- Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) und ehemaliger Präsident der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaues (AGFF)
Inhalt
Abstract
Zum Geleit
Abkürzungen
Vorwort und Dank
Zusammenfassung und Überblick
Teil A Ökologische und futterbauliche Grundlagen
1Einführung
1.1Entstehung, Ziele und Bedeutung des heutigen Naturfutterbaus
1.2Wiesen, Weiden, Wiesland und Co: Zur Klärung wichtiger Begriffe
1.3Multifunktionalität: Wiesland dient zu weit mehr als nur zur Futterproduktion
2Ökologie des Naturwieslandes
2.1Wiesen als Abbild von Standort und Bewirtschaftung
2.2Die abiotischen Umweltfaktoren
2.3Die biotischen Umweltfaktoren
2.4Wiesland und Biodiversität
2.5Standort- und Konkurrenzbedingungen: Warum kommt welche Pflanzenart wo vor?
2.6Der unterirdische Teil des Wiesenökosystems
3Beurteilung von Pflanzenbestand und Standort im Hinblick auf Ertrag und Nutzungsmöglichkeiten
3.1Pflanzenbestand als integraler Indikator
3.2Zeigerarten und Zeigerwerte zur Standortindikation
3.3Die funktionellen Gruppen Gräser, Kräuter und Leguminosen als Indikatoren für Stabilität, Ertrag und Artenvielfalt
4Einfluss der Bewirtschaftung auf Pflanzenbestand, Futterertrag, Futterqualität und Wirtschaftlichkeit
4.1Wirkung von Intensivierung und Extensivierung auf den Pflanzenbestand
4.2Steuerung des Pflanzenbestandes durch die Bewirtschaftung
4.3Einfluss von Nutzungszeitpunkt auf Futterertrag und -qualität
4.4Einfluss der Futterwerbung auf Wirtschaftlichkeit, Futterqualität und Futtermenge
4.5Produktionseffizienz und Wirtschaftlichkeit der Wieslandnutzung
4.6Hohes Eiweissproduktionspotenzial von Wiesland – kaum beachtet und ungenügend genutzt
4.7Nachhaltige Wieslandnutzung im Biolandbau und bei der Integrierten Produktion (IP)
5Wiesentypologie und Wiesentypen der Schweiz
5.1Anfänge einer systematischen Einteilung des Wieslandes
5.2Methodik und System der Pflanzensoziologie
5.3Veränderte Ansprüche an die Typologie führen zu neuen Ansätzen
5.4Die pflanzensoziologische Gliederung des Wieslandes nach Braun-Blanquet
5.5Standortbindungen der Wieslandtypen Mitteleuropas
5.6Typologie und Gliederung des gedüngten Wieslandes der Schweiz
Teil B Historische Grundlagen
6Entstehung und Entwicklung des Wieslandes in der Schweiz und in Mitteleuropa
6.1Wiesland im prähistorischen Mitteleuropa
6.2Vom Wald-Weide-Kontinuum zu den Mähwiesen und Weiden der mittelalterlichen Dreizelgenwirtschaft
6.3Herkunft und Evolution der Wieslandpflanzen
6.4Entstehung und Entwicklung der Mähwiesen
6.5Zentrale Bedeutung der Frühlingsweide (Etzen) für die Entwicklung der Artenvielfalt der Mähwiesen
6.6Verbesserte Dreifelderwirtschaft und weitere Innovationen der Landwirtschaft ab 1800
6.7Veränderungen in der Wieslandnutzung während der Industrialisierung 1850 bis 1950
6.8Wirtschaftswunder und Grüne Revolution: Die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel der Schweiz
7Fromentalwiesen: Das unbemerkte Verschwinden der blumenreichen Alltagswiesen
7.1Einleitung und Überblick
7.2Was sind Fromentalwiesen?
7.3Blütezeit und Zusammenbruch der Fromentalwiesen
7.4Das Fromentalwiesen-Projekt
7.5Qualitativer Vergleich 1949 bis 2009: Wiederholung der Vegetations-aufnahmen von Schneider
7.6Heutige Verbreitung der Fromentalwiesen in der Schweiz
7.7Rückgang der Fromentalwiesen: Vergleich mit anderen Lebensräumen und andern Regionen Mitteleuropas
7.8Futterbauliche Bedeutung der Fromentalwiesen
7.9Gefährdung, Schutz und Förderung der Fromentalwiesen: Aktuelle Situation in der Schweiz
7.10Ästhetischer Wert und weitere Ökosystemleistungen von Fromentalwiesen
8Entwicklung der Biodiversität im Wiesland: Ein zusammenfassender Überblick
8.1Vegetation und Flora
8.2Auswirkungen auf die Fauna
Teil C Praxis des standortgemässen, ressourcenschonenden Futterbaus auf dem Landwirtschaftsbetrieb
9Gesamtbetriebliche Gestaltung eines nachhaltigen, standortgemässen Futterbaus
9.1Wiesland als Teil des Gesamtsystems «Milch- und Fleischproduktion»
9.2Grundregeln eines nachhaltigen Futterbaus zur Milchproduktion
9.3Gesamtbetriebliche Umsetzung der Futterbauregeln
9.4Die wichtigsten bestandeslenkenden Massnahmen auf den Wiesenparzellen und ihre Anwendung
9.5Spezifische Massnahmen zur Förderung der Biodiversität im Rahmen eines nachhaltigen, ressourcenschonenden Futterbaus
9.6Optimierung der Ressourcen- und Energieeffizienz
9.7Schlussfolgerungen
9.8Acht Regeln des abgestuften, standortgemässen Naturfutterbaus
10 Literatur
Liste der Exkurse
Exkurs 1Naturfutterbau: Hindernis für die Industrialisierung der Landwirtschaft
Exkurs 2Wiese - ein altes Wort mit junger Bedeutung
Exkurs 3Ertrag ohne Düngung: Bedeutung und Effekt der natürlichen Nährstoff-Nachlieferung des Wieslandbodens
Exkurs 4Die Phosphor- und Stickstoffbilanz im Schweizer Futterbau: Geringe Effizienz und Nachhaltigkeit
Exkurs 5Einfluss der Höhenlage auf den Ertrag und die Futterqualität von Wiesen
Exkurs 6Mehr als nur Beigemüse: Kräuter der Wiesen als Medizin und Verkaufsargument für gesunde Milch
Exkurs 7Hochleistungszucht bei der Milchproduktion: Ein Weg mit vielen ethologischen, ökonomischen und ökologischen Fragezeichen
Exkurs 8Versuch einer Übersicht über die Wiesentypen der Schweiz
Exkurs 9Ungewisse Zukunft der Pflanzensoziologie
Exkurs 10Kollektive dörfliche Landnutzung: Die Dreizelgenwirtschaft am Beispiel des Dorfes Inckwil (Kanton Bern)
Exkurs 11Etzen: Begriffsklärung und Wirkung
Exkurs 12Wiesland- und Nutzungsgeschichte im Bild: Die Veränderungen einer Alltagslandschaft im Schweizer Mittelland seit 1931
Exkurs 13Düngungslehre und Nährstoffdynamik vor der Zeit des Stickstoff-überflusses
Exkurs 14Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft: Grüne Revolution oder Pyrrhus-Sieg?
Exkurs 15Methodik der Fromentalwiesen-Vergleichserhebungen
Exkurs 16Wiesenmeisterschaften: Wer ist die Schönste im ganzen Land?
Exkurs 17Kühe brauchen «Blüemliheu»: Futterqualität heisst je nach Lebensphase der Kuh etwas Anderes
Exkurs 18Weniger ist mehr: Die revolutionären Erfahrungen eines mutigen Milchvieh-Spitzenzüchters
Abkürzungen
BFF
Biodiversitätsförderfläche, s.
Kap. 1.2.2
DZV
Direktzahlungsverordnung
ECM
Energiekorrigierte Milch
ha
Hektare
LN
Landwirtschaftliche Nutzfläche
MJ
Mega-Joule
NEL
Netto Energie Laktation
ÖLN
Ökologischer Leistungsnachweis gemäss DZV
ÖQV
Öko-Qualitätsverordnung (erstmals Schweizerischer Bundesrat 2001)
QII
Biodiversitäts-Qualitätsniveau II gemäss DZV, s.
Kap.1.2.2
TS
Trockensubstanz
Vorwort und Dank
Anstoss zu diesem Buch gab eine Untersuchung über die Entwicklung der Fromentalwiesen in der Schweiz. Fromentalwiesen werden die Fettwiesen der Tallagen genannt. Sie stellten bis in die 1950er Jahre den am intensivsten genutzten Wiesentyp dar, der grosse Teile des Wieslandes einnahm und das Rückgrat der Futterproduktion bildete. Die Resultate des Projektes waren für alle Beteiligten überraschend. Der damalige Fettwiesentyp ist praktisch verschwunden. Er würde heute zu den artenreichen Wiesen zählen. Selbst Ökowiesen erreichen hinsichtlich der Artenvielfalt grossenteils nicht mehr das Niveau, welches in den Fettwiesen noch um 1950 alltäglich war. Offenbar ist es im «Alltagswies-land» während den vergangenen fünf bis sechs Jahrzehnten zumindest in den tieferen Lagen der Schweiz zu einem eigentlichen Zusammenbruch der Biodiversität gekommen, der viel weiter geht als bisher angenommen, und der bis heute lediglich ganz punktuell untersucht und dokumentiert ist.
Die Recherchen machten auch die Diskrepanz deutlich zwischen der umfangreichen Literatur zum extensiven, heute prioritär im Hinblick auf Naturschutzaspekte bewirtschafteten Wiesland und der ökologisch sehr geringen Beachtung, welche das gedüngte Spektrum des Wieslandes seit den 1950er Jahren erfahren hat. Insbesondere botanisch und pflanzensoziologisch wurde der gedüngte Bereich kaum bearbeitet. Das agronomische Interesse war dagegen seit den 1950er Jahren ganz auf den intensiv genutzten Bereich gerichtet und ermöglichte eine wesentliche Steigerung der Erträge und der Nutzungsintensität.
Die polarisierte Interessenlage hatte zur Folge, dass die mittelintensiv und wenig intensiv genutzten Wiesen quasi durch die Maschen der Aufmerksamkeit fielen. Diese Lücke sollte das Fromentalwiesenprojekt füllen, und hier setzt das vorliegende Buch entsprechend einen Schwerpunkt. Denn gerade diese Wiesentypen spielen flächenmässig und vom Produktionspotenzial her eine wichtige Rolle für die standortgemässe, effiziente Wieslandnutzung, aber auch für die Biodiversität in der offenen Kulturlandschaft.
Wie das Wiesland genutzt wurde und in Zukunft genutzt wird, ist letztlich immer die Folge von individuellen Entscheidungen auf dem einzelnen Landwirtschaftsbetrieb. Diese Entscheide lassen sich nur verstehen aus einer gesamtbetrieblichen Perspektive. Produktion, Wirtschaftlichkeit, Artenvielfalt, persönliche Interessen der Bauernfamilie, die auf dem Hof gehaltenen Raufutterverzehrer, äussere Rahmenbedingungen und viele weitere Aspekte gehören auf dem Hof auf’s Engste zusammen. Das komplexe Zusammenspiel macht die ganz bestimmte Bewirtschaftung des Wieslandes letztlich im Konkreten erst nachvollziehbar. Das Verständnis, wie das Wiesland und der Futterbau in den Gesamtbetrieb eingebettet ist, ist damit die Voraussetzung für eine erfolgsversprechende Suche nach Lösungen im Sinne eines nachhaltigen, standortgemässen Futterbaus. Die betriebliche Perspektive, vor allem auch die enge Verbindung des Wieslandes mit der Milch- und Fleischproduktion, nehmen deshalb im Buch einen wichtigen Stellenwert ein. Die langjährige Beschäftigung in der landwirtschaftlichen Beratung und in der ökologisch-futterbaulichen Planung und Forschung kamen dem Vorhaben eines umfassenderen Überblicks eines ganzheitlich orientierten Futterbaus entgegen.
Ein solches Vorhaben ist anspruchsvoll. Zweifellos sind viele Ausführungen ergänzungsbedürftig. In diesem Sinne soll das Buch Anregungen geben, diesen Ergänzungsbedarf in Forschung, Beratung und Praxis aufzugreifen und so der Nachhaltigkeit im Futterbau wieder vermehrt Gewicht zu geben.
Das Fromentalwiesenprojekt wurde in grosszügiger Weise durch die Bristol-Stiftung, Pro Natura und die Temperatio-Stiftung unterstützt. Diesen Institutionen gilt mein besonderer Dank. Die Bristol-Stiftung regte die Ausarbeitung der Resultate in Buchform an und finanzierte den Druck.
Herzlichen Dank schulde ich den verschiedenen Fachexperten, die zu einzelnen Kapiteln wesentliche Hinweise beisteuerten, insbesondere Peter Thomet, Hans Ulrich Gujer, Jodok Guntern, Frank Klötzli, Georg Grabherr, Alois Kapfer, Peter Moser und Thomas Walter. Besonders danke ich Mario Broggi und Ruth Landolt von der Bristol-Stiftung für das konstruktive und sorgfältige Lektorat des Buches, ebenso Jacqueline Annen für die Gestaltung der zahlreichen neuen Grafiken und des Layouts. Bei den Feldarbeiten und deren Auswertungen halfen verschiedene Mitarbeiter von Ö+L GmbH mit. Erwähnen möchte ich namentlich Isabelle Nussbeck-Stähli, die viele der Vegetationsaufnahmen durchgeführt hat, und Lina Kamleiter, die mit ihrer Diplomarbeit wichtige Resultate zum Projekt beisteuerte.
Nicht zuletzt danke ich meiner Familie für den Freiraum, den sie mir gewährte, um das Buch fertig zu stellen.
Andreas Bosshard
Zusammenfassung und Überblick
Das Buch gibt einen Überblick über Ökologie, Produktivität, Nutzung, Ökonomie, Typologie und Geschichte des Wieslandes Mitteleuropas, mit einem Schwerpunkt beim produktionsorientiert genutzten, gedüngten Wiesland in der Schweiz.
Im Teil A wird das komplexe Zusammenspiel von Standort, Pflanzenbestand und Nutzung des Wieslandes mit übersichtlichen Grafiken und an konkreten Beispielen anwendungsorientiert verständlich gemacht. In einem eigenen Kapitel werden die Wiesentypen der Schweiz, insbesondere des gedüngten Spektrums, im Detail beschrieben und erstmals ein quantitativer, reproduzierbar und damit ohne gutachterisches Vorwissen anwendbarer Bestimmungsschlüssel für die Zuordnung, Bewertung und Kartierung aller landwirtschaftlich wichtigen Wiesentypen präsentiert. Ausführlich wird auf das Ertragspotenzial der verschiedenen Wiesentypen und auf die Möglichkeiten und Faktoren einer wirtschaftlich optimierten, ressourcenschonenden, standortgemässen Nutzung eingegangen. Die Eigenschaften und Bedürfnisse der Raufutterverzehrer spielen dabei für eine nachhaltige Milch- und Fleischproduktion eine zentrale Rolle
Teil B widmet sich der bewegten Geschichte des Wieslandes und des Futterbaus. Das Wiesland in der heutigen Form ist eines unserer jüngsten Ökosysteme. Bis heute fehlt jedoch eine «Wiesengeschichte» Mitteleuropas von der Naturlandschaft bis zu den modernen 6-Schnittwiesen in einer Überschau, welche sowohl die Entwicklung der Nutzung wie diejenige der Pflanzenbestände und ihrer Produktivität umfasst.
Die Auswertung zahlreicher Quellen ermöglichte eine teilweise neue Sicht auf die Entstehungsgeschichte des Wieslandes und ihre treibenden Kräfte. So scheint die Herkunft der Wiesland-Pflanzenarten, wie sie bisher hauptsächlich vertreten wurde, teilweise revisionsbedürftig. Ebenso ist bisher die Entstehung der Mähwiesen kaum aufgearbeitet worden. Eigentliche Mähwiesen haben sich erst im Spätmittelalter mit der Verfügbarkeit neuer Stahlqualitäten aus den antiken Nutzungsformen des Wald-Weide-Kontinuums herausentwickelt. Doch dauerte es nochmals fast 1000 Jahre, bis die Mähnutzung im 19. Jahrhundert so schlagkräftig wurde, dass zusammen mit revolutionären Neuerungen im Ackerbau (Einführung der Leguminosen in die Fruchtfolge) die notorische Knappheit an Winterfuttur erstmals in der Geschichte der Viehhaltung überwunden werden konnte und Mähwiesen zur heutigen Dominanz gegenüber dem Weideland gelangten. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die früher allgegenwärtige Frühlingsweide aufgegeben – ein bisher stark unterschätzter, für das Verständnis der Biodiversität im Wiesland zentraler Faktor.
Bis heute sind Wiesland und Ackerbau aufs engste miteinander verflochten. Doch die Art und Weise unterlag einem grundlegenden Wandel. Fast ein Jahrtausend lang war das Wiesland «die Mutter des Ackers»: Seine prioritäre Funktion war nicht die Ernährung des Viehs zur Produktion von Milch und Fleisch, sondern von Dünger, der die unumgänglichen Nährstoffe für den Ackerbau lieferte. Denn nur der Ackerbau konnte die zunehmende Bevölkerung Mitteleuropas ernähren. Die Rolle des Wieslandes kehrte sich im 20. Jahrhundert komplett um. Die Milch- und Fleischproduktion baute zunehmend auf den Einsatz von Kraftfutter aus Getreide, Mais, Soja und anderen Ackerfrüchten. Selbst Landwirtschaftsbetriebe in Grünlandregionen importierten und importieren zunehmend hohe Mengen an Kraftfutter aus Ackerland auf ihren Betrieb, teils aus weit entfernten Weltgegenden. Dadurch nahm der Hofdüngeranfall auf den Betrieben entsprechend stark zu. Heute findet über den Futtermittelzukauf ein massiver Nährstofffluss vom Acker- ins Wiesland statt. Dieser ist die treibende Kraft hinter der Intensivierung der Wieslandnutzung Mitteleuropas in den vergangenen Jahrzehnten und für zahlreiche Umweltprobleme, und er ist in einigen Regionen für die grossflächige futterbauliche und ökologische Degeneration von Pflanzenbeständen im Wiesland verantwortlich.
Besonders betroffen von dieser Entwicklung waren die Fromentalwiesen, die im Rahmen des «Fromentalwiesenprojektes» Anlass zu diesem Buch gaben. Die Fromentalwiesen (Glatthaferwiesen) waren bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts der häufigste und zugleich produktivste Wiesentyp auf den guten Böden in den tieferen Lagen Mitteleuropas. Als leicht gedüngte, blumenreiche Fettwiesen waren sie noch in den 1950er Jahren das Rückgrat der Futterproduktion in der Schweiz und in Mitteleuropa.
Die fast unbegrenzte Verfügbarkeit von Kunstdünger, der zunehmende Zukauf von Futtermitteln auf den Hof, und eine exponentiell voranschreitende Mechanisierung im Futterbau brachten die Fromentalwiesen zwischen 1950 und 1970 praktisch zum Verschwinden. Kein anderer Lebensraum in der Schweiz ist so dramatisch zurückgegangen. Heute sind 90 Prozent der verbliebenen Fromentalwiesenrelikte botanisch stark verarmt. Mehr oder weniger typische Fromentalwiesen nehmen in der Schweiz durchschnittlich gerade noch rund ein oder zwei Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche ein, zumeist auf kleine Restflächen zurückgedrängt, die an sich gar keine typischen Fromentalwiesenstandorte sind.
An die Stelle der damaligen Fettwiesen sind ertragreichere, aber im Hinblick auf die Biodiversität massiv verarmte Intensivwiesen getreten. Viele ehemals typische und weit verbreitete Pflanzenarten, darunter viele attraktive Wiesenblumen wie Margeriten, Salbei, Glockenblumen oder Flockenblumen, wurden auf Restflächen zurückgedrängt. Heute erreicht in der Schweiz nur noch ein Bruchteil selbst der Ökowiesen die Pflanzenartenvielfalt, welche in den Fettwiesen um 1950 alltäglich war.
Noch stärker waren die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Wieslandfauna. Praktisch alle Tiergruppen, deren Verbreitungsschwerpunkt noch bis in die 1950er Jahre in den Fromentalwiesen lag und die einen Grossteil zur Artenvielfalt der Kulturlandschaft beitrugen, finden in den heutigen Intensivwiesen keine Überlebensmöglichkeiten mehr. Dazu gehören Heuschrecken, Tagfalter, vegetationsbewohnende Spinnen oder bodenbrütende Vogelarten. Ihre Individuenzahlen sind im Wiesland der tieferen Lagen in den letzten 100 Jahren auf noch rund 1 Prozent der damaligen Bestände zusammengebrochen. Bei einigen Tiergruppen sind grossflächig typische Wieslandarten ganz ausgestorben.
Im dritten Teil des Buches (Teil C) wird der Frage nachgegangen, welche Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten heute für einen wieder ressourcenschonenderen, standortgemässeren Futterbau existieren und wie beziehungsweise ob sich dieser mit der hohen Bedeutung des Futterbaus für die Erhaltung der Biodiversität Mitteleuropas, aber auch mit wirtschaftlichen Gesichtspunkten vereinbaren lässt. Umfangreiches Zahlenmaterial weist darauf hin, dass die heutige Nutzungsintensität im Wiesland den wirtschaftlich, ökologisch und für das Tierwohl optimalen Punkt teils bereits deutlich überschritten hat. Dies unabhängig von der Produktionsrichtung, denn der Bioanbau unterscheidet sich im Futterbau nur unwesentlich von der «konventionellen» Landwirtschaft. Ein Schlüsselelement für das Verständnis der Entwicklung und gleichzeitig auch für mögliche Lösungsansätze sind die kritisch zu hinterfragenden, immer höheren Milchleistungen.
Eine der treibenden Kräfte hinter dieser Entwicklung ist die Industrie, welche allein an der Schweizer Landwirtschaft jedes Jahr Milliarden abschöpft, während die Bauern mit der Rindviehhaltung nicht nur nichts mehr verdienen, sondern sogar ein negatives Einkommen generieren. Nur dank den hohen Direktzahlungen vom Staat und einem starken Grenzschutz geht die Rechnung Ende Jahr für die Bauernfamilien noch auf.
Doch es gibt im Hinblick auf eine ressourceneffiziente Wiesennutzung und die Biodiversität im Wiesland auch Lichtblicke. So wurden in den letzten 15 Jahren in der Schweiz mithilfe von Förderprogrammen des Bundes und einiger Kantone Hunderte Hektaren artenreicher Wiesen neu angesät. Damit konnte eine Trendwende im Rückgang der Fromentalwiesen erreicht werden. Mit der aktuellen Reform der Agrarpolitik kamen ab 2014 neue Anreizprogramme dazu, welche die Ressourceneffizienz der Wieslandnutzung verbessern oder den Kraftfuttereinsatz reduzieren helfen können. Seit einigen Jahren werden zudem die Stimmen aus der Forschung und von praktizierenden Landwirten immer prominenter, welche die Hochleistungsstrategie in der Milchproduktion, die für viele der gravierenden wirtschaftlichen und ökologischen Probleme im Futterbau verantwortlich ist, in Frage stellen und mit neuen Wegen in Richtung raufutterbasierter Produktion experimentieren – mit eindrücklichen Win-Win-Effekten.
Aus den dargestellten Fakten und Erfahrungen werden Schlussfolgerungen gezogen, wie ein zukunftsfähiger, die Produktionsbasis erhaltender und fördernder Futterbau auf dem Landwirtschaftsbetrieb und in der übergeordneten Planung aussehen kann. Eine Checkliste, welche ökonomische, futterbauliche, energetische und ökologische Gesichtspunkte miteinbezieht, ermöglicht die Identifikation von gezielten Optimierungsmöglichkeiten im konkreten Einzelfall eines landwirtschaftlichen Betriebes.
Bei einer standortangepassten, differenzierten Wieslandnutzung haben Fromentalund Goldhaferwiesen, also die Fettwiesen der Landwirtschaft bis in die 1950er Jahre, weiterhin einen wichtigen Stellenwert. Sie lassen sich nicht allein als Ökoflächen erhalten und fördern, sondern müssen wieder Bestandteil einer produktiven, nutzungsorientierten, standortgerechten Landwirtschaft werden.
Die Fakten und Beispiele zeigen, dass Ökologie und Ökonomie, Biodiversität und Produktion, Nachhaltigkeit und landwirtschaftliches Einkommen keine Gegensätze sind, sondern im Wiesland Mitteleuropas auch unter den heutigen Bedingungen über weite Strecken in Einklang stehen oder stehen würden, ja mehr noch: unabdingbar zusammen gehören.
Teil A
Ökologische und futterbauliche Grundlagen
Naturwiesen sind ein faszinierendes Zusammenspiel von Kultur und Natur, von Nutzung und Biodiversität. Naturfutterbau ist die einzige landwirtschaftliche Produktion, die fast ausschliesslich Pflanzen der einheimischen Flora nutzt. Ebenfalls im Gegensatz zu allen anderen landwirtschaftlichen Kulturen ist ihre Produktivität nicht durch einzelne Arten, sondern immer durch eine Gemeinschaft zahlreicher verschiedener Pflanzenarten gewährleistet. Das komplexe Zusammenwirken der Vielfalt an Pflanzen-, Tier-, und Mikrooganismenarten zu verstehen und langfristig produktiv zu nutzen, ist eine ebenso anspruchsvolle wie interessante Herausforderung. Im Gegensatz zu anderen landwirtschaftlichen Produktionssystemen wie Ackerbau, Gemüse- oder Obstbau, die auf Monokulturen aufbauen, sind die Möglichkeiten manipulativer Eingriffe, beispielsweise durch Pestizide oder Ansaaten, im Wiesland begrenzt und wirken meist nicht nachhaltig. Teil A vermittelt einen Überblick über die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Standort, Nutzung und Pflanzenbestand im Wiesland und den daraus resultierenden Steuerungsmöglichkeiten.
Abb. 1. Wiesenlandschaft im Zürcher Oberland (CH), geprägt von einem vielfältigen, vergleichsweise noch kleinräumigen Futterbau.
1 Einführung
1.1 Entstehung, Ziele und Bedeutung des heutigen Naturfutterbaus
In den letzten Jahren des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts umreissen STEBLER und SCHRÖTER (1892) erstmals und mit grosser Klarheit zentrale Fragestellungen, die bis heute Landwirtschaft, Naturschutz und Wissenschaft in Bezug auf das Wiesland der Schweiz und in anderen Ländern mit gemässigtem Klima beschäftigen:
«Wir wollen versuchen, die verschiedenen Arten der Wiesen unseres Landes nach der botanischen Zusammensetzung ihres Rasens zu charakterisieren und nachzuweisen, unter welchen Bedingungen jede Wiesenart auftritt, und welchen landwirtschaftlichen Wert sie besitzt. Als freilich noch fernab liegendes Endziel solcher Untersuchungen schwebt uns das vor: für jede natürliche und künstliche Kombination der Bedingungen (Boden, Feuchtigkeit, Höhenlage, Klima, Kultur) die entsprechende, mit Notwendigkeit sich einstellende Wiesenform angeben, oder umgekehrt, aus der vorhandenen Wiesennarbe den Grad der Kultur, den quantitativen und qualitativen Ertrag und die natürlichen Bedingungen ablesen zu können, – endlich noch: für eine gegebene Kombination natürlicher und wirtschaftlicher Faktoren die geeignetste und ertragreichste Wiesenform aufzuweisen.»
Nicht verändert hat sich auch die herausragende Bedeutung des Futterbaus und des Wieslandes für die Schweizer Landwirtschaft und Landschaft. Bis heute sind die Wiesen das Rückgrat der Primärproduktion und ebenso der Biodiversität und der Landschaft (Abb. 1 und Exkurs 1). Wiesland macht drei Viertel der landwirtschaftlich genutzten Fläche der Schweiz aus und gut ein Drittel der Landesfläche (Abb. 2). Die Schweiz ist ein Grasland wie nur wenige andere Länder; sowohl die Erträge wie die Artenzahlen unserer Naturwiesen erreichen im weltweiten Vergleich Spitzenwerte.
Der Naturfutterbau nimmt im landwirtschaftlichen Produktionssystem nicht nur hinsichtlich der Flächenausdehnung in der Schweiz und in anderen Berg- und Hügelregionen mit gemässigtem Klima eine Sonderstellung ein:
– Der Naturfutterbau ist der einzige bedeutsame landwirtschaftliche Produktionszweig der gemässigten Zonen, welcher ausschliesslich oder zumindest zum allergrössten Teil auf der natürlichen Artenvielfalt basiert und diese nutzt. Alle anderen landwirtschaftlichen Produktionszweige wie Ackerbau, Gemüsebau oder Obstbau nutzen demgegenüber gezielt eingeführte beziehungsweise angebaute Zuchtsorten.
– Damit trägt der Naturfutterbau durch die Nutzung selber, sofern sie standortangepasst und differenziert erfolgt, massgeblich zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Biodiversität bei.
– In Mitteleuropa kommt dem Naturfutterbau aufgrund der hohen Flächenanteile und des hohen Anteils an Arten, die fast oder ganz ausschliesslich im landwirtschaftlich genutzten Wiesland vorkommen, wohl die wichtigste Rolle überhaupt für die Erhaltung der Biodiversität zu – und damit auch eine besonders hohe Verantwortung.
– Im Naturfutterbau gewährleistet immer eine Gemeinschaft zahlreicher Pflanzenarten die Ertragsbildung, während der übrige landwirtschaftliche Pflanzenbau auf Monokulturen oder Wenig-Arten-Gemischen basiert. Dies erfordert in verschiedener Hinsicht grundlegend unterschiedliche Strategien und Methoden.
Abb. 2. Anteil des Wieslandes (hellgrau hinterlegt) in Bezug auf die Flächennutzung der Schweiz. Naturwiesen und Weiden bedecken knapp 60 Prozent der Landwirtschaftlichen Nutzfläche LN (bei welcher die Alpweiden nicht eingerechnet werden) beziehungsweise knapp drei Viertel der landwirtschaftlich genutzten Fläche der Schweiz (d. h. inkl. Alpweiden). Gesamtfläche der Schweiz: 4128 498 ha, davon Landwirtschaftliche Nutzfläche 1051 183 ha (2014). Quelle: BLW 2015c/BFS. Zur zeitlichen Entwicklung der Flächenanteile siehe Kapitel 6.9.5.
– Ebenfalls im Gegensatz zu praktisch allen anderen landwirtschaftlichen Kulturen kommt der Naturfutterbau bei sachgemässer Praxis ohne Pestizide und ohne weitere zugeführte Hilfsstoffe aus.
– Und schliesslich haben die Naturwiesen eine wichtige, das Ökosystem stabilisierende Wirkung, beispielsweise als Erosionsschutz oder als potenziell massgebliche CO2-Senke.
Mit diesen besonderen Eigenschaften hat der Naturfutterbau eine Zwischenstellung inne zwischen natürlichen und anthropogenen Ökosystemen und ist, bei nachhaltiger Praxis, ein Paradebeispiel für die Multifunktionalität, das heisst den Mehrfachnutzen eines landwirtschaftlichen Anbausystems.
Die multifunktionale Sonderstellung zwischen Natur und Kultur bringt viele Chancen für Praxis, Beratung und Forschung aber auch besondere Herausforderungen:
– Naturfutterbau ist komplex. Denn nicht allein für eine einzelne Art oder Sorte müssen möglichst gute Wuchsbedingungen geschaffen werden, sondern für ein Gefüge zahlreicher Arten – und dies nicht nur über eine Saison wie im Ackerbau, sondern langfristig über viele Jahre. Forschungsfragen ebenso wie Korrekturmöglichkeiten nach dem Prinzip «eine Ursache – eine Massnahme» und entsprechende einfach anwendbare Rezepte und Korrekturmöglichkeiten sind die Ausnahme.
– Der sich entwickelnde Pflanzenbestand von Naturwiesen variiert von Standort zu Standort und je nach Nutzungsweise, in Abhängigkeit von den lokal vorhandenen Arten und vom Lokalklima in hohem Masse. Aus dieser Vielzahl von einwirkenden Faktoren ergibt sich eine – überschaubare – Anzahl verschiedener Wiesentypen mit unzähligen Mischformen. Resultate oder Erfahrungen, die an einem Ort gewonnen worden sind, lassen sich deshalb nur beschränkt auf andere Standorte oder anders genutzte Pflanzenbestände übertragen. Auch dies macht den Naturfutterbau für Forschung und Praxis anspruchsvoll. Empfehlungen und richtiges Handeln sind oft nur auf der Basis langjähriger Erfahrungen oder ausgedehnter Versuche unter verschiedenen Bedingungen möglich.
Die Futterbauforschung in der Schweiz hat sich mit diesen Besonderheiten intensiver und ganzheitlicher als in vielen anderen Ländern auseinandergesetzt (Exkurs 1). Vor allem unter dem Einfluss angelsächsischer Forschung wurde in vielen Ländern der Naturfutterbau grundsätzlich in Frage gestellt bezeihungsweise nur noch unter dem Aspekt des Kunstfutterbaus weiter vertieft. Kunstfutterbau ist quasi die ackerbauliche Form des Futterbaus und erfordert einen viel höheren Grad an Interventionen und stofflichen Inputs. Beim Kunstfutterbau wird die bestehende Vegetation eliminiert, um Reinsaaten oder Wenig-Arten-Gemische mit Zuchtsorten zu etablieren. Diese sollen für ein oder wenige Jahre einen möglichst hohen Ertrag bringen, um dann wieder einer Neuansaat Platz zu machen.
In der Schweiz, aber auch in Österreich und in den höher gelegenen Regionen im übrigen Mitteleuropa, ist der Naturfutterbau aus topographischen und klimatischen Gründen bis heute die vorherrschende Futterbaumethode geblieben. Sein Ziel ist eine nachhaltige, produktive Nutzung des bestehenden, natürlichen Pflanzenbestandes.
In der Schweiz haben praxisorientierte Forscher wie Walter Dietl von der Forschungsanstalt Zürich-Reckenholz dem Futterbau bis weit über die Landesgrenze hinaus wichtige Impulse verliehen. Sie haben eine differenzierte, an der landwirtschaftlichen Praxis orientierte Methodik geschaffen, mit welcher Naturwiesen typisiert und futterbaulich hinsichtlich Ertrag, Ertragsfähigkeit und Nutzungsweise beurteilt und gegebenfalls verbessert werden können. Dieser Ansatz wurde in unzähligen Forschungsprojekten, vor allem aber in praxisorientierten Kartierungen, in Alpplanungen, bei Landumlegungen oder bei Betriebsberatungen angewandt und weiterentwickelt. In Deutschland und Österreich waren und sind insbesondere die Forschungsanstalten Aulendorf und Gumpenstein führend und haben mit vielen zukunftsweisenden Versuchen zum Verständnis des Produktionssystems Naturwiesland beigetragen.
Allerdings hat sich in der Wissenschaft das Interesse am Naturfutterbau in den letzten zwei Jahrzehnten in der Schweiz und in den umliegenden Ländern verschoben in Richtung einer vermehrt auf Einzelarten und damit auf Methoden des Kunstfutterbaus fokussierten Forschung und Praxis. Auch in der Beratung stehen heute «ackerbauliche» Methoden zur Steuerung der Bestandesentwicklung im Vordergrund. Statt mittels Nutzungs- und Pflegemassnahmen auf der Basis der vorhandenen Arten den Bestand in die gewünschte Richtung zu lenken, werden Bewirtschaftungsfehler immer häufiger mit Übersaaten von Handelssaatgut, mithilfe von Wiesenumbruch und Neuansaaten, durch Herbizide zur Bekämpfung unerwünschter Arten oder zur Erneuerung des ganzen Bestandes zu korrigieren versucht. Diese Entwicklung bedeutet für die Landwirte oft höhere Kosten, weil sie damit das Potenzial der – kostenlosen – Ökosystem-Dienstleistungen der Naturwiesen übergehen und durch mehr oder weniger teure technische Eingriffe ersetzen.
Ausserdem bringt dieser Wandel auch weitreichende ökologische Nachteile mit sich. So ist meist ein erhöhter Ressourcenverbrauch die Folge (Pflugeinsatz, Saatgutkosten, Pestizideinsatz usw.). Vor allem aber wird die vorhandene genetische Vielfalt auf Artenwie auf Ökotypenniveau durch die Neu- und Übersaaten zurückgedrängt. Naturwiesen, in welchen standörtlich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte angepasste Ökotypen wichtiger Futterpflanzen nicht durch Einsaaten mit Zuchtsorten «eingekreuzt» worden sind, werden immer seltener. Die vielfältige Genetik der Futterpflanzen mit den spezifischen Eigenschaften der Ökotypen wie Trockenheitsresistenz oder Anpassung an Höhenlagen geht damit zunehmend verloren. Die entsprechende Genetik steht dann auch der Züchtung nicht mehr als Ausgangsmaterial zur Verfügung (Exkurs 1). Aus diesem Grunde wurden vom Bundesamt für Landwirtschaft in den letzten Jahren im Rahmen des Nationalen Aktionsprogramms Pflanzengenetische Ressourcen (NAP-PGREL) Projekte lanciert zur gezielten Erhaltung von Naturwiesen, die solche «ursprünglichen» Ökotypen noch aufweisen (WEYERMANN 2007; BOSSHARDet al. 2009).
Angesichts der zentralen Bedeutung für die mitteleuropäische Landwirtschaft und im Besonderen für die Schweiz muss in Zukunft dem Naturfutterbau als eigenem Produktionszweig in Forschung, Ausbildung und Beratung wieder mehr Beachtung geschenkt werden. Dazu soll das vorliegende Buch einen Beitrag leisten.
Exkurs 1
Naturfutterbau: Hindernis für die Industrialisierung der Landwirtschaft
Welchem Druck der Naturfutterbau im Zuge der Industrialisierung der Landwirtschaft vor allem im angelsächsisch geprägten Ausland ausgesetzt war, und welchen verhältnismässig moderaten Weg die Schweiz bisher eingeschlagen hat, zeigt folgendes Zitat eindrücklich. Es stammt aus der Rede des emeritierten, langjährigen Futterbauprofessors der ETH Zürich, Joseph Nösberger, welche er 2009 zum 75-jährigen Jubiläum der schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für den Futterbau AGFF hielt.
«In Europa begann Ende der fünfziger, anfangs der sechziger Jahre ein sehr starker Trend zur Maximierung der Erträge der Naturwiesen und Kunstwiesen. Jede technische Möglichkeit sollte hierfür ausgenützt werden. Der Handel bot neue Herbizide an, die es ermöglichten die Kräuter und Leguminosen in den Naturwiesen zurückzudrängen oder lieber noch zu eliminieren. Gleichzeitig stieg das Angebot an billigen Stickstoffdüngern. Damit waren zwei wichtige Voraussetzungen für eine kurzfristige Maximierung der Erträge gegeben.
Das Motto lautete: «Make of the grass a crop». Ich erinnere mich noch gut an eine Exkursion während einer Europäischen Futterbautagung in Chur. William Davies, der damalige Direktor eines englischen Forschungsinstitutes für Futterbau beurteilte die relativ artenreichen Wiesen als völlig verunkrautet und empfahl den Einsatz von Herbiziden und hohen Stickstoffgaben. Viele Forschungs- und Beratungsinstitutionen in Europa für Futterbau liessen sich von diesem technokratischen, kurzfristig ausgerichteten Zeitgeist anstecken. Der damalige Präsident der AGFF, Prof. Rudolf Koblet, hatte grösste Bedenken gegenüber diesem Ansatz. Er sagte damals, die Empfehlungen von Davies seien für unser Gebiet nicht vertretbar, wir kennen die Bedeutung der meisten Kräuter in den Naturwiesen nur ungenügend, sie sind eine Komponente der standortsangepassten Pflanzengemeinschaften und schliesslich haben auch sie ein Existenzrecht. – Eine mutige und klare Analyse, die sich nicht dem Zeitgeist anpasste.
Koblet und die AGFF haben ein grosses Verdienst daran, dass bei uns die Naturwiesen nicht entkrautet wurden. Koblet muss es mit Genugtuung erfreut haben, dass ein gutes Jahrzehnt später eine Gruppe aus einem Züchtungsinstitut in Wales in den Naturwiesen des Zürcher Oberlandes und der Leventina Ökotypen von Gräsern für ihr Zuchtprogramm sammelten. Mit der angestrebten Maximierung der Erträge hat man die Naturwiesen … geopfert.»
1.2 Wiesen, Weiden, Wiesland und Co: Zur Klärung wichtiger Begriffe
1.2.1 Nutzungstypen: Matten, Mähweiden, Weiden
Die Nutzung von Wiesland erfolgt durch Mahd oder Beweidung – oder beides abwechslungsweise. Die daraus resultierenden drei Grundkategorien des Wieslandes sind die Mähwiesen (auch Matten genannt), die Weiden (auch Dauerweiden genannt) und die Mähweiden, bei denen abwechslungsweise gemäht und beweidet wird. Daneben existieren verschiedene weitere Begriffe mit synonymer Bedeutung (Abb. 2). Verwirrlich kann sich dabei auswirken, dass Mähwiesen häufig auch kurzerhand als Wiesen bezeichnet werden – so spricht man oft von «Wiesen und Weiden». Als Überbegriff eignet sich «Wiese» deshalb eigentlich nicht. Heute werden stattdessen als Sammelbegriffe für die «ausdauernden Pflanzengemeinschaften, die vorwiegend aus Gräsern und anderen krautigen Arten zusammengesetzt sind» (DIETL und LEHMANN 2004) – also alle Wiesen, Weiden und Mähweiden zusammen – die Begriffe «Grünland», «Grasland» und «Wiesland» synonym verwendet. Weder Grünland noch Grasland sind allerdings begrifflich korrekt – denn auch ein Wald ist grün, und in vielen Wiesen hat es deutlich mehr als nur Gräser, manchmal sogar überhaupt keine Gräser, abgesehen davon, dass auch im Wald Gräser vorkommen. Aufgrund dieser Überlegungen erscheint «Wiesland» als der am besten geeignete übergeordnete Begriff und wird entsprechend auch in diesem Buch verwendet.
In Abgrenzung des Wieslandes zum Wald auf der einen Seite und zur Ackernutzung auf der anderen Seite gibt es vielfältige Übergänge oder Mischformen und entsprechende weitere Begriffe; die wichtigsten sind in Abbildung 3 und 4 zusammengestellt.
1.2.2 Nutzungsintensität und Ökoflächen/Biodiversitätsförderflächen
Neben der Nutzungsform ist für die Praxis auch die Intensität der Wiesennutzung ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Als extensiv genutzt gelten alle Wiesen und Weiden, auf welche nicht aktiv Dünger eingebracht wird – das heisst abgesehen beispielsweise von den Ausscheidungen von Weidetieren oder vom Stickstoffeintrag aus der Luft. Die Anzahl Nutzungen ist dabei nicht definiert. Als wenig intensiv genutzt gelten Wiesen, denen jährlich oder alle paar Jahre etwas Mist und teilweise auch wenig Gülle verabreicht wird. Mittelintensiv bis sehr intensiv genutzte Wiesen werden jährlich ein- bis mehrmals mit höheren Hof- und/oder Kunstdüngergaben versehen und mindestens 3 mal jährlich genutzt.
Extensiv und wenig intensiv genutzte Wiesen können in der Schweiz als sogenannte Ökoflächen – ab 2014 neu als Biodiversitätsförderflächen BFF bezeichnet – angemeldet werden und erhalten dadurch zusätzliche Direktzahlungen (DZV 2014). Neben einem Düngungsverbot (extensiv genutzte Wiesen, extensiv genutzte Weiden) beziehungsweise einer eingeschränkten Düngung (wenig intensiv genutzte Wiesen) gilt zudem generell bei den Wiesen ein frühester erster Schnittzeitpunkt. Darüber hinaus gibt es viele Sonderregelungen, beispielsweise im Rahmen von Vernetzungsprojekten.
Wiesen und Weiden, die ein Minimum an bestimmten Indikatorpflanzenarten aufweisen, zählen zu den Ökoflächen mit Öko-Qualität, ab 2014 zu den BFF Qualitätsstufe II (BFF QII). Aus einer Liste mit rund 40 Pflanzenarten(gruppen) müssen jeweils mindestens sechs in definierten Flächenausschnitten vorhanden sein. Es wird unterschieden zwischen Wiesen und Streuwiesen in den unteren Lagen (in den meisten Kantonen bis 1000 m ü. M.), Wiesen und Streuwiesen in den höheren Lagen, Weiden in der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) und Weiden im Sömmerungsgebiet (BLW 2015a).
Je nach Lage, Umfeld und zusätzlichen Nutzungsbedingungen werden als BFF angemeldete Wieslandflächen in der LN zudem mit einem Vernetzungsbeitrag unterstützt (BLW 2015b).
Eine Übersicht über die aktuellen, bundesweiten Regelungen gibt die Webseite www.blw.admin.ch/themen/00006/01711/index.html?lang=de. Die kantonalen Spezifitäten sind jeweils auf den Webseiten der kantonalen Landwirtschafts- und Naturschutzämter aufgeschaltet.
Abb. 3. Begriffliche Übersicht über die wichtigsten Landnutzungs- und Vegetationsformen Mitteleuropas in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität und Nutzungsform. U=Ungenutzte Ökosysteme, Uw=Urwiesen (sowie Fels-, Auen-, Gewässerbiotope), HS=Hors-Sol-Kulturen.
Abb. 4. Übersicht über die Hauptnutzungstypen im Wiesland und ihre Bezeichnung. Die Begriffe ohne Klammern werden in diesem Buch verwendet. In Klammern sind Synonyme aufgeführt, wobei die mit ° markierten Begriffe leicht unterschiedliche Nutzungsformen bezeichnen. * Oft auch Mischformen mit Mähnutzung.
1.2.3 Naturfutterbau und Kunstfutterbau, Naturwiesen und Kunstwiesen
Naturfutterbau bezeichnet die landwirtschaftliche Nutzung und Pflege von Naturwiesen für die Fütterung von Raufutterverzehrern zur Erzeugung von Milch und Fleisch. Im Gegensatz zu Kunstwiesen werden Naturwiesen nicht umgebrochen oder – bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts für viele Fettwiesen üblich – nach einem Umbruch durch die bodenbürtige Samenbank, manchmal unter Ergänzung von «Heublumen» aus dem eigenen Heustock, wieder begrünt (Feldgras- oder Egartwirtschaft, vgl. z.B. MARSCHALL 1943). Die Ertragsfähigkeit von Naturwiesen gründet damit auf autochthonen Pflanzenarten undökotypen, also auf Pflanzen, die in der Region natürlicherweise vorkommen und die sich gegebenenfalls über Jahrhunderte an die vorherrschenden Bedingungen der Bewirtschaftung anpassen konnten. Ziel des Naturfutterbaus ist es, eine nachhaltige, effiziente und wirtschaftliche Nutzung auf der Basis des bestehenden, natürlichen Pflanzenbestandes sicherzustellen.
Kunstfutterbau und sein Resultat, die Kunstwiesen, stellen quasi die ackerbauliche Form des Futterbaus dar. Sie basieren auf gezielten Ansaaten züchterisch bearbeiteter Wieslandarten, die über ein bis mehrere Jahre gemäht oder beweidet und dann wieder umgebrochen werden, z.B. im Rahmen einer Fruchtfolge.
Die Anwendung von Übersaaten zur Verbesserung von Naturwiesenbeständen ist als eine Zwischenform zwischen Kunst- und Naturfutterbau einzuordnen.
1.3 Multifunktionalität: Wiesland dient zu weit mehr als nur zur Futterproduktion
Die Qualität und Quantität, die eine Wiese an Gras und Heu als Futter für Raufutterverzehrer liefert, ist zwar oft der wichtigste Gesichtspunkt, unter welchem Wiesland beurteilt wird. Das Wiesland bietet aber zahlreiche weitere «Ökosystemdienstleistungen», von denen einige zunehmend wichtiger werden (Abb. 5). So werden immer mehr staatliche Beiträge für «gemeinwirtschaftliche Leistungen» wie die Erhaltung beziehungsweise Förderung der Artenvielfalt oder die Landschaftsqualität an solche Eigenschaften beziehungsweise Leistungen des Wieslandes gekoppelt. Viele Eigenschaften ausserhalb der Futtermenge und -qualität wirken sich aber auch auf andere Weise direkt wirtschaftlich auf den Betrieb aus, beispielsweise der Erosionsschutz oder das Saatgutpotenzial von Wiesen. Ein zentrales Argument für die Gewährung von Direktzahlungen im Wiesland ist auch die Offenhaltung der Landschaft.
Die wichtigsten der vielfältigen Leistungen des Wieslandes sind:
–Futterertrag in Bezug auf Menge und Qualität: Aus landwirtschaftlicher Sicht gehören Ertrag und Qualität eng zusammen. Ein hoher Ertrag an qualitativ hochwertigem Futter ist heute im sogenannten Wirtschaftsgrünland die im Vordergrund stehende Funktion des Wieslandes. Die mit dem Wiesenfutter mögliche Milch- und Fleischleistung pro Tier, aber ebenso die ökonomisch wichtige Grösse der Flächenproduktivität, also die Anzahl Liter Milch oder Kilogramm Fleisch, die pro Hektare Wiesland produziert werden können, hängen direkt vom Ertrag und der Qualität des Futters einer Wiese ab (s. Kap. 9). Ein hoher Ertrag ist im Naturfutterbau nur möglich mit einem stabilen, ausgewogenen Pflanzenbestand, bei dem einerseits die ertragsbildenden Arten zugleich die wertvollen Futterpflanzen ausmachen und bei dem andererseits auch die weiteren unentbehrlichen Funktionen wie Resilienz («Stabilität»), Befahrbarkeit usw. erfüllt sind.
Exkurs 2
Wiese – ein altes Wort mit junger Bedeutung
Noch anfangs des 20. Jahrhunderts wurde in der Fachliteratur heftig darüber debattiert, wie der Begriff «Wiese» zu definieren sei und wie er sich von den zahlreichen anderen, teilweise synonym verwendeten Begriffen wie Fluren, Rasen, Spreiten, Matten, oder Grasland abgrenze. Im Bemühen, die verschiedenen Bezeichnungen einzuordnen und das Wiesland begrifflich klar und einheitlich zu fassen, wurden auch immer wieder neue Begriffe kreiert und verschiedene Unterscheidungskriterien festgelegt. So gab es beispielsweise die Aufteilung zwischen «langrasigen grasreichen Wiesen» und «kurzrasigen, kräuterreichen Matten». Der deutsche Pflanzengeograph DRUDE (1890) fasste die verschiedenen Begriffe für das heutige Wiesland unter dem Begriff «Grasflurformation» zusammen. Der Zürcher Vegetationskundler Eduard RÜBEL führte 1930 den Begriff Sempervirentiherbosa ein, mit dem er das Wiesland kennzeichnete – was übersetzt aus dem Lateinischen soviel heisst wie «immergrünes Kräuterland».
Ausführlich mit dem Wiesenbegriff und den damals gebräuchlichen oder vorgeschlagenen Termini und Definitionen befassten sich die beiden weitherum anerkannten Futterbauwissenschafter Friedrich Gottlieb STEBLER und Carl SCHRÖTER, beide ebenfalls in Zürich tätig. Sie definierten 1892 in einem wegweisenden Werk die Wiese als Sammelbegriff über die vielen anderen vorhandenen Bezeichnungen als eine «Pflanzengesellschaft, welche aus… vorwiegend ausdauernden und krautartigen … Landpflanzen inklusive Moose und Flechten sich zusammensetzt und den Boden mit einer mehr oder weniger geschlossenen Narbe überzieht…». Nach dem Kriterium der Nutzung unterteilten sie die Wiesen in die «unberührten Naturwiesen oder Urwiesen», und die bewirtschafteten «Kulturrasen», die sie wiederum differenzierten in Streuewiesen und Futterwiesen, wobei sie unter der letzteren Kategorie gemähte Matten von beweideten Weiden unterschieden. Von späteren Autoren wurde immer wieder auf diese Einteilung Bezug genommen.
Warum sich unter den zahlreichen Begriffen in den vergangenen 100 Jahren das Wort «Wiese» als Oberbegriff für alle Arten von Wiesland durchgesetzt hat, ist unklar. Sicher ist nur, dass «Wiese» auf Mittelhochdeutsch «wise» beziehungsweise Althochdeutsch «wisa» zurückgeht. Die weitere Herkunft ist unsicher. Nach Etymologie-Duden könnte es entweder mit lat. «viridis» (grün) oder mit engl. «ooze» (Schlamm) beziehungsweise «woosy» (feucht) verwandt sein – und damit auch mit dem deutschen Wort «Wasser» (KAUTER 2002).
Gut nachvollziehbar ist dagegen die Herkunft des heute ebenfalls gebräuchlichen Begriffs «Matte». Matte hat nichts mit dem Lateinischen «matta» zu tun – auf welches sich der Begriff Matte im Sinne von Teppich usw. bezieht –, sondern geht auf die indogermanische Wurzel «med» zurück, welche auch im lateinischen «metare» (mähen, ernten, abhauen), im englischen Wort «meadow» oder im deutschen «(nieder)metzeln» und «mähen» enthalten ist. Der Begriff reicht also noch zurück in die Zeiten, in welchen Wiesen mangels schneidender, hochqualitativer Langblattsensen noch nicht gemäht, sondern mit Hausensen kleinflächig abgehauen wurden. Auch das Wort «Heu» geht auf «hauen» zurück (vgl. auch Kap. 6.4).
–Befahrbarkeit und Erosionsschutz: Intensiv genutzte Mähwiesen werden heute miti mmer schlagkräftigeren, grösseren und schwereren Maschinen befahren. Bei einer Neigung des Wieslandes von über 18 Prozent wird die Stabilität des Wasens (Grasnarbe) zu einem ausschlaggebenden Faktor für die Befahrbarkeit und damit für die effiziente und sichere maschinelle Nutzung. Ebenso wichtig ist ein stabiler Wasen für Weiden – vor allem bei nassen oder steilen Verhältnissen. Die Wasenstabilität kommt im Wesentlichen durch die rasenbildenden Grasarten zustande, wobei die stabilisierende Wirkung von Grasart zu Grasart unterschiedlich ist und oft unterschiedliche Ökotypen unterschiedliche Wasenbildungsfähigkeiten aufweisen (z. B. verschiedene Rotschwingel-Typen). Bei einer zu düngerintensiven Nutzung fallen die Rasengräser oft als erste aus, weil ein dichter, hochwüchsiger Pflanzenbestand zu wenig Licht in die unteren Bestandesschichten durchlässt (Kap. 3.3.1). Ausnahmen sind Weiden und Mähweiden mit einer sehr häufigen Nutzung, wodurch der Bestand immer tief bleibt und immer genügend Licht auch in die tieferen Vegetationsschichten einfällt. Wenig intensiv und extensiv genutzte Wiesen weisen meist einen sehr stabilen Wasen auf. Ausnahmen bilden einerseits sehr trockene Standorte, auf denen die Rasengräser keine geschlossene Grasnarbe mehr bilden können, andererseits saure, schattige Standorte, auf denen verschiedene Moosarten die Gräser mehr oder weniger stark verdrängen können.
Abb. 5. Undifferenzierte Wieslandnutzung: Die einheitliche, intensive Nutzung grosser Flächen schafft für die meisten Arten der Wiesenflora und -fauna lebensfeindliche Bedingungen. Auch weitere multifunktionale Leistungen des Wieslandes, die neben der Erhaltung der Biodiversität wichtig sind, beispielsweise hinsichtlich der Ästhetik, können mit einer solchen Nutzungsweise nicht mehr erbracht werden. Toggenburg/CH.
–Resilienz («Stabilität»): Bei Ackerkulturen kann eine Ernte unter extremen Bedingungen ganz oder teilweise ausfallen – auf die Folgekultur hat das kaum Einfluss. Nicht so bei einer Naturwiese: Ein degenerierter Pflanzenbestand – sei es durch Bewirtschaftungsfehler, sei es beispielsweise durch Mäuse- oder Engerlingsschäden oder auch durch eine extreme Trockenheit – kann Jahre brauchen, bis er wieder das alte Niveau von Ertrag und Qualität erreicht. Resilienz, also Robustheit gegenüber Umwelt- und Bewirtschaftungseinflüssen, ist deshalb im Naturfutterbau von grosser Bedeutung.
–Artenvielfalt / Biodiversität: Obwohl in der heutigen Form menschlichen Ursprungs, beherbergt das Wiesland einen Grossteil der heimischen Biodiversität Mitteleuropas (Kap. 2.4.1). Der Beitrag des Wieslandes zur Erhaltung der Biodiversität ist deshalb eine zentrale Funktion. Sie hat in den letzten Jahrzehnten parallel beziehungsweise komplementär zur extremen Verarmung seiner Biodiversität stark an Bedeutung gewonnen. Dabei zählt weniger die schlichte Zahl an Arten – denn auch eine stark gestörte, übernutzte Wiese kann als Folge eines kurzfristigen Auftretens verschiedener Störungszeiger in beschränktem Masse artenreich sein. Wesentlich sind die Kriterien 1) Anzahl Wiesenarten, 2) Anzahl seltenere oder gefährdete Arten und 3) Vorhandensein spezifischer Ökotypen (Vielfalt auf genetischer Ebene).
–Ästhetik: Auch dieses Kriterium nahm weitgehend parallel zum Verschwinden der Blumen- und Strukturvielfalt unserer Wiesen und Weiden einen immer höheren Stellenwert ein. Als besonders schön wird Wiesland in der Regel dann empfunden, wenn es blumenreich, farbig und strukturreich, also zum Beispiel mosaikartig genutzt oder mit Strukturelementen wie Rainen, Einzelbäumen oder Hecken durchsetzt ist (SCHÜPBACHet al. 2009). Aber auch die Artenvielfalt wird ästhetisch direkt positiv beurteilt (LINDE-MANN-MATTHIESet al. 2010). Schliesslich ist auch das Nutzungsmosaik des Wieslandes ein landschaftsästhetisch bedeutsamer Faktor. Seit 2014 können in der Schweiz für besonders blumenreiche Wiesen und für die Aufrechterhaltung eines vielfältigen Nutzungsmosaiks neben den Biodiversitätsförderbeiträgen spezifische Landschaftsqualitätsbeiträge ausbezahlt werden (Schweizerischer Bundesrat 2014). Ein Beispiel für die Förderung des Wiesland-Nutzungsmosaikes und weiterer ästhetischer Qualitäten des Wieslandes beinhaltet das Landschaftsqualitätsprojekt im Kanton Appenzell Ausserr hoden (Appenzell a. Rh. 2014). Die futterbauliche Nutzung ist zudem für die Offenhaltung und damit den Charakter vor allem auch der touristisch genutzten Landschaften ausschlaggebend.
2 Ökologie des Naturwieslandes
2.1 Wiesen als Abbild von Standort und Bewirtschaftung
Ökologisch betrachtet sind Naturwiesen und -weiden Lebensgemeinschaften von höheren Pflanzen, Tieren, Pilzen und Mikroorganismen, die weitgehend ohne direktes menschliches Zutun (z. B. Ansaat, Pflanzung) am betreffenden Standort vorkommen und deren Zusammensetzung bei angepasster Nutzung über Jahrzehnte weitgehend stabil ist. Die Koexistenz der Vielzahl an Arten ist ein ökologisches Wesensmerkmal des Wieslandes, gleichzeitig ist sie wesentlich für seine Ertragsfähigkeit verantwortlich (Kap. 2.3.2).
Neben den Faktoren, welche alle natürlichen Ökosysteme prägen, wie Klima, Boden, Topographie und am Ort vorhandene Organismen, kommt bei den Naturwiesen – im Gegensatz zu den von menschlicher Nutzung unabhängigen Urwiesen (Abb. 3) – die Bewirtschaftung als ein dominanter Faktor dazu, der zudem unzählige Varianten aufweist.
Einen Überblick über das komplexe Wirkgefüge der Natur- und der Kulturfaktoren mit seinen zahlreichen Einflusskomponenten gibt Abbildung 6. Dabei ist zu bedenken, dass der sichtbare, oberirdische Teil der Wiese nur etwa die Hälfte des Lebensraumes ausmacht. Über viele der Prozesse und Wechselwirkungen, die im Wurzelraum ablaufen, haben wir erst ganz anfängliche Kenntnisse (Kap. 2.6).
Jede Bewirtschaftungsmassnahme beeinflusst das ganze Gefüge der vielfältigen Wechselwirkungen. Und die Folgen vieler Ereignisse oder Eingriffe manifestieren sich oft erst nach Jahren.
Der qualitative und quantitative Ertrag einer Wiese ebenso wie ihre botanische Zusammensetzung ist also das Resultat des Zusammenspiels aller Natur- und Kulturfaktoren. Boden, Klima und Gelände sind dabei die nicht oder nur eingeschränkt beeinflussbaren Faktoren, welche die Ertragsfähigkeit (Ertragspotenzial) eines gegebenen Standortes definieren. Die übrigen Faktoren sind mehr oder weniger direkt oder indirekt durch Nutzungs- und Pflegemassnahmen steuerbar.
2.2 Die abiotischen Umweltfaktoren
2.2.1 Wasserhaushalt
Die Wasserverfügbarkeit im Boden ist für die Pflanzen ganz direkt von vitaler Bedeutung zur Aufrechterhaltung ihrer Lebensfunktionen. Aber auch indirekt prägt die Wasserverfügbarkeit die Wachstumsbedingungen vielfältig mit. So können viele Nährstoffe von den Pflanzen nur dann aufgenommen werden, wenn sie im Bodenwasser gelöst sind. Wassermangel – auch nur temporär – wirkt sich deshalb auf die Ausprägung einer Wiese ähnlich aus wie Nährstoffmangel. Auch der Umkehrschluss ist richtig: Die Ausbringung von Nährstoffen auf Wiesen, die regelmässig unter Wassermangel leiden, verfehlt den gewünschten Effekt. Abhilfe kann in diesen Fällen eine Bewässerung schaffen. Dies wird in den niederschlagsärmeren Regionen der Zentralalpen zunehmend praktiziert, um das Wiesland weiter intensivieren und mehr Ertrag erzeugen zu können (Kap. 6.10).
Abb. 6. Die wichtigsten Einflussfaktoren, welche die Entwicklung und die Eigenschaften einer Naturwiese prägen. Links «Naturfaktoren», kursiv: durch die Bewirtschaftung und weitere menschliche Aktivitäten wesentlich beeinflussbar. Rechts «Kulturfaktoren», blau: mähwiesenspezifisch, grün: weidespezifisch. Nach BOSSHARD (1999), ergänzt.
Auch zu viel Wasser, das heisst eine Wassersättigung des Bodens über längere Zeit, schränkt die Wuchsbedingungen ein und bestimmt das Vorkommen oder Nichtvorkommen vieler Arten. Hauptsächlich verantwortlich für diesen Effekt ist nicht das Wasser selber, sondern die durch das Wasser bewirkte reduzierte Sauerstoffversorgung des Bodens im Wurzelraum.
2.2.2 Nährstoffe und Düngung
Für Ertrag und Artenzusammensetzung des Wieslandes ist das Nährstoffniveau ein ausschlaggebender Faktor. Die Nährstoffe können von der Pflanze allerdings nur unter der Voraussetzung aufgenommen werden, dass die Wasserverfügbarkeit während der Wachstumszeit in geeignetem Masse sichergestellt ist. Ein ausgewogener Wasserhaushalt ist deshalb für eine gute Nährstoffverfügbarkeit ebenso ausschlaggebend wie die im Boden vorhandenen Nährstoffe.
Während bei Extensivwiesen der jährliche Ertrag lediglich aus den im Boden vorhandenen und durch den Niederschlag eingetragenen Ressourcen gebildet wird (Exkurs 3), wird definitionsgemäss ab einer wenig intensiven Nutzung aktiv Dünger zugeführt. Je nach Betriebsorganisation stammt die Nährstoffzufuhr mehr oder weniger aus geschlossenen betrieblichen Kreisläufen, oder aus einem Import auf den Betrieb, sei es in Form von zugekauftem Dünger (Hofdünger, Kunstdünger) oder von zugekauften Futtermitteln, die über die Verfütterung an die Raufutterverzehrer zu zusätzlichem Hofdünger führen.
Düngung, in welcher Form auch immer, ist – von der Herstellung bis zur Ausbringung – immer mit Kosten verbunden. Jede Düngung benötigt zudem Energie zur Herstellung und zum Ausbringen, und je nach Düngerart werden auch nicht erneuerbare Ressourcen wie Phosphor oder Erdöl verbraucht. Schliesslich hat Düngung in den meisten Fällen unvermeidliche negative Auswirkungen auf die Umwelt, z. B. durch Stickstoffemissionen in die Luft, wie sie bei jedem Einsatz von stickstoffhaltigen Düngern resultieren, oder durch den Eintrag von Düngerfrachten in Oberflächengewässer durch Ab- und Ausschwemmung oder durch Versickerung ins Grundwasser.
Sowohl aus wirtschaftlichen wie ökologischen Gründen ist deshalb ein sehr gezielter Einsatz der Düngung bei der Bewirtschaftung des Wieslandes zentral. Der Hofdünger schliesst dabei den Stoffkreislauf zwischen Wiese und Raufutterverzehrer auf dem Hof. Für seine Effizienz im Hinblick auf die Ertragsbildung, aber ebenso zur Minimierung negativer Umweltwirkungen und von Verlusten, sind einerseits die Aufbereitung (z. B. als Mist/Gülle, mit/ohne Zusätze), andererseits die Ausbringung entscheidend. Bei der Ausbringung sind neben den technischen Möglichkeiten (z.B. Einsatz von Schleppschlauchverteiler) vor allem die Form, der Zeitpunkt und die Menge der Hofdüngergaben zu beachten. Ihre Anpassung an den Standort und den Pflanzenbestand gehört zu den wichtigsten Massnahmen des nachhaltigen Naturfutterbaus und ist für den Ertrag und die botanische Zusammensetzung des Wiesenbestandes einer der Hauptfaktoren (s. Kap. 4.1).
Der Einsatz von Handelsdünger ist im Wiesland der Schweiz und den meisten Teilen Mitteleuropas in aller Regel nicht mehr zu rechtfertigen. Die meisten intensiv genutzten Wieslandböden der Schweiz sind heute vor allem in Regionen mit hohen Tierbeständen als Folge der anhaltenden Futtermittelzufuhr und Gülledüngung im Hinblick auf die Ertragsbildung für Jahrzehnte mit Phosphor gut bis übermässig versorgt (Kap. 6.9.2 und 6.9.3). Der nötige P-Gehalt im Boden, der zur Vermeidung von Ertragseinbussen nötig ist, wurde offenbar lange stark überschätzt (BUWAL 2004; BOSSHARDet al. 2010).
Was den mineralischen Stickstoffdünger (Handelsdünger) anbelangt, ist sein Einsatz im Wiesland in energetischer Hinsicht besonders ineffizient, einerseits weil seine Herstellung sehr viel fossile Energie benötigt (BOSSHARDet al. 2010), andererseits weil im Wiesland vielfältige Möglichkeiten einer Förderung der bakteriellen Stickstofffixierung über Leguminosen bestehen, die je nach Leguminosenanteil bis über 300 kg Reinstickstoff pro Hektare und Jahr fixieren können (Übersicht in KLATT 2008). Je mehr Stickstoff gedüngt wird, desto weniger Stickstoff produzieren die Leguminosen (Abb. 7).
Exkurs 3
Ertrag ohne Düngung: Bedeutung und Effekt der natürlichen Nährstoff-Nachlieferung des Wieslandbodens
Wiesland ist ein Ökosystem, das auch ohne Düngung einen massgeblichen, konstanten Ertrag liefert. Ungedüngte Magerwiesen liefern langfristig Erträge von bis zu 4 Tonnen Trockensubstand (TS) pro ha (DIETL 1986). Wird andererseits die Düngung in langjährig gedüngten Beständen ausgesetzt, geht der Ertrag zwar zurück. Die Höhe dieses Rückgangs hängt aber in hohem Masse von den Standortsbedingungen, insbesondere vom Nährstoff-Nachlieferungsvermögen des Bodens und von den klimatischen Bedingungen, aber auch vom Pflanzenbestand selber ab. In einem 20-jährigen Düngungsversuch auf einem guten Boden im Schweizer Jura nahm der TS-Ertrag von 6 bis 8 t/ha (je nach Düngungsvariante) nach Aufgabe der Düngung in wenigen Jahren auf 3,5 t/ha ab und blieb dann über all die Jahre weitgehend konstant. Im Mittel wurden dann pro Jahr und Hektare 12 kg P2O2, 71 kg K2O und 69 kg N im Erntegut abgeführt (THOMET und KOCH 1993). SCHIEFER (1984) stellte im Rahmen ausgedehnter Aushagerungsversuche in Baden-Württemberg unter günstigen Bedingungen hinsichtlich unter anderem des Nährstoff-Nachlieferungsvermögens des Bodens selbst nach 15 Jahren Aushagerung keinen nennenswerten Rückgang des Ertragsniveaus nach Aufgabe der Düngung fest, während unter anderen Bedingungen ein Ertragsabfall unterschiedlicher Stärke und Geschwindigkeit eintrat (SCHIEFER 1984).
Diese Erkenntnisse stellen in Frage, was bis heute in Lehre und Beratung den Landwirten und Studierenden vermittelt wird und worauf die Nährstoffbilanz und Düngungspraxis in vielen Ländern basiert: dass nämlich die aus einer bewirtschafteten Fläche abgeführten Nährstoffe ersetzt werden müssten, um die Ertragsfähigkeit des Wieslandes erhalten zu können. Dieser Ansatz wird auf Justus von LIEBIG (1840) zurückgeführt.





























