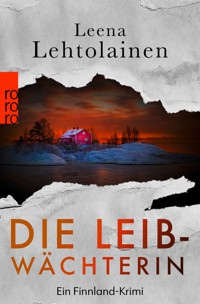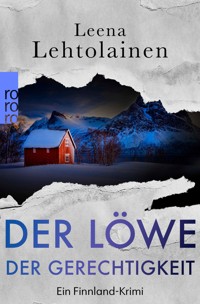9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Leibwächterin
- Sprache: Deutsch
Hilja Ilveskero hat sich als Leibwächterin der frisch verlobten Julia Gerbolt engagieren lassen, die sie zum Skifahren in die Schweiz begleitet. Als sie dort Julias Vater begegnet, fühlt sich Hilja sofort bedroht: Schließlich ist dieser Ivan Gezolian der weißrussische Waffenhändler, den Hiljas Ex-Freund und Agent David Stahl um illegales radioaktives Material erleichtert hat. Als wenig später der als verschollen geltende David selbst vor Hilja steht, stellt sie fest, dass sie noch immer Gefühle für ihn hat. Da David undercover weiterhin versucht, Gezolian zu überführen, steckt Hilja bald tiefer in dem Fall, als ihr lieb ist. Zudem erfährt sie, dass ihr Vater in Kürze Hafturlaub bekommen wird. Der Mörder ihrer Mutter hat auch sie selbst schon bedroht, und so fürchtet Hilja um die Sicherheit ihre Halbschwester. Zurück in Finnland kommt es zu einer Konfrontation, die sie nie wollte. Auch zwischen David und Hilja ist es an der Zeit, Klarheit zu schaffen. Als die beiden Gezolian eine Falle stellen, muss sich erweisen, ob sich Hilja dieses Mal auf David verlassen kann. In einem Showdown auf Leben und Tod schlägt sich Hilja den Weg frei in eine hellere Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Leena Lehtolainen
Das Nest des Teufels
Über dieses Buch
Hilja Ilveskero hat sich als Leibwächterin der frisch verlobten Julia Gerbolt engagieren lassen, die sie zum Skifahren in die Schweiz begleitet. Als sie dort Julias Vater begegnet, fühlt sich Hilja sofort bedroht: Schließlich ist dieser Ivan Gezolian der weißrussische Waffenhändler, den Hiljas Ex-Freund und Agent David Stahl um illegales radioaktives Material erleichtert hat. Als wenig später der als verschollen geltende David selbst vor Hilja steht, stellt sie fest, dass sie noch immer Gefühle für ihn hat. Da David undercover weiterhin versucht, Gezolian zu überführen, steckt Hilja bald tiefer in dem Fall, als ihr lieb ist.
Zudem erfährt sie, dass ihr Vater in Kürze Hafturlaub bekommen wird. Der Mörder ihrer Mutter hat auch sie selbst schon bedroht, und so fürchtet Hilja um die Sicherheit ihre Halbschwester. Zurück in Finnland kommt es zu einer Konfrontation, die sie nie wollte.
Auch zwischen David und Hilja ist es an der Zeit, Klarheit zu schaffen. Als die beiden Gezolian eine Falle stellen, muss sich erweisen, ob sich Hilja dieses Mal auf David verlassen kann.
In einem Showdown auf Leben und Tod schlägt sich Hilja den Weg frei in eine hellere Zukunft.
Vita
Leena Lehtolainen, 1964 geboren, lebt und arbeitet in Degerby, westlich von Helsinki. Sie ist eine der erfolgreichsten und renommiertesten Schriftstellerinnen Finnlands.
Bekannt wurde sie mit ihrer Krimireihe um die Anwältin und Kommissarin Maria Kallio. 2011 erschien bei Kindler «Die Leibwächterin», 2012 «der Löwe der Gerechtigkeit», die beiden ersten Bände der Thriller-Trilogie um die Personenschützerin Hilja Ilveskero.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel «Paholaisen Pennut» bei Tammi Publishers, Helsinki.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2014
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg «Paholaisen Pennut» Copyright © 2012 by Leena Lehtolainen
Redaktion Gisela Klemt
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-31161-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine lieben Freunde Carol und Larry Kohler, die mich nach Leysin eingeladen haben.
1
Die Bar hieß Le Lynx. Der schwarz-weiße Luchs im Firmenzeichen war extrem stilisiert und erinnerte eher an einen Löwen. Julia Gerbolt musterte die Drinkkarte und bestellte einen Mojito. Ich begnügte mich mit Mineralwasser, bat aber gleich um eine große Flasche. Meine Beine zitterten nach den Abfahrtsläufen vor Anstrengung, und Durst machte mich anfällig für Kopfschmerzen.
Ich fragte mich, warum Julia unter den vielen Skiorten in den Alpen ausgerechnet Leysin gewählt hatte und nicht eins der vom Jetset bevölkerten Dörfer. An der Landschaft war allerdings nichts auszusetzen: Als wir zur Bar spazierten, ging gerade die Sonne unter, und die rosa gefärbten Berggipfel glichen der Illustration in einem Märchenbuch.
Es war meine erste Reise mit Julia. Vor etwa drei Wochen, Anfang Februar, war ich in den Dienst der aus Russland stammenden Frau getreten. Sie war die Verlobte des finnischen Geschäftsmannes Usko Syrjänen, dessen Assistent Juri Trankow mir den Tipp gegeben hatte, Syrjänen suche eine Leibwächterin für sie. Als Mädchen für alles im Restaurant Sans Nom wollte ich nicht länger arbeiten, denn es kam mir vor, als wäre dadurch meine Ausbildung an der Sicherheitsakademie Queens in New York umsonst gewesen. Für die verwöhnte, hochnäsige Julia, deren wichtigster Lebensinhalt darin bestand, gut auszusehen und Geld zu verplempern, hatte ich zwar nicht viel übrig, aber ich verdiente mehr als je zuvor, und bisher war die Arbeit nicht gerade anstrengend gewesen.
Syrjänen war der Ansicht, dass Julia eine Leibwächterin brauchte. Die Öffentlichkeit interessierte sich für die Braut des Multimillionärs, die zu allem Überfluss selbst gut betucht war. Alexej Gerbolt, Julias erster Mann, war zweiunddreißig Jahre älter gewesen als seine Frau. Zwei Jahre nach der Hochzeit hatte ihn ein Herzinfarkt dahingerafft. Julia hatte den maximalen Anteil an seinem Vermögen geerbt, den das russische Gesetz zuließ. Gerbolts Verwandte waren darüber empört und sannen möglicherweise auf Rache. Ich hatte Julia gefragt, wer ihrer Meinung nach als Rächer in Betracht kam, doch sie hatte nur die Schultern gezuckt.
«Woher soll ich das wissen! Gefahren zu erkennen ist doch deine Aufgabe.»
Es war Usko Syrjänens Idee gewesen, mich zu engagieren, er wollte mich unbedingt als Angestellte, und Juri Trankow hatte ihn darin bestärkt. Auch zwischen Julia und Syrjänen lag ein beträchtlicher Altersunterschied, sechsundzwanzig Jahre, was beide jedoch nicht störte, weil Julia für junge Spunde nichts übrig hatte. Syrjänens Exfrau Satu war ausgerastet, als sie in der Zeitung las, dass ihr Mann sich wieder verlobt hatte, obwohl die Scheidung noch nicht rechtskräftig war. Sie hatte Julia mehrmals angerufen und als Flittchen beschimpft, doch ich glaubte nicht, dass Julia nur deshalb einen Bodyguard brauchte. Vielleicht fühlte sie sich wichtig, wenn sie ständig von einer Leibwächterin begleitet wurde. Wahrscheinlich betrachtete sie mich als Accessoire, wie Schuhe oder eine Handtasche. Jedenfalls hatte sie mir Anweisungen gegeben, wie ich mich zu kleiden hatte: Jeans, Blazer und Springerstiefel wirkten am glaubwürdigsten, meinte sie. Viele meiner männlichen Kollegen trugen maßgeschneiderte Anzüge mit speziellen Taschen für Waffen, Abhörgeräte und ähnliches Zubehör. Auch ein Schlips war praktisch, weil man in der Krawattennadel eine Videokamera verstecken konnte. Zum Zeitvertreib hatte ich begonnen, eine Halskette mit derselben Funktion zu entwerfen. Zwar trug ich nur dann Schmuck, wenn ich femininer wirken wollte, als ich war, doch die Vorstellung, ein Schmuckstück mit Spionagefunktion zu besitzen, reizte mich. Meine verbesserte Gehaltslage ermöglichte es mir schließlich, mein Berufswerkzeug zu modernisieren und einiges neu anzuschaffen. Ich liebäugelte schon seit langem mit einem Infrarotfernglas und effektiveren Ortungsgeräten.
Julia nippte nur an ihrem Mojito. Aus Angst vor Kalorien trank sie nur selten Alkohol, aber beim Skilaufen hatte sie reichlich Energie verbraucht. Sie war mir im Abfahrtslauf überlegen, was mich ziemlich fuchste. In der Schulzeit hatte ich zwar ein paarmal am Berg Maarianvaara Abfahren geübt, aber Onkel Jari, der mich großgezogen hatte, war ein eingefleischter Skilangläufer gewesen, und eine teure Slalomausrüstung hätten wir uns ohnehin nicht leisten können. Auf dem zugefrorenen See Rikkavesi konnte man umsonst Ski laufen. Erst als Erwachsene, nachdem ich aus New York nach Finnland zurückgekehrt war, hatte ich mich ernsthaft im alpinen Skilauf geübt, doch ich konnte die Kurven immer noch nicht so geschmeidig nehmen wie meine Klienten, die von Kindesbeinen an trainiert hatten. Auch im Tennis war ich meist die Schwächere. Meine Fähigkeiten im Judo führte ich meinen Auftraggebern dagegen nicht gern vor, obwohl ich sie natürlich im Vorstellungsgespräch erwähnte. Einmal hatte ich sie allerdings gegen den Mann meiner damaligen Klientin anwenden müssen. Er hatte innerhalb von zehn Sekunden auf dem Teppich gelegen.
Julias Handy klingelte. Sie kramte in ihrer Handtasche. Das Telefon war mit einer Diamantenkette an der Tasche befestigt. Ich warnte meine Auftraggeber immer davor, ihren Reichtum zur Schau zu stellen, doch Julia hatte erstaunt die Augen aufgerissen.
«Was hat man denn davon, reich zu sein, wenn man es nicht zeigen darf?»
Meine vorige Auftraggeberin, Monika von Hertzen, war in dieser Hinsicht das genaue Gegenteil, sie schämte sich ihres Wohlstands und bemühte sich, auch andere daran teilhaben zu lassen. Julia dagegen hatte eine Grimasse geschnitten, als Syrjänen sie halb mit Gewalt zu einer Benefizgala geschleppt hatte. Zum Glück hatte sie dort wenigstens ihren Schmuck vorführen können.
«Papa?» Julia sprach aufgekratzt Russisch. «Potschemu? O.K.» Über ihr Gesicht flog ein echtes Lächeln, eine Seltenheit bei ihr. Als ehemaliges Fotomodell verstand sie sich natürlich darauf, ihr Lächeln anzuknipsen, wann immer sie wollte, doch das war nur ein Profilächeln. Die Miene, die sie jetzt aufgesetzt hatte, war nicht für mich bestimmt – Julia wandte das Gesicht ab.
«In Genf herrscht Verkehrsstau, Vater wird sich ein bisschen verspäten», erklärte sie, nachdem das Telefonat beendet war, und trank wieder einen kleinen Schluck Mojito. Am Glasrand blieb ein glitzernder rosa Streifen zurück.
«Triffst du dich hier mit deinem Vater?»
Über ihre Familie hatte Julia mir nur erzählt, dass ihre Mutter schon lange tot war und dass sie keine Geschwister hatte. Bisher hatte ich angenommen, sie habe ein distanziertes Verhältnis zu ihrem Vater, denn zur Verlobungsfeier, die Syrjänen in einem Trendrestaurant in Helsinki ausgerichtet hatte, war er nicht gekommen.
«Mein Vater ist sehr beschäftigt. Aber jetzt hat er gerade Zeit für eine Stippvisite in der Schweiz.»
«Wohnt er in Moskau?»
«Nein, am Rand von Witebsk. Ich begreife nicht, warum er dieses Kaff Moskau vorzieht, aber er sagt, seine Geschäfte machen es notwendig.» Auf diese Erklärung folgte das typische Schulterzucken, das besagte, damit sei die Sache erledigt.
In der Bar war es bisher still gewesen, doch nun trat eine After-Ski-Gruppe von etwa zehn Männern ein, die Französisch miteinander sprachen. Sie waren deutlich jünger als Julia, die dennoch sofort die Aufmerksamkeit der Männer auf sich zog. Den zierlichen Körperbau und die langen Beine verdankte Julia ihren Genen, ebenso die auffällig dunkelbraunen Augen, die von dauergewellten Wimpern betont wurden. Bei den goldblonden Haaren, den vollen Lippen und den Brüsten, die D-Körbchen füllten, hatte sie der Natur nachgeholfen, und sie trainierte eifrig, um ihren Körper in Form zu halten. Julia verhüllte ihre Reize nicht, sondern bevorzugte enganliegende Kleider und hochhackige Schuhe, in denen sie ihren Verlobten Usko Syrjänen überragte.
Obwohl ich nicht damit rechnete, dass die jungen Männer uns Ärger machen würden, rückte ich meinen Stuhl so zurecht, dass ich sowohl den Eingang als auch den Tisch, an den sie sich setzten, im Auge behalten konnte. Julia verstand sich darauf, unmissverständlich zu zeigen, dass sie keinen Wert auf Gesellschaft legte. Beinahe bewunderte ich die Eiseskälte, die sich dann über ihr Gesicht legte und selbst den hartnäckigsten Verehrer abschreckte. Syrjänens Haushälterin Hanna und ich ließen uns von diesem Blick nicht einschüchtern, aber Juri Trankow fürchtete sich vor Julia.
Wie ich zu Juri stand, konnte ich nicht genau sagen. Ich war ein paarmal mit ihm im Bett gelandet, und er hatte mir das Leben gerettet, obwohl ich ihn zu Beginn unserer Bekanntschaft gründlich gedemütigt hatte. Der Mord, den er begangen hatte, verband uns, wir waren Teil eines Geheimbundes, zu dem als Dritter Hauptmeister Teppo Laitio von der Auslandsabteilung der Zentralkripo gehörte. Laitio hatte die Tat auf seine Kappe genommen. Die Situation war so verworren gewesen, dass jeder der vier Menschen, die sich auf dem Tanzboden des Gasthofs in Kopparnäs begegnet waren, sowohl zum Opfer als auch zum Täter hätten werden können. Letzten Endes war es Trankow gewesen, der Martti Rytkönen erschoss, einen Kommissar der Zentralkripo, der Informationen an Kriminelle verkauft hatte.
Mein Handy meldete sich, ich hatte eine SMS bekommen.
«Hallo, Hilja, unsere Katze Miina hat fünf Junge bekommen. Darf ich eins davon Frida nennen, nach deinem Luchs? Hier ist es noch furchtbar kalt, ich decke die Kätzchen mit Wolldecken zu. Gute Reise! Vanamo.» Lächelnd schrieb ich zurück, die Namenswahl sei eine Ehre für den Luchs. Ich hatte kurz vor Weihnachten von der Existenz meiner neunjährigen Schwester erfahren und sie erst zweimal gesehen. Dennoch war ich schon jetzt bereit, sie gegen jede Bedrohung zu verteidigen. Mike Virtue, der Gründer und Leiter der Sicherheitsakademie Queens, hatte uns eingeschärft, dass wir bei drohender Gefahr nicht an uns selbst denken durften, sondern nur an unseren Schützling. Schon jetzt bangte ich so sehr um meine Schwester, wie ich noch nie um einen Menschen gebangt hatte. Um Julia Gerbolt machte ich mir weniger Sorgen, doch ich wusste, dass ich notfalls auch für sie mein Leben riskieren würde. Ich hatte Mike Virtues Lehren gründlich verinnerlicht.
Syrjänen hatte uns eigentlich nach Leysin begleiten wollen, doch im letzten Moment war eine wichtige geschäftliche Verhandlung dazwischengekommen. Julia hatte auf Englisch gebrüllt und geschimpft und schließlich auf Russisch Flüche ausgestoßen, die offenbar reichlich wüst waren, denn Trankow, der wie ich Zeuge des Streits geworden war, hatte entsetzt das Gesicht verzogen. Zur Entschädigung hatten wir eine Nacht in Genf Station gemacht und Juweliergeschäfte besucht. Mit ausdrucksloser Miene hatte ich zugesehen, wie Julia noch ein Paar Diamantohrringe erstand. Zum Glück hatte sie die Pelzgeschäfte ausgelassen.
«Julia besitzt doch wohl keinen Luchspelz?», hatte ich Juri Trankow gefragt, als er zum wer-weiß-wie-vielten Mal versucht hatte, mich zu überreden, in Syrjänens Dienst zu treten. Er hatte sofort verstanden, was ich meinte. Ich hatte einer früheren Auftraggeberin gekündigt, weil sie einen Luchspelz gekauft hatte.
«Nein, Schätzchen. Julia akzeptiert nur Blaufuchs und Nerz. Luchs passt nicht zu ihrem Teint.»
Dass Julia aus Tierschutzgründen auf einen Luchspelz verzichtete, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Ich überlegte, warum sie für den After-Ski-Drink gerade die Bar Le Lynx gewählt hatte, die nicht besonders elegant war. Womöglich gefiel ihr die Techno-Musik, die hier lief. Vielleicht verdankte die Bar ihren Namen der Tatsache, dass man sich in den letzten Jahren bemüht hatte, den durch die Jagd schon fast ausgerotteten Luchsbestand in den Schweizer Alpen wieder aufzupäppeln. Die Ergebnisse waren vielversprechend.
Satu Syrjänen hatte sich nach Kräften bemüht, eine Medienkampagne als verstoßene Ehefrau zu führen; sie hatte allen möglichen Illustrierten Interviews gegeben und einen Verlagsvertrag über ihre Memoiren geschlossen.
«Ich war die Ärztin von Uskos erster Frau und habe sie behandelt, als sie schwer erkrankte. Nach ihrem Tod brach Usko zusammen und suchte meine Unterstützung. Ohne mich wäre er dem Alkohol verfallen, aber ich habe ihm wieder auf die Beine geholfen. Und das ist nun der Dank nach all den Jahren.» Julia hatte über die Stories nur gelacht und Satu im konkurrierenden Boulevardblatt empfohlen, mindestens zehn Kilo abzuspecken und sich die hängenden Augenlider liften zu lassen. Bis auf weiteres fochten die beiden ihren Kampf nur in den Medien aus.
Usko Syrjänen hatte in Långvik bei Kirkkonummi eine Villa am Meer gemietet, doch das hatte Julia nicht gereicht. Die Datscha sei viel zu weit vom Helsinkier Zentrum entfernt. Also kaufte Syrjänen eine Zweitwohnung am Bulevardi in der Innenstadt. In der Neunzimmerwohnung war auch für Trankow und mich Platz; wir teilten uns das für das Personal reservierte Bad mit Hanna. Juri fühlte sich allerdings in Långvik am wohlsten, kam aber immer nach Helsinki, wenn Syrjänen ihn brauchte.
Julia bat mich, den Kellner an unseren Tisch zu winken. Sie wollte noch einen Mojito. Für mich bestellte ich einen doppelten Espresso. Offenbar hatte Julia vor, in der Bar auf ihren Vater zu warten. Wir wohnten im besten Hotel von Leysin, das Julias Ansprüchen jedoch nicht genügte. Die Toilettenartikel seien Billigprodukte, und die Champagnerauswahl in der Bar sei miserabel. Ich hatte mich so an die Nörgeleien gewöhnt, dass ich in Gedanken eine Wette darauf abgeschlossen hatte, worüber sie als Nächstes meckern würde. Wahrscheinlich über das zu schwache Gebläse des Föhns. Ich hatte die Notausgänge überprüft und ein mit Kletterhaken versehenes Bergsteigerseil auf dem Balkon deponiert, damit wir das Hotel notfalls auf diesem Weg verlassen konnten. Statt in der lärmenden Bar zu sitzen, hätte ich lieber vom Balkon aus zugeschaut, wie die letzten Sonnenstrahlen am Horizont verschwanden, aber Dienst war Dienst.
Der Kellner brachte unsere Getränke und sagte, die Herren an der Theke würden sie uns gern spendieren.
«Möchtest du Gesellschaft?», fragte ich Julia.
«Absolut nicht.»
«Dann lehnen wir dankend ab.»
Julia zuckte wieder die Schultern und betrachtete die jungen Männer. «Das sind noch halbe Kinder, die interessieren mich nicht. Und wenn sie Ärger machen, wirst du schon mit ihnen fertig. Also los, zahl die Getränke.»
Ich reichte dem Kellner, der unser Gespräch mit angehört hatte, die Visa-Karte von Syrjänens Firma. Die jungen Männer unterhielten sich lachend miteinander. Julia funkelte sie wütend an und kehrte ihnen dann den Rücken zu. Ich hielt ihren Killerblick für effektiver als jede physische Selbstverteidigung. Wenn sie Syrjänen mit diesem Blick bedachte, kroch er vor ihr im Staub wie ein Wurm.
«Auch große Bosse haben irgendeine Schwäche. So diszipliniert ich sonst bin, nach schönen Frauen bin ich einfach verrückt», hatte Syrjänen in einem Interview gestanden, das aus Anlass seiner Verlobung in einer Boulevardzeitung erschienen war. «Jetzt ist meine Suche endlich beendet. Julia ist alles, was ich mir immer gewünscht habe.»
In demselben Interview hatte Syrjänen die Finnen kritisiert: Sie seien engstirnig, neidisch und geradezu besessen von dem Drang, alles durch Vorschriften zu regeln. Er fand es absurd, dass er warten musste, bis die Scheidung rechtskräftig war, obwohl er bereits seit anderthalb Jahren von seiner Frau getrennt lebte. Erwachsene Menschen wüssten doch wohl, was sie taten, warum musste man ihnen Vorschriften machen? Dasselbe gelte für das Arbeitszeitgesetz und den Mindestlohn. Davon seien die meisten Menschen ohnehin nicht betroffen. Ich übrigens auch nicht, aber ich hatte nichts dagegen, pausenlos zu schuften, wenn ich gut genug bezahlt wurde.
Die Tür ging auf, und eine weitere After-Ski-Clique betrat die Bar. Diesmal war es eine gemischte Gruppe, Frauen und Männer. Wieder zog Julia alle Blicke auf sich. In gewisser Weise war es sogar gut, dass sie in ihrem üblichen Outfit Aufsehen erregte. Falls ich sie aus Sicherheitsgründen verstecken musste, würde sie ohne Schmuck und Make-up, mit einer einfachen Wollmütze und in einem billigen Skianzug von niemandem erkannt werden.
Das Koffein im Espresso zeigte allmählich Wirkung; es würde hoffentlich den Milchsäurepegel in meinen Oberschenkeln senken und die Muskeln für den morgigen Skilauf fit machen. Als Julia sagte, sie gehe zur Toilette, überlegte ich routinemäßig, ob ich sie begleiten oder unsere Getränke bewachen sollte. Ich blieb am Tisch und dachte an Vanamos SMS. Wir hatten abgemacht, dass sie mich in den Osterferien in Helsinki besuchen würde, falls ich es arbeitsmäßig irgendwie einrichten konnte. Mein Verstand erinnerte mich daran, dass es mir schon viermal schlecht ergangen war, wenn ich ein lebendes Wesen ins Herz geschlossen hatte. Mutter, Frida, Onkel Jari, David … Hatte ich nicht genug verloren?
Julia näherte sich wieder unserem Tisch, blieb aber abrupt stehen, als sie den Mann erblickte, der gerade die Bar betrat. Er war mittelgroß und breitschultrig; allerdings fiel es mir schwer, seinen Körperbau genauer abzuschätzen, denn er war in einen dicken schwarzen Pelzmantel gehüllt, der ihm fast bis zu den Knöcheln reichte. Der Mann nahm die Pelzmütze ab, die aus dem gleichen glänzenden Material bestand, offenbar aus gefärbtem Wolfsfell. Seine braunen Augen schienen die ganze Bar zu überblicken und doch nur eine Person zu sehen: die schöne junge Frau, die jetzt einen Freudenruf ausstieß und sich in seine Arme warf.
Julia Gerbolt hatte ganz offensichtlich Sehnsucht nach ihrem Vater gehabt.
Dem Mann im Pelz folgte ein zwei Meter großer Hüne, der die Uniform unseres Berufsstandes und einen Ohrhörer im linken Ohr trug. Ich stand auf, um die Ankömmlinge zu begrüßen, denn hier war ich nicht in erster Linie eine Frau, sondern ein Sicherheitsprofi. Die Umarmungen und Wangenküsse wollten kein Ende nehmen, die Szene ließ selbst die Après-Ski-Cliquen verstummen.
«Lescha, hol uns den besten Champagner!» Ich verstand die russischen Worte. Der Bodyguard ging los, um den Auftrag zu erledigen.
Julia führte ihren Vater an unseren Tisch. Ich erwartete keine offizielle Vorstellung, hoffte aber, den Namen des Mannes im Pelz aufzuschnappen, damit ich bei Gelegenheit Informationen über ihn einholen konnte. Ein einfacher Gemischtwarenhändler aus Witebsk war er garantiert nicht, dafür trat er viel zu selbstsicher auf.
Lescha brachte eine Champagnerflasche und zwei Gläser, die Lohnabhängigen bekamen von der Gelben Witwe nichts ab. Da man uns auch nicht zum Sitzen aufforderte, blieben wir beide stehen, und ich hatte das Gefühl, für die Männer nicht wichtiger zu sein als ein Barhocker. Leschas Pranken, die in schwarzen Lederhandschuhen steckten, sahen stark genug dafür aus, den Korken einfach aus der Flasche zu drehen, doch er hielt sich an die traditionelle Methode. Kein Tropfen ging daneben.
Erst nach dem ersten Schluck sah Julias Vater mich an.
«Lescha kennst du ja, Liebling», wandte er sich an Julia, diesmal auf Englisch mit texanischem Akzent. «Nun stell mir auch deinen Schutzengel vor.»
«Hilja Ilveskero», sagte Julia folgsam. Der Mann reichte mir seine Hand, an der nicht weniger Ringe funkelten als an den Fingern seiner Tochter.
«Pass gut auf meinen Schatz auf, Hilja. Julia ist mein Ein und Alles. Ich kann mich doch auf dich verlassen? Ich heiße Iwan Gezolian.»
2
Mike Virtue hätte meine Selbstbeherrschung gelobt. Obwohl in meinem Inneren eine Lawine niederging, zuckte ich mit keiner Wimper.
«Schön, dass wir uns hier treffen.» Gezolian ließ meine Hand los und deutete auf seinen Leibwächter. «Aleksej Petuchkow, Hilja Ilveskero», machte er uns bekannt, wobei er Schwierigkeiten hatte, meinen Familiennamen auszusprechen. «Aleksej Nikolajewitsch hat schon im Dienst unserer Familie gestanden, als Julia noch ein kleines Mädchen war.»
Ich drückte meinem Kollegen kurz die Hand. Wir hatten beide die Aufgabe, unsere Auftraggeber zu schützen, aber Freundschaft brauchten wir deshalb nicht zu schließen. Das wollte ich auf keinen Fall. Lescha arbeitete für einen der schlimmsten Verbrecher, von dem ich je gehört hatte. Ich musste telefonieren, und zwar dringend. Hatte Juri Trankow etwa nicht gewusst, wer Julia Gerbolts Vater war? Man sollte doch annehmen, dass er seine Hausaufgaben gemacht hatte, bevor er sich bei Usko Syrjänen verdingte. Allerdings hatte ja auch ich nur Syrjänen ausgeforscht, nicht Julia.
Iwan Gezolian handelte mit schmutzigen Bomben. Er hatte Usko Syrjänens Geschäftspartner Boris Wasiljew ein SR-90-Isotop verkauft, doch dabei war etwas schiefgelaufen, weil einer von Wasiljews Leibwächtern sich als Verräter entpuppt, Syrjänens Jacht I believe in die Luft gejagt und das Isotop entwendet hatte. Gerüchten zufolge hatte dieser Mann auch einen Teil der Gezolian zustehenden Kaufsumme in die eigene Tasche gesteckt und stand deshalb auf Gezolians Abschussliste. Gezolian hatte einen Informanten bei der finnischen Zentralkripo gehabt – Martti Rytkönen, den Trankow erschossen hatte. Sicherlich hatte Rytkönen alles an Gezolian weitergegeben, was er über den Mann wusste, der sich das Isotop unter den Nagel gerissen hatte, unter anderem den Namen der finnischen Freundin dieses Mannes. Meinen Namen.
Es war natürlich möglich, dass Gezolian Frauen nicht als gefährliche Gegner betrachtete. Das war jedoch ein magerer Trost, auf den ich nicht bauen durfte. Sekundenlang sah ich ein Fangnetz, das über einen Luchs geworfen wurde. Anschließend brauchten die Jäger nur noch sorgfältig zu zielen, um das teure Fell nicht unnötig zu durchlöchern. Juri Trankow hatte mich in die Falle gelockt. Das war seine Rache, nachdem ich ihn vor den Augen seines Vaters schwer blamiert hatte. Nicht einmal die Tatsache, dass Laitio und ich ihn nach dem Mord an Rytkönen gedeckt hatten, hatte Trankow davon abgehalten, mich an Gezolian auszuliefern.
Gezolian trank Champagner und plauderte auf Russisch mit seiner Tochter. Ich wusste, dass Julia in Moskau geboren und russische Staatsbürgerin war, deshalb war ich nicht auf die Idee gekommen, ihr Vater könnte Weißrusse sein. In der Sowjetzeit hatte man die Einwohner des großen Reiches nach Belieben umgesiedelt. Vielleicht war Gezolian zu dem Schluss gekommen, dass Weißrussland der bessere Standort für seine schmutzigen Geschäfte war. Gegen die Verbrechen, die dort geschahen, war selbst Europol machtlos. Gezolian verstand sich blendend mit dem Präsidenten seines Landes, was in der Praxis bedeutete, dass er über dem Gesetz stand.
Da ich nichts tun konnte, setzte ich mich wieder an den Tisch. Der Espresso war kalt geworden und schmeckte bitter. Ich strengte mich an, um wenigstens Bruchstücke des Gesprächs zwischen Julia und ihrem Vater zu verstehen. Es schien um die bevorstehende Hochzeit zu gehen. Gezolian wollte, dass sie in Witebsk stattfand, aber Julia zögerte.
Seit ich den Dienst als Julia Gerbolts Leibwächterin angetreten hatte, war keine einzige Freundin bei ihr zu Besuch gewesen. Alle Gäste waren Geschäftsfreunde von Syrjänen. Zuerst hatte ich geglaubt, Julias Bekannte seien in Russland zurückgeblieben, dann hatte ich mich gefragt, ob sie überhaupt welche hatte. Doch ihren Vater liebte Julia Gerbolt, und er liebte sie, das konnte selbst dem Dümmsten nicht entgehen. Darin lag der größte Unterschied zwischen uns. Ich hasste meinen Vater, obwohl ich ihn seit über dreißig Jahren nicht mehr gesehen hatte.
Vanamos Geburt war die Folge des zweiten Ausbruchs meines Vaters aus der psychiatrischen Anstalt für Gefangene. Auf seiner Flucht war mein Vater in ein Bauernhaus in Tuusniemi eingebrochen, um sich etwas zu essen zu holen, und hatte die siebzehnjährige Saara vergewaltigt, die wegen einer Bronchitis im Bett lag und so dumm gewesen war, mit einem Besen auf den Einbrecher loszugehen. Saaras Familie gehörte der Sekte der Laestadianer an, die Vergewaltigung wurde als unerklärlicher Wille Gottes gedeutet, und Vanamo kam zur Welt, denn eine Abtreibung galt unter allen Umständen als Sünde.
Als ich das erste Mal nach Tuusniemi gefahren war, um Vanamo zu sehen, war Saara nicht zu Hause gewesen, sondern bei der Arbeit in einem Buchhaltungsbüro in Kuopio. Ich hatte mich vorher nicht mit Saara in Verbindung gesetzt, weil ich fürchtete, sie würde mir verbieten, Vanamo zu sehen. Ich wusste nicht einmal, ob man dem Mädchen erzählt hatte, wie ihr Leben begonnen hatte. Als ich Vanamo vor dem Haus traf, hatte sie gefragt, wer ich sei. Ich hatte geantwortet, ich sei Hilja aus Helsinki und wolle ihre Mutter besuchen. Vanamo führte mich in die Wohnküche, an deren Fenstern Eisblumen glitzerten.
«Mutti ist nicht zu Hause, aber Oma ist da.»
Eine schlanke Frau mit Kopftuch schob gerade ein Blech Zimtschnecken in den Ofen. Sie zuckte zusammen, als sie mich sah. Die Ähnlichkeit zwischen mir und ihrer Enkelin war ihr nicht entgangen.
«Guten Tag … Worum geht es? Springt Ihr Wagen bei der Kälte nicht an, oder sind Sie im Schnee stecken geblieben? Mein Mann hält Mittagsschlaf, aber ich kann ihn wecken, wenn ein Traktor gebraucht wird.»
Ich hatte den Wagen hinter den Wirtschaftsgebäuden geparkt, und Frau Huttunen hatte natürlich vom Fenster aus gesehen, dass eine fremde Frau zu Fuß auf den Hof kam.
«Mit meinem Wagen ist alles in Ordnung. Ich suche Saara Huttunen. Es geht um meinen Vater Keijo Kurkimäki, ehemals Suurluoto.»
Die Frau nahm den Schürhaken, öffnete die Ofentür und stocherte in den glimmenden Kohlen. Der Haken begann zu glühen, man hätte damit einem Menschen ein Brandzeichen aufdrücken können.
«Von ihm wird in diesem Haus nicht gesprochen. Er ist also Ihr Vater. Gott behüte Sie. Vanamo, geh mal nachsehen, ob Opa noch schläft. Das hier ist seine Sache.»
Nachdem das Mädchen folgsam gegangen war, wandte sich die Frau von mir ab. Sie hatte bereits einige graue Haare, ihr langer Zopf war zu einem Knoten aufgesteckt, der unter dem Kopftuch hervorschaute. Ihre graue Strickjacke war verfilzt, der Rock, in undefinierbarem Braun, reichte bis über die Knie, ihre Füße steckten in Filzpantoffeln, denn von dem mit Flickenteppichen belegten Boden stieg Kälte auf. In diesem Haus, vielleicht hier in der Wohnküche, hatte mein Vater seine Untat begangen. Damals war es Herbst gewesen, an den Bäumen hatte noch gelbes Laub gehangen. Die Huttunens waren ins Kirchdorf gefahren, um ihren Hund Vili impfen zu lassen. Deshalb war Saara nicht gewarnt worden, als der Teufel ins Haus kam.
Markku Huttunen war ein breitschultriger, hellblonder Mann mit tiefen Druckstellen zu beiden Seiten der Nase. Er blinzelte verwirrt, bis seine Frau ihm die Brille reichte. Dann musterte er mich, gab mir aber nicht die Hand. Das hatte auch seine Frau nicht getan. Vanamo war ihrem Großvater nicht gefolgt, aus der Schlafkammer hörte ich ihre Stimme, die sich mit dem fröhlichen Bellen eines Hundes mischte. Hatten die Huttunens noch denselben Hund wie vor neun Jahren?
«Was wollen Sie von uns? Geld haben wir nicht», begann Markku Huttunen. «Saara hat dank Gottes Hilfe ihr Leben in Ordnung gebracht, wir wollen nicht, dass es ihr wieder verdorben wird.»
Ich hatte in dem Auszug aus dem Melderegister, den Laitio mir besorgt hatte, gelesen, dass Saara Huttunen das Sorgerecht für ihre Tochter besaß. In Dingen, die Vanamo betrafen, lag die Entscheidung bei ihr, nicht bei ihrem Vater.
«Es liegt mir fern, Unruhe zu stiften. Ich möchte nur meine Schwester kennenlernen. Ich habe sonst keine Geschwister.»
Huttunen musterte mich abweisend. «Woher soll ich wissen, ob jemand Gutes oder Böses im Schilde führt? Das Blut eines solchen Mannes gereicht keinem zur Ehre, und der Altersunterschied zwischen Ihnen und Vanamo ist groß. Es wäre besser, wenn Sie sie in Ruhe ließen.»
Unter normalen Umständen hätte ich ihm widersprochen, doch die Verbindung zu Vanamo war mir zu wertvoll, um sie gleich zu Beginn aufs Spiel zu setzen.
«Ich möchte nicht stören. Ich lasse meine Kontaktdaten da, für Saara Huttunen, sie kann selbst entscheiden, wie sie damit umgeht.» Rasch kritzelte ich meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse auf ein Stück Papier. Visitenkarten besaß ich nicht, die gerieten doch nur in falsche Hände. Als ich über den Hof der Huttunens zu meinem Wagen ging, sah ich, dass Vanamo und ein Bernhardiner mir vom Fenster aus nachblickten. Das Mädchen winkte mir zu, und ich winkte zurück.
«Hilja!» Julia Gerbolts herrische Stimme riss mich aus meinen Gedanken. «Geh ins Hotel, packen! Ein Freund meines Vaters besitzt ein Chalet östlich vom Zentrum, wo wir wohnen können. Da sind wir ungestört.»
Der Befehl kam mir gelegen, denn auf dem Weg zum Hotel konnte ich versuchen, Juri Trankow anzurufen. Ich stand fügsam auf und warf Lescha einen Blick zu, als wolle ich ihn bitten, in meiner Abwesenheit auf Julia aufzupassen. Er hob kaum merklich die Augenbrauen. Wie gut war er wohl im Judo, war er mir gewachsen? Immerhin hatte ich den schwarzen Gürtel.
Es war dunkel geworden, über den Bergen funkelten die Sterne. Im Nordosten stand eine schmale Mondsichel, sie schaukelte wie ein Boot, als eine Wolke an ihr vorbeizog. Das Tal war nicht zu sehen, eine Wolkendecke lag über dem Genfer See. Konnte ich es wagen, auf der Straße zu telefonieren, oder sollte ich warten, bis ich im Hotel war? Die meisten Leute, denen ich im Dorf und auf den Pisten begegnet war, hatten Französisch gesprochen, aber auch hier verstanden viele Englisch, die Sprache, in der Trankow und ich uns verständigten. Ich hatte den Verdacht, dass er besser Finnisch verstand, als er mir gegenüber zu erkennen gab. Mit mir sprach er es nur selten und in kurzen, einfachen Sätzen.
Ich beschloss, vorsichtshalber zu warten, bis ich im Hotel war. Dort schaltete ich das Babyphone ab, das mich mit Julias Zimmer verband, und stöpselte in beiden Räumen die Hoteltelefone aus. Bei unserer Ankunft hatte ich unsere Zimmer routinemäßig nach Kameras und Mikrophonen abgesucht, während Julia mein Treiben belustigt, aber auch zufrieden beobachtet hatte.
Es war natürlich möglich, dass Juri seinen Arbeitgeber zu den Verhandlungen begleitete, die Syrjänen daran gehindert hatten, mit uns in die Schweiz zu fahren. Egal – wenn ich ihn an die Strippe bekam, konnte er sich auf etwas gefasst machen. Juri meldete sich nicht. Ich hinterließ ihm keine Nachricht, sondern probierte es nach ein paar Minuten erneut. Diesmal klappte es.
«Hilja, meine Liebe, ich bin gerade beim Malen. Wenn du es nicht wärst, wäre ich gar nicht drangegangen. Wie geht es in der Sch…»
«Warum hast du mir nicht gesagt, dass Julia die Tochter von Iwan Gezolian ist?»
Ein Seufzer war die einzige Antwort.
«Behaupte ja nicht, du hättest es nicht gewusst! Dir muss doch klar sein, wie gut Gezolian über David Stahls Aktionen informiert ist, immerhin war Martti Rytkönen, dein Erpresser, Gezolians Informant. In welche verdammte Falle hast du mich gelockt, Juri? Wenn du jetzt hier wärst, würde ich dich auspeitschen wie einen Muschik.»
Das war einer der Lieblingssprüche von Valentin Paskewitsch. Juri hatte diese Drohung jedes Mal von seinem Vater zu hören bekommen, wenn er einen Fehler gemacht hatte. Paskewitsch hatte ihn nie offiziell als seinen Sohn anerkannt, und Juri konnte noch so oft behaupten, das sei ihm egal – ich glaubte ihm nicht. Der beste Weg, ihn zu kränken, bestand darin, so mit ihm zu reden wie Paskewitsch. Und ich wollte ihn verletzen.
Trankow schwieg. Hatte er etwa keine Zeit gehabt, sich eine Verteidigung oder Erklärung zurechtzulegen, oder hatte er sich eingebildet, ich würde nie davon erfahren? Früher war er mir mitunter vorgekommen wie ein kleiner Junge, der sich abwechselnd vor Rytkönen und vor seinem Vater fürchtete. Hatte ich mich in ihm geirrt? Hatte er alles genau geplant, war sein Rachefeldzug gegen mich klüger eingefädelt, als ich es ihm zugetraut hätte?
«Julia ahnt überhaupt nicht, wie ihr Vater sein Vermögen angehäuft hat», brachte Juri schließlich hervor.
«Das spielt keine Rolle. Iwan Gezolian weiß, mit wem David Stahl befreundet war, als der ihn bei dem SR-90-Geschäft betrogen hat. Gezolian weiß auch, dass David Syrjänens Boot in die Luft gejagt hat. Du hast mich in Lebensgefahr gebracht, du mieses Schwein!»
Ich hörte Juri schlucken, doch er sagte nichts. Also legte ich auf. Bald darauf rief er zurück, aber ich meldete mich nicht. Auf dem Display erschien der Hinweis auf eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Ich hatte keine Lust, sie mir anzuhören. Stattdessen begann ich zu packen. Das Chalet von Gezolians Bekanntem erschien mir wie die Höhle des Löwen, in der es für einen Luchs gefährlich werden konnte. Aber Weglaufen wäre feige gewesen. Ich musste die Gelegenheit nutzen, Iwan Gezolian kennenzulernen.
Julia brachte es nicht fertig, mit leichtem Gepäck zu reisen. Ihr Koffer hatte schon bei der Abreise in Helsinki dreiundzwanzig Kilo gewogen, und in Genf war noch einiges hinzugekommen. Während ich ihre After-Ski-Kleider zusammenfaltete, rekapitulierte ich, was ich über Gezolian wusste. Ich hatte einerseits gehört, David habe die gesamte Summe, die Gezolian für das SR-90 erhalten sollte, in die eigene Tasche gesteckt. Andererseits hatte es geheißen, bei einem Teil der Scheine habe es sich um Falschgeld gehandelt. Und auch ein Teil der Isotope war weiterhin verschollen, David hatte der Europol nicht alles ausgehändigt. Der Mann, den ich in Davids Mietwohnung in Montemassi in der Toskana erschossen aufgefunden hatte, war Dolfini, Gezolians italienischer Kontaktmann, gewesen. David und Gezolian waren durch viele Fäden miteinander verbunden, und wenn man es schaffte, einen abzureißen, wurde sofort ein neuer geknüpft.
Beim Abschluss des Arbeitsvertrags mit Julia hatte ich natürlich eine Sicherheitsanalyse erstellt. Neben einer Liste der möglichen Bedrohungen von außen gehörten dazu auch Julias persönliche Risikofaktoren. Mike Virtue, der Leiter der Sicherheitsakademie Queens, hatte uns bei der Ausbildung immer wieder eingeschärft, dass die eventuellen Abhängigkeiten des Auftraggebers auch den Personenschützer in Gefahr brachten. Julia rauchte nicht, trank kaum Alkohol und behauptete, kein Interesse an Kokain und anderen Modedrogen zu haben. Von gelegentlichen Kopfschmerztabletten abgesehen, nahm sie keine Medikamente. Die Brustimplantate waren ihr in der Schweiz eingesetzt worden, erstklassige Produkte ohne Krebsrisiko.
Meine eigenen Sachen waren schnell gepackt. Die Skiausrüstung hatte ich vor Ort gemietet. Ich hatte nie Besitz angehäuft. Meistens hatte ich in provisorischen Unterkünften oder zur Untermiete gewohnt; ich besaß nur zwei Kaffeetassen und einen Kochtopf, und die Musik, die ich brauchte, war auf dem MP3-Player gespeichert. Meine Kleider hätten in zwei Koffer gepasst, ansonsten hatte ich nichts. Besitzlosigkeit machte frei, denn man brauchte sich nicht vor Verlusten zu fürchten. Der teuerste Gegenstand, den ich besaß, war meine Glock-Pistole, doch sie war nur ein Arbeitsinstrument. Sie konnte mir helfen, Menschenleben zu retten, aber abgesehen davon hatte sie keinen Gefühlswert für mich. Bisher hatte ich noch nie auf einen Menschen schießen müssen. Beim Training auf der Schießbahn hatte ich mir oft vorgestellt, auf meinen Vater zu zielen, der meine Mutter umgebracht hatte und den ich obendrein verdächtigte, auch meinen Onkel Jari ermordet zu haben. Mitunter hatte ich mir auch Iwan Gezolian als Ziel ausgemalt, denn er hatte den Mann bedroht, den ich zu lieben geglaubt hatte. Nun beschützte ich also die Tochter meines Feindes.
Hatte nicht einmal mein einziger Vertrauensmann bei der finnischen Polizei, der vorläufig vom Dienst suspendierte Hauptmeister Teppo Laitio von der Auslandsabteilung der Zentralkripo, gewusst, dass Julia Gerbolt Iwan Gezolians Tochter war? Da Europol nach Gezolian fahndete, mussten seine Familienmitglieder doch in seiner Akte registriert sein!
Die Schweiz gehörte nicht zur EU und war auch kein Mitglied der Europol, hatte aber bei vielen internationalen Operationen mit ihr zusammengearbeitet. Ich hatte geglaubt, Iwan Gezolian sei zumindest in den Ländern, in denen die Europol aktiv war, zur Fahndung ausgeschrieben, doch offenbar hatte er keinen Grund, die Schweiz zu meiden. Julia hatte gesagt, ihr Vater wolle während des Skiurlaubs in Genf Bankangelegenheiten erledigen. Hatte er überhaupt einen legalen Pass, oder reiste er mit gefälschten Papieren? Plötzlich war ich froh, dass ich mindestens eine Nacht mit ihm unter einem Dach verbringen würde. Wie gut war Lescha wohl in seinem Job? Auf keinen Fall durfte ich den primitiven Fehler begehen, ihn nach seinem Arbeitgeber auszufragen, das würde nur sein Misstrauen wecken.
Neben der Waffe gehörte zu meinen Schätzen noch ein verblichenes und leicht geknicktes Foto von Frida, dem verwaisten Luchsjungen, das ein paar Jahre bei meinem Onkel und mir gewohnt hatte. Frida war für mich wie eine Schwester gewesen. Eigentlich hätte ich kein Bild gebraucht, um mich an sie zu erinnern, denn sie war immer noch bei mir, als wäre sie nicht tot.
Der dritte Gegenstand, den ich hinter Schloss und Riegel verwahrte, war ein Ring. Er lag derzeit in meinem transportablen Waffenschrank in Långvik. Ich bewahrte ihn außer Sichtweite auf, weil ich nicht wusste, was ich von ihm halten sollte. Warum in aller Welt hatte David Stahl mir einen mit drei Rubinen geschmückten goldenen Ring zugespielt, der haargenau dem glich, den meine Mutter getragen hatte?
Das war eines der vielen Rätsel, die sich um David rankten. Ich hatte mir alle Mühe gegeben, nicht an ihn zu denken, dabei aber kläglich versagt.
Ich hörte Julias Absätze im Flur klappern, bevor sie die Tür öffnete. Ihre Wangen waren gerötet, die zwei Mojitos und der Champagner hatten ihr einen Schwips beschert.
«Bist du fertig? Vater und Lescha warten im Wagen.» Julia warf einen Blick in den Spiegel, strich sich die Haare zurecht und legte Lipgloss auf. «Toll, dass Vati es einrichten konnte, herzukommen. Ich sehe ihn viel zu selten.»
Julia sprach so gut wie nie über ihre Privatangelegenheiten. Ich beschloss, ihre alkoholbedingte Offenheit auszunutzen.
«Du bist also in Witebsk geboren?»
«Nein, in Moskau. Unsere Familie hat Anfang der achtziger Jahre dort gewohnt. Aber Vaters Familie stammt aus Weißrussland, und er ist dorthin zurückgekehrt, als man wieder wohnen durfte, wo man wollte. Wir hatten allerdings schon in der Sowjetzeit eine Datsche dort, im Gebirge, mein Vater hatte … Beziehungen. Ganz egal, welches System an der Macht ist, entscheidend ist immer nur, die richtigen Leute zu kennen.»
«Das hat Trankow auch gesagt.»
«Juri Trankow?» Julias Stimme troff vor Verachtung. «Der bringt doch nichts zustande! Ich habe Usko immer wieder gesagt, er soll Trankow feuern, aber er hat irgendwie Mitleid mit dem Jungen. Und Juri klammert sich an Usko wie ein Hündchen, das um Aufmerksamkeit bettelt. Trankow ist ja offenbar dein Freund, aber auch du nimmst ihn nicht ernst.» Julias letzter Satz war keine Frage, sondern eine Feststellung.
«Kennt dein Vater Trankow?»
«Natürlich, er ist doch Uskos Geschäftspartner! Mein Vater hält nicht viel von Trankow, und ich habe keinen Grund, an seinem Urteil zu zweifeln. Gehen wir.»
Julia nahm die Handtasche, die sie nachlässig aufs Bett geworfen hatte. Sie hatte sie für siebentausend Francs in Genf gekauft. Ich fand das Teil omahaft und hässlich, aber von der Handtaschenmode verstand ich nichts. Ich schleppte Julias Koffer und meine kleine Reisetasche zum Lift und brachte sie ins Foyer, wo Lescha und Iwan Gezolian uns erwarteten. Gezolian hatte inzwischen unsere Rechnung beglichen. Lescha machte keine Anstalten, mir beim Tragen zu helfen. Als Bedienstete hatte ich keinen Anspruch auf Vorzugsbehandlung, nur weil ich eine Frau war.
Eine schwarze Limousine mit Schweizer Kennzeichen stand mit laufendem Motor vor dem Hotel. Der Chauffeur stieg aus, und Gezolian befahl: «Anton, nimm die Koffer!»
Der Fahrer tat wie ihm geheißen. Er war groß, an die zwei Meter. Die schwarzen Haare reichten ihm bis auf die Schulter, ein ebenfalls schwarzer Bart bedeckte den größten Teil seines Gesichts, und um die buschigen Augenbrauen hätte ihn selbst Breschnjew beneidet. Die Augen hinter den dicken Brillengläsern waren mattbraun, und sein Rasierwasser, eine billige Mennen-Kopie, stank wie Insektengift.
Der als Anton angesprochene Mann nahm mir die Koffer ab und verstaute sie im Kofferraum, ohne mich eines Blicks zu würdigen. Lescha öffnete Gezolian und seiner Tochter die Tür zum Fond und nahm dann auf dem Beifahrersitz Platz. Er bedeutete mir, mich hinter ihn zu setzen. Die Limousine war ein überlanges Modell mit einem Klappsitz zwischen Vorder- und Hinterbank. Das sollte also mein Platz sein. Der Sitz hatte keinen Sicherheitsgurt, aber Julia und Gezolian schnallten sich auch nicht an. Ich hatte Julia ein paarmal erklärt, ich würde sie nicht fahren, wenn sie den Gurt nicht anlegte.
«Sonst ist eine Geldbuße fällig. In Finnland kannst du die Polizei nicht bestechen. Und stell dir mal vor, wie furchtbar die Glassplitter dein Gesicht zurichten würden.»
Das hatte gewirkt, aber jetzt meinte Julia wohl, ich säße ja zwischen ihrem Gesicht und den Glassplittern. Der Chauffeur fuhr vorsichtig über die kurvenreichen Bergstraßen, denn es war glatt. Der Dunst war bereits mehr als einen Kilometer über das Tal gestiegen, und auch ohne auf die Straße zu blicken, wusste ich, dass die Sicht schlecht war.
Die Fahrt dauerte nur fünf Minuten. Wegen der vielen Kurven konnte ich nicht abschätzen, ob wir uns östlich oder westlich vom Dorf befanden. Der Wagen hielt vor einem zwei Meter hohen Zaun, der Chauffeur öffnete das Fenster und tippte einen Code ein, dann glitt das Holztor auf. Wir fuhren einen Hügel hinauf zu einem dreistöckigen Blockhaus. Obwohl es im traditionellen Gebirgsstil gebaut war, wirkte es durch seine Größe protzig und war sicher nicht mehr als ein paar Jahre alt.
Ich stieg als Erste aus und hielt Julia die Tür auf. Lescha ging zum Haus, um aufzuschließen, und der Chauffeur Anton hob die Koffer aus dem Wagen. Ich nahm ihm meine Tasche ab und holte scharf Luft, als mir der Geruch des Rasierwassers entgegenschlug. Dann schnupperte ich wie ein Tier, das sich einem fremden Geschöpf nähert. Der Gestank war widerlich. Dennoch nahm ich darunter einen bekannten Geruch wahr, ich erkannte die Form der vom Bart bedeckten Wangenknochen und entdeckte hinter den gefärbten Wimpern einen Blick, in dem ich viele Male versunken war.
Gezolians Chauffeur war David Stahl. Der Mann, den ich seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen und schon einmal tot geglaubt hatte. Wieso zum Teufel stand er im Dienst seines schlimmsten Feindes?
3
«Wohin soll ich das Gepäck bringen?», fragte der Chauffeur auf Russisch, und als ich nicht antwortete, wiederholte er die Frage auf Englisch. Im ersten Moment brachte ich kein Wort heraus, obwohl ich am liebsten geschrien hätte. Beobachtete uns jemand von einem der Fenster des Chalets aus? Ich musste eine Gelegenheit finden, ungestört mit David zu reden.
«Ich weiß nicht, wo wir untergebracht sind, das Haus ist mir unbekannt», antwortete ich auf Englisch. Ich sah ihm in die Augen, die die Farbe von dünnem Kaffee mit Schlieren von gestockter Milch hatten. Wenn man ständig Kontaktlinsen trug, wurden die Augen trocken. In wessen Gesellschaft wagte es David noch, seine Maske abzulegen?
Anton brummte etwas Unverständliches und trug Julias Koffer ins Haus. Er hatte den Motor abgestellt, aber die Türen offen und den Schlüssel stecken gelassen. Es wäre leicht gewesen, den Wagen zu stehlen. Dann konnte ich nach Bern zur finnischen Botschaft fahren und um Asyl bitten. Schließlich war ich in Lebensgefahr. Und David, das verdammte Katzenviech, hatte auch schon mindestens sieben von seinen neun Leben verbraucht. Er musste verrückt sein. War ich noch verrückter, weil ich nicht abhaute?
Doch ich wusste, dass Flucht keine Lösung war. Es war aufreibend, sich zu verstecken, und eine falsche Identität konnte man nicht im Handumdrehen aufbauen. Ich hatte mich selbst in den Ameisenhaufen gesetzt, als ich Juri Trankows Vorschlag annahm.
Hatte David wohl gemerkt, dass ich ihn erkannt hatte? Ich folgte ihm ins Haus. Die Eingangshalle war drei Etagen hoch, an der Decke hing eine mit buntem Mosaik besetzte Statue einer Kuh in Originalgröße. Anton und Lescha besprachen die Quartierfrage. Welche Hierarchie galt wohl unter Gezolians Leuten?
Schließlich trug Anton Julias Koffer die Treppe hinauf, Julia folgte ihm, und ich schloss mich ebenfalls an.
Wir gingen in die erste Etage. Anton öffnete die Tür zu einem Eckzimmer und winkte Julia. Er tat, als ob er mich nicht bemerkte, und trug den Koffer hinein. Ich betrat das Zimmer, das größer war als eine komplette Hotelsuite.
«Du schläfst nicht hier!», fuhr Julia mich an. «Du bekommst ein Zimmer unter dem Dach. Vater sagt, die Sicherheitsanlage in diesem Haus ist perfekt, also brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ist die Tür zu Hiljas Zimmer auf?», fragte sie Anton, der stumm nickte.
«Tagsüber hat man hier bestimmt eine tolle Aussicht», sagte ich hastig. «Gibt es da draußen viele Tiere? Rehe bestimmt, und Schafe. Hast du auch Luchse gesehen?», wandte ich mich an Anton.
Seine Stimme war rau. «Abknallen sollte man diese Raubtiere, die bringen einem bloß Ärger.» Dann sah er mich an. David wusste, dass ich ihn erkannt hatte.
In Julias Anwesenheit wagte ich nicht, weiter mit ihm zu reden, und er ging auch bald. Während ich ins Obergeschoss hinaufstieg, hörte ich den Motor starten, offenbar fuhr Anton die Limousine in die Garage. Wo war er wohl untergebracht? Konnten wir miteinander sprechen, wenn die anderen schliefen? Doch da erinnerte ich mich an Julias Worte über die Sicherheitsvorkehrungen. Bewegungsmelder und Überwachungskameras boten Schutz, aber sie zeichneten auch auf. Nein, wir mussten warten, bis wir außerhalb des Chalets waren. Wie konnte ich es einrichten, mit dem Chauffeur allein zu sein? Sollte ich die Nymphomanin spielen? Julia wusste wohl, dass zwischen Juri und mir etwas gewesen war. Solange ich die Finger von Syrjänen ließ, waren ihr meine Männergeschichten vermutlich egal. Hauptsache, die Dienstboten blieben unter sich.
Die Zimmer im Obergeschoss waren etwa zwanzig Quadratmeter groß. In einem lagen Sachen, die der Größe nach Lescha gehören konnten. Vorsichtshalber schnupperte ich an einer Jacke: Sie roch weder nach David noch nach Antons Rasierwasser. Ein sorgloser Bursche, dieser Lescha – er hielt es nicht für nötig, sein Zimmer abzuschließen. Nur eine der Türen stand auf; dieses Zimmer war wohl mir zugedacht. Bevor ich Licht machte, trat ich ans Fenster und versuchte, unseren Standort zu lokalisieren. Das dunstige Tal war nur undeutlich zu sehen, doch ich erkannte im Westen einige Fixpunkte im Dorf und den Skilift. Allmählich wurde es Zeit, dass ich mir ein GPS-Ortungsgerät zulegte. Bei dem Gehalt, das Syrjänen mir zahlte, konnte ich es mir leisten.
Ich packte meine wenigen Sachen in den Schrank. Langsam verspürte ich Hunger, aber von Essen war keine Rede gewesen. Bei Syrjänen sorgte die Haushälterin Hanna für die Verpflegung; sie ließ niemand anderes in ihre Küche. In einem Chalet wie diesem gab es sicherlich mindestens einen Koch und ein Hausmädchen. Ich holte einen Energieriegel gegen den schlimmsten Hunger aus der Tasche und begann das Zimmer nach Überwachungskameras und Mikrophonen abzusuchen. Das war eine Routinemaßnahme, die ich in jedem neuen Quartier durchführte. Über die restlichen Sicherheitsvorkehrungen sollte Lescha mich aufklären, aber für mein Zimmer war ich allein zuständig. Ich entdeckte nur eine Alarmanlage außen am Fenster. Von innen konnte man das Fenster öffnen, aber wenn jemand einzusteigen versuchte, ging der Alarm los. Da mein Fenster zehn Meter über dem Erdboden lag, war die Anlage eigentlich überflüssig, doch die Tatsache, dass auch die obersten Fenster gesichert waren, verriet, dass der Besitzer des Chalets Grund hatte, sein Eigentum massiv zu schützen. Meine nächste Aufgabe bestand darin, herauszufinden, wer Iwan Gezolians Leysiner Freund war.
Ich schloss mein Zimmer mit dem Schlüssel ab, der von innen in der Tür gesteckt hatte. Das Schloss war altmodisch, und der Schlüssel lag schwer in meiner Hosentasche. Ich ging zunächst in die erste Etage, dann ins Erdgeschoss. Dort roch es nach Käse. Durch einen Türspalt spähte ich in einen Raum, der wie ein Esszimmer aussah. Auf einem Beistelltisch stand eine Obstschale, aus der ich einen Apfel stibitzte. Als ich mich umdrehte, stand Iwan Gezolian an der Tür.
«Hungrig?» Seine Stimme klang belustigt. Ich nickte.
«Pierre serviert in der Küche für dich. Frag Julia, ob sie dich noch braucht, und lass dir alles andere von Lescha erklären. Ich möchte heute allein mit meiner Tochter speisen.» Gezolian sprach immer noch freundlich, aber in einem Ton, der keinen Widerspruch zuließ. Mir war es egal, wo ich aß, wenn ich nur etwas in den Magen bekam. Dann würde auch mein Gehirn wieder funktionieren, und ich wäre fähig, den als Anton auftretenden David zur Rede zu stellen.
Eilig machte ich mich auf den Weg zur Quelle des Käseduftes. Mein Geruchssinn führte mich an den richtigen Ort. Lescha saß bereits am Tisch und schaufelte sich Kartoffeln, Schinken und Raclettekäse auf den Teller. Am Herd arbeitete ein sehr schlanker, ebenholzschwarzer Mann, der sich umdrehte, als er meine Schritte hörte.
«Madame Gerbolts Bodyguard?», erkundigte er sich auf Englisch mit starkem französischem Akzent. Als ich bejahte, trat er zu mir und küsste mich auf die Wangen, erst rechts, dann links, dann wieder rechts. So sei es in der Schweiz Brauch, erklärte er. Der Mann sagte, er sei Pierre, der Hauskoch, und zum Abendessen gebe es Raclette mit allem, was dazugehöre. Dann rückte er mir den Stuhl gegenüber von Lescha zurecht. Bevor ich ablehnen konnte, hatte Pierre mir bereits Weißwein eingegossen und machte sich wieder am Herd zu schaffen. Er trällerte auf Französisch vor sich hin. Die Melodie kam mir bekannt vor, wahrscheinlich hatte ich das Lied irgendwann einmal in einer anderen Sprache gehört. Pierre besaß eine tiefe, weiche Stimme, mit der er in den Karaoke-Bars von Helsinki Karriere gemacht hätte.
Auch am Essen war nichts auszusetzen. Die Essiggurken und die Perlzwiebeln waren frisch. Lescha schüttelte den Kopf, als ich eine Gurkenhälfte in den Käse dippte.
«Hierzulande wissen sie nicht, wie man Salzgurken zubereitet. Die russischen sind die einzig richtigen.»
Das war eine eindeutige Aufforderung zum Gespräch. Es wäre idiotisch von mir gewesen, schweigend weiterzuessen. Aus taktischen Gründen pries ich den Geschmack der russischen Knoblauchgurken mit Honig. Wir sprachen über unsere Lieblingsspeisen. Lescha liebte Lammbraten und Bärenfleisch. Schon bald war es ganz natürlich, ihn zu fragen, wie lange er schon für Gezolian arbeitete.
«Sehr lange! Seit zwölf Jahren. Iwan Romanowitsch ist ein guter Herr, ich sehe keinen Grund, die Stelle zu wechseln.»
«Dann hast du Julia schon als Teenager gekannt.»
Lescha lächelte. «Sie war eine magere Bohnenstange mit Pickeln und Zahnspange, und guck dir an, was für eine tolle Frau sie geworden ist! Der Finne kann sich glücklich schätzen, dass er einen solchen Schatz erobert hat. Er ist wohl ein wichtiger Mann in seinem Land.»
Je näher die Parlamentswahl heranrückte, desto intensiver hatte Syrjänen über die Zusammensetzung der nächsten Regierung spekuliert und überlegt, wie er sie für seine Zwecke einspannen konnte. Kandidatinnen und Kandidaten seines Vertrauens hatten auf Umwegen Wahlspenden von ihm erhalten. Auch mich hatte er gefragt, ob ich ihm helfen und als Sponsorin eines seiner handzahmen Abgeordneten auftreten könne, während das Geld in Wahrheit aus seiner Tasche käme. Ich verstehe nichts von Politik, aber ich hatte ihm erklärt, in meinem Beruf sei es ratsam, sich an keine Partei zu binden.
«Wir Leibwächter sind eine Art Berufssoldaten. Wir dienen unserem jeweiligen Arbeitgeber, aber wir ergreifen nicht Partei.»
Syrjänen hatte die Ausrede geschluckt. Er schien in mir immer noch eher eine Gesellschafterin seiner Verlobten zu sehen als einen Sicherheitsprofi.
Pierre hatte die nächsten Portionen fertig. Er tanzte gewissermaßen um den Herd, und ich musste an den mürrischen Jouni denken, den am ganzen Körper tätowierten Koch des Restaurants Sans Nom, der sich eckig bewegte und es strikt ablehnte, den hochtrabenden Titel Küchenchef zu verwenden. Jouni und Pierre unterschieden sich wie Tag und Nacht. Pierre rückte seinen Kragen zurecht, setzte die Kochmütze auf, grinste mich an und machte sich mit seinem Servierwagen auf den Weg zum Speisezimmer. Ich packte die Gelegenheit beim Schopf.
«Und Anton, der Chauffeur? Ist er auch schon so lange bei Gezolian wie du?»
Lescha hatte gerade eine Kartoffel in den Mund gesteckt und nuschelte undeutlich.
«Das ist nicht Gezolians Chauffeur, sondern der des Chalet-Besitzers. Er durfte nicht mit nach Florida, deshalb ist er sauer. Irgendein Este, bei dem man schon froh sein muss, dass er bereit ist, Russisch zu sprechen. Rääki, rääki.» Feixend ahmte Lescha ein estnisches Wort nach. «Verstehen Finnen und Esten gegenseitig ihre Sprache?»
«Teilweise.» Wie in aller Welt hatte David es geschafft, eine Stelle bei Gezolians Bekanntem zu ergattern? Wer war überhaupt der Besitzer des Chalets? Ich fragte Lescha danach, der mir die vage Auskunft gab, es handle sich um einen Genfer Bankier, mit dem Gezolian geschäftlich zu tun habe. «Mehr brauchen wir beide nicht zu wissen. Stimmt es eigentlich, dass die Finnen rohen Fisch essen wie die Japaner, oder ist das nur ein böswilliges Gerücht?»
Als ich gerade zu einem kulinarischen Vortrag angesetzt hatte, kam Pierre in die Küche zurück und teilte mir mit, Madame wünsche mich zu sprechen, wenn ich aufgegessen und zum Nachtisch in Ruhe einen Espresso getrunken hätte. Ich ließ mir Zeit, es konnte Julia nicht schaden, eine Weile zu warten. Unterdessen hatte Pierre bereits im Speisezimmer abgedeckt und sagte, Gezolian sei mit seiner Tochter zum Kaffee in die Bibliothek gegangen. Die befinde sich an der Nordseite der hohen Eingangshalle.
Die Tür zur Bibliothek war drei Meter hoch, und ich musste reichlich Kraft aufbieten, um sie zu öffnen. Ich hatte das Gefühl, zu schrumpfen, als ich den hohen Raum betrat, in dem alles riesig war. Die mit Glastüren versehenen Bücherregale waren mit uralt aussehenden, in Leder gebundenen Werken gefüllt, von denen einige auf dem Rücken kyrillische Buchstaben trugen. Die Sessel bestanden aus gedrechseltem Holz, sie hatten Lederpolster und so hohe Beine, dass Julias Füße trotz der Absätze nicht bis zum Boden reichten; sie schlenkerte mit den Beinen wie ein Kind. An den Wänden hingen Jagdtrophäen: ausgestopfte Vögel, ein Fuchs, ein Dachs, die Stoßzähne eines Elefanten, ein Bärenkopf. Ein Luchs war zum Glück nicht darunter.
«Ich will morgen schon früh Ski laufen, denn am Nachmittag soll es furchtbar windig werden. Der Chauffeur kann uns zum Hockenhorn bringen. Allerdings sind die Pisten dort vielleicht zu schwierig für dich. Ich überlasse es dir, ob du mit mir abfährst oder unten auf mich wartest», erklärte Julia.
Gezolian sagte etwas auf Russisch und strich seiner Tochter über den Arm.
«Weiß der Chauffeur schon Bescheid?», fragte ich und wunderte mich, dass meine Stimme ganz normal klang.
«Ich habe ihm eine Nachricht geschickt. Er wohnt unten im Dorf.»
Also musste ich die Hoffnung begraben, David noch an diesem Abend aufsuchen zu können. Als ich in meinem Zimmer war, rief ich ihn an, doch ich erhielt dieselbe Antwort wie seit fast einem Jahr: Der Teilnehmer ist derzeit nicht zu erreichen. Damit musste ich mich zufriedengeben. Am nächsten Morgen würde ich David allerdings nicht entkommen lassen, selbst wenn ich deshalb unter Lebensgefahr eine schwarz markierte Piste bezwingen musste.
Ich machte ein paar Dehnungsübungen, dann öffnete ich das Fenster. Der Frost stach mir in die Augen, die Temperatur war um mehr als zehn Grad gesunken. Der Nebel, der über dem Tal schwebte, schien sich zu senken, hier und da kamen Baumwipfel zum Vorschein. Die Lichter des Dorfes Leysin konnten den Glanz der Sterne nicht abschwächen. Am liebsten hätte ich geschrien, vor Wut und Freude zugleich.
David Stahl war doch nicht tot. Aber er schien es permanent darauf anzulegen, im Sarg oder in einer Urne zu landen.
Ich schickte Monika per SMS Grüße aus Leysin und fügte hinzu, ich hätte ein hervorragendes Raclette gegessen. Das eine Glas Wein, das ich dazu getrunken hatte, hielt mich wach. Dennoch schlief ich irgendwann ein, aber im Schlaf hörte ich Geräusche: das Rattern eines Hubschraubers im Norden, einen Schneepflug im Tal, Hundegebell weit weg in den Bergen. War der Hund einem Luchs auf der Spur?
Am Morgen begann der Nebel aufzureißen, und die Landschaft hatte viel tiefere Dimensionen als am Tag zuvor. Aber auch der Wind war stärker geworden, er rüttelte an den Fensterläden und blies Schnee über die Bergwände. Pierre sang in der Küche «Welke Blätter». Ich wies ihn darauf hin, dass das Chanson nicht zur Jahreszeit passte.
«Sei nicht so pedantisch! Wie möchtest du dein Frühstücksei? Wie wäre es mit meiner Spezialität, Schweizer Käse-Omelette? Aus zwei oder drei Eiern?»
Ich ließ ihn wursteln. Er schenkte Milchkaffee ein und brachte Toastbrot. Wenn ich in Gedanken nicht bereits damit beschäftigt gewesen wäre, David ins Gebet zu nehmen, hätte ich mich durchaus auf einen Flirt einlassen können. Ich lachte gerade über irgendein zweideutiges Bonmot, als die Tür, die vom Hof in die Küche führte, aufging. Ein Mann klopfte sich den Schnee von den Schuhen. Seine Schritte waren schwer und schleppend, ich erkannte sie dennoch.
«Guten Morgen, Anton. Einen Kaffee?» Pierre sprach auch mit Anton Englisch.
«Nein. Sag deiner Chefin, der Wagen wartet.» Anton richtete seine Worte an mich, sah mich aber nicht an. Er machte kehrt und ging wieder hinaus.
«Was für ein Klotz! Benimmt er sich gegenüber deinem Boss auch so?», fragte ich, als sich die Tür hinter dem Chauffeur geschlossen hatte.
«Ich weiß nicht, er ist erst kurze Zeit im Haus, und Monsieur Chagall ist oft auf Reisen.»
«Was heißt kurze Zeit?»
«Warum interessierst du dich so für diesen Esten?» Pierres Lächeln schien seine hohen, espressoschwarzen Wangenknochen zu spalten.
«Ich überlege nur, wie gut er die Bergstraßen kennt. Bei diesem Nebel muss man vorsichtig sein.»
Die dritte Tasse Kaffee lehnte ich ab. Da ich Julia nicht im Speisezimmer fand, klopfte ich an ihre Zimmertür. Sie war gerade dabei, sich für den Abfahrtslauf zu schminken, und sagte, sie komme gleich. Ich zog Skikleidung an und cremte mir sorgfältig das Gesicht ein. Der Wettervorhersage nach war die UV-Strahlung gefährlich hoch.
Anton verstaute unsere Skier in der Box und hielt uns den Schlag auf. Diesmal setzte ich mich nach hinten zu Julia und studierte die Abfahrtsroute auf der Karte. Der Startpunkt lag dreitausend Meter hoch.
«Versuch nicht mit Gewalt, mein Tempo zu halten. Ich warte unterwegs auf dich, oder wir treffen uns unten.»
«Das würde Syrjänen aber nicht gefallen.»
«Er braucht es ja nicht zu wissen! Ich bin schließlich nicht sein Eigentum.»
Anton fuhr ruhig und verzichtete darauf, Traktoren und Mopedautos zu überholen, obwohl Julia ungeduldig seufzte.
«Trag unsere Skier nach oben!», befahl ich ihm, als wir am Ziel waren. Er sah mich an wie eine Hirschlausfliege, gehorchte aber. Eine dicke Strickmütze bedeckte seinen schwarzen Schopf, die dickgefütterte Steppjacke sah aus, als sei sie für sibirische Verhältnisse gedacht. In meinen Skistiefeln kam ich mir klobig vor, ich war nicht an die steifen Knöchel gewöhnt.
An der Seilbahn hatte sich eine Schlange gebildet; bei den meisten Wartenden schien es sich allerdings um Touristen zu handeln, die nur wegen der Aussicht nach oben wollten. Es waren aber auch einige junge Männer mit Snowboards und ein Fotograf mit Profi-Ausstattung dabei. Der Himmel war klar, und schon beim Hinauffahren sahen wir das Dorf Leysin. Ich entdeckte auch die Umrisse des prächtigen Chalets von Herrn Chagall. Anton stand mitten in der Kabine; er wirkte verschlossen wie jemand, der diese Aussicht so oft erlebt hatte, dass sie ihn kaltließ. Obwohl er diesmal nicht so penetrant nach billigem Rasierwasser roch wie am vorigen Abend, hielten alle Passagiere Abstand von ihm.
Sobald wir ausstiegen, schlug der Wind zu. Er wehte garantiert mit Windstärke 9, und die amerikanischen Touristen kreischten überrascht auf. Ich zog mir die Kapuze über den Kopf. Julia wirkte nachdenklich, warf einen Blick auf die Karte und prüfte die Windrichtung.
«Wenn ich den Waldrand erreiche, ist das Schlimmste vorbei. Dann ist der Wind hinter dem Berg.»
Ich war einigermaßen überrascht, dass sich Julia mit dem Alpenwind auskannte. Anton half ihr, die Skier anzuschnallen. Meine Bindung bereitete mir Probleme, ich kannte die gemietete Ausrüstung nicht gut genug. Der rechte Ski wollte einfach nicht halten.
«Zeig mal.» Anton bückte sich und betrachtete die Bindung. «Die klemmt, ich muss sie reparieren. Das dauert einen Moment», sagte er zu Julia. Ein Windstoß hätte uns beinahe umgeworfen, und Julias Zähne klapperten.
«Ich erfriere in dieser Kälte! Komm mit der Seilbahn runter, wenn deine Skier nicht funktionieren. Ich starte jetzt!» Ohne auf Antwort zu warten, stieß sich Julia ab. Sie fuhr geschmeidig und egoistisch, in der Erwartung, dass die anderen Läufer ihr auswichen. Erst als ich sicher war, dass der Wind meine Worte nicht mehr zu ihr tragen konnte, brüllte ich los.
«Was hast du mit meiner Bindung angestellt? Oder besser gesagt: Was zum Teufel tust du hier?» Es war ein Risiko, Schwedisch zu sprechen, aber in meiner Wut nahm ich darauf keine Rücksicht. Der Wind trieb mir Schnee in die Augen und warf uns beinahe gegeneinander.
«Ich hab nur den Splint rausgezogen, das ist leicht zu reparieren. Wir müssen doch miteinander reden. Komm, wir klettern auf den Gipfel. Du weißt, dass Schall aufsteigt. Bei diesem Wetter sind wir da oben am besten vor neugierigen Ohren geschützt.»