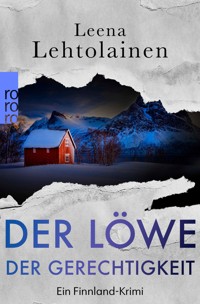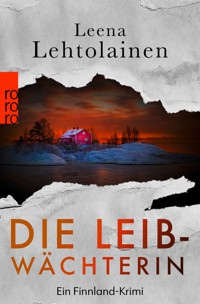
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Leibwächterin
- Sprache: Deutsch
Die junge Hilja Ilveskero wurde in New York zur Leibwächterin ausgebildet und arbeitet in Finnland für verschiedene Auftraggeberinnen. Momentan schützt sie Anita Nuutinen, eine Frau, die in Moskau Immobiliengeschäfte betreibt. Hilja geht die arrogante Frau auf die Nerven, und schließlich kündigt sie ihrer Auftraggeberin in einem Anfall von blinder Wut fristlos. Kurz darauf wird Hilja brutal zusammengeschlagen. Als sie Stunden später wieder zu sich kommt, hält sie Anitas Halstuch in der Hand, hat aber keine Erinnerung an das, was geschehen ist. Wenig später erfährt sie, dass Anita Nuutinen in der Nacht erschossen wurde. Und dass sie selbst des Mordes verdächtigt wird. Hilja ist selbst nicht sicher, ob sie die Täterin ist, und flieht zurück nach Finnland ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Leena Lehtolainen
Die Leibwächterin
Thriller
Über dieses Buch
Die junge Hilja Ilveskero wurde in New York zur Leibwächterin ausgebildet und arbeitet in Finnland für verschiedene Auftraggeberinnen. Momentan schützt sie Anita Nuutinen, eine Frau, die in Moskau Immobiliengeschäfte betreibt. Hilja geht die arrogante Frau auf die Nerven, und schließlich kündigt sie ihrer Auftraggeberin in einem Anfall von blinder Wut fristlos. Kurz darauf wird Hilja brutal zusammengeschlagen. Als sie Stunden später wieder zu sich kommt, hält sie Anitas Halstuch in der Hand, hat aber keine Erinnerung an das, was geschehen ist. Wenig später erfährt sie, dass Anita Nuutinen in der Nacht erschossen wurde. Und dass sie selbst des Mordes verdächtigt wird. Hilja ist selbst nicht sicher, ob sie die Täterin ist, und flieht zurück nach Finnland ...
Vita
Leena Lehtolainen, 1964 geboren, lebt und arbeitet in Degerby, westlich von Helsinki. Bekannt wurde sie mit ihrer Krimireihe um die Anwältin und Kommissarin Maria Kallio. Leena Lehtolainen ist eine der erfolgreichsten und renommiertesten Schriftstellerinnen Finnlands.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel «Henkivartija» bei Tammi, Helsinki.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg «Henkivartija» Copyright © 2009 by Leena Lehtolainen
Redaktion Stefan Moster
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-30441-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1
Das Tier, das wir in Finnland ilves nennen, heißt auf Kroatisch ris, auf Norwegisch gaupe, auf Deutsch Luchs. Ich kann Katzen-, Fuchs- und Wolfsluchse voneinander unterscheiden und erkenne Luchsspuren auf Anhieb. Die Luchse waren schuld daran, dass ich arbeitslos wurde.
Anita Nuutinen, auf die ich seit einem Jahr aufpasste, wollte sich in einem Juwelierladen in einem der vornehmsten neuen Einkaufszentren Moskaus Prunkeier ansehen. Am Eingang mussten wir einen Metalldetektor passieren, der natürlich Alarm schlug, als ich hindurchging. Man sagte mir, ich müsse meine 9-mm-Glock beim Pförtner hinterlegen.
«Die brauche ich beruflich», versuchte ich den Männern vom Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums zu erklären, die selbst bis an die Zähne bewaffnet waren, doch es half nichts. Wenn ich Anita auf ihrem Einkaufsbummel begleiten wollte, musste ich die Waffe so lange abgeben.
«Wir passen auf, dass keiner reinkommt», erklärte einer der Wächter in holprigem Englisch. Auf dieses Versprechen gab ich überhaupt nichts. Wenn man genug Geld hinblätterte, war jeder käuflich. Aber Anita wollte das Risiko eingehen.
«Gehen wir hinein, wenn wir schon einmal hier sind. Schließlich bin ich diejenige, die sich in Gefahr begibt.» Ihr Lächeln war ein Befehl. Ich erwiderte es nicht.
Anita bekam ihr Prunkei. Ich musste schlucken, denn was sie dafür bezahlte, entsprach meinem Gehalt für drei Monate. Natürlich war es kein echtes Fabergé-Ei, das hätte zehn Jahresgehälter gekostet. Das Prunkei genügte ihr aber nicht, sie wollte noch in das Pelzgeschäft gleich nebenan.
Im Allgemeinen rate ich meinen Klienten, keine allzu auffällige Kleidung zu tragen, also auch keine teuren Pelze. Anita hatte sich nie um meinen Rat gekümmert. Die toten Nerze oder Silberfüchse, mit denen sie sich behängte, waren nicht mein Geschmack, doch ich hatte sie hingenommen. Es gab aber eine Grenze, und die lag beim Luchspelz.
Auch auf Russisch heißt der Luchs ris. Für den knöchellangen Mantel, den Anita ins Auge gefasst hatte, waren meiner Schätzung nach fast zwanzig Luchse abgeschlachtet worden. Mein Puls beschleunigte sich, ich spürte, dass ich kurz vor einem Wutausbruch stand, und bemühte mich, ruhig zu atmen. Ich hatte die unterschiedlichsten Atemtechniken gelernt, doch in diesem Fall half mir keine von ihnen.
Anita zog den Pelz an. Die beiden Verkäuferinnen eilten zu ihr, um ihr zu helfen und zu zeigen, wie sie ihn schließen sollte. Sie standen so nahe bei ihr, dass sie ihr ein Messer ins Herz rammen oder Gift injizieren konnten, ohne mir die geringste Chance zu lassen, sie daran zu hindern. Ich hätte näher herangehen müssen, doch ich tat es nicht.
«Lynx, very beautiful», lächelte Anita die Verkäuferinnen an und wandte sich dann auf Finnisch an mich: «Was meinst du, Hilja? Ist der nicht unglaublich sinnlich? Ich fühle mich darin selbst wie eine Katze.»
Anita hatte keine Ahnung von meiner Vergangenheit mit den Luchsen. Ich hatte ihr nur das Nötigste über mich erzählt, sie interessierte sich ohnehin nicht für meine Angelegenheiten. Dafür war sie zu sehr mit sich selbst und ihrem Erfolg beschäftigt.
«Die Felle sind schön – an Luchsen.» Meine Stimme klang anders als sonst, als ich das sagte, wie ein tiefes Brummen. Anita fuhr zusammen.
«Was sagst du da?» Sie wickelte den Mantel enger um sich und streichelte das weiche Fell. «Na, auf deine Meinung bin ich nicht angewiesen. I’ll take that, thank you.»
Sie zog den Pelzmantel aus und suchte nach einer ihrer vier Kreditkarten. Das Prunkei hatte sie mit American Express bezahlt, nun war die Visa-Karte an der Reihe. Eine der Verkäuferinnen schlug den Mantel in Seidenpapier ein. Die Luchse, die dafür ihr Leben gelassen hatten, waren Katzenluchse, wie ich an der Musterung des Rückenfells erkannte.
«Wenn du den Pelzmantel kaufst, kündige ich auf der Stelle.»
«Was redest du denn da?» Anita drehte sich zu mir um, die Kreditkarte schimmerte zwischen ihren Fingern.
«Du hast mich schon verstanden. Ich arbeite nicht für Menschen, die Dinge tun, die ich nicht gutheißen kann.»
«Ich kaufe doch nur einen Pelzmantel.»
«Einen Luchspelz.»
Nun war es Anita, die einen Wutanfall bekam. Ich hatte zig Mal miterlebt, wie sie ihre Mitarbeiter oder das Personal in irgendeinem Geschäft oder Restaurant herunterputzte. Sie konnte es sich leisten, viel zu zahlen, und erwartete eine entsprechende Gegenleistung für ihr Geld. Eine kleine Lohnabhängige wie ich solle ja nicht versuchen, ihr auf der Nase herumzutanzen, giftete sie. Ich würde nicht kündigen, sondern sie würde mich feuern. Ich brüllte zurück, das sei mir völlig egal. Ich wusste, dass ich feuerrot war und heftig schwitzte. Nur mühsam konnte ich mich beherrschen, nicht die Kleiderständer umzuwerfen und die Spiegel im Verkaufsraum in Stücke zu treten.
Die Verkäuferinnen sahen uns entsetzt an, und aus dem Hinterzimmer kam der Wächter des Pelzgeschäfts, ein Hüne mit schwarzem Schnurrbart. Er roch penetrant nach Sauerkraut. Natürlich verstand er unser finnischsprachiges Wortgefecht ebenso wenig wie die Verkäuferinnen, aber jeder konnte sehen, wer von uns beiden das Geld hatte. Der Wächter kam auf mich zu.
«Idite», sagte er auf Russisch. Soweit ich wusste, hieß das «Verschwinden Sie». Immerhin war er so höflich, mich zu siezen.
«Bilde dir ja nicht ein, dass ich dir eine Empfehlung schreibe! Ich werde dafür sorgen, dass du nie mehr einen Auftrag bekommst, jedenfalls nicht in Finnland!», schrie Anita aufgebracht.
«Du bist nicht so einflussreich, wie du denkst», brüllte ich zurück, und als der Wächter mich am Arm packte, war ich drauf und dran, den Kerl gegen den nächsten Spiegel zu stoßen. Am Eingang ließ ich mir meine Waffe aushändigen, ohne auf die verwunderten Fragen der Sicherheitsbeamten einzugehen, wo meine Auftraggeberin sei. Auf meinen Reisen mit Anita hatte ich ein wenig Russisch gelernt; mein Lieblingswort war durak, Idiot. Das fauchte ich nun, weil einer der beiden versuchte, mich aufzuhalten. Als ich auf die Straße trat, stieg unser Chauffeur aus, um die Türen zu öffnen, doch ich ging wortlos an ihm vorbei. Vom Einkaufszentrum zum Hotel hatte ich nur einen Kilometer zu laufen, da ich den Stadtplan von Moskau längst im Kopf hatte, fand ich mühelos den Weg. Ich fuhr mit dem Aufzug in den neunten Stock. Anita und ich hatten wie immer nebeneinanderliegende Zimmer mit einer Verbindungstür. Anita konnte die Vorstellung nicht ertragen, mit mir im selben Zimmer zu übernachten, aber ich musste in Hörweite sein. Oft benutzten wir zur Sicherheit sogar ein Babyphon.
An sich hatte ich meine Kündigung glänzend getimt. Es war der erste September, das Gehalt für August war in der Vorwoche auf mein Konto eingegangen. Es würde Anita ganz schön fuchsen, mich bis zum letzten Tag bezahlt zu haben. Bestenfalls würde sie noch einen Trick finden, mir das Urlaubsgeld vorzuenthalten. Ich ging ins Internet und sah nach, ob ich schon heute zurückfliegen konnte. Doch es gab nur noch in der billigsten Klasse freie Plätze, nicht in der Business Class, in der Anita und ich flogen, und die Umbuchung hätte mich eine ziemliche Stange Geld gekostet. Also rief ich am Bahnhof an. Der Nachtzug war voll besetzt, aber am nächsten Tag war noch ein komplettes Schlafabteil für drei Personen frei. In diesem Abteil reservierte ich einen Platz und rief anschließend im Nachbarhotel an, wo ich tatsächlich ein Zimmer für eine Nacht bekam. Ich packte meine Sachen und verschwand, ohne Anita eine Nachricht zu hinterlassen. Sooft ich an den Luchspelz dachte, stieg finstere Wut in mir auf; ich wollte von meiner nunmehr ehemaligen Auftraggeberin nichts mehr wissen. An der Rezeption knallte ich den Zimmerschlüssel auf die Theke und winkte ab, als der Empfangschef mir etwas nachrief. Es interessierte mich nicht. Auch die Taxifahrer wimmelte ich ab. Ich ging zu Fuß zu dem Hotel, in dem ich noch nie übernachtet hatte. Mein Zimmer war klein und verraucht, aber für eine Nacht würde ich es aushalten. Kurz darauf klingelte mein Handy: Anita. Ich nahm nicht ab. Nach einer Weile ging ich ins Hotelrestaurant und bestellte eine Vorspeisenplatte: Blini, Kaviar, Salzgurken, Honig, saure Sahne und Pilzsalat. Und Wodka. Auf der Getränkekarte war der georgische Rotwein gestrichen, offenbar eine Folge des Kriegszustandes. Dafür gab es litauisches Starkbier. Ich trank das erste Glas in ein paar Zügen leer und bestellte das nächste.
Ich hatte Anita von Anfang an nicht gemocht, mich von dieser Abneigung aber nicht in meiner Arbeit beeinträchtigen lassen. Vor sieben Jahren hatte ich meine Ausbildung an der Sicherheitsakademie Queens in New York mit Bestnote abgeschlossen, und da weibliche Bodyguards in Finnland dünn gesät sind, hatte ich mir die Aufträge aussuchen können. Anita zahlte doppelt so viel wie meine bisherigen Auftraggeber. Sie reiste mindestens einmal im Monat von Helsinki nach Moskau oder Sankt Petersburg und brauchte dafür eine Aufpasserin. Offenbar bewegten sich ihre Immobiliengeschäfte in der Grauzone, aber solange ich nicht in illegale Aktionen einbezogen wurde, brauchte ich nicht um meine Lizenz zu fürchten. Dass ich nun ohne Empfehlung dastand, war allerdings unangenehm. Mike Virtue, unser Hauptausbilder an der Sicherheitsakademie, hätte über mein Verhalten nur den Kopf geschüttelt. Er hatte immer wieder betont, das Wichtigste für Bodyguards sei ein guter Ruf. Pannen seien nie ganz auszuschließen – zum Beispiel könne ein Einzelner sein Objekt nicht vor den Kugeln einer ganzen Bande von Killern schützen, die es gleich von mehreren Verstecken aus ins Visier nahmen. Doch niemals dürfe man das Vertrauen seines Auftraggebers enttäuschen. Ich hörte Mikes Predigt im Kopf, während ich mein zweites Bier trank.
Natürlich versuchte Anita, mich zu erreichen und meine Kündigung rückgängig zu machen. Ich wusste einfach zu viel über sie. Unter anderem war ich genau darüber informiert, wie die Sicherheitssysteme in ihrem Haus und in ihrer Firma funktionierten. Die Leute, die Anita bedroht hatten, würden sich diese Informationen eine hübsche Summe kosten lassen. Wenn ich die nächsten paar Jahre müßig leben wollte, bräuchte ich mein Insiderwissen nur an die Person zu verkaufen, die noch im Frühsommer mehrmals gedroht hatte, Anita umzubringen.
Ich hatte Anita nach und nach dazu gebracht, mir zu verraten, wen sie in Verdacht hatte. Ein Bodyguard muss die Fähigkeit besitzen, wie Kriminelle zu denken und ihre Aktionen vorherzuahnen. Außerdem hatte ich dafür gesorgt, dass meine Auftraggeberin nie allein war. Ihr Mann war schon vor Jahren von der Bildfläche verschwunden und in irgendein Kaff in Ostlappland gezogen, und ihre einzige Tochter lebte in Hongkong. Deshalb hatte ich oft in ihrem zweihundert Quadratmeter großen Reihenhaus im Helsinkier Luxusviertel Lehtisaari übernachtet. Als Allererstes hatte ich dort das Alarmsystem ausgewechselt, denn hinter den Drohungen steckte mit größter Wahrscheinlichkeit Anitas ehemaliger Liebhaber, der des Öfteren in ihrem Haus gewesen war. Dieser Mann hieß Valentin Feodorowitsch Paskewitsch, er war einer der Immobilienkönige von Moskau und hatte es Anita sehr übelgenommen, dass sie seine vielversprechenden Geschäfte mit Ferienhäusern in Südkarelien torpediert hatte.
Mein Handy klingelte erneut. Wieder Anita. Sollte sie es ruhig versuchen. War sie verängstigt, fürchtete sie sich vor jedem vorbeifahrenden Auto, zuckte sie zusammen, wenn ihr jemand entgegenkam? Oder hatte sie sich in ihrem Zimmer verbarrikadiert? Unser Chauffeur Sergej Schabalin hatte uns bisher treu gedient, aber vermutlich war auch er käuflich, wenn der Preis stimmte. Anita hatte immer gewusst, dass die beste Garantie für ihre Sicherheit darin bestand, mehr zu zahlen als andere. Sie bildete sich ein, alle Menschen verhielten sich so wie sie, jeder sei nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Ich hatte ihr bewusst die starke und wachsame, aber nicht übermäßig intelligente Frau vorgespielt. Alle ihre Unternehmungen und Treffen hatte ich genauestens registriert, angeblich, um so gut wie möglich für ihre Sicherheit garantieren zu können. Doch mit den Informationen, die ich gesammelt hatte, könnte ich ihr das Leben zur Hölle machen, wenn ich es wollte.
Trotz des deftigen Essens waren mir der Wodka und das zweite Bier zu Kopf gestiegen. Ich zahlte und brach zu einem kleinen Spaziergang auf. Es dämmerte bereits, auf den Straßen drängten sich die Menschen. An einem Kiosk kaufte ich eine Cola und eine Flasche Mineralwasser. Das Foto von Premierminister Putin prangte auf der neuesten Ausgabe der Prawda, in der er die Situation in Georgien kommentierte. Paskewitsch zählte zu Putins Anhängern; auch deshalb fürchtete Anita sich vor ihm.
«Kak djela, dewuschka?», fragte ein Mann neben mir. Ich warf ihm nur einen kurzen Blick zu, um mich zu vergewissern, dass er keiner der mir bekannten Gorillas von Paskewitsch war.
«Für dich bin ich kein Mädchen», knurrte ich auf Finnisch und ging weiter, während der Mann mir noch einmal «Dewuschka» nachrief. Hielt er mich etwa für eine Prostituierte? Mein Äußeres gab dazu bestimmt keinen Anlass. Ich war eins achtzig groß, wog siebzig Kilo und trug die Haare jungenhaft kurz geschnitten. Meine Kleidung war meinem Beruf angemessen: Jeans, kurze Lederjacke und Pilotenstiefel mit Metallkappen. Da ich in diesen Schuhen nicht an den Metalldetektoren der Einkaufszentren vorbeigekommen wäre, trug ich sie in Moskau selten. Doch bevor ich mein neues Hotel verließ, hatte ich sie angezogen, denn es war eine beruhigende Vorstellung, mit einem einzigen Tritt einen erwachsenen Mann außer Gefecht setzen zu können.
Ich ging zu dem Hotel, in dem Anita und ich abgestiegen waren. Gleich beim ersten Blick auf die Fassade erkannte ich Anitas Fenster, denn ich hatte die Angewohnheit, mir immer und überall die grundlegenden Fakten einzuprägen, die für den Personenschutz wichtig waren. Unter Umständen verriet ein erleuchtetes Fenster einen Eindringling. In Anitas Zimmer brannte Licht, sie hatte die Vorhänge nicht zugezogen. Die dumme Kuh tat genau das Gegenteil von dem, was ich ihr geraten hatte. Es würde ihr nur recht geschehen, wenn ihr etwas zustieße.
Wieder hörte ich Mike Virtues Stimme: Es ist falsch, deine Klientin im Stich zu lassen. Aber Mike hätte ja nicht ahnen können, wieso der Kauf eines Luchspelzes mich so in Rage brachte. Er hatte selbst gesagt, jeder müsse selbst entscheiden, wen er beschützen wolle. Auch Gangster engagierten Leibwächter. Ich hatte eine ganze Reihe von Paskewitschs Handlangern und Bodyguards zu Gesicht bekommen, schon vor längerer Zeit, als er noch mit Anita liiert war und die beiden häufig im Restaurant Chez Monique speisten, für dessen Besitzerin ich damals arbeitete. Und ich hatte es ganz allein geschafft, Anita vor diesem Männerrudel zu schützen. Eigentlich durfte ich stolz auf mich sein.
Ich vergewisserte mich, dass der Mann, der mich beim Auschecken angesprochen hatte, nicht mehr an der Rezeption saß, bevor ich das Foyer betrat und zu der Telefonkabine eilte, die sich am Gang zur Bar befand. Ich rief in Anitas Zimmer an, legte aber sofort auf, als sie sich meldete. Sie war wohlauf, würde am Mittwoch mit der Frühmaschine nach Finnland zurückkehren, und bis dahin würde sie allein zurechtkommen. Morgen früh hatte sie noch eine letzte Besprechung mit dem Verwalter ihrer Immobilien in Moskau. Sie kannte den Weg zu seinem Büro, außerdem würde Sergej Schabalin sie chauffieren. Also konnte ich diesen Abend und den nächsten Tag unbesorgt für mich allein verbringen.
Ich merkte, dass der Empfangschef mich anstarrte, ebenso der Wächter, dem man den Zimmerpass vorweisen musste, bevor man den Aufzug betreten durfte. Ich hatte Anita erklärt, dass der Aufzugwächter keinen hundertprozentigen Schutz bot. Immerhin waren im Hotel zum Beispiel auch Zimmermädchen beschäftigt, über deren Hintergrund wir nichts wussten. Nun plagte mich doch wieder der Gedanke, Anita werde von allen Seiten bedroht, nachdem ich sie im Stich gelassen hatte. Da ertönte die Fahrstuhlglocke. Ich sah die Spitze von Anitas Lacklederstiefel auftauchen und zog mich blitzschnell in die Telefonnische zurück. Anita trug ihren neuen Luchsmantel, hatte sich aber nicht die Mühe gemacht, die verdeckten Knöpfe zu schließen. Sie stolzierte schnurstracks zum Ausgang, und als ich ihr nachsah, erkannte ich das gewohnte Taxi: Schabalin erwartete sie. Eigentlich hatte sie für diesen Abend keine Verabredung, wir hatten vorgehabt, das Abendessen aufs Zimmer zu bestellen und früh schlafen zu gehen. Was hatte Anita veranlasst, ihre Pläne zu ändern?
Vor dem Hotel standen Wagen von verschiedenen Taxiunternehmen. Eins davon kannte ich von früheren Fahrten. Ich stieg ein und wies den Fahrer an, Schabalin zu folgen. Der Mann murmelte nur «Da» und tat wie geheißen. Wir fuhren am Kreml vorbei zum Grundstück des ehemaligen Hotels Rossija, dann über den Fluss in Richtung Süden. Diese Route führte zu den Immobilien, um die Anita diesen Paskewitsch betrogen hatte. Hatte sie die Besprechung mit ihrem Verwalter vorverlegt?
Anfang der neunziger Jahre, auf dem Tiefpunkt der Rezession, hatte Anita von ihrer Mutter ein mehrere hundert Hektar großes Areal geerbt, das sich seit jeher im Familienbesitz befunden hatte. Es handelte sich um Ufergrundstücke und ganze Inseln in Savitaipale am Saimaa-See. Da zu dieser Zeit in Finnland kaum Sommerhäuser gebaut wurden und die Arbeitslosenrate hoch war, schaffte Anita es überraschend leicht, einen neuen Bebauungsplan durchzusetzen. Der Gemeinderat rechnete sich aus, dass die Bautätigkeit Arbeitsplätze schuf und die künftigen Bewohner der neuen Sommerhäuser die lokale Wirtschaft beleben würden. Allerdings fehlte Anita das Kapital zum Bauen.
Da lernte sie in Lappeenranta Paskewitsch kennen, der dort nach Villen für seine russischen Kunden suchte. Er war ein aufstrebender Oligarch mit Verbindungen zum Öl- und Gashandel. Es waren die verrückten Jahre, in denen die wirtschaftliche Macht in Russland neu verteilt wurde, wobei Frechheit siegte. Kurz zuvor war Nuutinen, ihr Mann, aus Anitas Leben verschwunden; sie behauptete, sie habe sich aus purer Einsamkeit in Paskewitsch verliebt und sei von ihm so verzaubert gewesen, dass sie nicht nur mit ihm ins Bett ging, sondern auch seine Geschäftspartnerin wurde. Rubel schien er genug zu haben. Paskewitsch und Anita ließen drei Sommerhausdörfer am Ufer des Saimaa-Sees und einige Luxusvillen auf den Inseln bauen. Sie gingen davon aus, dass sie genug reiche russische Kunden finden würden. Um die gleiche Zeit scheffelte Paskewitsch mit Immobiliengeschäften in Moskau Geld. Anita nahm einen riesigen Kredit auf, um auch dort seine Teilhaberin zu werden. Sie spekulierte darauf, dass die Rezession in Finnland bald zu Ende gehen und es sich lohnen würde, in Russland zu investieren. Ein paar Jahre lang lief auch alles plangemäß. Anitas Investitionen in Finnland und in Moskau trugen reiche Früchte, und sie konnte ihren Kredit in einem Tempo zurückzahlen, über das der Bankdirektor staunte. Ihre Beziehung zu Paskewitsch wurde nie offiziell gemacht, hielt aber jahrelang. Allerdings war Paskewitsch nicht daran gewöhnt, treu zu sein. Anita war eine elegante und gepflegte Frau, doch der virile Russe brauchte Abwechslung. Als Anita eines Abends unangemeldet die gemeinsame Loftwohnung in Moskau betrat, entdeckte sie in Paskewitschs Bett zwei kaum volljährige Models; wie sich schnell herausstellte, waren sie nicht zum ersten Mal bei ihm.
Anita handelte besonnen. Statt eine Szene hinzulegen, holte sie eine Flasche Champagner aus dem Kühlschrank und goss allen Anwesenden ein Glas ein. Sie sagte, sie verstehe Valentin, ihr selbst sei Herr Nuutinen nach zehn Ehejahren ja auch langweilig geworden. Paskewitsch beteuerte, er wolle sich keineswegs von Anita trennen, aber er brauche nun einmal mehr als eine Frau.
Anita fasste darauf einen Plan, den sie über Jahre hinweg verwirklichte. Sie nahm Paskewitschs Seitensprünge scheinbar gleichmütig hin, denn letztlich kehrte er doch immer wieder zu ihr zurück, aber insgeheim bereitete sie einen Betrug vor, und zwei Jahre bevor ich in ihren Dienst trat, setzte sie ihn in die Tat um. Die genauen technischen Einzelheiten der Aktion kannte ich nicht, aber jedenfalls hatte Anita es geschafft, ein Ferienhausdorf und zwei Mietshäuser am Ufer der Moskwa auf sich allein überschreiben zu lassen. Ich hatte den Verdacht, dass sie Paskewitsch unter Drogen gesetzt hatte oder dass ihm aus irgendwelchen anderen Gründen einfach nicht klar gewesen war, was er unterschrieb. Aber seine Unterschriften waren rechtskräftig. Anita hatte das Gesetz auf ihrer Seite, allerdings setzte Paskewitsch nun seine Killer auf sie an, und sie wagte zwei Jahre lang nicht, Finnland zu verlassen. Schließlich sah sie sich jedoch gezwungen, wieder nach Russland zu reisen, da sie ihrer Sachwalterin in Moskau nicht uneingeschränkt trauen konnte. Ihr voriger Leibwächter hatte seinen Beruf wegen eines Unfalls in der Freizeit aufgeben müssen: Er hatte sich die Achillessehne gerissen und würde nie mehr schnell laufen können. Anita hatte jedoch den Verdacht, dass er bestochen oder misshandelt worden war. Er war später nach Florida gezogen, wo er nun in einem Fitnesscenter arbeitete.
Ich sah, dass Schabalin vor einem Haus stoppte, das ich kannte. Mein Taxi hielt ebenfalls, und zwar näher an Schabalins Wagen, als mir lieb war. Der Fahrer fragte, wie es nun weitergehen solle. Ich antwortete auf Englisch, wir würden erst einmal abwarten. Schabalin hielt Wache, bis Anita das Haus betreten hatte. Dann wendete er in einem waghalsigen Manöver, das prompt ein Hupkonzert auslöste.
Im Erdgeschoss des Hauses befand sich ein Lokal. Wenn ich dort einen Fenstertisch bekam, würde ich Schabalin sehen, wenn er zurückkam, um Anita abzuholen. Ich bezahlte das Taxi und stellte fest, dass mir nur noch fünfzig Rubel Bargeld blieben. Zum Glück genug für einen Drink in der Bar, die Swoboda hieß, nichtssagend, zu hell und fast leer war. Einen Fenstertisch zu ergattern war kein Problem. Obwohl es in dem Lokal keinerlei Textilien gab, nur Holztische und Barhocker aus Plastik, schien sich überall Zigarettenrauch eingefressen zu haben. Ich bestellte ein Bier und vergewisserte mich, dass die Flasche wirklich fest verschlossen war, bevor der Kellner sie öffnete. Er funkelte mich böse an, sagte aber nichts. Ich setzte mich an den Fenstertisch und wartete. Es war bereits halb neun.
Nach etwa einer Viertelstunde betrat eine Männerrunde die Bar, offenbar Stammgäste, denn der Kellner begrüßte sie wie alte Bekannte. Keiner der Männer kam mir bekannt vor. Da sich die Theke in der Fensterscheibe spiegelte, sah ich, dass eine volle Wodkaflasche daraufgestellt wurde. Sobald die Gläser gefüllt waren, brachten die Männer einen Toast aus. Dann erschienen ein Teller Salzgurken und Schüsseln mit Honig und saurer Sahne auf der Theke. Die Männer lärmten, der Kellner ließ sich zu einem Glas Wodka einladen. Anfangs beachtete mich niemand.
Draußen ging nur selten jemand vorbei. In dieser Straße mit Wohnhäusern für die gehobene Mittelschicht gab es außer einem kleinen Lebensmittelladen und der Bar Swoboda keine Geschäfte. Die Wohnungen, die Anita besaß, waren keine Luxusapartments, aber für einen normalen Moskauer Lohnempfänger dennoch unbezahlbar. Nach finnischer Art hatte jede Wohnung eine eingebaute Sauna, was den Preis in die Höhe trieb. Womöglich zählten auch die Männer, die in meinem Rücken lärmten, zu Anitas Mietern. Im verzerrten Spiegelbild auf der Fensterscheibe sah ich, dass einer von ihnen mich anstarrte. Ich trank einen Schluck Bier, stellte das Glas ab, zog es aber gleich darauf näher heran, denn ich sah, dass der Mann an meinen Tisch kam. Er bot mir eine Zigarette an, die ich wortlos ablehnte. Dann redete er in irgendeinem russischen Dialekt auf mich ein. Ich brauchte nicht einmal so zu tun, als verstünde ich kein Russisch, denn ich kapierte tatsächlich nicht, was er sagte. Ein zweiter Mann kam dazu. Ich war zwischen den beiden eingekeilt, unternahm aber nichts dagegen, weil ich unbedingt auf meinem Posten bleiben wollte. Vielleicht konnte ich mich irgendwie mit Anita versöhnen, sodass ich wenigstens eine neutrale Empfehlung von ihr bekam. Nun trat ein dritter Mann ans Fenster, offenbar in der Absicht, die beiden anderen von mir wegzulotsen.
Im selben Moment kam Anita aus dem Haus. Sie starrte entgeistert auf die leere Straße. Offenbar hatte sie angenommen, dass der Wagen auf sie wartete. Als sie wieder hineinging, vermutlich um Schabalin anzurufen, trank ich schnell mein Bier aus. Ich hasste es, zu Kreuze zu kriechen, zumal ich wusste, dass ich von Anita einiges zu hören bekäme, ging aber widerstrebend hinaus. Bald musste Anita kommen, dann würden wir die Sache klären. Die Haustür war aus solidem Holz, sie hatte nicht einmal einen Türspion. Auf der Straße war kein Auto zu sehen, nur ein einsamer Hund streunte zwischen den Häusern herum.
Das Nächste, woran ich mich erinnerte, war der Moment, in dem ich in einem unbekannten Zimmer aufwachte, weil mich eine fremde Frau mit einer fürchterlichen Stimme anschrie. Mir tat der Kopf weh, es roch nach Erbrochenem. Die Uhr an meinem Handgelenk zeigte fast drei Uhr. Es war heller Nachmittag, ich hatte mehr als zwölf Stunden aus meinem Leben verloren.
2
Die schreiende Frau war eine Empfangsdame des Hotels, die mir erklärte, die Frist zum Auschecken sei schon vor zweieinhalb Stunden abgelaufen und ich müsse sowohl für die überzähligen Stunden als auch für die Reinigung des Fußbodens, auf den ich mich übergeben hatte, einen Zuschlag zahlen. Ich versprach, das Zimmer spätestens um sechs Uhr zu räumen und alles zu bezahlen; ich wollte die Frau so schnell wie möglich loswerden und meine Gedanken sortieren. Mir war schwindlig und übel, aber offenbar hatte ich nichts mehr im Magen, was hochkommen konnte. Als die Frau nach einer letzten Tirade über die versoffenen Finnen endlich verschwand, stand ich auf. Ich hatte entsetzlichen Durst. Nach einigem Überlegen erinnerte ich mich, dass ich am Tag zuvor eine Cola und eine Literflasche Mineralwasser gekauft und in meinen Rucksack gesteckt hatte. Und der Rucksack war … dort, an der Wand. War auch alles andere noch vorhanden? Ich hatte in meinen Kleidern geschlafen, die Schuhe und die Lederjacke lagen auf dem Fußboden. Mein Handy steckte in der Seitentasche der Lederjacke, die Geldbörse in der Brusttasche. Sie enthielt die wenigen Rubel, die mir geblieben waren, nachdem ich das Bier bezahlt hatte. Meine Waffe lag unter der Bettdecke. Ich war also nicht ausgeraubt worden.
Ich trank Mineralwasser, nahm eine Tablette gegen die Übelkeit und zwei gegen die Kopfschmerzen und tastete vorsichtig meinen Kopf ab. Nichts deutete darauf hin, dass man mich niedergeschlagen hatte. Als Nächstes zog ich mich aus, stellte mich vor den Spiegel und inspizierte meinen Körper. Die Knie waren leicht verschorft, wie nach einem Sturz, aber meine Handflächen waren unversehrt. Zwischen den Beinen spürte ich keinen Schmerz, entdeckte auch keine Prellungen, die den Verdacht auf Vergewaltigung geweckt hätten. Als ich unter der Dusche stand, erinnerte ich mich, dass ich zu den Blinis einen Wodka und zwei Glas litauisches Starkbier und in der Bar Swoboda noch ein Bier getrunken hatte. Wenn in dem Bier, das ich beim Essen zu mir genommen hatte, ein Betäubungsmittel gewesen wäre, hätte es weitaus früher wirken müssen, und das Bier in der Bar hatte ich behütet wie eine Mutter ihr Baby. Oder? Als Anita auf die Straße getreten war, hatte ich einen Moment lang nur auf sie geachtet. Hatte es einer der drei Männer, die mich umringten, fertiggebracht, mir etwas ins Glas zu träufeln, bevor ich den letzten Schluck getrunken hatte? Fluchend wickelte ich mich in das dünne Handtuch, das gerade breit genug war, um meinen Körper vom Brustansatz bis zum Po zu bedecken. Dann zog ich die Vorhänge zu und rief Anita am Handy an. Keine Antwort.
Hatte ich mit ihr gesprochen? Hatten wir uns ausgesöhnt? Wie war ich ins Hotel gekommen? Vergeblich durchforstete ich mein Gedächtnis. Ich rief in Anitas Hotelzimmer an, doch auch dort meldete sie sich nicht. An der Rezeption sagte man mir lediglich, Frau Nuutinen logiere noch im Haus; weitere Auskünfte könne man mir nicht geben.
Wer wusste etwas über Anitas Angelegenheiten? Ihre Sachwalterin Maja Petrowa? Der Taxifahrer Sergej Schabalin? Petrowas Telefonnummer kannte ich nicht, und als ich Schabalin anrief, hörte ich das Besetztzeichen. Der Ton war unerträglich, er bohrte sich geradezu in meinen Schädel. Ich musste mich noch einmal aufs Bett legen und zog auch die Decke über mich, obwohl sie ebenso schlecht roch wie meine schmutzigen Kleider. Die Duschfrische war im Nu verflogen. Als ich mich umdrehte, strich mir etwas Weiches über die Füße. Ich griff danach, spürte glatte Seide. In meinem Bett lag Anitas goldfarbenes Gucci-Tuch, das sie oft verwendete, wenn sie Kleidung in neutralen Farben trug. Wie war es bei mir gelandet?
Panik erfasste mich, denn alle Erklärungen, die mir einfielen, waren gleichermaßen schlimm. Anita hätte mir nie im Leben ihr Tuch gegeben, selbst wenn wir in Freundschaft auseinandergegangen waren. Ich zwang mich, meine Waffe zu inspizieren – war sie während meines Blackouts benutzt worden? Nein, es waren keine Pulverspuren zu sehen, und im Magazin fehlte keine Kugel. Warum hallte mir dennoch ein Schuss in den Ohren, den ich nicht einzuordnen wusste?
Plötzlich drängte es mich, das stickige Zimmer so schnell wie möglich zu verlassen, obwohl es noch Stunden dauerte, bis mein Zug fuhr. Ich verspürte Hunger. Im Rucksack fand ich den Energieriegel, den ich für Notfälle eingesteckt hatte. Ich aß ihn langsam, voller Angst, die Übelkeit würde zurückkommen. Dann duschte ich noch einmal und zog mich an. Anitas Tuch packte ich ganz unten in meinen Rucksack, unter die Reservemagazine, die Glock steckte ich ins Schulterhalfter. Nachdem ich die Hotelrechnung beglichen hatte, bekam ich meinen Pass ausgehändigt, den ich beim Einchecken als Pfand hatte hinterlegen müssen. Ich fuhr mit der Metro zum Bahnhof und löste die vorbestellte Fahrkarte. Wieder versuchte ich vergeblich, Anita oder Schabalin zu erreichen. Schabalins Anschluss war nicht mehr besetzt, ich ließ es lange läuten, doch er meldete sich nicht.
Da ich keine Lust hatte, mit meinem Gepäck herumzulaufen, es aber auch nicht bei der Aufbewahrung hinterlassen wollte, ging ich ins Bahnhofsrestaurant, wo ich Borschtsch und Mineralwasser bestellte. Nachdem ich mich gestärkt hatte, versuchte ich erneut, mir die Ereignisse des gestrigen Abends ins Gedächtnis zu rufen, doch meine Erinnerung endete schlagartig an dem Punkt, als ich die Bar verlassen hatte, um auf Anita zu warten. Vielleicht waren wir uns nicht begegnet, oder sie hatte es abgelehnt, mit mir zu reden. Vielleicht hatte sie das Tuch versehentlich fallen gelassen, und ich hatte es aufgehoben. Die meisten Knock-out-Tropfen führen zu tiefem Gedächtnisschwund, der weder durch Hypnose noch durch eine Therapie zu beheben ist. Aber ich hatte doch keine Dummheiten gemacht? Vielleicht hatte ich ein Taxi genommen und mich zum Hotel bringen lassen, bevor ich das Bewusstsein verlor. Das hoffte ich jedenfalls. Sobald ich dazu Gelegenheit hatte, musste ich per Internet mein Konto überprüfen, dann würde ich sehen, ob ich mit meiner Kreditkarte eine Taxifahrt bezahlt hatte.
Meine Stimmung, die der Borschtsch ein wenig aufgehellt hatte, verdüsterte sich restlos, als ich wieder Anita anrief und sich ein Unbekannter auf Russisch meldete. Wieso war Anitas Telefon in der Hand eines Fremden – der nun wusste, dass sie Anrufe von meinem Anschluss bekommen hatte? Verdammt nochmal! Womöglich waren die Männer in der Bar allesamt Paskewitschs Handlanger gewesen, einschließlich des Kellners. Ich wollte diesen Gedanken nicht weiter verfolgen. Irgendwer hatte es geschafft, alle meine Sicherheitsnetze zu überwinden. Dass man es nicht einmal für nötig befunden hatte, mich zum Schein auszurauben, machte das Ganze nur noch bedrohlicher.
Als der Zug endlich zum Einsteigen bereitstand, suchte ich mein Abteil und belegte das Einzelbett, das durch einen schmalen Gang von dem Etagenbett an der anderen Wand getrennt war. Die eine Nacht würde ich heil überstehen, selbst wenn ein kirgisischer Straßenräuber das Abteil mit mir teilte – immerhin war ich bewaffnet. Anita war nie mit dem Zug nach Russland gefahren, weil es sie ekelte, mit allen möglichen Leuten das WC teilen zu müssen. Auf meine Bemerkung, das bleibe ihr auch im Flugzeug nicht erspart, hatte sie erwidert, die Toilette der Business Class sei wenigstens nicht jedem Hinz und Kunz zugänglich.
Der Kondukteur rief irgendetwas, dann schrillte eine Pfeife. Ruckelnd setzte sich der Zug in Bewegung. Ich streckte mich auf dem Bett aus und wartete auf den Schaffner. Der Zug würde erst in Sankt Petersburg wieder halten, mindestens bis dahin hatte ich das Abteil für mich allein. Obwohl der lange Schlaf, aus dem die Hoteldame mich gerissen hatte, nur eine chemische Illusion gewesen war, wollte es mir nicht gelingen, fest einzuschlafen. Allerdings nickte ich immer wieder kurz ein und wusste dann nicht, ob der Schuss, der mir beim Aufwachen in den Ohren hallte, Traum oder Erinnerung war. Beiderseits der Grenze wurde ich geweckt, zuerst von der Passkontrolle, dann vom Zoll, aber ich registrierte die Grenzbeamten nur im Halbschlaf und hätte im Nachhinein nicht beschwören können, dass sie tatsächlich in meinem Abteil gewesen waren.
In Helsinki fuhr ich mit der Straßenbahn vom Bahnhof in die Untamontie im Stadtteil Käpylä, wo der größte Teil meiner Besitztümer lagerte. Mein Zimmer, in dem nur ein Bett, ein Schreibtisch und ein Sattelstuhl standen, war staubig und unpersönlich. Meine Mitbewohnerinnen waren nicht zu Hause. Ich teilte mir die Wohnung mit zwei Studentinnen, etwa zehn Jahre jünger als ich, die es zu schätzen wussten, dass ich ein Drittel der Miete zahlte, mich aber nur selten blicken ließ. Sie wussten, dass ich von Beruf Wächterin war, und ich hatte gelegentlich vage von Werttransporten gesprochen, deren Schutz mich für längere Zeit ins Ausland führte. Dass die Wohngemeinschaft mit mir gewisse Risiken einschloss, war ihnen nicht bewusst. Mir war es wichtig, als offizielle Adresse nicht das Ferienhaus angeben zu müssen, das ich in Degerby gemietet hatte und in dem ich den größten Teil meiner freien Zeit verbrachte. Da aus meinen Papieren nicht hervorging, an wen ich die Miete zahlte, war das Ferienhaus sicherer als das Zimmer in der Untamontie sieben, wo ich offiziell gemeldet war.
Es konnte durchaus sein, dass mir jemand auf den Fersen war. Anitas Tätigkeit als Ferienhausmaklerin hatte sowohl die Finnen enttäuscht, die ihr die Grundstücke verkauft hatten, als auch die russischen Käufer, denen sie Exklusivität versprochen hatte. Ein Ferienhaus in Finnland, in der unberührten Natur, war für die Russen ein Statussymbol, das an Wert verlor, wenn Dutzende ihrer Landsleute ein ähnliches Objekt besaßen. In den Feriendörfern entwickelten die fröhlichen Slawen finnische Charakterzüge, sie verschanzten sich hinter Zäunen und zogen sogar im See Stacheldraht, um zweifelhafte Gestalten fernzuhalten. Mich hätten keine zehn Pferde dazu gebracht, in einer der Urlaubshöllen zu wohnen, die Anita verschacherte. Stellenweise ähnelte das Ufer des Saimaa-Sees bereits den Hotelghettos südlicher Urlaubsresorts.
Ich hatte praktisch nichts zu essen in der Wohnung. Immerhin fand ich ein Paket Wonton-Nudeln, die ich aß, während die Waschmaschine lief. Viel zu waschen hatte ich nicht, nur Unterwäsche und einige Blusen. Meinen Jogginganzug hatte ich am Morgen vor dem Zerwürfnis mit Anita aus der Hotelreinigung geholt; seitdem war ich nicht mehr dazu gekommen, ihn zu benutzen. Als ich die Nudeln aß, bemerkte ich plötzlich einen Jeep, der auf der Straße parkte. Er hatte dunkel getönte Scheiben und ein russisches Kennzeichen.
Verdammt! Sie waren immer noch hinter mir her, daran konnte ich weder mit meiner Waffe noch mit dem schwarzen Gürtel im ersten Dan des Judo etwas ändern. Paskewitschs Männer hatten noch bessere Arbeit geleistet als ich. Ich durfte den Russen nicht unterschätzen, er war beileibe kein Amateur.
So unauffällig wie möglich schlich ich durch die Wohnung. Die Jalousie in meinem Schlafzimmer war Tag und Nacht heruntergelassen, aber am Küchenfenster hing nur eine zwanzig Zentimeter breite Seitengardine. Die Tür zu Jennis Zimmer war geschlossen, ich zog auch Riikkas Tür zu. Dann holte ich das Fernglas aus meinem Zimmer. Doch ins Wageninnere konnte ich auch damit nicht sehen. Ich versuchte mich zu erinnern, ob mir das Kennzeichen schon einmal untergekommen war. Natürlich kannte ich nicht alle in Finnland tätigen russischen Gorillas, aber vorsichtshalber verglich ich das Nummernschild mit den verdächtigen Kennzeichen, die ich mir bei früheren Gelegenheiten notiert hatte. Ein paar der Mafiosi, die ich kannte, waren so arrogant, dass sie sich gegen Aufpreis persönliche Kennzeichen verschafften, die sie verrieten, andererseits aber auch einschüchternd wirken mochten.
Der Waschgang war beendet, aber es kam natürlich nicht in Frage, auf den Hof zu gehen und die Wäsche aufzuhängen. Dort wäre ich ein allzu leichtes Ziel gewesen. Ich besaß eine kugelsichere Weste, aber keinen Helm – und hätte ihn ohnehin nicht aufsetzen können, ohne in der Nachbarschaft Aufsehen zu erregen. In der Waschküche im Keller stand ein Wäschetrockner, damit würde es schnell gehen. Falls mein Verfolger immer noch auf der Straße wartete, wenn die Wäsche trocken war, konnte ich ihn vielleicht abschütteln, indem ich durch den Keller ans andere Ende des Hauses ging und den zweiten Ausgang benutzte. Aber wenn mein Gegner sein Metier beherrschte, hatte er sich natürlich einen Grundriss des Hauses beschafft und diese Möglichkeit einkalkuliert.
Ich durfte auf keinen Fall riskieren, dass mein Beschatter die Hütte in Degerby entdeckte, aber in meiner offiziellen Wohnung wollte ich auch nicht bleiben. In Hevonpersiinsaari, der Gegend, in der ich aufgewachsen war, würde es keinem gelingen, mich zu observieren. Ich konnte in Joensuu ein Auto mieten und hinfahren. Bis Joensuu könnte ich fliegen, im Flugzeug wäre ich sicherer als im Zug, andererseits kam man aus einem Zug notfalls leichter heraus. Während ich die Wäsche aus dem Trockner nahm, wog ich die Alternativen gegeneinander ab.
Nach dem Tod meiner Mutter hatte mein Onkel Jari mich großgezogen. Erst als Erwachsene hatte ich begriffen, was für ein Glücksfall es war, dass das Jugendamt ein vierjähriges Mädchen in die Obhut eines zweiundzwanzigjährigen Mannes gegeben hatte; für mich war es einfach die beste Variante gewesen. Mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, wohnte in der Landgemeinde Kaavi an der Grenze zwischen den Provinzen Nordkarelien und Kuopio, in einem Gebiet, das allgemein Hevonpersiinsaari genannt wurde. Nach seinem Tod hatte ich das Holzhaus geerbt, in dem ich meine Kindheit verlebt hatte, doch ich wollte nicht mehr dort einziehen. Unser Nachbar Matti Hakkarainen hatte mir das Grundstück gern abgekauft, denn es lag auf einer wunderschönen Landspitze direkt am See und war so groß, dass er darauf für jedes seiner fünf Kinder ein Sommerhaus bauen konnte. Bisher war aus diesen Plänen noch nichts geworden, und das Haus stand meist leer. Ich hatte dadurch eine lebenslängliche Option: Sofern Hakkarainen das Haus nicht selbst brauchte, konnte ich jederzeit dort wohnen. Ich benutzte Riikkas Festanschluss, um Hakkarainen anzurufen. Der Anschluss war sicherer als mein Handy, obwohl ich Prepaids und Sim-Chips wechselte, sooft ich konnte.
Matti Hakkarainen meldete sich an seinem Handy; im Hintergrund heulte eine Motorsäge.
«Komm ruhig, der Schlüssel liegt an seinem Platz. Ich öffne den Schlagbaum an der Zufahrt zur Insel und lege das Schloss in die Stube. Dann kannst du ihn wieder herunterlassen, wenn du willst. Es gibt jetzt sogar Strom.»
«Wirklich?»
«Auf dem Land der Forstverwaltung werden neue Ferienhäuser gebaut, deswegen hat man neue Leitungen verlegt. Heutzutage will keiner mehr ein Sommerhaus ohne Strom. In der Sauna habe ich eine Wasserpumpe eingebaut. Komm bei uns vorbei und hol dir Milch, Brot und Eier, wenn du Zeit hast. Maija backt Piroggen, und der Wald ist voll von Preiselbeeren und Steinpilzen», meinte Hakkarainen gastfreundlich. Ich bestellte einen Mietwagen, kaufte im Internet eine Zugfahrkarte und druckte sie aus. Als ich alles erledigt hatte, stellte ich fest, dass der russische Jeep verschwunden war.
Es konnte sich um ein Täuschungsmanöver handeln, deshalb verließ ich das Haus durch den C-Eingang. In der Mäkelänkatu nahm ich den Bus, stieg an der übernächsten Haltestelle in die Straßenbahn um und fuhr bis zum Bahnhof Pasila. Allem Anschein nach folgte mir niemand. Meinen Mitbewohnerinnen würde nicht auffallen, dass ich in der Wohnung gewesen war, es sei denn, sie wunderten sich über die fehlende Nudelpackung. Riikka und Jenni waren zwar arme Studentinnen, doch ich vertraute ihnen voll und ganz. Sie würden mich keinesfalls an Paskewitsch verkaufen. Riikka studierte Theologie und Jenni Theaterwissenschaften, beide befassten sich also mit Ritualen. Jenni, eine strenge Veganerin, schauspielerte neben dem Studium, Riikka wiederum sprach oft über die Pastorinnenrolle, die sie in ihrem künftigen Beruf spielen musste. Ich hatte mir ihre Gespräche über Schauspielerei leicht belustigt angehört, denn während die beiden sich in ihren Rollen sichtbar präsentieren wollten, bestand meine Aufgabe darin, mich verborgen zu halten.
Der Zug war halb leer, und niemand schien mir Beachtung zu schenken. Dennoch blieb ich wachsam, vor allem, als der Zug in Kouvola, Lappeenranta und Imatra hielt. Am Bahnhof in Joensuu stand der Mietwagen bereit. Ich hatte einen kleinen Geländewagen gewählt, denn der Weg nach Hevonpersiinsaari war steinig, und die heftigen Gewitterregen im Frühherbst hatten vermutlich den Belag angefressen. Zudem genoss ich das Gefühl, erhöht zu sitzen und den Verkehr besser beobachten zu können. Ich untersuchte den Wagen von außen, schob den Sprengstoffdetektor so weit unter den Boden, wie ich nur konnte, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Dann fuhr ich zu einem großen Einkaufszentrum am Stadtrand und deckte mich mit Lebensmitteln ein: Kartoffeln, Nudeln, Thunfischdosen, Lammwurst, Piroggen und ein Kasten Bier. Kalorien waren in meiner Situation wichtiger als Bio. Im Schnapsladen holte ich zwei Flaschen Rum, eine davon als Mitbringsel für Matti Hakkarainen. Für Maija kaufte ich Geleefrüchte.
Auf den Straßen rund um Joensuu waren jede Menge russische Wagen unterwegs, ich konnte nicht jeden argwöhnisch beobachten. Nach Ylämylly leerte sich die Straße, bald hatte ich sie fast für mich allein. Auch auf der einzigen Straße von Outokumpu herrschte kaum Verkehr. Seit Onkel Jaris Tod war ich nicht mehr hier gewesen, denn auf den beiden Heimatbesuchen, die ich danach gemacht hatte, war ich über Kuopio gefahren und hatte in Tuusniemi eingekauft. Hevonpersiinsaari gehörte zur Gemeinde Kaavi, doch da die Schule in Rikkaranta, einem der Nachbardörfer von Outokumpu, weitaus leichter zu erreichen war als die in Maarianvaara, hatte Onkel Jari durchgesetzt, dass ich in der benachbarten Kommune eingeschult wurde, obwohl sie zu einer anderen Provinz gehörte. In Rikkaranta gab es allerdings nur eine Elementarschule. Daher hatte ich ab der siebten Klasse die Schule in Outokumpu besucht und für den Schulweg zu Fuß und mit dem Bus eine Stunde gebraucht. Mein soziales Leben war stark eingeschränkt gewesen. Onkel Jari besaß nur sporadisch ein Auto, der Pkw war das Erste, woran er sparte, wenn uns das Geld auszugehen drohte. Einer seiner Bekannten, ein Gebrauchtwagenhändler, lieferte ihm gelegentlich einen alten Lada oder Datsun, weshalb ich als Kind verrostete Trittbretter für normal hielt.
Der von Weidenbüschen gesäumte Weg war mit faustgroßen Steinen übersät. Am Rand einer Hiebfläche blühten noch späte Weidenröschen. Hevonpersiinsaari war von dichten Wäldern umgeben, die ich immer als Schutz empfunden hatte. Jetzt stellte ich fest, dass sich die Umgebung radikal verändert hatte. Kahlschläge waren ein grausames Spiel, sie verwandelten den Wald in Holzwüsten, deren Hässlichkeit nur die Weidenröschenflocken ein wenig milderten. Auch bei Hevonpersiinsaari hatte man jetzt allem Anschein nach Ferienhausgrundstücke parzelliert, denn am Straßenrand stand ein Schild mit der Aufschrift «Ufergebiet Kaavinjärvi-Rikkavesi, Flächennutzungsplan Suuriniemi».
Offenbar war denjenigen, die den Bebauungsplan erstellt hatten, der Name Hevonpersiinsaari – Pferdearschinsel – zu unanständig erschienen, und sie hatten die Gegend für potenzielle Käufer umgetauft. Meine Mitschüler in der Sekundarstufe hatten sich über den Namen meines Wohnorts natürlich lustig gemacht, aber ich hatte ihren Frotzeleien rasch einen Riegel vorgeschoben. Mit Hilja Ilveskero spielte man besser nicht. Dass ich keine engen Freunde hatte, störte mich nicht, ich war kein Herdentier.
Die Schranke war geöffnet, wie Hakkarainen es versprochen hatte. Ihre Existenz gab mir ein wenig Sicherheit, obwohl sie nur Fahrzeugen den Zugang verwehrte. Zu Fuß und mit dem Boot gelangte man mühelos auf die Insel, die eigentlich gar keine richtige Insel, sondern durch eine schmale Landenge mit dem Festland verbunden war. Die Dämmerung senkte sich über den Wald, es nieselte leicht. Am Wegrand wuchsen Täublinge und Preiselbeeren, und plötzlich hatte ich den Geschmack von Onkel Jaris eingelegten Preiselbeeren im Mund. Vor Paskewitsch und seinen Handlangern mochte ich hier in Sicherheit sein, doch meiner Kindheit entkam ich nicht. Zu beiden Seiten des Weges blühte Heidekraut, dazwischen standen Eimer mit Sonnenblumen. Die Hakkarainens hatten einiges getan, um die Insel zu verschönern. Natürlich hatte auch Onkel Jari die Umgebung des Hauses gepflegt, aber für Zierrat hatte er keinen Sinn gehabt. Als ich vor dem Haus anhielt, entdeckte ich gehäkelte Vorhänge an den Fenstern. Die gute Frau Hakkarainen häkelte leidenschaftlich gern, es war undenkbar, dass sie ohne Häkelzeug vor dem Fernseher saß oder mit Bekannten plauderte.
Ich stieg aus und lauschte eine Weile. Es war fast vollkommen still, nirgendwo brannte Licht. Im September hielten sich die Leute unter der Woche nicht mehr in ihren Sommerhäusern auf. Ich suchte unter der Treppe am Schuppen nach dem Schlüssel. Der Schuppen war gestrichen worden, die braune Farbe verdeckte die Kratzer, die Frida hinterlassen hatte. Für die Hakkarainens existierte Frida gar nicht, niemand wusste, dass rund zwei Jahre lang eine Luchsin bei uns gehaust hatte. Als Matti Hakkarainen einmal gefragt hatte, wieso es vor unserem Haus nach Tierharn rieche, hatte Onkel Jari streunende Hunde dafür verantwortlich gemacht.
Ich war acht, als Frida zu uns kam. Ich erinnere mich genau an den Abend im Juli vierundachtzig. Onkel Jari bekam einen Anruf, der ihm sichtlich unangenehm war.
«Dieser verdammte Kauppinen», schimpfte er. «Du musst heute allein schlafen gehen. Schaffst du das? Ich komme sofort nach Hause, wenn die Sache erledigt ist.»
«Welche Sache?»
«Das ist nichts für Kinder. Hol dir den Nudelauflauf von gestern aus dem Keller und mach ihn in der Bratpfanne warm. Aber tu genug Butter dazu, damit er nicht anbrennt, und vergiss nicht, das Gas abzudrehen!» Onkel Jari strich sich ein paar Butterbrote als Proviant und packte eine Flasche verdünnten Blaubeersaft ein. Er tätschelte mir rasch die Wange, nahm sein Jagdgewehr und seine Flinte und ging. Als Kind wollte ich die Geschichte, wie Frida gefunden wurde, immer wieder hören, und mein Onkel erzählte sie mir, obwohl er sich für seinen Anteil daran schämte.
Kauppinen, der ein paar Kilometer weiter einen Hühnerhof betrieb, hatte schon seit langem den Verdacht gehabt, dass ein Luchs unter den frei auf dem Hof herumlaufenden Hühnern wilderte, und ein paarmal hatte er das Raubtier sogar von weitem zu Gesicht bekommen. An diesem Abend hatte Kauppinen seinen Hofhund, eine Mischung aus Finnischem Spitz und Karelischem Bärenhund, von der Leine gelassen. Der Hund hatte die Fährte des Luchses aufgenommen und den Räuber in seinen Bau getrieben. Kauppinen hatte Onkel Jari und zwei weitere Bekannte angerufen, die es mit der Schonzeit nicht so genau nahmen. Die Jagd auf Luchse war nur von Dezember bis Februar erlaubt, doch Kauppinen wollte den Hühnerdieb sofort loswerden.
Der Luchs nistete in einem Dickicht am Berg Maarianvaara. Als Onkel Jari endlich dort eintraf, war der Hund schon weggebracht worden. Am Bau lauerten Kauppinen, Hakkarainen und Seppo Holopainen, mit dem mein Onkel sich nicht gut verstand. Die Männer warteten darauf, dass der Luchs aus seinem Loch kam. Er musste ausgehungert sein, denn sonst wäre er nicht schon vor Einbruch der Dunkelheit auf Beutezug gegangen. Onkel Jari, der am sichersten auf den Beinen war, musste sich über dem Eingang der Höhle postieren. Wenn der Luchs aus seinem Versteck kam, sollte Jari herunterspringen und ihm den Rückweg abschneiden.
Gegen drei Uhr in der Nacht kam das Tier endlich zum Vorschein. Es war ein mageres, kleines Weibchen, bei dessen Anblick mein Onkel zu zittern begann. Dennoch sprang er von seinem Ausguck herunter. Der Luchs rannte in Panik auf den Waldrand zu, bremste aber ab, als er den nach Schnaps stinkenden Holopainen witterte. Holopainen zielte und traf einen Baumstamm. Der Luchs lief zurück zu seinem Bau, aber vor dem Eingang stand Onkel Jari und sah ihm geradewegs in die Augen.
«Ich konnte nicht abdrücken, obwohl ich mit dem Gewehr ganz sicher getroffen hätte. Es war ein so schönes Geschöpf. Kauppinen brüllte und fluchte, und Holopainen schoss wieder daneben. Dann traf Kauppinen das Tier in die Hüfte. Es versuchte zu fliehen, brach aber zu Hakkarainens Füßen zusammen. Er gab ihm dann den Gnadenschuss.»
Die anderen Männer hatten sich darüber gestritten, wessen Frau das Luchsfell bekommen sollte, und das Tier nach altem Brauch mit den Läufen an einen dicken Ast gebunden, um es im Triumphzug nach Hause zu tragen. Onkel Jari merkte, dass er seinen Kompass verloren hatte, und blieb zurück, um ihn zu suchen.
«Ich wollte mich nicht mit den anderen bei Kauppinen zur Feier des Tages besaufen. Ich kam mir vor wie ein Mörder und bereute es, dass ich bei der Hatz mitgemacht hatte. Vor dem Eingang zum Bau fand ich den Kompass, und als ich mich danach bückte, hörte ich das kläglichste Geräusch der Welt. Ein Junges spähte aus der Höhle und machte ‹Miu›. Es vermisste seine Mutter. Wir Halunken hatten doppelt gegen das Jagdgesetz verstoßen, indem wir ein Weibchen erlegt hatten, das ein Junges hatte. Die sind ja zu jeder Jahreszeit geschützt.»
An dieser Stelle der Erzählung bebte Onkel Jaris Stimme jedes Mal. Das Jagdgesetz war ihm nicht so wichtig, doch er hatte das Gefühl, sich an den Luchsen versündigt zu haben.
«Kauppinen hätte das Junge abgeknallt, wenn er es gesehen hätte, und allein im Wald wäre es auch umgekommen. Das arme Ding konnte ja noch nicht jagen. Es war scheu und flink und schlüpfte zurück in den Bau, aber ich bin ihm nachgekrochen und habe es schließlich erwischt, nachdem es mir fast die Nase abgebissen hätte. Ich habe es in meinen Rucksack gesteckt, ein kleines Luftloch offen gelassen und gehofft, dass es nicht allzu sehr schreien und zappeln würde. Auf dem Heimweg habe ich überlegt, was ich ihm zu fressen geben könnte.»
«Und am nächsten Morgen wurde ich davon wach, dass der Luchs Jagd auf meine Zehen machte», hatte ich an dieser Stelle zu ergänzen. «Seitdem waren Frida und ich die besten Freundinnen.»
Ich sah Anita vor mir, wie sie über den Luchsmantel strich. Es war mir keine andere Wahl geblieben, als zu kündigen, um Fridas willen. Ich trug mein Gepäck ins Haus und tastete nach dem Lichtschalter. Er befand sich neben der Tür, wie ich es vermutet hatte. Im elektrischen Licht wirkte der Raum fremd. Ich entdeckte neue Geräte: Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine und sogar einen Fernseher. Nachdem ich den Schlagbaum geschlossen hatte, ging ich schwimmen. Das Seewasser war eisig, sogar die Spirale, die ich mir hatte einsetzen lassen, wurde kalt. Das Wasser machte mich hellwach und aufmerksam, ich hörte und roch die Dunkelheit wie als Kind. Damals hatte ich Frida um ihre Fähigkeit beneidet, im Dunkeln zu sehen. Als ich zum ersten Mal ein Infrarotfernglas ausprobiert hatte, im Trainingskeller der Akademie in Queens, hatte ich mich wie eine Raubkatze gefühlt.
Es würde mir guttun, mich an die Dunkelheit zu gewöhnen und meine Wachsamkeit zu steigern, denn wie sich in Moskau gezeigt hatte, war ich nicht mehr in Bestform. Hoffentlich hatte Hakkarainen wenigstens eine der alten Öllampen im Haus gelassen. Ihr Licht war anheimelnder als das der Glühbirne. Immerhin war der Stromanschluss insofern nützlich, als ich erstens meinen Laptop nicht im Auto aufzuladen brauchte und zweitens einen einfachen Bewegungsmelder am Haus anbringen konnte. Ein Profi würde ihn zwar sofort entdecken, aber gewöhnliche Einbrecher würde er fernhalten. Zu Fridas Zeiten waren solche Vorsichtsmaßnahmen überflüssig gewesen; der Luchs hatte sogar den Dieb bemerkt, der im Ruderboot um die Landspitze gekommen war, um Onkel Jaris Außenbordmotor zu stehlen. Da Frida an Menschen gewöhnt war, hätte sie dem Dieb nicht mehr Schaden zugefügt als eine Hauskatze, aber sie hatte Onkel Jari geweckt. Dessen Flinte war zwar nicht geladen, doch der Anblick des Mannes, der mit der Waffe im Arm zum Bootssteg rannte, hatte genügt, um dem Übeltäter, einem Nachbarjungen, einen gewaltigen Schreck einzujagen.
Nachdem ich in der Mikrowelle zwei Piroggen aufgewärmt und dazu ein Bier getrunken hatte, legte ich mich schlafen. In einem Geschäft für Wanderausrüstung hatte ich vor Monaten einen superleichten, auf Taschentuchgröße faltbaren Bettbezug gekauft, der als Innenfutter für Schlafsäcke gedacht war. Ich trug ihn immer bei mir, er war mein persönliches Nest. Als ich mich auf die Matratze legte und die Decken über mich zog, stieg mir ein fremdartiger Geruch in die Nase. Offenbar hatte Hakkarainens Frau die Bettwäsche mit parfümiertem Waschpulver gewaschen.
Ich erinnerte mich daran, wie der Fußboden unter Fridas Pfoten geknarrt hatte. Sie hatte von Anfang an neben mir schlafen wollen, was Onkel Jari damit erklärte, dass meine Körpertemperatur höher sei als seine. Anfangs war Frida kleiner gewesen als ich, aber schon im Frühjahr hatte sie meine Größe erreicht. Selbst bei stärkstem Frost hatte ich nur eine Decke gebraucht, weil Frida mich wärmte. Wenn ich die Erinnerung wachrief, spürte ich das weiche Fell an meinen Zehen, nahm ihren nach faulem Fleisch riechenden Atem wahr. Frida war meine Schwester gewesen … Ich schlief neben ihr ein, wie so oft zuvor.
Lautes Hupen und ein gellender Aufschrei weckten mich. Ich nahm die Pistole von dem Stuhl, der mir als Nachttisch diente. Es war schon hell, die Uhr zeigte kurz nach sieben. Ich blickte zum Fenster hinaus und sah eine vertraute Gestalt, die rückwärts davonlief. Maija Hakkarainen. Die Alarmanlage, die an den Bewegungsmelder angeschlossen war, hatte sie erschreckt.
«Maija!», rief ich ihr nach. Der Korb, den sie mir hatte bringen wollen, war auf die Treppe gefallen, Eigelb lief heraus. Wie hatte ich nur vergessen können, dass die Hakkarainens im Rhythmus ihrer Kühe lebten und jeden Morgen um fünf Uhr aufstanden? Maija hatte sich aus purer Gutmütigkeit auf den Weg gemacht, um mir frische Zutaten für mein Frühstück zu bringen. Ich steckte die Pistole in die Tasche meines Schlafanzugs und lief auf bloßen Füßen hinter Maija her.
«Maija! Ich bin’s, Hilja! Du brauchst keine Angst zu haben.» Maija Hakkarainen war schon über sechzig und schlecht zu Fuß, es fiel mir nicht schwer, sie einzuholen. Ich schob den schrecklichen Lärm auf die Alarmanlage des Mietwagens und hoffte, dass Maija die faule Ausrede schluckte. Immerhin nahm sie meine Einladung zum Kaffee an. Glücklicherweise war nur ein Ei zerbrochen, und die Milchflasche war so fest zugeschraubt, dass kein Tropfen ausgelaufen war.
«Warst du wieder in Amerika?», erkundigte sich Maija, für die es damals eine Sensation gewesen war, dass ich zur Ausbildung nach New York ging. Als ich ihr erzählte, dass ich mich in letzter Zeit hauptsächlich in Russland aufgehalten hatte, klagte sie über den Georgien-Krieg und darüber, dass Hevonpersiinsaari viel zu nah an der Ostgrenze lag. Das könne nicht gutgehen. Doch sie hatte auch eine erfreuliche Nachricht: Die Stute Tähti, deren Mutter vor vielen Jahren mein Lieblingspferd gewesen war, hatte vor zwei Wochen gefohlt. Ich versprach, sie zu besuchen, sobald ich Zeit hatte.
Dann gab ich Maija meine Mitbringsel. Sie meinte, Matti werde sich über den Rum freuen und sie werde aufpassen, dass er nicht zu viel auf einmal trank. Nachdem sie gegangen war, schaltete ich den Fernseher ein, obwohl es mir immer noch seltsam vorkam, dass es hier am Ende der Welt eine Flimmerkiste gab. Die Nachrichtensendung fing gerade an, und der Sprecher sagte mit ernster Miene:
«In Moskau wurde eine finnische Geschäftsfrau getötet. Ihre Leiche wurde am Dienstagmorgen in der Nähe der Metrostation Frunzenskaja gefunden. Die Moskauer Miliz ermittelt.»
3
Obwohl der Name des Opfers nicht erwähnt wurde, war ich sicher, dass es sich um Anita handelte. Die Puzzlestücke passten einfach zu gut zusammen. Der Kaffee wollte mir hochkommen, mir wurde schwindlig. «Getötet in der Nähe der Metrostation Frunzenskaja.» Von der Tatwaffe und der genauen Tatzeit war nicht die Rede gewesen, aber Anita musste auf jeden Fall vor Dienstagmorgen umgebracht worden sein. Da war ich noch in Moskau gewesen. Aber ich konnte mich nicht entsinnen, mich am Montag auch nur in der Nähe der Frunzenskaja aufgehalten zu haben. Sie lag im Südwesten der Stadt, und wir waren im Osten unterwegs gewesen. Allerdings hatte ich auch sonst keinerlei Erinnerung an die Stunden zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag.
Anitas Kopftuch lag immer noch in meinem Rucksack. Wie in aller Welt war es bei mir gelandet? Ich nahm es heraus und überlegte, ob ich es im Saunaofen verbrennen sollte. Wenn ich die Asche in den See warf, würde mir niemand nachweisen können, dass das Tuch jemals in meinem Besitz gewesen war.
Ich schaltete mein Handy an und legte den Sim-Chip für den Anschluss ein, dessen Nummer ich Anita gegeben hatte. Sie hatte nichts von sich hören lassen. Dafür waren etwa ein Dutzend andere Anrufe gekommen, der letzte von meiner Mitbewohnerin Riikka, die auch auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen und mir eine SMS gleichen Inhalts geschickt hatte:
«Hallo, Hilja, die Polizei hat nach dir gefragt, aber nicht verraten, warum. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wo du bist, vielleicht dienstlich im Ausland. Hauptmeister Teppo Laitio von der Zentralkripo bittet dich, ihn unter der Nummer 071–8787 007 anzurufen oder ihm eine Mail zu schicken, Vorname.Nachname at poliisi.fi.»
Die finnische zentrale Kriminalpolizei hatte unter anderem in Moskau und in Sankt Petersburg einen Vertreter, doch keiner der beiden hieß Laitio. Die hiesige Polizei würde mich nicht so leicht auftreiben. Natürlich war ich eine der Hauptverdächtigen, aber wie sollte ich die Fragen der Kripo beantworten, wenn ich keine Ahnung hatte, was ich zur Tatzeit getrieben hatte? Hauptmeister Laitio hatte auf Band gesprochen und gesimst und mich zweimal angerufen. Schon vorher war ein Anruf von einem unbekannten Anschluss gekommen. Auch dieser Anrufer hatte eine Nachricht hinterlassen:
«You don’t have any idea who is behind your boss’s murder. No idea, if you don’t want to end up as dead as those lynxes on your boss’s fur coat. You understand?»
Der Mann, der mir diese Drohung auf die eigene Mailbox gesprochen hatte, sprach mit starkem russischem Akzent, der jedoch leicht nachzuahmen war. Er konnte ebenso gut Finne, Este oder Pole sein. Ich überlegte, ob ich seine Stimme eventuell in der Bar Swoboda gehört hatte, konnte mir die Stimmen der Gäste aber nicht exakt ins Gedächtnis rufen. Ich hatte mich darauf konzentriert, die Männer zu ignorieren, statt mir ihre Eigenschaften einzuprägen. Das war ein Fehler gewesen.
Ich gierte nach weiteren Informationen über die in Moskau ermordete Finnin. In der Hütte gab es keine Internetverbindung, aber immerhin Bildschirmtext. Doch bei allen Sendern fand ich nur dieselbe kurze Meldung, die ich bereits in den Nachrichten gehört hatte. Ich spielte mit dem Gedanken, nach Outokumpu zu fahren und die Boulevardblätter zu kaufen. Die Hakkarainens hatten sicherlich nur die Provinzzeitung abonniert, und natürlich das Organ des Bauernverbandes. Laitio, der Polizist, wiederum würde mir am Telefon nichts verraten, sondern im Gegenteil versuchen, mir Informationen zu entlocken.