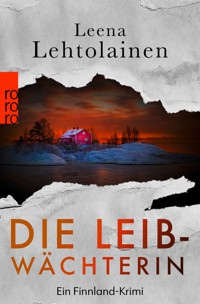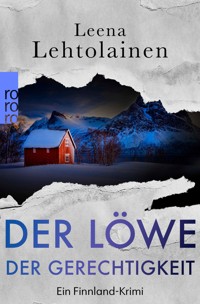
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Leibwächterin
- Sprache: Deutsch
Die junge Leibwächterin Hilja hatte sich so sehr auf ein paar Tage mit ihrem Geliebten David, dem untergetauchten Europol-Agenten, gefreut. Doch der Besuch in seinem italienischen Unterschlupf verläuft anders als geplant: David ist spurlos verschwunden, in seiner Wohnung liegt ein erschossener Mafioso. Hat ihr Freund wirklich etwas mit dem Mord zu tun? Und wenn er in Schwierigkeiten steckte, wieso hat er sich ihr nicht anvertraut? Zurück in Finnland, stellt Hilja Nachforschungen an – offenbar führte David ein Doppelleben. Hilja kann niemandem trauen, nur der eigenwillige, zigarrenrauchende Kommissar Teppo Laitio steht ihr zur Seite. Die beiden geraten in einen Strudel aus Macht, Gewalt und Korruption, und Hiljas Liebe zu David wird auf eine harte Probe gestellt. Mit dem zweiten Teil der «Leibwächterin»-Trilogie spannt Leena Lehtolainen grandios den Bogen von organisiertem Verbrechen und globaler Verschwörung zur düsteren Vergangenheit ihrer Heldin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Leena Lehtolainen
Der Löwe der Gerechtigkeit
Über dieses Buch
Die junge Leibwächterin Hilja hatte sich so sehr auf ein paar Tage mit ihrem Geliebten David, dem untergetauchten Europol-Agenten, gefreut. Doch der Besuch in seinem italienischen Unterschlupf verläuft anders als geplant: David ist spurlos verschwunden, in seiner Wohnung liegt ein erschossener Mafioso. Hat ihr Freund wirklich etwas mit dem Mord zu tun? Und wenn er in Schwierigkeiten steckte, wieso hat er sich ihr nicht anvertraut? Zurück in Finnland, stellt Hilja Nachforschungen an – offenbar führte David ein Doppelleben. Hilja kann niemandem trauen, nur der eigenwillige, zigarrenrauchende Kommissar Teppo Laitio steht ihr zur Seite. Die beiden geraten in einen Strudel aus Macht, Gewalt und Korruption, und Hiljas Liebe zu David wird auf eine harte Probe gestellt.
Mit dem zweiten Teil der «Leibwächterin»-Trilogie spannt Leena Lehtolainen grandios den Bogen von organisiertem Verbrechen und globaler Verschwörung zur düsteren Vergangenheit ihrer Heldin.
Vita
Leena Lehtolainen, 1964 geboren, lebt und arbeitet in Degerby, westlich von Helsinki. Sie ist eine der erfolgreichsten und renommiertesten Schriftstellerinnen Finnlands. Bekannt wurde sie mit ihrer Krimireihe um die Anwältin und Kommissarin Maria Kallio. 2011 erschien bei Kindler «Die Leibwächterin», der Auftakt zur Thriller-Trilogie um die Personenschützerin Hilja Ilveskero.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel «Oikeuden Jalopeura» bei Tammi Publishers, Helsinki.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2013
Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH , Reinbek bei Hamburg «Oikeuden Jalopeura» Copyright © 2011 by Leena Lehtolainen
Redaktion lüra – Klemt & Mues GbR
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-30921-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Mapi, Vale und Niki
1
In der Toskana gibt es keine Luchse. Dafür kann man in den Hügeln der südlichen Toskana noch Wildkatzen antreffen. Doch als ich in meinem grauen Mietwagen von Florenz nach Südwesten fuhr, sah ich keine anderen Tiere außer Schwalben und Tauben, deren Gurren bis ins Wageninnere zu hören war.
Montemassi war schon von weitem zu sehen. Die Festung erhob sich auf einem Hügel, etwa dreihundert Meter über dem Meeresspiegel. Sie sah tatsächlich so abweisend aus wie auf dem Fresko von Simone Martini, auf dem Guidoriccio in das Dorf einreitet. Der schmale, hohe Turm auf der Nordseite fehlte allerdings, und im mittleren Teil waren Dach und Wände eingestürzt. Als die zum Festungsdorf führende Straße steiler wurde, schaltete ich in den zweiten Gang hinunter. Ich war zum ersten Mal in Italien, aber während meiner Ausbildung in New York war ich oft genug durch Little Italy gestreift, um ein wenig Küchenitalienisch aufzuschnappen, das ich mir nun ins Gedächtnis rief. Mein italienischer Mitschüler an der Sicherheitsakademie Queens hatte mir außerdem einige nützliche Schimpfwörter beigebracht.
Ich hatte David seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen. Zuletzt hatten wir uns im Spätsommer in Kiel getroffen, wohin er von Spanien aus gesegelt war. Außer mir wussten zwei Vertrauensleute Davids bei Europol, dass er die Explosion auf der Ostsee überlebt hatte. Dieses Wissen teilten zudem Kriminalhauptmeister Teppo Laitio von der finnischen Zentralkripo sowie einige finnische Politiker, für die David nur ein Name war. Doch irgendwer hatte die Information weitergegeben, sodass Davids früheres Versteck in der Nähe von Sevilla zu unsicher geworden war. Er hatte es aufgeben müssen.
David wusste damals nicht, wer hinter ihm her war, aber wir merkten beide, dass wir observiert wurden. Wir waren darin geübt, Menschen zu beobachten, Maskeraden zu durchschauen, zu merken, wenn ein Gegenstand am falschen Platz lag. Zudem hatte derjenige, der David nachspürte, es darauf angelegt, sich bemerkbar zu machen. Auf den Pfaden, die zu Davids Hütte führten, erschienen über Nacht frische Spuren, und das Küchenfenster wurde eingeschlagen, während wir einen Spaziergang machten. David bekam seltsame Anrufe, obwohl er seine Telefonnummer ständig wechselte. Der Verfolger wollte David Angst einjagen und ihn dazu bringen, sein Versteck zu verlassen.
Wir hatten uns heftig gestritten, als David mich gebeten hatte, nach Finnland zurückzukehren. Natürlich musste ich noch einmal hin, um meine Angelegenheiten zu ordnen, doch ich hatte vorgehabt, anschließend wieder nach Spanien zu reisen. Meine Ersparnisse waren aufgebraucht, aber ich hatte ein paar kleine Besitztümer, die ich zu Geld machen konnte. Da ich meine Stelle bei der Sicherheitskontrolle Hals über Kopf gekündigt hatte, konnte ich kein Arbeitslosengeld erwarten, zumal ich monatelang in Südspanien gefaulenzt hatte, statt dem Arbeitsamt zur Verfügung zu stehen. Als ich schließlich doch wieder nach Finnland gezogen war, hatte ich zum Glück meinen alten Job zurückbekommen. Bei der Sicherheitskontrolle herrschte ständig Personalmangel.
Die gemeinsame Woche in Kiel war nur ein kurzes Intermezzo gewesen, danach wurde die Sehnsucht nur noch unerträglicher. Ich hasste es, dass meine Stimmung davon abhing, ob sich David meldete. Er tat es unregelmäßig, seine E-Mail-Accounts und Telefonnummern wechselten häufig, und manchmal ließ er wochenlang nichts von sich hören. Mein Verstand riet mir immer wieder, diesen Mann zu vergessen. Doch mein Herz war dazu noch nicht bereit.
Nun hatte David endlich einen besseren Unterschlupf gefunden und wagte es, mich zu sich zu rufen. Im Süden der Toskana gab es viele Ausländer, da fiel ein einzelner Schwede nicht auf. Derzeit reiste David mit einem schwedischen Pass auf den italienisch-schwedischen Namen Daniel Lanotte. Der Familienname gefiel mir ausnehmend gut, doch der Vorname erschien mir verräterisch, denn er war auch in Wirklichkeit Davids zweiter Taufname. Er tat meine Bedenken mit den Worten ab, es gebe viele Daniels auf der Welt und momentan bringe man den Namen überall mit dem schwedischen Königshaus in Verbindung.
Ich wusste, dass David so tollkühn gewesen war, von Kiel aus zu seiner Familie nach Tartu zu reisen, und später hatte er mir SMS aus vielen Ländern geschickt, aus Polen, Frankreich, Süddeutschland. Er hatte versucht, seine Verfolger abzuschütteln, und glaubte nun, es sei ihm endlich gelungen. Wer seine Feinde waren, hatte er mir nicht verraten. Je weniger ich wisse, desto besser sei ich geschützt, meinte er.
Das Dorf Montemassi hatte er zufällig entdeckt. Ich wusste nicht, wo er Bruder Gianni, einen Mönch des nahegelegenen Klosters Sant’Antimo, kennengelernt hatte, aber mit seiner Hilfe hatte er eine Wohnung im Dorf gefunden, gleich bei der Festung. Alle vier Wohnungen in dem Haus waren leer. Sie standen schon seit einiger Zeit zum Verkauf; die Rezession wirkte sich auch in der Toskana auf das Immobiliengeschäft aus. Bruder Gianni kannte den Makler und hatte ihn überredet, die Wohnung an David zu vermieten.
«Im Kloster konnte ich nicht bleiben», erklärte David. «Dort gibt es zu viele Besucher, und außerdem ist es als Asyl zu offensichtlich. Ich werde einen Halbschweden spielen, der durch irgendwelche Börsengeschäfte zu Geld gekommen ist, von einer Schriftstellerkarriere träumt und aus dem Schneematsch in seiner Heimat in die Wärme Italiens flieht.»
Obwohl David mich vorgewarnt hatte, sein Äußeres habe sich seit unserer kurzen Begegnung in einem Kieler Hafenhotel verändert, hätte ich den Mann, der sich an die Mauer auf dem Dorfplatz von Montemassi lehnte, fast nicht erkannt. Seine Körpergröße konnte David natürlich nicht verbergen. Er hatte während seiner Genesung einen Teil seiner Muskelmasse verloren, aber so krumm hatte ich ihn nie zuvor gesehen. Die veränderte Haltung ließ ihn um Jahre älter wirken. In dem dichten schwarzen Lockenschopf erkannte ich die Perücke, mit der er mich einmal im Foyer des Hotels Torni in Helsinki abgeholt hatte. Auch der schmale Schnauzer und der kleine, lächerliche Spitzbart waren pechschwarz. Der dunkelblaue Pullover und die graue Jeans schlotterten an ihm, und zu meiner Verwunderung waren auch seine Handrücken schwarz behaart. Eine Sonnenbrille verdeckte die Augen.
Dennoch wusste ich, dass der zwei Meter große, magere Fremde David war. Ich parkte am Rand des Platzes, stieg aus und reckte mich. Meine Haare hatte ich wachsen lassen, sodass ich sie zu Rattenschwänzchen binden konnte, aber ansonsten sah ich so aus wie immer. Das geblümte Kleid, in dem ich mich fremd fühlte, passte zu einer Touristin, die in den toskanischen Frühling reist und hofft, dass die Aprilsonne bereits wärmt. Mit gespielter Neugier betrachtete ich die hässliche moderne Bronzestatue, die in dieser Umgebung fehl am Platz schien, dann studierte ich den Stadtplan.
Ich war mit meinem eigenen Pass eingereist. Warum hätte ich mir gefälschte Papiere besorgen sollen? Schließlich war ich eine fern von allen offiziellen Organisationen tätige Sicherheitskraft im Dienst der Airpro AG. Früher hatte ich als Leibwächterin für Privatpersonen gearbeitet, doch diese Tätigkeit hatte ich aufgegeben, nachdem eine meiner Auftraggeberinnen unmittelbar nach meiner Kündigung ermordet und die nächste trotz meiner Vorkehrungen entführt worden war. Die Schichtarbeit, bei der ich schlimmstenfalls mit Wutanfällen wichtigtuerischer Passagiere rechnen musste, war genau das Richtige für mich. Wenn ich mich nach Gefahr sehnte, brauchte ich mich nur an David zu halten.
«Buongiorno, signora.» Davids Stimme klang vertraut. Er trat zu mir und sprach weiter Italienisch, was ich nur bruchstückhaft verstand. Ich fragte, ob er Englisch könne. Er bejahte und wechselte die Sprache. Wir hatten vereinbart, dass wir vorgeben würden, uns nicht zu kennen, aber sofort Interesse aneinander zu finden. Die finnische Touristin würde den Ortsansässigen bitten, ihr die Festung zu zeigen, und was dann folgte, wäre wie aus einem romantischen Schmöker oder einem kitschigen Film: Liebe auf den ersten Blick, unter dem blauen Himmel der Toskana. Falls diejenigen, die David auf den Fersen waren, sich über mich informiert hatten, wussten sie, dass ich es mit der Keuschheit nicht allzu genau nahm. Wenn ich Lust hatte, mit jemandem ins Bett zu gehen, tat ich es. Mitunter tat ich es auch dann, wenn ich keine Lust hatte.
Wir wussten natürlich, dass uns auch die sorgfältigste Maskerade nicht lange schützen würde, sofern man mich beobachtet hatte, um David auf die Spur zu kommen. Dennoch hatte ich nicht gezögert, das Risiko auf mich zu nehmen, denn David zog mich unwiderstehlich an, und ich wäre ihm überallhin gefolgt.
David benutzte ein neues Rasierwasser, das den Eigengeruch seiner Haut jedoch nicht überdeckte. Er fragte, woher ich käme, und ich antwortete wie eine harmlose Touristin. Wir machten uns an den Aufstieg zur Festung. Auf der Terrasse eines Hauses mit blauer Tür döste eine schwarze Katze, ein Traktor brummte irgendwo auf einem Acker. Es war früher Nachmittag, und das Dorf wirkte wie ausgestorben.
Die Festung Montemassi hatte nur noch zwei Türme. Die Ruinen der dazwischenliegenden Wohnquartiere waren von Pflanzen überwuchert: ein Baum, etwa so groß wie ich, der an eine Malve erinnerte, seltsame Kleeblüten, Klatschmohn und irgendein Lippenblütler, dessen dunkles Purpurrot Onkel Jari begeistert hätte. Mein Onkel hatte ein Faible für Blumen gehabt, obwohl er das vermutlich für unmännlich hielt. Ich hatte die Namen und die Klassifizierung der Pflanzen wie nebenbei gelernt. Jede Art von Wissen konnte nützlich, womöglich sogar lebensrettend sein. In der Grundschule hatten einige Jungen aus meiner Klasse mich dazu überreden wollen, Seidelbastbeeren zu essen, doch ich wusste damals bereits, dass die giftig waren. Ich hatte die Jungen nicht bei der Lehrerin verpetzt, aber eine Zeitlang hatte ich einige Beeren in einem zusammengebundenen Taschentuch mit mir herumgetragen und mir ausgemalt, wie ich sie den Bösewichten unter den Brei mischen würde.
Von der Festung hatte man freien Blick in alle Himmelsrichtungen. Im Süden breitete sich eine Ebene aus, die bis ans Meer reichte. Unten im Dorf regte sich immer noch nichts, nur ein Mischlingshund lief mit einem Fleischbrocken über die Straße.
Es kam mir seltsam vor, mit David Englisch zu sprechen, doch es war das Klügste. Früher war Schwedisch unsere gemeinsame Sprache gewesen, und erst als David vermisst wurde, hatte ich erfahren, dass er auch ein wenig Finnisch konnte. Das war eine der vielen Einzelheiten, die er mir trotz allem verheimlicht hatte. Spanisch hatte er mühelos gelernt, und nun schien er sich auch im Italienischen zurechtzufinden. Vielleicht waren vielseitige Sprachkenntnisse für David eine Art Lebensversicherung in einer Welt, die ihn immer wieder vor Überraschungen stellte.
Wir taten, als würden wir gerade erst Bekanntschaft schließen. Ich berichtete so wahrheitsgemäß über mich, wie ich konnte: Ich wohnte in Helsinki bei einer älteren Dame zur Untermiete und arbeitete bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Helsinki-Vantaa. Ich war ledig und hatte weder Kinder noch Haustiere. David wiederum zeichnete im Gespräch die Person, die er gerade verkörperte: den Sohn eines italienischen Vaters und einer schwedischen Mutter, der bisher hauptsächlich in Schweden gelebt, sich jetzt aber, nachdem ihm eine kleine Erbschaft zugefallen war, in die Toskana zurückgezogen hatte, um einen Roman zu schreiben, wovon er seit langem träumte. Dies erwähnte Daniel Lanotte ein wenig verlegen.
«Das ist ein ziemliches Klischee, nicht wahr? Als wäre es hier leichter zu schreiben als in Sollentuna oder Småland. Aber landschaftlich ist es hier wirklich schön. Möchtest du die Aussicht aus meinem Arbeitszimmer einmal sehen? Ich könnte dir auch eine Tasse Kaffee anbieten oder einen Espresso.»
Die klassische Anmache. Italiano schleppt blonde Touristin ab. Ich willigte ein. Davids Wohnung lag einige Meter unterhalb der Festung und bot tatsächlich eine beeindruckende Aussicht, die obendrein nützlich war, denn so hatte David den von Süden und Osten kommenden Verkehr im Blick.
In der Wohnung sprach David Schwedisch mit mir.
«Hier drinnen dürften wir sicher sein. Ich habe die Wohnung jeden Tag überprüft und keine Abhöranlagen gefunden. Jedenfalls ist Schwedisch ungefährlicher als Englisch, weil es von viel weniger Menschen verstanden wird. Hier im Dorf habe ich es noch niemanden sprechen gehört, und auch in Roccastrada nur ein einziges Mal. Da habe ich schnell die Straßenseite gewechselt. In Sant’Antimo bin ich einmal einer Touristengruppe aus Skåne begegnet, aber die Leute wirkten harmlos. Irgendwelche Rentner.»
«Du müsstest doch wissen, dass es keine ungefährlichen Gruppen gibt. Die Rentner wären eine hervorragende Tarnung, hinter der sich ein Feind verbergen könnte. Aber wieso achtest du vor allem auf Leute, die Schwedisch sprechen? Hast du den Verdacht, dass deine Verfolger Schweden sind? Warum?»
David kam näher. Bisher hatte er mich noch nicht berührt, und ich ihn auch nicht. In Kiel waren wir übereinander hergefallen, sobald ich die Kajüte seines Segelbootes betreten hatte. Es kam mir vor, als stünde jetzt eine durchsichtige, aber dennoch unüberwindliche Mauer zwischen uns.
«Ich weiß nicht, wer mich bedroht. Deshalb kann ich dir dazu nichts sagen. Vielleicht steckt einer von Wasiljews Erbprinzen dahinter, den es fuchst, dass das SR-90-Radioisotop in die falschen Hände geraten ist, vielleicht aber auch Iwan Gezolian, der das Zeug ja an Wasiljew vermittelt hatte. Womöglich sind sie gar nicht hinter mir her, sondern hinter dem Isotop.»
David hatte mir nicht verraten, was mit dem Isotop geschehen war. Als ich zu Beginn des vorigen Winters erfahren hatte, dass er mit dem Leben davongekommen war, war alles andere unwichtig gewesen. Erst nach meiner Rückkehr aus Spanien hatte ich begonnen, darüber nachzudenken, was David mir alles verheimlichte. Ein Jahr hatte nicht ausgereicht, es herauszufinden.
«Du musst mir einfach vertrauen. Lass uns die kurze gemeinsame Zeit nicht mit fruchtlosen Grübeleien vergeuden. Hier bin ich vorläufig in Sicherheit, und du auch.» David zog mich an sich, und ich ließ es geschehen, vergaß wieder einmal Vernunft und Vorsicht, es war mir egal. Sein Bart kitzelte mich, das raue schwarze Haar fühlte sich fremd an, aber seine Berührungen waren so wie früher, seine Küsse so fordernd, wie ich sie kannte, die Wärme seiner Haut war unwiderstehlich.
Es waren heitere Tage Anfang April. Die Obstbäume blühten, überall grünte es. Die Sonne schien zeitweise so warm, dass wir in T-Shirts herumlaufen konnten, aber oben auf dem Monte Amiata lag noch genug Schnee zum Skilaufen. Wir fuhren von einem kleinen Dorf ins nächste, machten Spaziergänge über die Hügel, küssten uns in leeren Kirchen und bewunderten die modernen Skulpturen in den Kunstparks. Obwohl ich glücklich war, hatte ich die ganze Zeit über ein Gefühl der Unwirklichkeit. Als wäre ich in einen Film geraten, in dem David Regie führte und von dessen Handlung ich nur wusste, dass jederzeit eine überraschende Wendung eintreten konnte.
In der Wohnung gab es zwei verschlossene Schubladen, deren Schlüssel ich nirgendwo entdeckte, obwohl ich eifrig danach suchte, wenn ich, was selten vorkam, allein war. Ich war davon überzeugt, dass David wusste, was ich tat.
Ich war seit etwa zwei Wochen in Montemassi, als David einen Anruf erhielt. Wir saßen in der Küche beim Abendessen, als Vorspeise hatte David frisch geerntete Artischocken serviert, deren dunkelviolette Blätter unsere Teller füllten.
«Pronto!», meldete er sich auf Italienisch, wechselte dann zum Englischen über. «Ja, ich bin Daniel Lanotte. Wer ist da?» Er stand auf und ging ins Wohnzimmer. Ich hörte ihn noch einmal fragen, wer am Apparat sei. Dann brach die Verbindung offenbar ab.
«Perkele!», fluchte David auf Finnisch. In seinen Augen lag ein seltsamer Ausdruck. Ich glaubte, Furcht zu erkennen. Als das Handy erneut klingelte, meldete sich David auf Englisch: «Was soll das? Wer ist da?»
Ich stand auf und warf die Artischockenblätter in den Eimer für Bioabfall. Das als Hauptgericht vorgesehene Zitronenrisotto blubberte auf dem Herd, ich rührte darin, weil mir nichts Gescheiteres einfiel. David konnte zum Telefonieren nicht ins Freie gehen, wollte mich aber auf Distanz halten. Ich hörte, wie er ins Schlafzimmer ging und die schwere Holztür hinter sich schloss, die seine Worte dämpfte.
Verdammt, dachte ich. Aber David war kein Auftraggeber, für dessen Sicherheit ich zu sorgen hatte, sondern mein Liebhaber. Von einem Auftraggeber hätte ich verlangen können, die Gespräche mitzuhören, was sich allerdings, wie mich die Erfahrung gelehrt hatte, auch nicht immer durchsetzen ließ. Ich kostete von dem Risotto, das pikant und sahnig schmeckte, und gab ein wenig frisch gemahlenen weißen Pfeffer hinzu.
David blieb nicht lange fort.
«Wer war das?», fragte ich, als er in die Küche zurückkam.
«Mein früherer Chef bei Europol. Nichts Besonderes, nur der wöchentliche Routineanruf, zur Bestätigung, dass ich weiterhin in Sicherheit bin.»
«Warum hast du dann geflucht?»
«Weil er uns beim Essen gestört hat, cara.» David lächelte, aber nur mit den Lippen. In seinen Augen lag wieder ein unergründlicher Ausdruck, und er wich meinem Blick aus. Er nahm das Risotto vom Herd und rieb Pecorino darüber. Seine starken Hände zogen die Reibe energisch über den Käse. Killerhände, dachte ich unwillkürlich. Rasch trank ich einen Schluck Wein aus der Region, der auf die Artischocken sauer schmeckte. Wieder eine Lüge, oder jedenfalls etwas, wovon ich nichts wissen durfte. David hatte sich auch geweigert, mir von der Nacht zu erzählen, in der er die Yacht I believe in die Luft gesprengt und das SR-90-Isotop entwendet hatte.
«Das ist keine Tat, an die ich gern zurückdenke. Ich habe vier Menschen getötet und bin ganz und gar nicht stolz darauf. Damit muss ich leben.»
Das war die einzige Antwort, die ich bekommen hatte. In Spanien hatte David mir immerhin erzählt, wie er stundenlang im Wasser getrieben war und trotz des Neoprenanzugs vor Kälte geschlottert hatte. Einmal, nach einer halben Flasche Brandy, hatte er noch gesagt, die vier Toten hätten insgesamt Hunderte von Verwandten und Freunden, die um sie trauerten. Zwar hatten die vier Männer ihre Lebensweise selbst gewählt, aber für ihre Angehörigen war das gewiss kein Trost.
Nachdem wir das Risotto gegessen hatten, machten wir einen Abendspaziergang. Draußen sprachen wir wieder Englisch miteinander. Wir hatten vor, am nächsten Tag nach Siena zu fahren. David schlug vor, früh aufzustehen und Sachen zum Übernachten mitzunehmen. Da die Touristensaison gerade erst anlief, würden wir in der Stadt auch ohne Reservierung eine Unterkunft finden. David wollte mir Simone Martinis Fresko von Montemassi zeigen, das in Siena im Rathaus hing.
«Ich kenne mich in der Geschichte zu wenig aus, um beurteilen zu können, ob Guidoriccio mit der Eroberung von Montemassi eine Heldentat vollbracht hat. Vielleicht hängt das auch davon ab, wer die Geschichte schreibt», sagte er, als wir in der Festung standen und die schmale Mondsichel betrachteten, die ihren Schein ins Tal warf. Eine schwarze Katze kletterte auf der Mauer entlang, blieb stehen und maunzte, worauf sich im Nu zwei weitere Katzen zu ihr gesellten, eine gelbscheckige und eine graugestreifte. Man sah, dass sich die Tiere gut kannten. Wenn es doch bei den Menschen auch so leicht wäre: Ein Schnüffeln am Hinterteil verriet, ob der andere ein vertrauenswürdiger alter Bekannter war oder jemand, vor dem man sich hüten musste. Da fauchte die graugestreifte Katze die schwarze an, die wüst knurrte, und meine schöne Katzentheorie zerbröselte wie der Blütenstaub, der auf meine Hand geweht war.
In der Dunkelheit mussten wir uns enger aneinanderdrängen. Die Gerüche waren intensiver als bei Tag, die Umrisse wirkten schwer und wirklich. David drückte mich an die Mauer des Südturms und küsste mich, seine Hände berührten meinen Hals, sie konnten ihn leicht umspannen … Die Montemassiner hatten Herrn Lanotte mit einer blonden Touristin gesehen, also würde deren Leiche nicht ausgerechnet in der Festung liegen können. Wie kam ich überhaupt auf solche Ideen?
Als wir wieder in der Wohnung waren, meinte David, es sei Zeit, schlafen zu gehen. Doch mir ging so viel im Kopf herum, dass ich keinen Schlaf fand. Ich lag bis weit nach Mitternacht hellwach neben David und spielte sogar mit dem Gedanken, eine Schlaftablette zu nehmen, verzichtete aber darauf, denn sonst wäre ich am nächsten Morgen zu benommen gewesen, um die mit Baustellen und Umleitungen gespickte Strecke nach Siena zurückzulegen. Als ich das letzte Mal auf die Uhr sah, zeigte sie sechs Minuten nach drei.
Gegen sieben Uhr wurde ich davon wach, dass ich meine Decke weggestrampelt hatte und weiter unten am Hang ein Hahn krähte. Davids Betthälfte war leer. Ich schnupperte erwartungsvoll: Kochte er schon Espresso? Doch der einzige Geruch, der mir in die Nase stieg, was der Duft von Davids neuem Rasierwasser. Als hätte er es gerade eben im Zimmer versprüht.
Ich zog den Morgenmantel über und ging in die Küche. Der Espressokocher war nicht benutzt worden, er fühlte sich kühl an. War David auf der Toilette, oder war er vielleicht in den kleinen Dorfladen gegangen, um frisches Brot zu kaufen? Meine Lider waren so schwer, dass ich die Augen kaum aufhalten konnte. Ich kühlte sie mit Wasser aus dem Hahn in der Küche. Auf der Toilette war niemand.
David hatte kein Auto, nur einen Scooter, mit dem er gelegentlich nach Roccastrada oder Paganico fuhr. Da der Scooter vor dem Haus stand, konnte sein Besitzer nicht weit fort sein. Ich ging ins Schlafzimmer. Davids Kleider hingen im Schrank. Doch die Jeans und das blaue Hemd, die Socken und die Unterhose, die er am Abend ausgezogen und über den Stuhl gelegt hatte, waren nirgends zu sehen. Auch seine braunen Lederschuhe und die Jacke waren verschwunden.
Wahrscheinlich holte David nur Brot.
Als er um acht Uhr noch nicht zurückgekommen war, rief ich ihn an. Jemand antwortete sofort auf Italienisch, ich verstand genug, um zu erkennen, dass es sich um eine automatische Ansage handelte. «Der gewünschte Teilnehmer ist derzeit nicht erreichbar.» In der Wohnung hörte ich Davids Handy nicht klingeln.
Ich saß den ganzen Morgen wartend im Haus und rief alle zehn Minuten bei David an, immer wieder vergeblich. Einmal ging ich kurz nach draußen und vergewisserte mich, dass mein Wagen noch an seinem Platz stand. Die schwarze Katze aus der Festung hockte auf der Motorhaube, und ich war mir ganz sicher, dass sie gesehen hatte, wie David wegging.
Als die Kirchenglocke zwölf Uhr schlug, wurde mir allmählich klar, dass etwas oberfaul war. Würde David überhaupt noch zurückkommen? Er hatte mir kein Vertrauen geschenkt, deshalb pfiff ich auf seine Privatsphäre. Ich wollte sofort darangehen, die verschlossenen Schubladen aufzubrechen.
2
Die massive Kommode war aus altem Holz, vielleicht aus Mahagoni. Die beiden unteren der vier Schubladen waren nicht verschlossen. Da ich sie ein paarmal mit frischer Wäsche aufgefüllt hatte, wusste ich, dass in der einen Socken, in der anderen Unterhosen lagen. Ich zog sie auf und stellte auf den ersten Blick fest, dass David höchstens einen Satz zum Wechseln mitgenommen hatte. Die Socken mit dem Luchsmuster, der Fanartikel einer Eishockeymannschaft, lagen an ihrem Platz. Ich hatte sie nicht wegen der Mannschaft gekauft, sondern wegen des Raubkatzenmotivs.
Für die altmodischen Schlösser an den beiden oberen Schubladen hätte man einen knapp zehn Zentimeter langen Schlüssel gebraucht. Ich versuchte sie mit den Fingern zu erkunden, doch nur ein Stück meines kleinen Fingers passte hinein. Also holte ich aus der Küche einen schmalen Löffel und steckte den Griff ins Schlüsselloch, wo ich ihn eine Weile lang hin und her drehte, bis ich zu der Überzeugung kam, dass das Schloss vermutlich nur zwei Einkerbungen hatte. Ein paarmal hatte ich mich schon flüchtig nach dem Schlüssel umgesehen, wenn David nicht in der Wohnung gewesen war. Nun war es Zeit für eine systematische Suche. Allerdings bestand die Möglichkeit, dass David ihn mitgenommen hatte. Natürlich würde ich die Schubladen notfalls auch ohne Schlüssel aufbekommen, immerhin waren Axt und Säge bereits erfunden. Nur um das schöne Holz tat es mir leid.
Ich untersuchte Davids Kleiderschränke, klopfte alle Taschen ab und schüttelte die Schuhe aus. In Davids Manteltasche fand ich eine unbenutzte Patrone von einem Jagdgewehr und eine Restaurantquittung. Eine Woche vor meiner Ankunft hatte David im Il tre cantoni in Paganico luxuriös gespeist: der Quittung zufolge ein Menü mit fünf Gängen. Er hatte Gesellschaft gehabt, denn auf der Rechnung standen jeweils zwei Portionen Antipasti, Primi und Secondi, zudem waren anderthalb Karaffen Wein und fünf Portionen Kaffee oder Likör getrunken worden. Bei den Antipasti musste es sich um eine besondere Delikatesse handeln, denn sie waren teurer als die Hauptgerichte. Obwohl David groß und kräftig war, hätte er kaum allein so viel in sich hineinstopfen können. Er hatte mir nichts von dem Abendessen erzählt und mich auch nicht in dieses Restaurant geführt. Vielleicht war sein Vermieter vorbeigekommen, um den Zustand der Wohnung zu begutachten, und David hatte ihn zum Essen eingeladen. Doch diese Erklärung schien mir nicht überzeugend.
In der Küche gab es wenig Geschirr, nur die Grundausstattung für vier Personen. Ich spähte in den Spargeltopf und in die Käsereibe. Kein Schlüssel. Ich selbst hatte den Schlüssel zu meinem Waffenschrank oft in einem Müslipaket oder zwischen den Slipeinlagen versteckt, wo ich sie in Sicherheit wähnte. In der Annahme, dass David nach einer ähnlichen Logik handelte, untersuchte ich die wenigen Lebensmittelpackungen in den Küchenschränken. Weder zwischen den Tagliatelle noch in der Espressopackung wurde ich fündig. Ich setzte mich an den Küchentisch und versuchte mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ich den Schlüssel nicht finden würde. Natürlich hatte David ihn mitgenommen.
David hatte immer schon genau darauf geachtet, dass die Gegenstände in seinem jeweiligen Quartier nicht zu viel über ihn verrieten. Kleider, Körperpflegeprodukte und Rasierer waren neben zwei Büchern die einzigen persönlichen Habseligkeiten, und sie hätten jedem x-Beliebigen gehören können. Gerade deshalb weckten die verschlossenen Schubladen meine Neugier, doch gleichzeitig hatte ich den Verdacht, dass ich darin nichts Besonderes finden würde. David konnte doch wohl nicht so dumm sein, etwas wirklich Wichtiges in Schubladen zu verstauen, die man mit ganz normalem Werkzeug zu öffnen vermochte? Ich ging wieder zu der Kommode und rückte sie von der Wand, drehte sie ein Stück, sodass ich auch die Rückseite sehen konnte. Dann zog ich die beiden unverschlossenen Schubladen ganz heraus, damit die Kommode leichter wurde. Ich rüttelte an ihr, um zu hören, welche Geräusche der Inhalt machte, und um zu spüren, wie er sich bewegte. In der unteren Lade lag ein kleiner Gegenstand, der mit metallischem Klang gegen das Holz stieß. Für eine Feuerwaffe schien er mir nicht schwer genug, eher hörte er sich nach einem Messer an. Aus der oberen Lade war nur ein schabendes Geräusch zu hören. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen.
Ich untersuchte die Rückseite der Kommode. Mein verstorbener Onkel Jari, bei dem ich von meinem vierten Lebensjahr bis zum Abitur gelebt hatte, war von Beruf Zimmermann gewesen und hatte auch selbst Möbel gebaut. Er hatte mir beigebracht, mit Tischlerwerkzeug umzugehen. Der Fugenstreifen an der Rückwand der Kommode war gut gearbeitet, mit den Jahren jedoch ein wenig brüchig geworden. Würde ich die Fuge mit einem flachen Messer öffnen können, sodass ich an den Inhalt herankam? Wahrscheinlich. Möglicherweise würde es mir auch gelingen, die Teile anschließend mit Holzleim zu verbinden, aber das Ergebnis würde wohl kaum so perfekt ausfallen, dass mein Eingriff unentdeckt bliebe. Aber immer noch besser, als die Kommode mit der Axt zu zerschlagen.
Ich suchte im Haus vergeblich nach einem passenden Messer. Also blieb mir nur das kleine Dolchmesser, das ich immer bei mir hatte. Ich versuchte es damit, doch die Klinge war zu kurz und am oberen Ende zu dick. Eine dünne Feile wäre das Beste gewesen. Der kleine Werkzeugkasten in meinem Mietwagen enthielt nur einen Schraubenzieher und einen Wagenheber. Das nächste Eisenwarengeschäft war vermutlich in Roccastrada, und ich hatte keine Ahnung von den hiesigen Öffnungszeiten. Ich fummelte noch eine Weile lang mit meinem Dolchmesser herum, bis ich plötzlich merkte, wie hungrig ich war. Es war mittlerweile fünf Uhr am Nachmittag, und ich hatte seit dem Frühstück nichts gegessen. Im Kühlschrank lagen nur eine Tomate, ein Stück Käse und ein paar Apfelsinen. Wegen des geplanten Ausflugs nach Siena hatten wir die Vorräte nicht aufgestockt. Ich aß zwei Apfelsinen und stellte mich dann unter die Dusche. Mit dem Auto konnte ich das Trüffelrestaurant in einer halben Stunde erreichen. Vielleicht würde ich dort erfahren, mit wem David gespeist hatte.
Ich zog eine schwarze Jeans, eine schwarz-grau gestreifte Tunika und Tennisschuhe an. Außer Mascara legte ich keine Schminke auf. Ich wollte den Eindruck erwecken, ich hätte keine Zeit gehabt, mich großartig zurechtzumachen. Im Restaurant würde ich eine Frau spielen, die an ihrer Attraktivität zweifelt, denn ich stellte mir vor, dass gerade solche Frauen verzweifelt einer Urlaubsbekanntschaft nachspüren würden.
Der Wohnungsschlüssel steckte von innen. Ich zog dem blauen Löwen auf der Tür eine Grimasse, als ich abschloss. Dieser Schlüssel passte jedenfalls nicht auf die Kommode. Wenn ich ihn mitnahm, kam David nicht ins Haus, denn es gab nur ein Exemplar. Am Hang blühten Schwertlilien, das Laub der Apfelbäume raschelte, und in der Festung gurrten Tauben. Sie schienen mich zu verspotten.
Die Straße von Montemassi nach Paganico schlängelte sich den steilen Hügel hinab in die Ebene, ich fuhr mit Motorbremsung. Die Blätter an den Bäumen hatten ihre volle Größe noch nicht erreicht, ihre Farbskala reichte von zartem zu tiefem Grün. Die Weinstöcke an den Hügeln brachten neue Triebe hervor, und an sonnigen Stellen blühten die ersten Rosen. Ich überquerte den kleinen Fluss auf einer Brücke, die so niedrig war, dass man sich bei Hochwasser in Acht nehmen musste, wich bald darauf zwei Hühnern und dann einer trächtigen Hündin aus, die gemächlich über die Straße dackelte. In jedem Haus gab es Tiere, mindestens einen Hund und zwei Katzen sowie Hühner und einen Hahn, damit man täglich frische Eier hatte. Onkel Jari hatte auch einmal drei Hühner und einen Hahn angeschafft, aber unser Hühnerstall war offenbar schlecht gebaut. Zuerst verschwand ein Huhn, dann der Hahn. Unser Nachbar Matti Hakkarainen wusste zu berichten, dass ein Fuchs die Gegend unsicher machte. Ohne Hahn hörten die verbliebenen Hühner bald auf, Eier zu legen, und schließlich wurden sie draußen vor dem Haus in der großen Grillpfanne gebraten, in der mein Onkel im Sommer fast alle Mahlzeiten zubereitete. Er hatte schon damals biologisch-dynamische Nahrungsmittel aus dem Umland favorisiert, lange bevor daraus ein Trend wurde. In puncto Küchenphilosophie hätte sich Onkel Jari gut mit meiner Freundin, der Starköchin Monika von Hertzen, verstanden, doch er hatte keine Gelegenheit mehr gehabt, sie kennenzulernen. Auch von Monika hatte ich seit einer Ewigkeit nichts mehr gehört, denn die Verbindungen in den Dschungel von Mosambik, wo sie eine Armenküche betrieb, waren miserabel.
Ich fuhr an der Dorfmauer von Paganico entlang nach Osten und fand das Restaurant mühelos. Es war erst kurz nach sieben, für toskanische Verhältnisse zu früh für ein Abendessen, doch der Hunger plagte mich inzwischen dermaßen, dass ich es vorzog, wie eine unverständige Touristin zu handeln, statt zu warten. Ich parkte und ging in das Restaurant, das noch völlig leer war. An den rund zwanzig Tischen fanden etwa hundert Gäste Platz. Das Lokal war leicht zu überwachen, denn der Raum war übersichtlich, es gab keine Logen oder versteckten Nischen. Aus alter Gewohnheit setzte ich mich an einen Tisch, von dem aus ich den ganzen Raum überblicken konnte. Der Kellner eilte sofort mit der Speisekarte herbei. Trüffel, die Spezialität des Restaurants, hatte ich noch nie gegessen, aber ich mochte ja Pilze. Auch die Preise waren erträglich. Nachdem ich die Speisekarte eine Weile lang studiert hatte, stellte ich fest, dass es sich bei der teuren Vorspeise, die David bestellt hatte, um eine Kombination aus fünf verschiedenen Trüffelgerichten handelte. Irgendwann würde ich mich bei dem freundlich wirkenden Kellner, der ungefähr in meinem Alter sein musste, nach David erkundigen, doch zuvor wollte ich mindestens eine Vorspeise essen. Ich bestellte Trüffelcarpaccio, Trüffelpasta und als Hauptgericht ein klassisches Florentiner Steak. Fleisch war genau das, was ich brauchte, es würde mir Kraft geben und mir vielleicht trotz Davids Abwesenheit einen ruhigen Schlaf bescheren. Vom Rotwein bestellte ich nur eine Viertelkaraffe, weil ich noch fahren musste.
Mir war klar, dass ich einen erbärmlichen Eindruck machte, als ich mein Handy neben den Platzteller legte. Sicher hielt mich der Kellner für eine Touristin mit unerhört schlechten Manieren. Essen war hier heilig – wenn man bei Tisch saß, telefonierte man nicht. Ich schaltete das Handy auf stumm. Falls ein Anruf kam, würde ich das Aufleuchten des Displays sehen. Der Rotwein, der mir serviert wurde, war vermutlich ganz ordentlich – ich verstand nicht viel von Wein. In meiner Zeit als Aufpasserin im Chez Monique hatte Monika versucht, mich in die Geheimnisse des Weingenusses einzuweihen, aber bald frustriert aufgegeben. Meiner Meinung nach schmeckte ein Rotwein für sechs Euro genauso wie einer, für den man sechzig Euro hinblättern musste, und es wollte mir beim besten Willen nicht gelingen, zwischen Sekt und Champagner zu unterscheiden. Wenn nötig, war ich allerdings fähig, so zu tun, als ob.
Als die Vorspeise aufgetragen wurde, vergaß ich das Handy. Die weißen Trüffeln dufteten meterweit. Vorsichtig probierte ich von dem Pilz und dem rohen Fleisch. Monikas Lehren saßen immer noch so tief, dass ich es schaffte, langsam und mit Genuss zu essen, statt die Portion hinunterzuschlingen.
Als ich beim letzten Bissen der Vorspeise angelangt war, kündigte die Klingel über der Tür neue Gäste an. Eine junge Familie kam herein, drei Kinder, alle unter zehn. Mit dem friedlichen Nachtmahl war es nun wohl vorbei. Die Familie setzte sich an einen Nachbartisch. In Finnland hätte sie natürlich einen Tisch am anderen Ende des Raums gewählt, damit die Kinder die fremde Frau nicht störten. Ich versuchte zu erlauschen, was für die Kinder bestellt wurde. Würstchen mit Kartoffelbrei gab es hier wohl nicht.
Die Trüffelpasta-Portion war riesig, und glücklich machte ich mich darüber her. Das fröhliche Geplapper der Kinder empfand ich plötzlich als angenehme Hintergrundmusik. Der Kellner schien die Familie zu kennen. Es wäre ein Glücksfall für mich, wenn die meisten Gäste Stammkunden waren, denn dann würde sich das Personal umso eher an David und seine Begleitung erinnern. Mit zwei Metern Körpergröße war David eine beeindruckende Erscheinung. Ich bemühte mich, nicht darüber nachzudenken, wie hinreißend die Frau gewesen sein mochte, mit der er hier gespeist hatte. Die Quittung aus Davids Manteltasche hatte ich mitgenommen, vielleicht würde sie dem Kellner helfen, sich zu erinnern.
Weitere Gäste kamen herein, zwei Frauen jenseits der fünfzig, mit einem mittelgroßen, honigfarbenen Hund. Auch Monika hätte in ihrem Restaurant gern Hunde zugelassen, doch das Amt für Lebensmittelüberwachung war dagegen gewesen. Die Frauen nahmen ebenfalls in meiner Nähe Platz; sie sprachen Italienisch miteinander. Der Hund rollte sich zu ihren Füßen zusammen. Die eine Frau war klein und grauhaarig und strahlte Kraft aus, aus den Augen der anderen strahlte jugendliche Neugier. Ich verschlang meine Pasta und überlegte, ob ich den Kellner auf David ansprechen sollte, wenn er den Teller abräumte. Wie viel Englisch verstanden die anderen Gäste?
Als sich der Kellner meinem Tisch näherte, stand der Hund auf, reckte sich und kam vorsichtig zu mir herüber. Ich streckte ihm die Hand hin. Er war kein Luchs, aber er schien Charakter zu haben. Der Hund schnupperte an meinen Schuhen und ließ sich hinter den Ohren kraulen. Sein Fell war seidiger als ein Luchspelz.
«Bei Fuß, Nikuzza», sagte die größere Frau auf Finnisch. Vor Überraschung schnappte ich nach Luft, dann wandte ich rasch den Blick von der Frau ab und versuchte meine Reaktion zu überspielen. Konnte es ein Zufall sein, dass ich hier in dieser gottverlassenen Gegend einer Finnin begegnete? War diese Frau womöglich Davids Begleiterin gewesen? Wenn ja, wer war sie?
Der Kellner machte eine Bemerkung über den Hund, die den beiden Frauen einen Redeschwall entlockte. Offenbar waren Hunde in den Innenräumen nicht willkommen. Die größere Frau stand auf und rief dem Tier einen Befehl zu, diesmal auf Italienisch. Hatte ich mir nur eingebildet, Finnisch gehört zu haben? Sie ging mit dem Hund hinaus. Der Kellner trat an meinen Tisch, um mir Wasser nachzuschenken, und lächelte unbefangen. Sollte ich es wagen, ihm meine Frage zu stellen, obwohl am Nebentisch möglicherweise Finninnen saßen? Während meiner zweijährigen Ausbildung an der Sicherheitsakademie Queens in New York hatte mein Englisch den schlimmsten savokarelischen Akzent verloren. Aber wenn man genauer hinhörte, nahm man immer noch einen finnischen Beiklang wahr. In den italienischen Worten der Hundebesitzerin hatte ich zwar keinen Akzent festgestellt, aber Italienisch war nicht meine stärkste Sprache.
Ich versuchte mich zu erinnern, wie unser Lehrer Mike Virtue, der Gründer und Leiter der Sicherheitsakademie Queens, gesprochen hatte. Ein amerikanischer Akzent verriet nichts über die Nationalität des Sprechers, viele schnappten ihn durch Popsongs und unsynchronisierte Filme auf. Als ich mein Steak bekam, zog ich Davids Rechnung aus der Tasche und fragte den Kellner, ob er sich an einen zwei Meter großen Mann mit schwarzen Haaren und schwarzem Bart erinnerte, der vor etwa zwei Wochen hier gegessen hatte.
Die Miene des Kellners war vielsagend: wieder eine dieser Eifersuchtsgeschichten. Es tue ihm leid, Signora, aber an dem fraglichen Abend habe er nicht im Restaurant gearbeitet. Luigi habe Dienst gehabt, außerdem achte er nicht auf Männer, er erinnere sich nur an entzückende Frauen wie mich. Ich überlegte, ob ich ihm Geld zustecken sollte. Würden zwanzig Euro genügen? Doch dann zog ich es vor, mich meinem Steak zu widmen. Ich glaubte nicht, dass dieser Luigi überhaupt existierte, denn Restaurants dieser Art waren Familienbetriebe, wo Vater und Mutter in der Küche arbeiteten und der Nachwuchs für die Bedienung zuständig war. Allerdings konnte Luigi natürlich der Bruder des Kellners sein.
Mein Handy flackerte, ich hatte eine SMS bekommen. Nicht von David, sondern von meiner ehemaligen Mitbewohnerin Riikka, die mich bat, mir den ersten Samstag im September freizuhalten, weil sie dann heiraten würde. Ein altes Lied ging mir durch den Kopf: «Mein Begräbnis, deine Hochzeit». Ich war in meinem ganzen Leben erst einmal auf einer Hochzeit gewesen, als Leibwächterin, aber Beerdigungen hatte ich umso öfter miterlebt.
Die Frauen am Nebentisch aßen ihre Pasta. Ich überlegte, ob ich ihnen den Knochen von meinem Steak für den Hund anbieten sollte, wagte aber nicht, die beiden anzusprechen, aus Furcht, sie könnten mich als Finnin erkennen. Der Kellner fragte, ob ich Kaffee wolle, doch ich lehnte ab und bat um die Rechnung. Mein Hunger war schon nach der Pasta gestillt gewesen. Ich zahlte und legte ein bescheidenes Trinkgeld auf den Tisch, dann ging ich hinaus in den dunklen Abend. Es hatte angefangen zu nieseln, der Wind spielte mit dem Saum meines offenen Mantels. Als ich den Wagen aufschloss, hörte ich hinter mir einen Ruf.
«Signora, warten Sie! Luigi hat gerade angerufen.» Der Kellner war mir nachgeeilt und stand unter dem kleinen Terrassendach im Schutz der Zypressen. «Luigi erinnert sich an den Mann mit dem schwarzen Bart. Oder eher an seinen Begleiter. Das war kein netter Mensch. Er war sicher Russe oder so etwas, denn seine Sprache klang russisch, und am Hals trug er das Kreuz der Griechisch-Katholischen.» Der Kellner zuckte verächtlich mit den Schultern. «Er konnte keine andere Sprache, nicht einmal Englisch, aber das Wort für Trüffel kannte er, wollte tartufo, tartufo. Er hat sich die fünf kleinen Antipasti nicht auf der Zunge zergehen lassen, sondern hinuntergeschlungen. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen, Ihr Mann war nicht mit einer schönen Frau hier, sondern mit einem ungehobelten Russen.»
Im Halbdunkel konnte ich das Lächeln des Kellners gerade noch erkennen. Er schüttelte den Kopf, als ich nach dem Portemonnaie griff.
«Ich will kein Geld. Und Luigi auch nicht», fügte er hastig hinzu. «Wir möchten nur, dass die Signora lächelt.»
Ich zwang eine Art Lächeln auf meine Lippen, obwohl es nicht unbedingt erfreulich war, dass David mit einem widerwärtigen Russen im Il tre cantoni gespeist hatte. Dann fragte ich: «War dieser Russe auch zu meinem Mann unfreundlich? Wie standen sie zueinander?»
«An dem Abend herrschte Hochbetrieb, deshalb hatte Luigi kaum Zeit, sie zu beobachten. Viele Tische waren besetzt, anders als heute. Gelacht haben sie jedenfalls nicht. Sie haben diese zischelnde Sprache gesprochen. Ich erinnere mich … das heißt, Luigi erinnert sich, dass Ihr Mann mehrmals njet, njet gesagt hat. Das Wort verstehen auch hier alle.»
Ich bedankte mich, und der Kellner sagte, er würde sich freuen, wenn ich einmal wiederkäme. Dann eilte er zurück an seine Arbeit. Der honigfarbene Hund saß bellend in einem dunkelblauen Ford. Der Nieselregen hatte meine Haare angefeuchtet und drang in die Stoffschuhe ein. Die Autofenster waren beschlagen. Was hatte den Kellner zum Umdenken bewogen? War die Geschichte, die er mir erzählt hatte, seine eigene Erfindung, oder hatte sie ihm jemand eingeflüstert? Ein garstiger Russe, das klang wie ein Klischee aus einem Agententhriller. War David vor diesem Mann geflohen – oder mit ihm?
Ich war in eine Welt zurückgekehrt, in der man niemandem trauen konnte. Ich hatte mir eingebildet, David sei einer der wenigen, die mich nicht hintergehen würden, doch ich hatte mich geirrt. Nun war ich allein in einem fremden Land, dessen Sprache ich kaum beherrschte. Was hatte Mike Virtue uns über die verschiedenen Zweige der italienischen Mafia erzählt? Einige von ihnen trieben mit der russischen Mafia rege Zusammenarbeit, die wohl auch auf höchster Ebene abgesegnet war, so blendend wie Berlusconi und Putin sich verstanden. David hatte mir weisgemacht, er sei in die Toskana gefahren, weil sie die richtige Kulisse für seine Rolle als Möchtegern-Schriftsteller war. Allmählich ging mir auf, dass ich die ganze Zeit nichts anderes gesehen hatte als Kulissen.
Obwohl ich von klein auf an Dunkelheit gewöhnt war, strengte es mich an, im mittlerweile heftig strömenden Regen auf unbekannten Straßen durch die Finsternis zu fahren. Ich nahm die Kurven übervorsichtig, weil ich der Bodenhaftung der Reifen an meinem alten Punto nicht restlos traute. Außer mir war kaum jemand unterwegs. Die perfekte Szenerie für einen fingierten Unfall ohne Augenzeugen.
Doch ich gelangte unversehrt nach Montemassi. Inzwischen regnete es so stark, dass ich so nahe wie möglich am Haus parkte. Als ich ausstieg, zuckte ich zusammen. Durch das Küchenfenster fiel Licht. War David zurückgekommen? Auch in meinem Innern schien plötzlich Licht anzugehen. Ich lief zur Tür, schloss sie auf und rief:
«Hallo, David! Ich bin’s. Wo warst du?»
Keine Antwort. In der Küche brannte Licht, doch sie war leer. Auf der Spüle stand kein Geschirr. Ich warf einen Blick in den Kühlschrank, dessen spärlicher Inhalt exakt an derselben Stelle lag wie vorher.
Hatte ich selbst das Licht angelassen? Nein, ich erinnerte mich ganz genau, dass ich es gar nicht eingeschaltet hatte, denn bei meiner Abfahrt war es noch hell gewesen. Erneut rief ich nach David. Ich sah auf der Toilette nach, auch dort war er nicht.
Ich ging ins Wohnzimmer. Schon bevor ich das Licht einschaltete, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Es roch nach Sekreten, nach Schweiß und Urin. Meine Nase nahm auch Pulvergeruch wahr und …
Das Blut rauschte mir im Kopf, als ich die Deckenlampe anknipste. Anfangs entdeckte ich nichts Auffälliges, denn das eine Sofa verdeckte die Sicht auf das andere, das am Fenster stand. Doch als ich näher trat, sah ich, was dort lag: ein Mann, mit dem Rücken zu mir, das Gesicht in den Kissen vergraben. In dem von schwarzen Locken bedeckten Hinterkopf klaffte ein blutiges Loch, und auf das Sofa und den Fußboden war Blut geströmt. Der Pulvergeruch hing noch in der Luft, also konnte es nicht allzu lange her sein, seit der Schuss gefallen war. Der Körper hob und senkte sich nicht, er war vollkommen reglos, und ich brauchte nicht näher heranzugehen, um zu wissen, dass der Mann auf dem Sofa tot war.
3
Nach und nach begriff ich, dass der Tote auf dem Sofa nicht David war. Er war viel kleiner, schätzungsweise eins siebzig, und schmächtig wie ein Teenager. Seine Haare waren länger als Davids und von Natur aus gelockt. Er trug eine helle Baumwollhose und einen braunen Lederblazer, aber weder Schuhe noch Strümpfe.
Ich verließ das Wohnzimmer, ängstlich darauf bedacht, keine Spuren zu hinterlassen, und ging zurück in die Küche. Unter der Spüle lagen Plastiktüten. Ich wickelte mir zwei davon als Schutz um die Füße und eine um die rechte Hand. Dann schlich ich vorsichtig zum Schlafzimmer und machte Licht. Nachdem ich mich von der Tür aus vergewissert hatte, dass dort keine weiteren Leichen lagen, betrat ich das Zimmer und spähte unter das Bett, wo ich jedoch nur eine schmale Teppichrolle entdeckte. Die Handschuhe, die ich für alle Fälle im Koffer hatte, waren praktischer als die Plastiktüte. Ich zog sie an und band mir ein Tuch über die Haare. Natürlich war die Wohnung voller Fingerabdrücke von David und mir. Soweit ich wusste, waren meine Abdrücke nirgends registriert, aber ganz sicher konnte man nie sein. Hastig packte ich meinen Koffer, denn ich vermochte die Nacht nicht in einer Wohnung zu verbringen, in der eine Leiche lag. Sobald ich weit genug von Montemassi entfernt war, würde ich meinen Fund anonym bei der Polizei melden. Zum Glück gab es in Italien noch Telefonzellen.
Meine verdammte Neugier und das Wissen, dass ich im Wohnzimmer zwei Bücher liegengelassen hatte, führten mich zurück zu der Leiche. Sie war noch warm und beweglich. Vorsichtig drehte ich den Kopf des Mannes zur Seite, obwohl ich wusste, dass ich damit Spuren verwischte und meine ohnehin prekäre Lage verschlimmerte. Aber ich musste nachsehen, ob ich den Mann kannte. Die Kugel war offenbar in seinem Gehirn stecken geblieben, denn sein Gesicht war unversehrt. Es war vollkommen ausdruckslos. Die braunen Augen standen offen, die dünnen, blutleeren Lippen und der kleine dunkle Schnurrbart wirkten wie das Werk eines untalentierten Malers, leblos und unpersönlich. Das Alter des Mannes war schwer zu schätzen, er mochte zwischen fünfundzwanzig und vierzig gewesen sein. Um den Hals hing ein kleines goldenes Kreuz, das Symbol der Lutheraner wie der Katholiken. Das Leben des Mannes hatte es nicht schützen können, aber vielleicht würde es seine Seele behüten.
Ich kannte den Mann nicht.
Behutsam bettete ich den Kopf des Toten wieder auf die Sofakissen. Zum Glück steckten meine Füße in Plastiktüten, sonst hätte sein Urin meine Schuhe getränkt. Ich zwang mich, nach einem Portemonnaie zu suchen, doch zumindest in den Hosentaschen fand ich keins. Der Mann trug weder eine Uhr noch Ringe. Er war barfuß. Auf den Zehen und Fußrücken sprossen wellige schwarze Haare.
Ich sah mich im Zimmer um, suchte nach den Schuhen des Unbekannten und nach der Mordwaffe. Warum hatte man ihm die Schuhe ausgezogen? Welche Art von Schuhen hätte dazu beitragen können, ihn zu identifizieren? Vielleicht maßgearbeitete, handgefertigte. Aufgrund der Lage der Leiche konnte ich nicht feststellen, ob ein Bein kürzer war als das andere. Falls ja, hätte er Maßschuhe mit speziellen Einlagen gebraucht.
Was ließ sich daraus schließen, dass keinerlei Kampfspuren zu sehen waren? War der Raum nach der Tat gesäubert worden, oder hatte sich der Mann ohne Gegenwehr in sein Schicksal ergeben? Auch seine Position auf dem Sofa war merkwürdig, als sei er im Schlaf überrascht worden. Die Eintrittswunde befand sich an einer Stelle, an der der Mann die Waffe auch selbst hätte aufsetzen können, wenn er einigermaßen gelenkig war. Aber ein Selbstmörder schoss sich wohl nicht ausgerechnet in den Hinterkopf, außerdem hätte die Waffe dann irgendwo liegen müssen.
Draußen vor der Küche polterte etwas. Meine Nackenhaare sträubten sich. Dann verstummte das Geräusch. Ich schlich in die Küche und blickte aus dem Fenster. Ein alter Mann, den ich schon einige Male gesehen hatte, fegte die Straße. Eine seltsame Zeit für diese Arbeit. Auf seinen Fersen folgte eine schwarz-weiß gefleckte Katze, die plötzlich den Kopf drehte und mich ansah. Ihre Augen verengten sich, und sie sprang mit einem Satz auf das Fensterbrett. Ich zog mich hastig zurück, denn ich wollte nicht, dass das Tier meine Anwesenheit verriet. Vielleicht warteten diejenigen, die den Toten in Davids Wohnung gebracht hatten, irgendwo in der Nähe auf meine Reaktion. Aber war die Leiche tatsächlich für mich ausgelegt worden, oder versuchte jemand, David einen Mord in die Schuhe zu schieben?
Oder war David selbst der Mörder? Daniel Lanotte, der die Wohnung gemietet hatte, konnte spurlos verschwinden, und nur ich kannte seine wahre Identität. Glaubte David, ich würde ihn nicht verraten? Oder lag er irgendwo, genauso leblos wie der namenlose Mann auf seinem Sofa?
Eins blieb mir noch zu tun. Ich wollte herausfinden, was David in den verschlossenen Kommodenschubladen aufbewahrte. Aber jetzt hatte ich keine Zeit mehr, mit einem Messer herumzufummeln. Ich holte ein kleines Fleischerbeil, das zur Ausstattung der Wohnung gehörte, und einen Kuhfuß aus dem Besenschrank. Obwohl es mir um das schöne Holz leidtat, spaltete ich die Deckplatte der Kommode und zwang die Hälften mit dem Kuhfuß auseinander. Das Holz knarzte wütend, und ich war mir sicher, dass der Tischler, der das Möbelstück gebaut hatte, mich vom Rand seiner Wolke aus verfluchte.
In der oberen Schublade lag ein mit rotem Lack versiegelter großer Briefumschlag. Er war aus festem, weißem Papier und unbeschriftet. Ich hob die obere Schublade an, um den Inhalt der unteren zu sehen. Was ich fand, war weder eine Schusswaffe noch ein Messer, sondern ein Fernrohr aus Messing. War es tatsächlich ein Fernrohr? Als ich hineinspähte und die bunten Glasstücke sah, begriff ich, dass es sich um ein Kaleidoskop handelte. Warum in aller Welt hatte David ein Kaleidoskop in der Schublade eingeschlossen? Waren das überhaupt Davids Sachen, oder gehörten sie dem Besitzer der Wohnung? Konnte das Kaleidoskop als Versteck dienen? In das Rohr passte alles Mögliche, Mikrofilme zum Beispiel oder Drogen.
Die Dorfuhr schlug halb elf. Wenn ich sofort losfuhr, würde ich in einem der Dörfer in der Umgebung vielleicht noch eine Unterkunft finden. Aber was sollte ich mit den Sachen tun, die ich in den Schubladen entdeckt hatte? Nach kurzem Überlegen beschloss ich, sie mitzunehmen. Die Mörder des Unbekannten hatten nicht gewusst, dass die Kommode etwas Wichtiges enthielt. Also war ich ihnen einen Schritt voraus. Ich versteckte das Kaleidoskop und den Umschlag in meinem Schmutzwäschebeutel. Dann rief ich noch einmal David an. Diesmal kam keine Ansage, der Teilnehmer sei nicht zu erreichen. Stattdessen hörte ich im Wohnzimmer ein Handy klingeln.
Ich ging hin, und als das Klingeln verstummte, rief ich erneut an. Das Geräusch schien vom Sofa zu kommen. Vorsichtig näherte ich mich der Leiche. Ich hatte nur die Gesäßtaschen des Mannes untersucht, nicht die Brusttaschen seiner Jacke. Davids Handy steckte entweder dort, oder es lag unter dem Körper.
Was um Himmels willen sollte ich tun? Mein Kopf war völlig durcheinander. Ich musste das Haus verlassen, sofort. Bei meinem eigenen Handy konnte ich die Liste der getätigten Anrufe löschen, aber was nutzte das? Das Handy, das man bei dem Toten finden würde, verzeichnete Anrufe von meinem Anschluss. Ich durfte nicht riskieren, dass es irgendwen auf meine Spur führte. Mein Herz schlug so laut, dass man es sicher bis zur Festung hörte, und meine Hände zitterten, als ich endlich wagte, die Brusttaschen des Toten abzutasten. Das Handy steckte in der Tasche über seinem Herzen. Ich nahm es heraus und schaltete es auf stumm, dann steckte ich es in meine Handtasche. Sobald ich überprüft hatte, welche Anschlüsse von dem Apparat angerufen worden waren, würde ich ihn verschwinden lassen.
Ich schloss meinen Koffer und brachte ihn an die Tür. Mit einer Verbeugung vor dem Toten nahm ich eine gelbe Tulpe aus der Vase und legte sie neben seinen Kopf. Ich wusste nicht, ob die Seele, die in diesem Körper gewohnt hatte, Freund oder Feind gewesen war. Als ich die Wohnung verließ, überlegte ich, was ich mit dem Schlüssel tun sollte. Mitnehmen? Das wäre riskant, denn er brachte mich mit der Wohnung und der Leiche in Verbindung. Schließlich warf ich ihn durch den Briefschlitz, setzte mich in den Punto und ließ vorsichtig den Motor an. Womöglich wurde ich beobachtet. Erst als ich die abschüssige Strecke außerhalb des Dorfs erreichte, wagte ich es, auf achtzig Kilometer zu beschleunigen.
Ich fuhr nach Roccastrada und weiter in östlicher Richtung. Mein Ziel war die Fernstraße nach Siena und Florenz. Ich erinnerte mich, dass David erzählt hatte, in Civitella Marittima gebe es ein gutes Restaurant mit angeschlossenem Bed & Breakfast. Hoffentlich war dort noch jemand auf. Notfalls musste ich im Punto übernachten.
Im Tal roch es nach Thymian. Die Sterne standen am Himmel wie immer, doch die Welt war aus der Bahn geraten. Ich versuchte, nicht an den Toten zu denken, sondern mich auf die Suche nach einem Nachtquartier zu konzentrieren. Es war mir auch in der Vergangenheit schon gelungen, unangenehme Dinge zu verdrängen, ich hatte es früh lernen müssen.
Die Straßen von Civitella Marittima waren steil und kurvenreich. Ich hatte keine Ahnung, wie die Herberge hieß, und entdeckte auch kein Hinweisschild. Also kehrte ich zu der Tankstelle am Dorfeingang zurück, die jedoch geschlossen war. Ich ließ den Wagen am Hügel stehen und setzte meinen Weg zu Fuß fort. Aus einer hell erleuchteten Bar drang Lärm, ein Dutzend Araber saß dort beim Kaffee. Als ich eintrat, spürte ich ihre Blicke auf mir lasten. Der Mann hinter der Theke war dem Aussehen nach ein Einheimischer. Ich fragte ihn, ob er Englisch spreche.
«Nur wenig», antwortete er verlegen.
«Bed and breakfast?» Ich legte beide Hände an das linke Ohr und neigte den Kopf. Zum Glück brauchte ich keine Schnarchgeräusche zu machen, der Mann verstand mich auch so.
«Dormire! Alessandro, Locanda nel Cassero.»