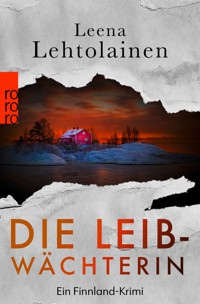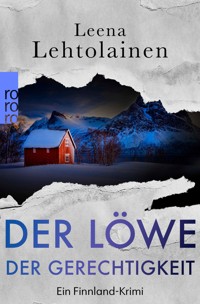9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Leibwächterin
- Sprache: Deutsch
Das Geld der alten Dame Tief im Wald liegt das verwunschene Anwesen Loberga Gård. Im Winter, wenn große Schneemassen fallen, ist das Herrenhaus gelegentlich von der Außenwelt abgeschnitten. Das Gerücht, es würde dort spuken, passt zu diesem Ort. Niemand wundert sich, als die zweiundneunzigjährige Besitzerin des Hauses, Lovisa Johnson, sich bedroht fühlt. Sie heuert Hilja Ilveskero als Bodyguard an, die ihre Berichte von angeblichen Anschlägen auf ihr Leben nicht ganz ernst nimmt. Doch als sie auf Loberga Gård eintrifft und der illustren Schar von Lovisas Erben begegnet, weiß sie, dass sie einen Job zu erledigen hat. Der vierte Fall der Leibwächterin Hilja Ilveskero entführt ins tief verschneite Finnland, das nicht so idyllisch ist, wie man denken könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Leena Lehtolainen
Schüsse im Schnee
Kriminalroman
Über dieses Buch
Das Geld der alten Dame
Tief im Wald liegt das verwunschene Anwesen Loberga Gård. Im Winter, wenn große Schneemassen fallen, ist das Herrenhaus gelegentlich von der Außenwelt abgeschnitten. Das Gerücht, es würde dort spuken, passt zu diesem Ort. Niemand wundert sich, als die zweiundneunzigjährige Besitzerin des Hauses, Lovisa Johnson, sich bedroht fühlt. Sie heuert Hilja Ilveskero als Bodyguard an, die ihre Berichte von angeblichen Anschlägen auf ihr Leben nicht ganz ernst nimmt. Doch als sie auf Loberga Gård eintrifft und der illustren Schar von Lovisas Erben begegnet, weiß sie, dass sie einen Job zu erledigen hat.
Der vierte Fall der Leibwächterin Hilja Ilveskero entführt ins tief verschneite Finnland, das nicht so idyllisch ist, wie man denken könnte.
Vita
Leena Lehtolainen, 1964 geboren, lebt und arbeitet als Kritikerin und Autorin in Degerby, westlich von Helsinki. Sie ist eine der auch international erfolgreichsten finnischen Schriftstellerinnen. 1994 erschien in Deutschland der erste Roman mit der Anwältin und Kommissarin Maria Kallio, 2012 der erste Krimi um die Personenschützerin Hilja Ilveskero. In dieser Serie sind bereits erschienen: «Die Leibwächterin», «Der Löwe der Gerechtigkeit» und «Das Nest des Teufels».
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel «Tiikerinsilmä» bei Tammi Publishers, Helsinki.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg «Tiikerinsilmä» Copyright © 2016 by Leena Lehtolainen
Redaktion Tanja Küddelsmann
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-30013-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1
Einen halben Kilometer vor Loberga Gård funktionierte das Navigationsgerät plötzlich nicht mehr. Die Karte verschwand, stattdessen erschien auf dem Bildschirm der Text, die Route sei nicht zu finden. Da ich wusste, dass die Straße am Tor des Gutshofs endete, machte ich mir keine Sorgen, obwohl auch das Handy meldete, es habe kein Netz. Ich fuhr weiter, bis der Schnee, der sich in einer Lichtung auf der Straße angesammelt hatte, den Wagen ins Rutschen brachte.
Im selben Moment zerbarst das Heckfenster. Außer Glassplittern hagelte noch etwas anderes ins Auto. Schrotkugeln.
Ich hielt an, schaltete den Warnblinker ein, zog meine Glock und stieg aus, um den Schaden zu begutachten. In der Scheibe war ein fünf Quadratzentimeter großes Loch, von dem drei Risse ausgingen. Ich holte die Werkzeugkiste aus dem Kofferraum und klebte Panzerband über das Loch und die Risse, war dabei aber ständig auf dem Sprung, mich auf den Boden zu werfen, sollten weitere Schüsse fallen. Die Scheinwerfer machten mich zu einem leichten Ziel.
«Kapierst du Arschloch, dass hier Menschen sind!», brüllte ich in den Wald, doch der Schnee und der Sturm verschluckten meine Stimme. Ich stieg wieder ein und inspizierte eine der Kugeln. Sie maß allem Anschein nach vier Millimeter. Nur mit Mühe unterdrückte ich den Impuls, Gas zu geben und möglichst schnell wegzufahren. Hatte man etwa absichtlich auf mich geschossen? Wollte mir jemand Angst einjagen, damit ich es nicht wagen würde, zum Gutshof Loberga zu fahren? Der Gedanke stachelte mich auf: So leicht ließ ich mich nicht einschüchtern. Es war nicht das erste Mal, dass ich mit einer Waffe bedroht wurde. Daran konnte und durfte man sich nicht gewöhnen. Wenn mich tatsächlich jemand loswerden wollte, noch bevor ich mein Ziel erreicht hatte, musste die Aufgabe, die mich dort erwartete, enorm wichtig sein. Im schlimmsten Fall sogar lebensgefährlich.
Ich holte ein paarmal tief Luft und ließ den Motor an. Obwohl ich langsam fuhr, erreichte ich schon nach einer Minute das Tor des Gutshofs. Es war geschlossen, aber links entdeckte ich in Höhe des Seitenfensters eine Klingel, darüber eine Überwachungskamera. Da das Autofenster zugefroren war, musste ich die Tür öffnen, um zu klingeln. Ein Wappen schmückte das Tor. Zwei gekreuzte Schwerter, darunter ein stilisierter Luchskopf. Das gleiche Wappen hatte auch auf dem Brief geprangt, mit dem ich nach Loberga eingeladen worden war. Bald nachdem ich geklingelt hatte, glitt das Tor auf. Offenbar verließ sich die Person im Haus darauf, dass ich diejenige war, die sie erwartete.
Das zweistöckige Gutshaus war in dem hellgelben Ton getüncht, wie man ihn vom Senatsplatz in Helsinki kennt, den Haupteingang rahmten Doppelsäulen ein. Ich parkte vor der Treppe und legte eine Plane über das Heckfenster. Dann stieg ich die Stufen zur Tür hinauf, fand aber keine Klingel, sondern nur einen Klopfer. Als ich nach ihm griff, merkte ich, dass die Tür offen war. Ich betrat die Eingangshalle.
«Treten Sie näher und gehen Sie durch die erste Tür in die Bibliothek. Ich komme gleich.»
Die Stimme kam vom oberen Ende der Treppe. Eine gebogene Spiegelwand ließ oben eine menschliche Gestalt erkennen, die im selben Moment verschwand. Ich folgte der Aufforderung und betrat die Bibliothek. Der Raum war halbkreisförmig, die bodenlangen Vorhänge schlossen das Schneegestöber aus, und im Kamin prasselte ein Feuer. Die mehr als drei Meter hohen Wände waren mit Büchern und Gemälden bedeckt. Auf einem Bild saß ein Kanadischer Luchs im Schnee. Sein dichtes graues Fell sah so echt aus, dass ich am liebsten die Leinwand gestreichelt hätte.
Ich hörte, wie sich hinter mir die Tür öffnete, und drehte mich um. Meine Arbeitgeberin in spe war der älteste Mensch, dem ich je begegnet war.
«Guten Tag, Frau Ilveskero.» Die Frau kam näher. Unter ihrer wächsernen Haut zeichneten sich die Gesichtsknochen ab, die Finger der Hand, die sie mir entgegenstreckte, waren dünn und knotig, ich spürte die Kälte, die sie ausstrahlten, schon bevor sie meine Hand umschlossen. Die Frau war erheblich kleiner als ich, sie maß kaum anderthalb Meter, obwohl sie hochhackige Schuhe trug. Sie hielt sich gerade, doch die Ringe saßen locker an ihren Fingern, und die Halskette aus gelb-braun gestreiften Steinen schien viel zu schwer für den zarten Körper. Unter den schütteren weißen Haaren schimmerte die Kopfhaut, und der hellrote Lippenstift konnte nicht verbergen, wie blass ihre Lippen waren.
«Sie haben sich verspätet», stellte die Frau fest.
«Ich musste anhalten, weil auf meinen Wagen geschossen wurde. Ich musste das Heckfenster flicken.»
«Geschossen? Gütiger Gott.» Das Gesicht der Frau verlor den letzten Rest an Farbe, ihre rechte Hand tastete nach der Halskette, als wollte sie sich aus den Steinen Kraft holen. «Es sollte doch niemand wissen, dass Sie zu mir kommen. Auch Dunja hat es erst vor zwei Stunden erfahren, und sie hat seitdem nicht telefoniert. Haben Sie jemandem erzählt, wohin Sie fahren?»
Ich schüttelte den Kopf. Ein nasses Rinnsal lief mir aus den Haaren in den Nacken, ich trat näher an den Kamin und überlegte, ob ich gleich wieder verschwinden sollte. Zwar gehörte es zu meinem Beruf, mich gelegentlich in Lebensgefahr zu begeben, doch ich entschied selbst, welche Risiken ich eingehen wollte. In einen Schrothagel zu geraten war kein besonders angenehmer Auftakt für ein Arbeitsverhältnis.
«Ich konnte Sie nicht über die Verspätung informieren, weil mein Handy kein Netz hatte. Das GPS hat auch nicht funktioniert. Haben Sie dieses Problem hier immer?»
Die Frau stieß einen Laut aus, der halb Schnauben, halb Lachen war.
«Wir befinden uns in einem der wenigen Funklöcher Südfinnlands. Hier gibt es kein Mobilnetz und keine Internetverbindung. Man muss auf den Felsen hinter dem Garten steigen, um zu telefonieren, wenn einem der Festnetzanschluss nicht ausreicht.»
Ich begann zu verstehen, warum ich durch einen traditionellen Brief auf das Gut eingeladen worden war. Der dicke gelblich weiße Umschlag hatte auf dem Flurteppich gelegen, darauf stand mein Name in Schönschrift. Wegen des Luchswappens auf dem Umschlag hatte ich zum Öffnen ein Papiermesser verwendet. Auf dem Kuvert hatte kein Absender gestanden.
Sehr geehrte Frau Ilveskero,
ich würde gern mit Ihnen über einen Auftrag verhandeln. Unsere gemeinsame Freundin Monika von Hertzen meint, dass Sie für die Aufgabe geeignet wären, die ich anzubieten habe, und hat mir gesagt, dass ich Sie unter ihrer Adresse erreiche. Der Auftrag setzt voraus, dass Sie auf unbestimmte Zeit ganz in meine Dienste treten. Falls Sie interessiert sind, besuchen Sie mich in meinem Haus Loberga Gård in Raasepori am elften des nächsten Monats um siebzehn Uhr. Bringen Sie die erforderlichen Unterlagen mit. Bewahren Sie Stillschweigen über meine Kontaktaufnahme.
Industrierätin Lovisa Johnson
Der Brief enthielt keine Bitte um Antwort. Offenbar war es die Industrierätin gewohnt, dass man ihrer Einladung nachkam. Der für eine Frau seltene Titel hatte mein Interesse geweckt. Zudem hatte ich seit dem letzten Sommer keine Beschäftigung in meiner Branche gefunden. Stellenangebote für Leibwächter gab es nicht beim Arbeitsamt, man erfuhr davon nur über private Kanäle. Ich hatte mich mit Monika von Hertzen in Verbindung gesetzt. Sie war eine der wenigen, denen ich vertraute, und ich wohnte derzeit in ihrer Wohnung, weil sie sich auf einer dreimonatigen Studienreise in Malaysia befand. Monika hatte mir per SMS bestätigt, dass sie Frau Johnson kannte und mich empfohlen hatte.
«Nehmen Sie doch bitte Platz.» Frau Johnson zeigte auf ein Sofa mit silbergrauem Seidenpolster, das aussah, als wäre es mindestens zweihundert Jahre alt. Sie selbst setzte sich auf einen ebenfalls silbergrau bezogenen Sessel. «Möchten Sie Kaffee oder Tee? Ich würde Ihnen auch einen Sherry anbieten, aber Sie sind ja mit dem Auto unterwegs.»
Als ich antwortete, schwarzer Tee sei mir recht, streckte Frau Johnson die Hand zum Tisch aus. Sie bewegte sich langsam, ihre Gelenke knirschten. Ein gedämpftes Klingeln war zu hören, kurz darauf wurde die Tür geöffnet.
«Gnädige Frau haben geklingelt», sagte eine Altstimme, und als ich den Kopf drehte, sah ich eine etwa vierzigjährige Frau in grauem Rock und weißer Bluse, die ihre dunklen Haare im Nacken zu einem straffen Knoten gebunden hatte.
«Dunja, würden Sie Frau Ilveskero einen schwarzen Tee bringen?» Trotz der Frageform war Johnsons Satz eine klare Anordnung. Dunja gab keine Antwort, ich sah lediglich, wie ihr Schatten aus dem Raum verschwand.
Neben dem Luchsbild hingen weitere Gemälde mit Tiermotiven an den Wänden: altertümliche Jagdszenen, Pferde und Hunde in englischem Stil, ein Schwarzspecht, der an einer toten Kiefer hämmerte.
«Mögen Sie Kunst?»
«Ich verstehe nicht viel davon», antwortete ich. Da kam Dunja zurück.
«Der Tee muss noch ein wenig ziehen, aber nicht mehr als eine Minute», sagte sie. Dann trat sie an den Servierwagen an der Wand und goss in ein Kristallglas Sherry für die Hausherrin. Dunja sprach mit leichtem Akzent, der an die Gegend des ehemaligen Jugoslawien denken ließ, vielleicht kam sie aus Slowenien oder Kroatien. Sie schürte das Feuer im Kamin, der Wind heulte im Rauchfang wie ein verletzter Vogel.
«Kommen wir zur Sache», sagte Frau Johnson, als Dunja gegangen war. «Jemand will mich töten, deshalb brauche ich eine Leibwächterin.» Lovisa Johnsons Stimme klang furchtlos. «Lange habe ich ohnehin nicht mehr zu leben, aber vorläufig bin ich noch nicht bereit zu sterben.»
Als ich nicht sofort antwortete, sah Frau Johnson mich mit scharfem Blick an. «Halten Sie mich für paranoid? Das hat zumindest anscheinend die Polizei im Ort gedacht, als ich mich nach dem Vorfall mit der Pralinenschachtel an sie gewandt habe. Aber ich phantasiere mir nichts zusammen. Mein Gehirn funktioniert einwandfrei, auch wenn ich schon zweiundneunzig bin. Ich habe alle Briefe aufbewahrt, die ich bekommen habe, und auch im Internet gibt es Morddrohungen gegen mich. Ich selbst besuche diese Seiten zwar nicht, aber meine Verwandten berichten mir darüber, selbst wenn ich davon lieber nichts hören würde.»
Ich goss mir Tee ein und nahm das Sieb aus der Kanne. Dabei merkte ich, dass meine Hände noch nicht wieder ganz ruhig waren; dennoch gelang es mir, keinen Tee auf das Tischtuch tropfen zu lassen. Ich bat Frau Johnson, mir genauer zu berichten, wie man versucht hatte, sie umzubringen.
Sie schnupperte an ihrem Sherryglas und steckte die Zungenspitze hinein wie eine Katze.
«Sie gehen aber schnell voran. Sie sind also bereit, den Auftrag anzunehmen?»
«Zuerst möchte ich hören, worum es geht.»
«Sie haben behauptet, dass auf Ihr Auto geschossen wurde, als Sie auf dem Weg hierher waren. Dennoch wirken Sie sehr gefasst. Sind Sie daran gewöhnt, dass man Ihnen nach dem Leben trachtet?»
«Sie wissen ja, dass ich ausgebildete Personenschützerin bin. In meinem Beruf muss man Risiken eingehen, um den Auftraggeber zu schützen, vor allem aber muss man Risiken im Voraus eliminieren und in jeder Situation die Ruhe bewahren.»
Frau Johnson hatte also nicht bemerkt, dass meine Hände zitterten und meine Lippen trocken waren. Furcht war der schlimmste Feind, gefährlicher als die eigentliche Bedrohung. Furcht schränkte die Beobachtungsgabe ein, denn sie hatte nur eine Botschaft: Fliehen! Ein Teil von mir warnte mich vor einem Ort, an dem man mich mit Schrotkugeln empfing, doch mein Verstand hielt die Fluchtreaktion in Schach.
«Dürfte ich Ihre Empfehlungen, Zeugnisse und sonstigen Papiere sehen?», fragte Frau Johnson. Ich holte die Mappe aus meiner Tasche und reichte sie ihr. Sie enthielt alles, was Frau Johnson wissen musste: einen Auszug aus dem Personenstandsregister, das Abschlusszeugnis der Sicherheitsakademie Queens und meine Arbeitszeugnisse. Frau Johnson vertiefte sich in die Papiere wie jemand, der Routine in der Anstellung von Arbeitskräften hat. Ich trank meinen Tee, betrachtete die Bilder an den Wänden und bemühte mich, gleichmäßig zu atmen.
Ich hatte nicht die ganze Wahrheit gesagt. Natürlich hatte ich mich erschreckt, als auf mich geschossen wurde. Eigentlich hätte ich den Vorfall der Polizei melden müssen. Dazu hatte ich allerdings keine Lust. Ich wollte so unsichtbar sein wie möglich.
«In Ihrem Lebenslauf gibt es einige Lücken.»
«Ich war zeitweise arbeitslos. Und von einer Auftraggeberin habe ich kein Arbeitszeugnis bekommen.»
«War sie so unzufrieden mit Ihnen?» Frau Johnsons Augen waren hell, der Halsschmuck spiegelte sich in ihnen und gab ihnen einen hellbraunen Schimmer. Doch ihr Blick war unnachgiebig.
«Sie kam ums Leben, kurz nachdem ich gekündigt hatte. In Moskau. Offiziell hieß es, der Schütze sei ein obdachloser Alkoholiker gewesen.»
«Und inoffiziell?»
«Ein ehemaliger Geschäftspartner wollte sich an ihr rächen. Mir tut meine überstürzte Kündigung immer noch leid, aber meine Arbeitgeberin hatte mich in eine Situation gebracht, in der ich keine andere Wahl hatte. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen, Sie verstehen sicher, dass ich an die Schweigepflicht gebunden bin.»
Frau Johnson nickte.
«Sie sind kinderlos. Haben Sie vor, eine Familie zu gründen?»
Diese Frage durfte sie eigentlich gar nicht stellen, doch es fiel mir leicht, sie zu beantworten. Ich hatte meine Entscheidung schon vor langer Zeit getroffen.
«Nein.»
Lovisa Johnson nickte. «Und das Liebesleben? Gibt es jemanden, der Ihre Bewegungsfreiheit einschränkt und dem Sie mitteilen müssen, wo Sie wann sind?»
«Wenn jemand versucht, über mein Tun und Lassen zu bestimmen, ist er die längste Zeit mein Partner gewesen. Ich bin völlig ungebunden. Meine einzige nahe Angehörige ist meine zehnjährige Halbschwester. Sie lebt mit ihrer Mutter in Savo.»
«Sie haben also einen gemeinsamen Vater?»
«Ja, aber mit ihm haben wir beide nichts zu tun. Er hat sich aus meinem Leben zurückgezogen, als ich vier war.»
Frau Johnson musterte mich prüfend, sagte aber nichts. Ihre Hände, die die Mappe hielten, waren knochig und krumm, der hellrote Perlmuttlack unterstrich den wächsernen Ton der Haut.
«Sie haben einen Waffenschein und besitzen eine Waffe», stellte sie fest. «Ihr militärischer Rang ist Fähnrich der Reserve. Ich war gegen Ende des Krieges Flakhelferin. Wir haben unser Land genauso verteidigt wie die Männer, aber darüber hat hinterher niemand gesprochen. Aber was soll’s. Sie würden also bei Bedarf sofort anfangen?»
Wieder heulte der Wind im Rauchfang, Frau Johnson schauderte, als hätte der kalte Luftzug sie getroffen. Es war, als würde sie mit aller Kraft dagegen ankämpfen, ihre Angst zu zeigen. Sie nahm die goldbraune Stola von der Stuhllehne, legte sie um ihre Schultern und sah mich prüfend an.
«Bevor ich zusagen kann, möchte ich mehr darüber wissen, warum Sie glauben, dass man Sie töten will.»
«Das erzähle ich nur jemandem, dem ich voll und ganz vertrauen kann. Monika von Hertzen sagt, Sie seien zwar eigenartig, aber ehrlich und zuverlässig. Ich hatte angenommen, Sie wären bereit, auch mit mir ein Risiko einzugehen.» Lovisa Johnson verzog die Lippen zu einem schiefen Lächeln, als hätte sie mich gerade als Feigling entlarvt.
«Das hängt natürlich vom Preis ab», antwortete ich und versuchte, auf die gleiche Weise zu lächeln.
«Jetzt fangen wir an, dieselbe Sprache zu sprechen. Viertausendfünfhundert Euro monatlich, Unterkunft und volle Verpflegung plus gesonderte Erstattung von Auslagen. Wie hört sich das an?»
Ich ließ mein Lächeln versiegen. «Zu wenig für Dienst rund um die Uhr. Fünftausend im Monat. Außerdem brauche ich einen Wagen. Der, mit dem ich gekommen bin, ist nur gemietet.»
«Ein Auto ist selbstverständlich, Sie können sich in der Garage eins aussuchen. Sagen wir also fünftausend.»
Ich suchte nach einem Grund abzulehnen, fand aber keinen. Frau Johnson hatte mich neugierig gemacht. Sie stand auf und trat an einen Nebentisch, wo die Papiere schon bereitlagen. Ich hörte das müde Knacken ihrer Knochen und erhob mich ebenfalls. Frau Johnson nahm einen altmodischen Füller zur Hand und machte Vermerke auf den Papieren.
«Jetzt fehlt nur noch Ihre Unterschrift.» Sie reichte mir den Federhalter. Er schien aus Gold zu sein. Ich las den Arbeitsvertrag, der auf schweres Papier gedruckt war, gründlich durch, bevor ich meinen vollen Namen – Hilja Kanerva Ilveskero – und meine Personenkennziffer daruntersetzte. Dann holte ich tief Luft und unterschrieb. Mit meiner Unterschrift verpflichtete ich mich, alles für Lovisa Johnson zu tun – auch für sie zu sterben.
2
«Warum will man Sie töten?», fragte ich, als wir wieder am Tisch saßen und Dunja meine Tasse mit heißem Tee aufgefüllt hatte. Mein Arbeitsverhältnis begann laut Vertrag noch am selben Tag. Morgen würde ich im Gutshaus einziehen. Dazu bräuchte ich nur meine wenigen Habseligkeiten aus Monikas Wohnung zu holen. An häufige Umzüge war ich gewöhnt, mein ganzer Besitz passte in zwei Koffer. Ich hatte aufgehört, eine Bindung an Orte zu entwickeln, denn ich wusste, dass ich sie früher oder später verlassen musste. Von einem festen Zuhause träumte ich nicht einmal.
«Ich verunsichere die Menschen. Ich hatte nie Angst davor, meine Meinung zu äußern oder nach meinem eigenen Willen zu handeln. Eine Frau kommt im Geschäftsleben nicht weit, wenn ihr wichtig ist, was die anderen von ihr denken. Man hat immer schon versucht, mich in die Schranken zu weisen, aber in letzter Zeit haben vor allem die Interviews zu meinem neunzigsten Geburtstag vor zwei Jahren und meine Kolumne in der Zeitschrift Unternehmerin für böses Blut gesorgt. Dort schreibe ich zweimal jährlich unter der Rubrik der Alterfahrenen, und die Zeitschrift erscheint auch im Internet. Ich habe die gedruckten Ausgaben hier, falls Sie sie lesen möchten.»
Lovisa Johnsons Augen funkelten resolut, aber ihre Hände umklammerten die Sessellehnen, als sollten sie ihr Kraft übertragen. Ich nickte, um sie zum Weiterreden aufzufordern.
«Das Interview zu meinem Geburtstag erschien in allen großen Tageszeitungen. Man erwartete wohl, dass ich verkünde, wie viel leichter es Frauen als Unternehmenschefs heute haben als damals nach dem Krieg, als ich die Tyyki AG gründete. Es gibt ja heute gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuung und Elternzeit und so weiter. Aber ich habe nicht die Angewohnheit, Blödsinn zu reden. Ich habe gesagt, dass zwar viel erreicht worden ist, dass es aber in den letzten zehn Jahren auch wieder Rückschritte gegeben hat. Die Möglichkeiten von Frauen werden ständig eingeschränkt. Schon darüber haben sich manche aufgeregt und mit Morddrohungen reagiert, aber der letzte Tropfen war wohl meine jüngste Kolumne. Dort habe ich erklärt, dass einige finnische Männer Asylbewerber und Migranten als Vorwand benutzen, um die Stellung der finnischen Frau im Berufsleben zu schwächen, und dass sie die Frauen behandeln wie ein Eigentum, das sie schützen müssen. Beachten Sie bitte, dass ich den Ausdruck einige finnische Männer verwendet habe, ich habe keineswegs verallgemeinert. Aber offenbar war auch das zu viel. Ich wäre eine alte Hexe und dement und so manches andere, was ich in kultivierter Gesellschaft nicht wiederholen möchte. Die Kommentare im Netz und die anonymen Briefe haben mich nicht geschockt, aber dann passierte noch mehr.»
Frau Johnson führte das Sherryglas an den Mund. Der Lippenstift hatte sich nicht in den tiefen senkrechten Falten ihrer Oberlippe abgesetzt. Morddrohungen im Internet oder die Aufforderung, sich selbst umzubringen, waren so alltäglich geworden, dass die Behörden nicht jeder einzelnen nachgehen konnten. Anonyme Briefe konnte man verbrennen und aus dem Gedächtnis verbannen, während Hassbotschaften im Netz nicht so schnell verschwanden.
«Der erste Vorfall ereignete sich kurz vor Weihnachten», begann Lovisa Johnson. «Alle meine engeren Verwandten wissen, dass ich äußerst allergisch gegen Nüsse bin, ganz besonders gegen Haselnüsse. Zum Luciatag bekam ich eine Schachtel Pralinen mit einer Karte, auf der als Absender Johannes genannt war, der Enkel meiner Schwester. Johannes ist Arzt und in jeder Hinsicht vertrauenswürdig, daher habe ich ohne weiteres eine der Pralinen ausgepackt. Leider funktioniert mein Geruchssinn nicht mehr so gut wie früher. Ich hatte kaum in die Praline gebissen, als mein Gaumen und meine Luftröhre auch schon anschwollen. Natürlich habe ich das Stück sofort ausgespuckt und es auch noch geschafft, nach Dunja zu klingeln. Sie kann mit der Adrenalinspritze umgehen. Aber mein Leben hing am seidenen Faden, es ging um Sekunden. Johannes hat kategorisch bestritten, mir die Pralinen geschickt zu haben. Sie waren im Zentrum von Helsinki aufgegeben worden. Die Marke, Godiva, gibt es nur auf Flughäfen und in Spezialgeschäften zu kaufen. Ich habe mich mit der Polizei in Verbindung gesetzt, aber was kann die schon tun. Weder am Geschenkpapier noch an der Schachtel wurden Fingerabdrücke gefunden.»
Ich notierte mir den Namen des Ermittlungsleiters, obwohl ich wusste, dass er nicht verpflichtet war, mit mir zu sprechen. Insgeheim ärgerte ich mich darüber, dass die Polizei überhaupt involviert war. Im schlimmsten Fall konnte das meine Handlungsfreiheit einschränken.
«Wie viele Menschen außerhalb Ihrer Familie wissen von der Allergie?»
«Darüber habe ich mit ziemlich vielen Leuten gesprochen. In den fünfziger Jahren waren Allergien noch recht ungewöhnlich, daher erinnern sich meine früheren Mitarbeiter womöglich daran. Natürlich ist es auch in den Restaurants, die ich besucht habe, zur Sprache gekommen. Im Prinzip kann jeder davon erfahren haben. Aber der Absender muss auch gewusst haben, dass ich einen Großneffen namens Johannes habe. Ich habe zwar im Lauf meiner Karriere viele Interviews gegeben, aber über mein Privatleben habe ich nie gesprochen. Auch in meinen Kolumnen geht es immer um allgemeine Themen.»
Lovisa Johnson musste eine der ältesten Kolumnistinnen Finnlands sein. Ich erinnerte mich nicht an die Interviews, die sie vor zwei Jahren gegeben hatte, denn damals war ich gerade in Spanien gewesen und hatte nichts anderes im Sinn gehabt als … Ich kappte den Gedanken.
«Und dann war ich zu Weihnachtseinkäufen in Helsinki. Ich bin selbst gefahren, vor Weihnachten waren die Straßen ja noch schneefrei. Ich habe meinen Wagen im Parkhaus bei Stockmann abgestellt, in der zweiten Etage. Kennen Sie es?»
Ich nickte. Parkhäuser waren Orte, an denen ich immer besonders auf der Hut war.
«Als ich zurückfuhr, rumpelte mein Wagen auf einmal so merkwürdig. An der Ausfahrt in Matinkylä fing er immer mehr zu bocken an. Es war viel Verkehr, deshalb wollte ich die Autobahn in Suomenoja verlassen. Ich hatte mich gerade auf die Spur zur Ausfahrt eingeordnet, als es laut krachte. Der rechte Vorderreifen löste sich, das Auto rutschte direkt gegen die Leitplanke, und der Reifen rollte davon.»
«Hatten sich die Schrauben gelöst?»
«Das haben sie in der Werkstatt behauptet, ja. Aber Hagelberg hatte Ende November die Winterreifen aufgezogen, und er schwor, dass er alles fest angezogen hatte, außerdem war ich danach ja noch einige hundert Kilometer mit dem Auto gefahren. Unter anderem nach Helsinki. Jemand muss die Schrauben gelöst haben, als der Wagen im Parkhaus stand.»
«War auf den Videos der Überwachungskameras etwas zu sehen?»
«Aus irgendeinem Grund war ausgerechnet die Kamera in der Nähe meines Wagens außer Betrieb. Und die Aufnahmen der anderen durfte ich mir nicht ansehen, obwohl ich vielleicht jemanden hätte erkennen können.»
Sicher hätte der Missetäter keinen Sechskant- oder Schraubenschlüssel offen in der Hand getragen, aber höchstwahrscheinlich wäre sein Treiben mitten im Weihnachtsbetrieb, im zweifellos gut gefüllten Parkhaus, dennoch nicht unbemerkt geblieben.
«Bei den letzten Vorfällen bin ich mir nicht sicher. Eigentlich möchte ich nicht glauben, dass sie etwas mit den Drohungen zu tun haben. Der erste ereignete sich am Morgen nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich verbringe den Heiligabend meist allein und lade meine Verwandten und Bekannten erst am zweiten Feiertag ein. An diesem Abend saßen wir zu zehnt am Tisch, es waren auch Kinder dabei. Raisas Sohn Anton und Johannes’ Sohn Henry spielten oben in der Halle Ball, obwohl Aurora sie gewarnt hatte, dass dabei die Spiegel zerbrechen könnten und das bedeute sieben Jahre Unglück. Ich glaube nicht an so etwas, und außerdem blieben die Spiegel heil, aber am nächsten Morgen wäre ich beinahe über den Ball gestolpert, der auf der Treppe liegengeblieben war. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Dunja überprüft jeden Abend, dass auf der Treppe nichts liegt, was da nicht hingehört, und sie schwört, dass die Treppe abends um zehn Uhr frei war. Aber am Morgen lag der Ball da.»
Frau Johnsons Stimme bebte, die Erschütterung war noch nicht vergessen.
«Vielleicht hat einer der beiden Jungen ihn dort liegenlassen.»
«Das ist es ja gerade. Die Kinder sind mit Raisas Mann zurück in die Stadt gefahren. Nur meine direkten Verwandten sind über Nacht geblieben. Natürlich kann man Erklärungen finden, aber ich werde den Gedanken nicht los, dass es keine Vergesslichkeit, sondern Absicht war. Und das ist nicht alles. Ich habe die Angewohnheit, mehrmals wöchentlich im Teich hinter dem Haus in einem Eisloch zu schwimmen. An einer Stelle ist die Strömung so stark, dass der Teich dort erst zufriert, wenn es sehr lange kalt ist. Um Weihnachten herum hatte es noch nicht geschneit, sodass ich zum Teich gehen konnte, ohne dass mir jemand den Weg frei schaufeln musste. Am Rand des Eislochs liegt ein Polster, auf das ich mich setze, um dann ins Wasser zu gleiten. Dort ist auch eine Leiter befestigt, über die ich heraussteigen kann. Aber an dem Morgen war die Leiter nicht da. Als ich ins Wasser glitt, war es mir nicht aufgefallen. Dann bekam ich Angst … Gut, dass ich mich mit den Armen auf den Rand der Eisfläche hochstemmen konnte. Mein Herz schlug, als wollte es mir aus der Brust springen, und ich war sicher, ich werde ohnmächtig und erfriere. Es kann natürlich sein, dass die Strömung und das mehrfache Frieren und Tauen die Leiter vom Eis gelöst haben. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit.»
Lovisa Johnson nahm ihre goldrandige Brille ab, die ihr an einer Kette um den Hals hing. Sie zog ein Spitzentuch aus dem Ärmel und tupfte sich über die Augen.
«Wie Sie wohl gemerkt haben, kommt man nicht ohne Einladung durch das Tor von Loberga. Das bedeutet, dass für diese Anschläge jemand aus meinem engsten Verwandtenkreis verantwortlich wäre.»
«Haben Sie die Polizei benachrichtigt?»
«Die wollte ich damit nicht belästigen. Lieber handle ich selbständig. Vielleicht ist es auch besser, wenn der Schuldige nicht weiß, dass ich auf der Hut bin.» Johnson fingerte an ihrer Halskette und bat mich, ihr noch ein wenig Sherry nachzuschenken. Ich goss ihr einen Fingerbreit ins Glas.
«Wer profitiert von Ihrem Tod?»
«Ich war nie verheiratet und habe keine Kinder. Meine nächsten Angehörigen sind die Enkelkinder meiner verstorbenen Schwester Olivia. Es sind vier, Johannes, Aurora, Raisa und Sampo. Meine Nichte Ritva starb, als Johannes sechs Jahre alt war, und auch ihr Mann ist schon seit mehr als zehn Jahren tot. Die Eltern von Aurora, Raisa und Sampo sind 2005 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Olivias Mann Martti Railo war Kriegsveteran und hat sich in den sechziger Jahren zu Tode getrunken. Mein Neffe …»
Ich hob die Hand, um Frau Johnsons Redefluss zu unterbrechen. Außer Johannes gab es also noch weitere Erben. Am nächsten Tag würde ich als Erstes die Sicherheitsvorkehrungen am Haus überprüfen. Ich fragte Frau Johnson nach dem Grundriss und den Alarm- und Überwachungsanlagen. Sie führte mich in ihr Arbeitszimmer, das sich hinter der Bibliothek befand und im gleichen Stil eingerichtet war. Der Schreibtisch und der Stuhl mit hoher Lehne waren aus dunklem Holz, ebenso die abschließbaren Archivschränke. Die Schlüssel bewahrte Frau Johnson in einem Fach unter der Tischplatte auf. Wenn hier jemand herumstöbern wollte, musste er nicht einmal besonders erfahren sein, um den Schlüssel dort zu vermuten.
Das Haus hatte eine Gesamtfläche von etwa sechshundert Quadratmetern. Im Erdgeschoss gab es neben der Bibliothek und dem Arbeitszimmer einen Salon, ein Speisezimmer, Küche und Hauswirtschaftsraum, zwei Toiletten sowie eine Dienstbotenwohnung mit Bad. In der ersten Etage befanden sich ein großes Vestibül und fünf Schlafzimmer, jedes mit eigenem Bad. An Lovisa Johnsons Zimmer schloss sich außerdem ein Ankleideraum an. Es lag als einziges auf der rechten Seite des oberen Vestibüls. Die anderen Zimmer befanden sich zu beiden Seiten des Flurs, der nach Westen führte. Ich entschied mich für das nach Norden gehende Zimmer, das Lovisas Räumen am nächsten lag.
Als wir die Treppe hinaufgingen, blieb meine Arbeitgeberin kurz stehen, um nach Luft zu schnappen.
«Ich habe mir etwas überlegt. Einigen wir uns darauf, dass Sie meine Sekretärin sind. Ich will meine Memoiren schreiben, und Sie nehmen mein Diktat auf. Das ist eine gute Erklärung für Ihre Anwesenheit im Haus. Lassen wir auch Dunja in diesem Glauben, jedenfalls vorläufig.»
Mir erschien diese Fassade zwar überflüssig, doch ich stimmte zu. Johnson kannte ihre Verwandten besser als ich.
Das Vestibül im Obergeschoss war ein halbes Oval. Seine Wände waren mit Spiegeln bedeckt, die sich endlos ineinander reflektierten. In ihnen sah ich dutzendfach eine große, muskulöse Frau mit kurzen blonden Haaren und geschlechtsneutraler Kleidung: schwarze Jeans, ein schwarzer Pullover und darüber eine graue Steppweste.
«Die Spiegelwände wurden beim Bau des Gutshauses 1817 angebracht. Der Bauherr Bertel Frimodig, der Urgroßvater mütterlicherseits meines Vaters, war offenbar ein eitler Mann. Aurora hat mich immer wieder gebeten, die Spiegel zu entfernen, weil sie angeblich darin Verstorbene sieht. An so etwas glaube ich nicht, außer einmal im Jahr, aber für Dunja ist es natürlich viel Arbeit, sie blank zu putzen.»
Lovisa Johnsons Schlafzimmer war so groß wie eine Zweizimmerwohnung. Es hatte einen Balkon, der an der südlichen Hauptfassade des Hauses lag und durch das ausladende Dach geschützt war. Hinter den Hoflampen war nur dichter, verschneiter Wald zu sehen. Das Schneegestöber kam von Nordost, der Südbalkon war ziemlich gut geschützt. Mit einer sechs Meter langen Leiter hätte man allerdings auf den Balkon klettern können, zudem hatten die Fenster altertümliche Verschlüsse.
«Ich habe nachts oft Schmerzen in den Beinen, und dann ist es das Beste, aufzustehen und im Vestibül auf und ab zu gehen. Meine Verwandten wissen das. Irgendwer hat sich anscheinend überlegt, dass die alte Frau dabei doch leicht einen Unfall haben könnte. Wenn ich es nicht gerade noch geschafft hätte, mich am Geländer festzuhalten, wäre ich kopfüber die Treppe hinuntergestürzt und hätte mir vielleicht das Genick gebrochen. Johannes hat meinen Schrei gehört und ist mir zu Hilfe geeilt. Ich habe ihm gesagt, ich wäre über meine eigenen Füße gestolpert.»
«Wo ist der Ball jetzt?»
Frau Johnson öffnete die Tür zum Ankleidezimmer und zeigte auf den Boden. Das Corpus Delicti war ein gelb-weißer Futsal-Ball.
«Ich fahre jetzt los, um meine Sachen zu holen, und komme morgen früh zurück. Lassen Sie in der Zwischenzeit niemanden ins Haus, nicht einmal Ihre Verwandten.»
«Bei diesem Wetter wird wohl niemand kommen.» Lovisa Johnson lachte auf, wirkte aber nicht amüsiert.
«Sie sollten das Tor und die Haustür nicht einfach so öffnen wie bei meiner Ankunft.»
Frau Johnsons Miene verriet, dass ihr mein Ratschlag nicht gefiel. «Ich wusste doch, dass Sie es sind.»
«Woher? Es hätte doch jeder behaupten können, Hilja Ilveskero zu sein. Haben Sie etwa ein Foto von mir gesehen?» Diese Möglichkeit beunruhigte mich. Ich hatte so gut wie möglich dafür gesorgt, dass über Suchmaschinen keine Bilder von mir zu finden waren.
Jetzt war Frau Johnsons Lachen echt. «Nein, aber Ihr Gang hat mir Gewissheit gegeben. Monika hatte ihn mir genau beschrieben.»
«Was denn für ein Gang?»
«Locker, aber wachsam, wie ein Tier, das auf dem Sprung ist, die Flucht zu ergreifen oder seiner Beute nachzusetzen, je nachdem. Kommen Sie morgen mit dem Zug nach Karjaa und nehmen Sie dort ein Taxi. Möchten Sie Ihr Zimmer noch sehen, bevor Sie aufbrechen?»
«Nicht nötig. Bekomme ich Handtücher und Bettwäsche gestellt?»
An eine solche Kleinigkeit hatte meine neue Arbeitgeberin offenbar überhaupt nicht gedacht, das war Dunjas Sache. Meine Aufgabe wiederum würde es sein, den Hintergrund der Hausgehilfin möglichst bald abzuklären. Lovisa Johnson schien Dunja zu vertrauen und hatte sie nicht zu denen gezählt, die von ihrem Tod profitierten, doch eine Haushälterin hatte die besten Möglichkeiten, einen Unfall zu arrangieren.
Obwohl ich die Heizung im Auto voll aufdrehte, war es anfangs eiskalt. An der Stelle, wo auf meinen Wagen geschossen worden war, hielt ich an. Durch das Fenster konnte ich erkennen, dass die Reifenabdrücke inzwischen vom Schnee zugedeckt waren. Konnte ich es wagen auszusteigen, oder hatte der Schütze auf meine Rückkehr gewartet? Die Hasenjagd war im Gang, und in Raasepori waren angeblich auch Wolfsrudel unterwegs, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand in der abendlichen Dunkelheit und bei Schneefall auf der Jagd war. Da ich meine Kindheit auf dem Land verbracht hatte, wusste ich, dass die wenigsten Jäger unnötige Risiken eingingen. Dennoch gab es gelegentlich Fehlschüsse. Lovisa Johnson schien es jedoch für möglich zu halten, dass man mit Absicht auf mich geschossen hatte.
Ich fuhr weiter, ohne auszusteigen, denn falls es im Wald Spuren gegeben hatte, waren sie inzwischen zugeschneit. Bis nach Karjaa fuhr ich aufmerksamer als sonst und blieb von Überraschungen verschont. Auf der Hankoer Landstraße dachte ich darüber nach, worauf ich mich eingelassen hatte. Lovisa Johnson war womöglich dement oder hatte Alzheimer und litt deshalb unter Verfolgungswahn. Für ein paar Stunden konnte jeder vortäuschen, geistig auf der Höhe zu sein.
Bei der Autovermietung behauptete ich, das Rückfenster sei von einem Stein beschädigt worden, und sagte zu, den Teil der Kosten zu übernehmen, den die Versicherung nicht abdeckte. Die Angestellte notierte den Schaden. Sie schien nichts von Waffen zu verstehen, sodass meine Erklärung durchging.
Der Gedanke an einen Ort, wo es keine Handy- und Internetverbindung gab, faszinierte mich. Dort wäre ich genau das, was ich sein wollte: unsichtbar. Ich hatte beinahe die Hoffnung aufgegeben, dass so etwas in der modernen Welt noch möglich war.
Mit der letzten Straßenbahn fuhr ich nach Ruoholahti. Ich goss Monikas Blumen und schrieb ihr eine Mail, in der ich ihr von meinem neuen Job berichtete. Monikas Restaurant Sans Nom war im Januar geschlossen, aber jemand vom Personal würde sich wohl um die Pflanzen kümmern können. Ich spürte keine Wehmut, als ich zum letzten Mal auf dem Diwan im Wohnzimmer einschlief. Ortswechsel hatte ich immer erfrischend gefunden.
Das Schneetreiben blockierte die Weichen und führte zu Verspätungen, sodass ich erst nach elf Uhr mit dem Zug in Karjaa ankam. Am Bahnhof waren keine Taxis zu sehen, doch als ich gerade die Nummer der Taxizentrale eintippte, fuhr ein grauer Mercedes mit Aufklebern der örtlichen Handballmannschaft vor. Der Fahrer war kahlköpfig und mager und stank nach Zigaretten. Am Rückspiegel hing ein Lufterfrischer in den Farben des schwedischsprachigen Teils von Uusimaa. Als ich mein Ziel nannte, setzte der Mann eine abweisende Miene auf.
«Der Weg nach Loberga ist mühsam, und auf dem Rückweg kann ich garantiert auch niemanden fahren.»
Das war ja nicht mein Problem, doch ich schluckte eine patzige Antwort hinunter. Der Fahrer seufzte und fuhr los. Auf dem Weg zur Brücke beschleunigte er heftig, musste aber gleich wieder bremsen, denn ein Betrunkener rutschte auf die Fahrbahn und stürzte direkt vor dem Wagen auf die Straße. Der Fahrer hupte nur und stieg nicht aus, um nachzusehen, was dem Mann passiert war.
«Es ist das achte Weltwunder, dass Jomppa Järvinen noch lebt», maulte er mehr zu sich selbst als zu mir. Ich wollte schon die Tür öffnen, als der Betrunkene aufstand, sich mit einer Hand auf die Motorhaube stützte und mit der anderen dem Fahrer den Mittelfinger zeigte. Dann tänzelte er mit schwankenden Schritten über die Straße und holte aus der Brusttasche eine Flasche hervor, die den Purzelbaum anscheinend heil überstanden hatte.
Der Fahrer schnaubte und gab wieder Gas. Als sein Handy klingelte, meldete er sich auf Schwedisch. Ich ließ die Worte an mir vorbeirauschen, spitzte aber die Ohren, als er Loberga Gård erwähnte. Er erklärte seinem Gesprächspartner, er sei auf dem Weg zu «der komischen Alten». Es war interessant zu hören, welchen Ruf Lovisa Johnson in ihrer Gegend hatte. 1950 hatte sie ihr Studium an der schwedischsprachigen Handelshochschule abgeschlossen und bald darauf in der Zeit des Aufschwungs eine Textilfabrik gegründet. Die Tyyki AG hatte sich auf Haushaltstextilien spezialisiert, die sowohl nach Schweden als auch in die Sowjetunion exportiert wurden. Kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der schweren Rezession in den neunziger Jahren hatte Frau Johnson ihre Firma an das Unternehmen Finlayson verkauft. Da der Betrieb seine Tätigkeit vor Beginn der Internet-Ära eingestellt hatte, fanden sich dort nur spärliche Informationen. Aus den Bildern schloss ich, dass die Küchenhandtücher mit Luchsmuster, die wir in meiner Kindheit in Hevonpersiinsaari verwendet hatten, bei der Tyyki AG hergestellt worden waren.
Als der Taxifahrer sein Telefonat beendet hatte, beschloss er, freundlich zu werden, und fragte, was mich nach Loberga Gård führte. Ich testete die Sekretärinnengeschichte an ihm, mit Erfolg.
«Die alte Dame hat bestimmt genug Erinnerungen, ist sie nicht schon fast hundert? Mein Opa hat erzählt, dass sich im Krieg alle möglichen Leute auf dem Gut herumgetrieben haben, mal angeblich russische Spione, mal Offiziere, die vor den Russen Waffen versteckt haben. Ich weiß nicht, was davon wahr ist. In dem Haus war man immer sehr verschwiegen. Die Tyyki AG hat ja früher viele Frauen aus der Gegend beschäftigt, und manche Männer waren sauer, weil ihre Frauen mehr verdienten als sie selbst. Trotzdem hat sich die Firma rentiert, Frau Johnson war immer eine der größten Steuerzahlerinnen in Karjaa. Aber Karjaa gibt es ja nicht mehr, wir sind jetzt bloß noch ein Teil von Raasepori …» Der Taxifahrer begann mich über die Winkelzüge der Kommunalpolitik aufzuklären. Ich ließ ihn reden. Man wusste nie, welche kleinen lokalen Informationen nützlich sein konnten. Als wir auf die Straße zum Gutshof abbogen, fragte ich wie nebenbei:
«In den großen Wäldern hier gibt es doch bestimmt reichlich Elche und Rehe. Haben die Leute hier viele Abschussgenehmigungen bekommen?»
«Gehen Sie auch zur Jagd?»
«In den letzten Jahren kaum noch, aber da, wo ich herkomme, habe ich früher Elche und Enten gejagt.»
Daraus schloss der Taxifahrer, dass ich wohl doch ganz in Ordnung sei. Er hielt mir einen Vortrag über die großen Schäden, die die Rehe auf den Feldern anrichteten, und über die vielen Unfälle, die von Elchen verursacht wurden. Im Verhältnis zur Größe des Wildbestands habe man viel zu wenige Abschussgenehmigungen bekommen.
«Und außerdem gibt es hier Wölfe. Die Leute trauen sich nicht, ihre Kinder allein auf das Schultaxi warten zu lassen. Aber auf dem Grund und Boden der Dame von Loberga darf nicht gejagt werden. Sie hat es verboten. Sie sagt, sie hätte im Krieg genug Schüsse gehört. Wer weiß, wen oder was sie in ihren Wäldern beherbergt. Im Lauf der Jahre sollen dort ja alle möglichen Typen zugange gewesen sein.»
«Gibt es hier auch Luchse?»
«Nach denen ist der Gutshof ja benannt. Wissen Sie nicht, was Loberg bedeutet?»
Ich hatte schon vor längerer Zeit gelernt zu verbergen, dass ich außer Finnisch und Englisch noch andere Sprachen beherrschte. Also schüttelte ich naiv den Kopf. Ich erfuhr, welche Jagdvereine in der Gegend aktiv waren, und als wir das Gutshaus erreicht hatten, wusste ich zumindest eins: Derjenige, der gestern auf mich geschossen hatte, war nicht legal auf der Jagd gewesen. Der Taxifahrer fuhr bis vor die Tür, trug meine Koffer zur Treppe und sah sich so gründlich wie möglich um, damit er im Dorf berichten konnte, wie es im Gutshaus aussah. Zum Glück trug der eisige Wind den Sieg über seine Neugier davon.
Dunja empfing mich. Sie wollte nach meinem Gepäck greifen, doch ich sagte, ich würde es selbst tragen. Schließlich war ich einen Kopf größer und zehn Jahre jünger als sie. Die Geste machte jedoch eins klar: Dunja war der Ansicht, dass ich in der Hierarchie des Hauses über ihr stand.
Bei Tageslicht wirkte die vielfache Reflexion der Spiegel noch wilder als bei künstlicher Beleuchtung. Obwohl der Himmel bewölkt war, fiel von Süden Licht herein. Wer zu Migräne neigte, hätte möglicherweise einen Anfall bekommen.
«Hier ist das Zimmer der Dame, bitte sehr.»
Dunjas Stimme war ruhig und verriet nicht, was sie von mir hielt. Ich wusste nicht, wie man sich in ihrer Kultur anredete. So unbefangen wie in Finnland und Schweden duzte man sich in wenigen Ländern. Ich hatte immer ein Faible für das Siezen gehabt, denn es erlaubte einem, Distanz zum Gesprächspartner zu halten. Je unangenehmer mir jemand war, desto mehr Wert legte ich darauf, ihn zu siezen.
Das Zimmer lag nach Norden, doch das einzige Fenster war groß, etwa zwei Meter hoch und drei Meter breit. Von dort aus sah man die Hofgebäude, dahinter erstreckte sich eine Ackerfläche, die an einer schroff aufragenden Felswand endete. Dass musste der Loberg sein, nach dem der Gutshof benannt worden war. Im Westen, wo der Felsen und der Acker an einer Ecke aufeinandertrafen, war eine glatte Fläche, vermutlich der Teich, von dem Frau Johnson gesprochen hatte. Ob es im Haus wohl Schneeschuhe oder Skier in der passenden Größe gab? Es war ratsam, in den nächsten Tagen die Umgebung in Augenschein zu nehmen.
«Sie sagen Bescheid, wenn Sie mehr Handtücher oder etwas anderes brauchen. Die Laken werden einmal wöchentlich gewechselt, sonstige Wäsche können Sie in den Wäschekorb unten im Hauswirtschaftsraum werfen. Sind Sie gegen irgendwelche Nahrungsmittel allergisch?»
«Nein.»
«Warten Sie!» Dunja spitzte die Ohren und lief ins Vestibül. Die Tür blieb offen stehen, und in den Spiegeln erkannte ich, dass sich dem Tor ein Traktor mit einem Schneepflug näherte.
«Hagelberg», seufzte Dunja und lief nach unten, um das Tor zu öffnen. Sie hatte doch wohl am Monitor überprüft, dass am Steuer des Traktors wirklich derjenige saß, der für das Schneeräumen zuständig war?
Das schmiedeeiserne Schloss an meiner Zimmertür war altmodisch, aber solide. Ich war nicht dazu gekommen, Frau Johnson zu fragen, wie viel Geld sie in Sicherheitsanlagen investieren wollte. Eine Weile betrachtete ich den aufwirbelnden Schnee in den Spiegeln, dann ging ich in mein Zimmer zurück. Rechts von der Tür standen zwei altmodische, stabile Schränke. Die Säulen des Himmelbetts waren aus dem gleichen dunklen Holz, die Bettdecke und der Himmel aus blau-weiß gestreiftem Seidensatin. Das gleiche Material fand sich auch an dem Sessel in der rechten Fensterecke. Die andere Ecke bot Platz für Schreibtisch und Stuhl. Das Mobiliar schien so alt zu sein wie das Haus selbst, fast zweihundert Jahre. Ich strich über den Tisch und nahm den schwachen Geruch eines Poliermittels wahr. Wie in einem Luxushotel, das seinen Gästen die Atmosphäre des ausgehenden 19. Jahrhunderts bieten wollte.
Ich wollte gerade einen Blick in mein Badezimmer werfen, als das Rattern des Schneepflugs verstummte und das Brummen eines anderen Fahrzeugs hörbar wurde. In den Spiegeln sah ich blaues Metall. Vor dem Tor stand ein himmelblauer VW Beetle, ein neues Modell. Fordernd ertönte die Hupe. Das Tor öffnete sich wieder, und der Schneepflug wich aus, als der Wagen auf das Grundstück fuhr. Dunja kannte die Ankömmlinge also. Ich blieb im Vestibül stehen, denn ich wollte die Besucher direkt und nicht nur im Spiegel sehen. An der Fahrerseite stieg ein großer blonder Mann aus, er eilte um den Wagen herum und öffnete die Beifahrertür, durch die eine zweite blonde Person ausstieg. Der Wind griff nach den langen Haaren und der pastellfarbenen Kleidung der Frau, als würde er sie gleich davontragen. Noch bevor ich Lovisa Johnson sah, hörte ich durch die offene Tür ihres Arbeitszimmers ihre Stimme.
«Um Himmels willen, Aurora steht vor dem Haus! Und Sampo ist auch dabei. Was wollen die beiden hier? Dunja, sag ihnen, dass ich zu tun habe. Meine neue Sekretärin fängt heute an. Ist Frau Ilveskero schon da?»
«Sie ist vor einer Viertelstunde angekommen. Soll ich Aurora und ihren Bruder denn nicht hereinlassen?»
«Doch, es muss wohl sein, aber nur kurz. Einen schlechteren Zeitpunkt hätten sie sich nicht aussuchen können!» Lovisa Johnson erschien in der Eingangshalle. Offenbar sah sie mich in den Spiegeln, denn sie winkte mir zu.
«Sie sind also da. Kommen Sie herunter, Sie können die Kinder meines Neffen kennenlernen. Wir müssen ihnen wohl etwas anbieten, bevor wir mit der Arbeit beginnen.»
Ich ging die Treppe hinunter, und Dunja öffnete die Haustür. Die Frau kam als Erste herein und umarmte Lovisa, die nicht sonderlich begeistert von der Begrüßung wirkte.
«Liebste Tante Lovisa! Wir wollten am Todestag unserer Eltern vorbeikommen und Blumen auf ihr Grab legen. An einem solchen Tag ist die Trauer so schmerzhaft, als wäre es erst gestern geschehen.»
Lovisa Johnson wurde von den blonden Locken und den weiten, umhangartigen Ärmeln der Frau verdeckt. Darunter hätte sie eine Giftspritze oder ein Messer verbergen können. Erst als ich neben die beiden trat, ließ die Frau Lovisa los.
«Wer bist du denn?», fragte sie mit einer Stimme, die jünger klang, als es ihre äußere Erscheinung erwarten ließ. Dem Aussehen nach schätzte ich sie auf etwa vierzig. Ihre klaren blauen Augen musterten mich forschend. «Was hast du für eine trübe Aura! Dir sind sicher schreckliche Dinge zugestoßen, so verschlossen, wie du bist. Du hast als Kind einen wichtigen Menschen verloren …»
Sie wich zurück, als hätte sie Angst vor mir. Lovisa Johnsons Mundwinkel zuckten. «Was für ein Willkommensgruß», meinte sie. «Frau Hilja Ilveskero ist meine Sekretärin. Ich habe beschlossen, meine Memoiren zu schreiben. Das hier sind die Enkel meiner Schwester, Aurora und Sampo Railo.»
Ich wandte mich zu dem Mann um und musste mir alle Mühe geben, meine Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten. Wenn er sich an mich erinnerte, wäre meine vorgetäuschte Identität als Sekretärin dahin. Einige Jahre zuvor hatte ich bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen gejobbt, wo Sampo Railo damals bei der Security arbeitete. Wegen zu harten Durchgreifens hatte man ihn ein paarmal zur Rede gestellt. Ich stufte ihn als Hitzkopf ein, von dem man sich besser fernhielt. Dennoch setzte ich jetzt mein strahlendstes Lächeln auf und reichte Sampo die Hand. Als er sie ergriff, fiel mein Blick auf den silbernen Löwenanhänger an seinem Hals. Sein Händedruck war kraftlos, und wir sahen uns nicht an. Als ich zu den Spiegeln aufschaute, sah ich seine Augen. In ihnen lag ein nur notdürftig verborgener Hass.
3
«Der Weg zum Friedhof muss frei geschaufelt werden. Hagelberg denkt nicht daran, wenn man es ihm nicht extra sagt.» Lovisa Johnson sprach in kühlem, sachlichem Ton, doch ihr Körper war angespannt, und sie fingerte so heftig am Saum ihrer Bluse, dass ihre Ringe klirrten. «Kümmere dich gleich mal darum, Sampo. Seit Weihnachten war niemand mehr auf dem Friedhof, und inzwischen sind an die zwanzig Zentimeter Schnee gefallen. Bitte ihn, auch den Pfad zum Eisloch frei zu schaufeln und nachzusehen, ob der Teich zugefroren ist. Ich habe Lust, wieder einmal schwimmen zu gehen.»
Sampo folgte der Aufforderung. Aurora zog ihren obersten Umhang aus und reichte ihn Dunja. Der Filzstoff war mit Blumen und Planeten bestickt, das Kleidungsstück war ein kleines Kunstwerk. Darunter trug sie weitere Schichten bunter, flatternder Kleidung, unter denen ihre Körperformen kaum zu erkennen waren. Ihre Haare schienen teilweise künstlich verlängert zu sein, ich konnte die Nähte erkennen, als sie sich durch die Nackenhaare fuhr.
«Könnte ich eine Tasse Tee bekommen? In Sampos Auto war es eiskalt. Er ist so geizig, dass er glaubt, er würde Benzin sparen, wenn er im Wagen nicht heizt.»
«Frau Ilveskero und ich wollten gerade mit der Arbeit beginnen. Du kannst deinen Tee in der Bibliothek trinken, wir haben keine Zeit, dir Gesellschaft zu leisten. Möchte Sampo auch Tee?»
«Woher soll ich das wissen?»
«Du spürst die Bedürfnisse und Gefühle anderer Menschen doch so ungemein sensibel.» Lovisa Johnsons Miene glich der eines boshaften kleinen Mädchens.
«Ich verschwende meine Energie nicht auf Leute wie Sampo, die keine Hilfe wollen, obwohl sie sie vielleicht nötig hätten. Aber Sampo trinkt ja meistens Kaffee. Es macht Dunja doch keine Mühe, beides zu kochen?» Aurora riss ihre großen blauen Augen fragend auf. Ihre Wimperntusche war verklumpt, und in ihren Haaren war der ungefärbte Ansatz deutlich zu erkennen. Mit den Engeln und Amuletten, die sie um den Hals trug, erinnerte sie an eine New-Age-Karikatur aus einem Sketch.
«Sag Dunja, sie soll beides kochen. Ich gehe später mit euch zu den Gräbern.» Lovisa Johnson nickte mir zu, also folgte ich ihr ins Arbeitszimmer. Sie setzte sich an den Schreibtisch, ich machte es mir auf dem Sofa bequem. Frau Johnson durchstöberte einige Schubladen, bis sie ein Diktiergerät fand. Sie reichte es mir, und ich schaltete es ein, ohne jedoch zu wissen, was ich damit sollte.
«Am besten fangen wir mit dem Beginn meines Lebens an. Ich habe mir die Reihenfolge und die Gliederung schon überlegt. Geburt, Jugend im Schatten des Krieges, erfolgreiche Berufslaufbahn, dann ein abgeklärtes Ende, das eine Belehrung enthält. Jeder hat wohl im Lauf seines Lebens etwas zu bereuen. Die größte Tragödie meines Lebens war der frühe Tod meiner Schwester, dann das Ertrinken ihrer Tochter und der tödliche Autounfall ihres Sohnes.» Frau Johnson starrte mir in die Augen, ihre Mundwinkel zuckten.
«Das Leben eines Menschen kann man äußerst nichtssagend schildern, wenn man will. Welche Enthüllungen meine Verwandten wohl befürchten? Sie überlegen schon fieberhaft, warum ich gerade Sie beauftragt habe, meine Erinnerungen aufzuzeichnen. Aber eine Sekretärin ist immerhin glaubhafter als eine Gesellschafterin. Ich habe nie besonders darunter gelitten, allein zu sein oder keine Familie zu haben. Ich habe Männer zwar immer gemocht, aber keinen genug, um ihn zu heiraten. Wäre das nicht ein guter Satz für die Biographie?»
«Aurora und Sampo bekommen also den Pflichtteil an Ihrem Erbe?»
Frau Johnson schrieb etwas auf einen Zettel und hielt ihn mir hin. Man kann uns belauschen. Nahm sie an, dass ihre Verwandten über den Flur schlichen und das Ohr ans Schlüsselloch legten?
«Natürlich spielen die Enkel meiner Schwester eine wichtige Rolle in meinem Leben. Sampo arbeitet für einen Sicherheitsdienst. Er hat die Polizeischule besucht, aber keine feste Stelle bei der Polizei bekommen. Aurora ist Heilerin, also Unternehmerin, wie ich es war. Sie und ihre Schwester Raisa haben den Geschäftsfraueninstinkt der Johnsons geerbt. Aurora arbeitet allerdings, um zu helfen, nicht wegen des Geldes. Insofern ist sie ihrem Vetter Johannes ähnlich, er ist Arzt. Aurora behandelt wiederum diejenigen, denen die Schulmedizin nicht helfen kann.»
Der Schneepflug rumpelte am Fenster des Arbeitszimmers vorbei zu den Wirtschaftsgebäuden. Ich fragte, wer Hagelberg war.
«Er wohnt auf dem nächsten Bauernhof hinter dem Wald. Auf der Straße sind es fünf Kilometer bis dahin. Seine Familie ist fast so lange hier ansässig wie die Johnsons. Die Hagelbergs haben schon seit Generationen diverse Arbeiten auf Loberga übernommen. Hagelbergs Großvater machte meiner Schwester Olivia den Hof, aber der Krieg hat die Romanze beendet, wie so viele andere. Hagelberg räumt im Winter Schnee und fällt bei Bedarf Bäume, im Sommer hilft er bei der Gartenarbeit.»
Das Schneetreiben hatte aufgehört, und die Wolkendecke riss auf. Durch den Schnee würde es auch nach vier Uhr noch nicht ganz dunkel sein, der Frost würde dafür sorgen, dass die Tiere den kürzeren Weg über das Eis wählen konnten. Ein Reh oder ein Wolfsrudel konnte seine Spuren nicht vor den Jägern verbergen, daher war der Schnee für die Tiere Verbündeter und Gefahr zugleich.
«Ich habe die Grabkerzen vergessen.» Aurora kam herein, ohne anzuklopfen. Ich schaltete das Diktiergerät aus und bemühte mich, geschäftig zu wirken. «Habt ihr welche in Reserve, Tante Lovisa?»
«Frag Dunja.»
«Sie mag mich nicht. Wahrscheinlich weil ich weiß, dass sie unter ungeklärten Umständen aus Serbien geflohen ist.»
«Vor dem Krieg ist sie geflohen. Sie hat schon mit fünfzehn Jahren solche Grausamkeiten mit ansehen müssen, dass du froh sein kannst, wenn so etwas nicht in deinen Visionen auftaucht. Die Teelichter sind im mittleren Schrank im Hauswirtschaftsraum. Wollt ihr jetzt gleich zum Friedhof?»
«Sampo muss um fünf Uhr bei der Arbeit sein. Wir gehen hin, sobald Hagelberg den Weg geräumt hat.»
«Am besten kommt Frau Ilveskero auch mit. Man kann mich nicht verstehen, ohne die Geschichte der Familie Johnson zu kennen, und da bietet unser Friedhof einen Schnellkurs. Deine Mutter hat die Grabtradition unserer Familie ja nie so recht verstanden. Als hätte sie sich davor gefürchtet, aber nun liegt sie selbst hier.»
«Mutter blieb keine Zeit, sich vorzubereiten.» Aurora wischte sich über die Augen. Dann klingelte sie nach Dunja und trug ihr auf, Grabkerzen zu holen.
Unsere Gruppe glich einem kleinen Trauerzug. Sampo Railo ging voran, hinter ihm folgte Aurora, den Blick zum Himmel gerichtet. Lovisa Johnson hielt sich an meinem Arm fest. Der Gutsfriedhof lag etwa zweihundert Meter vom Haus entfernt, an der nordwestlichen Ecke des Grundstücks. Von meinem Fenster aus war er nicht zu sehen, da er hinter den Stallgebäuden verborgen war.
«Wir hatten sogar eine eigene Kapelle neben dem Friedhof, aber sie ist vor über hundert Jahren abgebrannt», erzählte Frau Johnson.
«Ja, eine Magd betete in der Kapelle und bekam einen Anfall, dabei stieß sie eine Kerze um», ergänzte Aurora. «Sie verbrannte mitsamt der Kapelle. Wenn ich hier spazieren gehe, höre ich manchmal ihre Schreie. Ich habe schon versucht, ihr dabei zu helfen, endlich Ruhe zu finden.»
Ich sah, wie Sampos Gesicht sich verhärtete. Er trug einen knielangen Lammfellmantel, auf seiner schwarzen Mütze stand Finnland. Seine Gesichtszüge waren scharf geschnitten, seine Augen schmaler als die seiner Schwester, aber ebenso tiefblau. Ich stellte fest, dass ihm die Gelassenheit eines Berufssoldaten oder Polizisten fehlte, sein Blick wanderte unstet hin und her.
Auf dem Friedhof gab es rund dreißig Grabsteine. Bei einem etwa meterhohen Stein am Zaun blieb Sampo stehen, schob den Schnee herunter und nahm die Laternen zu beiden Seiten des Grabes aus ihrer Halterung. Er steckte neue Kerzen hinein und zündete sie an. Dann nahm er die Mütze ab und senkte den Kopf. Aurora schluchzte. Ich wagte es nicht, Lovisa Johnson anzusehen, die sich an meinen Arm klammerte, sondern las stattdessen die Aufschrift auf dem Stein. Raimo Railo war bei seinem Tod siebenundfünfzig Jahre alt gewesen, seine Frau Pirjo-Riitta drei Jahre jünger.
«Ich weiß, dass ihre Seelen jetzt Frieden gefunden haben», seufzte Aurora und wischte sich die Tränen ab. «In den ersten zwei Jahren nach dem Unfall irrten sie ruhelos umher, aber jetzt ist alles gut. Sie sind Engel, sie beschützen uns und nehmen an unserem Leben teil.»
Lovisa Johnson ließ mich los und fasste ihre Großnichte am Arm. «Du schaffst es immer noch, in deinem Glauben glücklich zu sein. Ich für meinen Teil bekomme keine Botschaften aus dem Jenseits.»
«Weil du es nicht wagst, ihnen deine Seele zu öffnen!» Aurora strich mit ihrem bunten Handschuh über die Wange ihrer Großtante. «Gehen wir noch zu Omas Grab», schlug sie vor. Sampo bückte sich, um den Fichtenkranz abzuklopfen, der vor dem Grabstein lag.
«Unsere Großtante hat also eine Sekretärin eingestellt», sagte er bedächtig. «Woher der Sinneswandel? Früher war sie strikt dagegen, ihre Memoiren zu schreiben. Ist sie etwa nicht mehr gut beieinander?» Sampo verneigte sich vor dem Grab seiner Eltern und setzte die Mütze wieder auf. «Warum hat sie gerade dich als Verfasserin ausgesucht?»
«Ich schreibe nur auf, was ich diktiert bekomme. Frau Johnson ist selbst bestens in der Lage, ihre Gedanken zu strukturieren. Sie hat einen klareren Kopf als manche weitaus jüngere Person.»
«Wie lange kennst du sie schon? Ein paar Stunden lang schafft sie es, sich frisch und munter zu geben, aber dann schlägt die Müdigkeit zu. Gibt es schon einen Verlag für die Memoiren?»
«Frag sie selbst. Sie hat mich eingestellt, weil eine gemeinsame Bekannte mich empfohlen hat.» Ich machte mich auf, Frau Johnson zu folgen. Ich würde ihr erzählen müssen, dass Sampo mich womöglich wiedererkennen könnte. Auroras Stimme schallte über den Friedhof.
«Die Seele von Tante Ritva irrt immer noch heimatlos umher. Sie schwebt über dem Teich und findet keinen Frieden. Johannes sagt ja, alles, was von seiner Mutter übrig ist, ruht auf dem Friedhof von Loberga. Er glaubt nur an die Materie.»
«Es ist sicher vergebliche Liebesmüh, mit Johannes über diese Dinge zu sprechen.» Lovisa Johnsons Stimme klang überraschend sanft. Sie blieb vor einem Grabstein aus rotem Granit stehen, der genauso groß war wie sie selbst. Auch in diesen Stein war ein Wappen gemeißelt. Ich sah die Namen Olivia Railo, geb. Johnson, und Ritva Arola. Neben dem Geburts- und Todestag von Martti Railo prangte das Eichenlaubsymbol der Kriegsveteranen.
«Unter diesem Stein werde auch ich eines Tages liegen», konstatierte Frau Johnson. «Allerdings sollte man besser nicht im Winter sterben, es ist so anstrengend, die gefrorene Erde aufzugraben.»