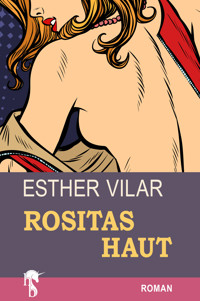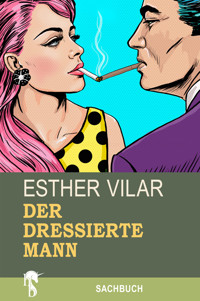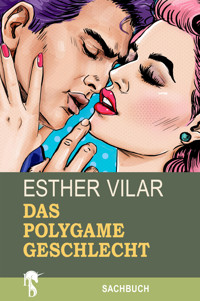
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Das polygame Geschlecht« ist ein Buch über die Liebe; ein Buch über das, was Liebe ist, was sie sein könnte und was die Frauen aus ihr gemacht haben. Im Gegensatz zu Frauen können Männer mehrere Partner gleichzeitig lieben, so Esther Vilar. Die Ursache darin liegt im opportunistischen Verhalten der Frau: Sie spielt dem Mann das schutzbedürftige Kind vor, lässt sich von ihm »adoptieren« und zwingt ihn, wenn man so will, zur Polygamie. Denn ein Mann mit einer kindlichen Frau braucht noch eine richtige Frau. Doch auch diese Geliebte will sich von ihm beschützen lassen, der Mann sucht also weiter nach einer richtigen Frau – und so nehmen die Dinge ihren Lauf … Esther Vilar knüpft an »Der dressierte Mann« an und spinnt ihre Überlegungen zu Rollen und Klischees, zu Manipulation und Versklavung im Umgang der Geschlechter miteinander weiter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Esther Vilar
Das polygame Geschlecht
Das Recht des Mannes auf zwei Frauen
Sachbuch
Dies ist ein Buch über die Liebe. Über das, was Liebe ist, was sie sein könnte, und was Frauen aus ihr gemacht haben.
E. V.
1. Gibt es zwei Lieben zwischen Mann und Frau?
Die »wahre« Liebe
Man stelle sich ein Filmdrehbuch vor, das folgende Szene enthält:
Sonne, Meer, einsamer Strand, ein Mann und eine Frau
Der Mann: Liebling, du bist so still. Was hast du?
Die Frau: Nichts.
Der Mann: Sag schon.
Die Frau: Ich weiß nicht, wie ich es dir beibringen soll.
Der Mann: Wie du mir was beibringen sollst?
(Pause)
Die Frau: Ich möchte dich verlassen.
Der Mann: Du hast einen anderen?
Die Frau: Ja.
Der Mann: Bist du sicher, dass du ihn liebst?
Die Frau: Ja.
Der Mann: Mehr als mich?
Die Frau: Ich kann ohne ihn nicht mehr leben.
Der Mann (legt den Arm um sie): Wunderbar.
Die Frau: Wie bitte?
Der Mann: Ich sage »wunderbar« – nimm ihn dir.
Die Frau: Du freust dich?
Der Mann: Weshalb sollte ich mich nicht freuen?
Die Frau: Du liebst mich also nicht mehr?
Der Mann: Im Gegenteil.
Die Frau: Du liebst mich?
Der Mann: Ich liebe dich, ich will, dass du glücklich bist. Erwartest du etwas anderes?
Spätestens an dieser Stelle greift der Produzent, der das Drehbuch gerade liest, zum Telefon und verlangt nach seinem Autor. Er fragt ihn, ob er den Verstand verloren hat: Er habe doch ausdrücklich eine Liebesszene bestellt, aber das sei doch nie im Leben eine Liebesszene. In einer echten Liebesszene müsse der Mann hier seiner Frau den Schädel einschlagen, oder wenigstens so tun. Darauf müsse er in den Wagen springen, mit heulenden Reifen davonfahren, und seinen Rivalen verprügeln.
Doch der Autor findet sich nur widerwillig zu einer Änderung bereit: Ein Mann, der seine Frau wirklich liebt, sagt er, verhalte sich so und nicht anders. Wahre Liebe sei in erster Linie selbstlos.
Würde der Produzent sich auf weitere Diskussionen einlassen, käme dabei vermutlich heraus, dass es zwischen Mann und Frau zwei verschiedene Arten von Liebe geben müsse: eine verzeihende und eine rächende, eine opferwillige und eine besitzergreifende, eine gebende und eine nehmende …
Stimmt das? Gibt es zwischen Mann und Frau zwei verschiedene Formen von Liebe, die ihrem Wesen nach entgegengesetzt sind? Oder ist nur eine die wahre Liebe und die andere die falsche?
Wie ist es möglich, dass über ein Phänomen, das so gut wie jeder erwachsene Mensch mindestens einmal erlebt hat, das mehrere Generationen von Psychoanalytikern gründlichst erforscht haben, das seit jeher das Lieblingsthema der Schriftsteller, Komponisten und anderer Künstler ist, noch immer so viele Missverständnisse bestehen?
Was ist Liebe?
Schutzobjekt und Sexpartner
Will man von der Liebe reden, muss man ganz von vorn anfangen: Dass wir leben und um uns herum Leben vorfinden, muss auf bestimmte Prinzipien zurückzuführen sein. Das heißt, wenn wir hier oder auf einem anderen Stern etwas antreffen, das lebt, dann dürfen wir voraussetzen, dass dieses Etwas Gesetzen unterworfen ist, die letzten Endes darauf hinauslaufen, aus toter Materie Leben zu produzieren. Andernfalls träfen wir es ja nicht an. Meint man mit Leben das allgemeine Prinzip Veränderung – Darwin nennt es Variation und Selektion –, so muss man den Tod, die Vernichtung mit einbeziehen, sonst wäre das Material für Veränderungen rasch verbraucht.
Ein Lebewesen müsste dann zumindest drei »Grundprinzipien des Lebens« erfüllen:
Sein eigenes Leben erhalten (Selbsterhaltung).
Sein Leben vor seinem Tod weitergeben, damit das Leben an sich erhalten bleibt (Fortpflanzung).
Das Leben jener erhalten, an die es seines weitergegeben hat, solange sie nicht selbst dazu in der Lage sind (Brutpflege).
Auch das Lebewesen Mensch ist den Prinzipien der Selbsterhaltung, Fortpflanzung und Brutpflege unterworfen –, andernfalls wäre es nicht da.
Der Selbsterhaltungstrieb ist gewissermaßen asozial, die Sorge gilt ausschließlich der eigenen Person. Fortpflanzung und Brutpflege sind dagegen soziale Mechanismen. Die Fortpflanzung zu verwirklichen – sie ist, offensichtlich mangels eigener Attraktivität, durch den Geschlechtstrieb versüßt – schaffen wir nicht allein. Auch der Brutpflegetrieb ist auf andere gerichtet.
Die anderen, die wir für unsere sozialen Triebe brauchen, sind – je nachdem, welchen unserer sozialen Triebe wir an ihnen befriedigen – Sexpartner oder Schutzobjekt.
Es liegt nahe, in diesen beiden sozialen Trieben die biologische Grundlage von Liebe zu sehen, denn ihre intensivste und dauerhafteste Verwirklichung – das Hingezogensein zu einem Geschlechtspartner oder zu seinen eigenen Kindern – ist Liebe. Wer einen Geliebten oder eine Geliebte hat, ist glücklich. Er stillt so häufig wie möglich sein Bedürfnis nach Sexualität an ihm und sagt ihm, dass er ihn oder sie liebt. Geht die Beziehung in die Brüche, sagt er, er habe »Liebeskummer«. Dieser Zustand hält so lange an, bis Ersatz gefunden ist, das heißt, »eine neue Liebe«.
Wer ein Schutzobjekt hat, beschützt es. Er riskiert sein Leben dafür, will immer nur sein Bestes und beteuert ihm seine Liebe. Verliert er es, ist er unglücklich. Er sagt, er habe nun sein Liebstes auf der Welt verloren.
Egal, wen wir meinen – Schutzobjekt oder Sexpartner –, wir gebrauchen immer wieder das gleiche Wort: Liebe. Dennoch ist das, was es bezeichnet, seinem Wesen nach grundverschieden. Ein Schutzobjekt muss – damit man es beschützen will – bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die sich mit den Voraussetzungen für einen Sexpartner nicht vertragen, und umgekehrt. Das heißt, die Eigenschaften eines anderen bestimmen die Art des biologischen Bedürfnisses, das wir an ihm befriedigen wollen. Sie bestimmen letzten Endes die Art von Liebe, die wir ihm entgegenbringen werden.
Welche Eigenschaften sind das?
Was ist ein Schutzobjekt?
Um den Beschützertrieb auf sich zu lenken, muss jemand drei Grundvoraussetzungen erfüllen: er muss körperlich dem unterlegen sein, der ihn beschützen soll, er muss ihm geistig unterlegen sein, und er muss ihm ähnlich sein.
Die Unentbehrlichkeit der beiden ersten Eigenschaften muss nicht ausdrücklich bewiesen werden: Einen körperlich und geistig Stärkeren oder Gleichstarken beschützen zu wollen, wäre sinnlos. Der Generationsunterschied ist die beste Voraussetzung für den nötigen Abstand der körperlichen und geistigen Kräfte. Daher funktioniert der Mechanismus am reibungslosesten zwischen Eltern und Kindern.
Die Notwendigkeit der Ähnlichkeit ist leicht zu beweisen. Die Liebe zum Schutzobjekt beruht auf dem denkbar einfachsten und zugleich wirksamsten Motiv: dem der Identifikation. Ich muss mich in meinem Schützling selbst erkennen, er muss mir so ähnlich sein wie nur möglich. Wenn jeder jeden beschützen wollte, nur weil er schwächer ist als er selbst, könnte es passieren, dass manche – zum Beispiel die eigenen Artgenossen – zu kurz kämen und andere bevorzugt würden. Der »Gruppenegoismus« ist gewissermaßen der einfachste, effektivste und »gerechteste« aller sozialen Mechanismen: Jeder sorgt zuerst einmal für sich und die Seinen – nur so ist es den Tieren gelungen, ohne spezielle Sozialgesetzgebung und ohne Ideologien zu überleben.
Dass der Beschützertrieb dem Ähnlichen gilt, lässt sich gerade bei Tieren besonders deutlich beobachten: Eine Tiermutter, die ein Junges geboren hat, das ihr nicht gleicht, verstößt es gnadenlos. Die Gleichheit muss sich nicht unbedingt auf das Aussehen beziehen, sie kann – von unserem menschlichen Standpunkt aus betrachtet – solch eine Nebensächlichkeit wie gleicher Geruch sein. Sie kann partiell sein – sie muss partiell sein –, aber dort, wo sie gilt, entscheidet sie über Leben oder Tod. Jedes Kind weiß, dass es ein Vögelchen, das aus dem Nest gefallen ist, nicht mit bloßen Händen dorthin zurücksetzen darf: Wegen des fremden Geruchs würde es die Mutter sofort wieder aus dem Nest werfen. Will man erreichen, dass eine Tiermutter ein verwaistes Tierkind annimmt, muss man bestimmte Betrugsmanöver anwenden, die letzten Endes immer darauf hinauslaufen, der Pflegemutter Gleichheit vorzutäuschen. Erst dann wird sie bereit sein, es zu versorgen.
Auch der Mensch versorgt seine Nachkommen nach dem Prinzip der Gleichheit. Die Mutter tut sich mit der Identifikation mit dem Neugeborenen am leichtesten: Sie hat es monatelang gespürt, es ist aus ihr herausgekommen, es ist sie. Der Vater ist dabei nur auf den Verstand angewiesen, er steht seinem Kind anfangs ziemlich gleichgültig gegenüber. Obwohl man ihm immer wieder versichert, es sei »ganz der Vater«, fällt es ihm schwer, das zu erkennen. Erst später akzeptiert er die Ähnlichkeit, er beginnt, sein Kind zu lieben.
Diese Bereitschaft zur sofortigen Identifikation, die dem Mann nicht möglich ist, bringt die Frau in den Ruf, der selbstlosere Elternteil zu sein. Da sie keinen Augenblick zögert, in ihrem Kind ihr Schutzobjekt zu sehen und deshalb ihren Brutpflegetrieb unmittelbar in Aktion umsetzt, hält man Mutterliebe für ein stärkeres Gefühl als Vaterliebe. In Wahrheit handelt es sich nur um eine kleine Zeitverschiebung im Auftreten von zwei gleich starken Gefühlen, denen ausschließlich biologische Ursachen zugrunde liegen.
Dass Väter ihre Kinder genauso lieben können wie Mütter, dass der männliche Brutpflegetrieb dem weiblichen in nichts nachsteht, ist sowohl durch den Rollentausch in einigen primitiven Kulturen als auch durch moderne soziologische Experimente hinlänglich bewiesen.
Nächstenliebe
Der Mensch ist nicht nur ein Tier, er folgt nicht nur, wie ein Tier, seinen Trieben: Er kann sie erkennen, sie bewusst machen und sich von ihnen distanzieren, er kann sie modifizieren oder verallgemeinern. Er kann zum Beispiel das Prinzip der Ähnlichkeit erweitern und sich auch in fremden hilfsbedürftigen Lebewesen erkennen. Er kann sich durch seine Vernunft bescheinigen lassen, dass Menschen anderer Hautfarbe entgegen dem stumpfen Diktat seiner Triebe gleich sind (»Schwarze sind auch Menschen«, »Weiße sind auch Menschen«), dass körperliche und geistige Krüppel den gesunden Menschen gleich sind. Diese »Humanisierung« des Brutpflegetriebs, die nur beim Menschen möglich ist, ist die Nächstenliebe. Nächstenliebe ist durch Einsicht kultivierter Brutpflegetrieb.
Nächstenliebe ist nur unvollkommen durch Triebe abgesichert. Dem Schutzobjekt fehlt die »biologische« Ähnlichkeit. Es ist daher ganz und gar nicht selbstverständlich, dass man es beschützt. Es braucht oft viel Überredungskunst, und es kostet oft beträchtliche »Selbstüberwindung«, den primitiven Gleichheitstrieb zu überlisten. Daher gilt Nächstenliebe auch als tugendhaft.
Nicht einmal in den christlichen Ländern ist es bisher gelungen, die zuerst von Jesus propagierte Rationalisierung des Brutpflegetriebes in großem Maßstab in die Praxis zu übertragen. Die Lehre Jesu, im Nächsten sich selbst zu erkennen und danach zu handeln, ersetzt eine biologisch bedingte Gleichheit durch eine intellektuelle, sie verstößt gegen die biologischen Voraussetzungen – nennt sie »böse« – ebenso wie etwa das Gleichheitsprinzip der Marxisten. Gerade wegen ihrer Unerreichbarkeit handelt es sich um »höhere« Werte: Der Wert von etwas wird durch seine Seltenheit bestimmt.
In der Regel sorgt man für unvollkommene Schutzobjekte nur gegen Bezahlung. Sie kann materieller oder ideeller Natur sein: Geld, Erbschaft, weniger Einsamkeit, gesellschaftliches Ansehen, ewiges Leben in paradiesischem Luxus.
Die häufigsten Varianten unvollkommener Schutzobjekte sind:
unähnliche körperlich Unterlegene: Kranke, Arme
unähnliche geistig Unterlegene: Geisteskranke
unähnliche körperlich und geistig Unterlegene: fremde Kinder, Frauen. – Mit der Frau als unvollkommenem Schutzobjekt des Mannes werden wir uns an anderer Stelle ausführlich befassen.
Noch eine Variante von Schutzobjekten soll hier erwähnt sein, die, würde sie nicht einer nichtmenschlichen Art angehören, vollkommen wäre: Psychologen sind davon überzeugt, dass Hunde nach dem Indentifikationsprinzip, das heißt, nach ihrer Ähnlichkeit mit ihrem Halter, ausgesucht werden. Hunde, besonders die der kleinen Rassen, genießen daher nicht selten den Status eigener Kinder.
Was ist ein Sexpartner?
Die Voraussetzungen für die Eignung zum Schutzobjekt, wurde gesagt, seien größtmögliche Ähnlichkeit mit dem Beschützer bei größtmöglicher körperlicher und geistiger Unterlegenheit – wobei Letztere am besten durch den Generationsunterschied gegeben ist. Die Voraussetzungen für die Eignung zum Sexpartner sind genau umgekehrt. Sie bestehen in größtmöglicher – jedoch polarer– Gegensätzlichkeit der Partner in allem, was von ihnen als geschlechtsspezifisch angesehen wird (physische Eigenschaften im weitesten Sinn), und in größtmöglicher Ähnlichkeit in allem, was nicht als geschlechtsspezifisch angesehen wird (psychische Eigenschaften im weitesten Sinn).
Alle Eigenschaften, die den Gegensatz zwischen mir und einem anderen des anderen Geschlechts unterstreichen, erhöhen meine Chancen, sein Sexpartner zu werden – vorausgesetzt, wir »verstehen uns«, das heißt, wir sind uns in allem, was wir nicht als geschlechtsspezifisch ansehen, gleich. Die geschlechtsspezifischen Gegensätze können mehr oder weniger allgemein oder mehr oder weniger individuell sein, das heißt, sie können sich auf das ganze andere Geschlecht oder auf eine bestimmte Person des anderen Geschlechts beziehen. Männer mit starkem Bartwuchs, behaarter Brust, breiten Schultern, schmalen Hüften, großem Glied sind zum Beispiel ganz allgemein begehrter als andere. Frauen mit zarter Haut, großen Brüsten, breiten Hüften sind bei Männern für den Geschlechtsverkehr ganz allgemein beliebter als andere. Je mehr individuelle Polaritäten hinzukommen, desto idealer gestaltet sich eine sexuelle Beziehung. Die bekannte Faszination von Blonden auf Dunkelhaarige oder Blauäugigen auf Braunäugige ist kein Zufall. Deshalb tut jeder alles, seine Gegensätzlichkeit zum anderen Geschlecht– oder zu einer bestimmten Person des anderen Geschlechts – so geschickt wie möglich herauszustreichen. Ist sie nicht vorhanden, so versucht er zumindest, sie vorzutäuschen – indem er zum Beispiel seine Armmuskeln durch Training entwickelt, Gummibusen benützt, seine Haare kurz trägt oder sie bis zur Taille wachsen lässt usw.
Auch die sogenannten »typisch männlichen« und »typisch weiblichen« Verhaltensweisen haben hier ihren Ursprung – es handelt sich dabei immer um bewusste oder unbewusste Vortäuschung geschlechtsspezifischer Eigenschaften. Selten oder oft zu lächeln, viel zu reden oder wenig, sich beim Gehen in den Hüften zu wiegen oder nicht, macht Menschen »männlicher« oder »weiblicher«. Dass es sich dabei um vorgetäuschte Eigenschaften handelt, ist dadurch bewiesen, dass sie der Mode unterworfen sind und bei Bedarf sofort wieder abgelegt werden können. Die Frauen in alten Spielfilmen sind anders »weiblich« als die bei Truffaut oder Godard. Eine Frau, die sich heute wie ein Vamp der zwanziger Jahre benimmt, wirkt auf einen Mann nicht mehr weiblich, sondern lächerlich.
Das biologische Gesetz schreibt Mischung extremer Erbfaktoren vor. Wer es ignoriert oder umgehen will – wer keine extrem weiblichen oder männlichen Eigenschaften vorzuweisen hat und sich auch keine zulegt –, hat wenig Aussicht, den Geschlechtstrieb eines anderen auf sich zu ziehen, das heißt, wenig Aussicht auf Fortpflanzung.
Wie schon erwähnt, kommt zur Polarität in geschlechtsspezifischen Eigenschaften die Ähnlichkeit in allem anderen. Natürlich wird der Mann in den meisten Fällen der Frau an Körperkräften etwas überlegen sein, dies ist eine geschlechtsspezifische Eigenschaft, die sie füreinander attraktiv macht. Doch sobald der Unterschied zu groß wird – sobald eine Frau so schwach ist oder sich so schwach stellt, dass der Unterschied an Körperkräften nicht mehr als geschlechtsspezifisch angesehen werden kann –, besteht die Gefahr, dass der Beschützerinstinkt des stärkeren Partners seinem Sexinstinkt im Wege ist. Er wird fürchten, seinem Sexpartner wehzutun, und schont ihn. Kommt zur körperlichen Inferiorität auch noch eine geistige, so wird der Sexpartner mehr und mehr zum Schutzobjekt. Der Geschlechtsakt – normalerweise eine Art Nahkampf – ist dann nur bei beträchtlicher Selbstbeherrschung des Stärkeren möglich und büßt das Wesentliche ein. Die Gleichheit des intellektuellen Niveaus ist deshalb neben der physischen Gegensätzlichkeit die Voraussetzung für Liebe zwischen Mann und Frau.
Eine gute Garantie für Ähnlichkeit im nicht geschlechtsspezifischen Bereich ist Generationengleichheit. Unter Generation verstehen wir die Zeitspanne zwischen der Geburt eines Individuums und der Geburt seiner ersten Nachkommen – beim Menschen also etwa zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre. Sexualität ist ohnehin eine Angelegenheit unter Erwachsenen, aber wenn einer der Partner mehr als fünfundzwanzig Jahre älter ist und somit der Generation der Großeltern angehört, so sind die Chancen für eine beide Seiten befriedigende Geschlechtsbeziehung relativ gering. Es gibt zwar Fälle, in denen die besondere Dynamik einer bestimmten Person diese biologische Grenze für einige Zeit zu überbrücken vermag, doch diese Ausnahmen bestätigen die Regel. Die häufigen Verbindungen zwischen jungen Frauen und mehr als eine Generation älteren Männern sind kein Gegenbeweis; sie beruhen auf stets gleichbleibenden Voraussetzungen: dem Wohlstand oder gesellschaftlichen Ansehen des um mehr als eine Generation älteren Mannes. Wäre es ein biologischer Mechanismus, der attraktive junge Frauen alten Männern in die Arme treibt, dann würde gelegentlich auch einmal ein armer alter Rentner von einem reichen jungen Mädchen geheiratet.
Vernunftliebe
Ebenso wie ein Mensch seinen Brutpflegetrieb rationalisieren und zur Nächstenliebe umfunktionieren kann, lässt sich auch der Geschlechtstrieb rationalisieren. Der Mensch kann, anders als ein Tier, kultureller oder religiöser Bindungen wegen, aus Angst vor den Folgen oder um eines bestimmten Vorteils willen – etwa Heirat – auf sexuelle Betätigung vorübergehend oder für immer verzichten. Er kann seinen Geschlechtstrieb, statt ihn ganz zu unterdrücken, aber auch durch Ersatzhandlungen oder Übertragungen korrigieren. Er kann sich zum Beispiel bewusstmachen, dass er den Sexpartner X begehrt, und zwar wegen dieser und jener Eigenschaften, und er kann sich sagen, dass er zwar X nicht haben kann, dafür aber Y, der zwar nicht alle Eigenschaften besitzt, die er begehrenswert findet, dass jedoch sein Verlangen nach sexueller Betätigung so stark ist, dass er sich dennoch mit Y paaren will. Diese Art Rationalisierung des Geschlechtstriebs nennen wir Vernunftliebe. Vernunftliebe ist Liebe aufgrund »höherer Einsicht«.
Wie ein Objekt der Nächstenliebe immer ein unvollkommenes Schutzobjekt ist, kann ein Objekt der Vernunftliebe immer nur ein unvollkommener Sexpartner sein. Das heißt, es handelt sich um einen Menschen, der als Geschlechtspartner entweder physisch nicht gegensätzlich genug ist – er ist zu »unmännlich« oder zu »unweiblich« – oder psychisch nicht ähnlich genug – er ist zu dumm oder zu intelligent. Einen derart unvollkommenen Sexpartner begehrt man nur so lange, als kein vollkommener erreichbar ist, oder solange eine – wie auch immer geartete – Belohnung oder Bezahlung in Aussicht steht (Geld, weniger Einsamkeit, gesellschaftliches Ansehen, Zeugung von Schutzobjekten, usw.).
Extreme Formen von »Vernunftliebe« sind zum Beispiel Bordellbesuch, Selbstbefriedigung, Pornographie, Voyeurismus. Die Abstraktion von der eigentlichen Liebe geht hier so weit, dass sie total durch Symbolhandlungen ersetzt wird.
Alle Triebe sind manipulierbar
Fassen wir zusammen: Die Eigenschaften, die ein Schutzobjekt auszeichnen, sind denen eines Sexpartners genau entgegengesetzt: Schutzobjekt und Beschützer sind einander äußerlich ähnlich, Sexpartner sind ihr Gegensatz, Schutzobjekte sind ihrem Beschützer körperlich und geistig unterlegen, Sexpartner sind einander ebenbürtig. Diese in jeder Beziehung kontradiktorischen, sich gegenseitig ausschließenden Eigenschaften von Sexpartner und Schutzobjekt bedingen die in jeder Beziehung sich ausschließenden Gefühle, die wir beiden entgegenbringen. Die einzige – allerdings folgenschwere – Gemeinsamkeit dieser Gefühle besteht in dem Namen, mit dem wir sie bezeichnen: Liebe.
Kehren wir nun zu unserem Beispiel zurück, zur Diskussion zwischen Filmproduzent und Autor über die wahre