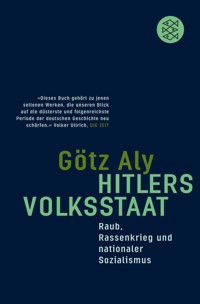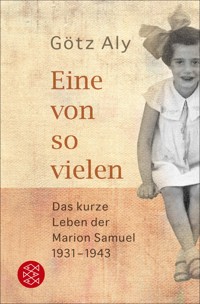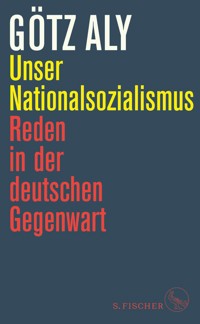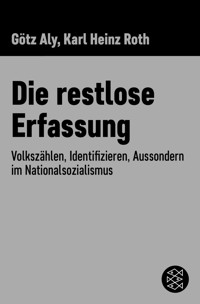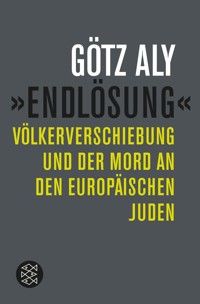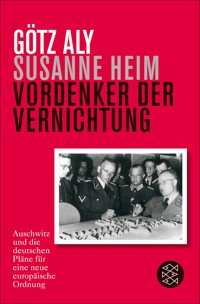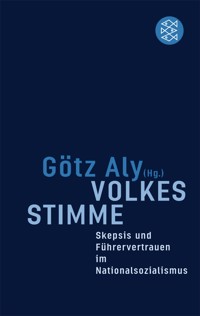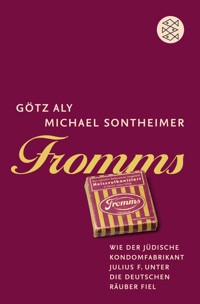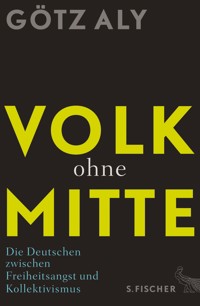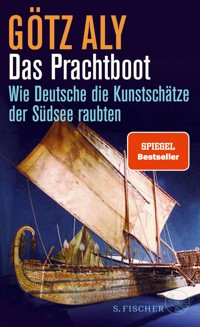
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Neben Denkmälern und Straßennamen zeugen zauberhafte Museumsobjekte von den einstigen Kolonien – doch wie sind sie zu uns gekommen und woher stammen sie? Götz Aly deckt auf, dass es sich in den allermeisten Fällen um koloniale Raubkunst handelt, und erzählt, wie brutal deutsche Händler, Abenteurer und Ethnologen in der Südsee auf Raubzug gingen. So auch auf der Insel Luf: Dort zerstörten sie Hütten und Boote und rotteten die Bewohner fast vollständig aus. 1902 rissen Hamburger Kaufleute das letzte, von den Überlebenden kunstvoll geschaffene, hochseetüchtige Auslegerboot an sich. Heute ist das weltweit einmalige Prachtstück für das Entree des Berliner Humboldt Forums vorgesehen. Götz Aly dokumentiert die Gewalt, Zerstörungswut und Gier, mit der deutsche »Strafexpeditionen« über die kulturellen Schätze herfielen. Das Publikum sollte und soll sie bestaunen – aber bis heute möglichst wenig vom Leid der ausgeraubten Völker erfahren. Ein wichtiger Beitrag zur Debatte über Raubkunst, Kolonialismus und Rassismus und zugleich ein erschütterndes Stück deutscher Geschichte. »Was für ein Buch! Was für Erkenntnisse!« Bénédicte Savoy
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Götz Aly
Das Prachtboot
Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten
Über dieses Buch
Koloniale Raubkunst in deutschen Museen: die Wahrheit über das Prachtboot von der Insel Luf
Neben Denkmälern und Straßennamen zeugen zauberhafte Museumsobjekte von den einstigen Kolonien. Götz Aly deckt auf, wie brutal Deutsche in der Südsee auf Raubzug gingen. So auch auf der Insel Luf: Dort zerstörten sie Hütten und Boote und rotteten die Bewohner fast vollständig aus. 1902 rissen Hamburger Händler das letzte, von den Überlebenden kunstvoll geschaffene, hochseetüchtige Auslegerboot an sich. Heute ist das weltweit einmalige Prachtstück für das Entree des Berliner Humboldt Forums vorgesehen.
Götz Aly dokumentiert die Gewalt, Zerstörungswut und Gier, mit der Geschäftemacher, Ethnologen, Marinesoldaten und Museumsdirektoren über die kulturellen Schätze herfielen. Das Publikum sollte und soll sie bestaunen – aber bis heute möglichst wenig vom Leid der ausgeraubten Völker erfahren.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Götz Aly ist Historiker und lebt in Berlin. Für seine Bücher wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Heinrich-Mann- und dem Ludwig-Börne-Preis. 2018 erhielt er für »Europa gegen die Juden 1880–1945« (S. Fischer) den Geschwister-Scholl-Preis. Sein neues Buch handelt von deutschen Kolonialverbrechen – ein ungewohntes Thema, aber ein »echter Aly«.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114,
D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Coverabbildung: Andreas Praefcke
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491271-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Vorwort
1 Tatort Kolonie Deutsch-Neuguinea
2 Strafexpedition auf der Insel Aly
3 Der »Publikumsliebling« Luf-Boot
4 1882: Das deutsche Massaker auf Luf
5 »Bastians Netzwerk« der Räuber
6 Betrügen, stehlen und plündern
7 Kuratoren, Kreuzer und Kanonenboote
8 Ethnologie, ein Kind des Kolonialismus
9 1903: Die Beschaffung des Luf-Boots
10 Das Schiff, ein Zeugnis uralter Kultur
11 Kahlfraß und Menschenverachtung
12 Wohin gehört das Prachtboot?
Kurzbiographien
Abkürzungen
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Namensregister
»Im Allgemeinen wird man ohne Übertreibung von sehr vielen Kolonien Folgendes behaupten können: Prügeln, Rauben, Schänden, Brennen, Morden nehmen einen großen Anteil der Arbeitskraft europäischer Beamter, Offiziere, Kaufleute und Forschungsreisender in Anspruch.«
Siegfried Lichtenstaedter (1865–1942) in seinem Buch »Kultur und Humanität«, Würzburg 1897
Im Original farbige Bildanimation des durch die Meere segelnden Luf-Boots, geschaffen vom kaiserlichen Marinemaler Hans Bohrdt (1857 – 1945), hier als Feldpostkarte von 1916. Auf der Rückseite steht: »Das letzte Boot von der Insel Agomes (= Luf), Südsee«, herausgegeben von »Kolonialkriegerdank, eingetrag. Verein zur Unterstützung ehemaliger Kolonialkrieger der Armee, Marine, der Schutzund Polizeitruppen sowie deren Hinterbliebenen«.
Vorwort
Über unfair getauschte, erschwindelte oder geraubte ethnologische Kulturgüter wird schon länger und heftig debattiert, sofern sie aus Afrika stammen – kaum jedoch, wenn es um die Museumsschätze aus der Südsee geht. Deshalb richtete ich den Blick auf die frühere Kolonie Deutsch-Neuguinea. Das Manuskript schloss ich im April 2020 ab. Jedoch erschien das vorliegende Buch erst ein Jahr später, weil der wichtigste Anlass für meine Recherchen noch immer nicht zu sehen war: die neu konzipierte ethnologische Ausstellung im Berliner Humboldt Forum, deren Eröffnung mehrfach verschoben worden war.
Selbst wenn es gelegentlich so scheint, wollte und will ich nicht gegen Museumskuratoren anschreiben. Nicht wenige von ihnen kritisieren den Kolonialismus und weisen im Kontext ihrer Sammlungen auf koloniale Gewalttaten hin. Vor allem aber kommt ihnen das Verdienst zu, die einst gierig angehäuften Kult-, Kunst- und Alltagsgegenstände zu bewahren. Kustoden und Kuratoren hüten, konservieren und erforschen das Überkommene. Das ehrt sie. Der damit verbundene Konservatismus, das Zusammenhalten und Erweitern der Sammlungen zählen zu den Tugenden ihres Berufes.
Nicht dazu gehört das Konzept der seit dem 22. September 2021 endlich zugänglichen ethnologischen Ausstellung im Zentrum Berlins, die zur imperialen Trophäenschau geriet. Sie lässt kolonialgeschichtliche Ehrlichkeit und kulturgeschichtliche Einordnung des Gezeigten vermissen. Die jetzige Präsentation bedarf der entschlossenen Revision. Dazu soll dieses Buch beitragen, und zwar, um es politikwissenschaftlich zu formulieren, in antagonistischer Kooperation.
Derzeit werden die zu Objekten reduzierten Fragmente ferner und häufig ganz unverstandener menschlicher Kulturen zum erheblichen Teil als nicht weiter erläuterte, zusammenhanglos angeordnete Stapelware vorgeführt. In teils meterhohe Vitrinen stopften die Museumsmacher jeweils Ähnliches: mal Holzkrokodile, mal Tanzmasken oder menschliche Figuren. Beschönigend bezeichnen sie die jedem Bildungsanspruch abholde Präsentation als »zeitgemäßes Schaumagazin«. Darin zeigt sich eine geradezu kolonialistische Missachtung außereuropäischer Hochkulturen.
Wie zum Hohn findet all das im Humboldt Forum statt. Dessen Namensgeber Wilhelm und Alexander von Humboldt sahen sich zu ständig gesteigerter Erkenntnis verpflichtet. Nicht so Völkerkundler, Kuriositätensammler, Raubhändler, Abenteurer und Soldaten, die während der um 1880 beginnenden deutschen Kolonialzeit oft mit Kriegsschiffen, zumindest aber gut bewaffnet, in fremde Länder einfielen. In himmelweitem Unterschied dazu forschte der weitreisende und wissbegierige Alexander von Humboldt knapp hundert Jahre früher. Unbewaffnet erkundete er Welten, die den damaligen Europäern noch weithin unbekannt geblieben waren. Begleitet von nur einem Gefährten folgte er dieser Forschungsmaxime: »Auf das Zusammenwirken der Kräfte, den Einfluss der unbelebten Schöpfung auf die belebte Tier- und Pflanzenwelt kommt es an. Auf diese Harmonie sollen stets meine Augen gerichtet sein.«
Auf die Ethnologie angewandt wäre die Menschenwelt hinzuzufügen. Selbstverständlich befragte Humboldt die Einheimischen immer wieder, protokollierte, was sie ihm über ihren Lebenskreis mitteilten. Von ihnen wollte er lernen. In seinem Buch über Mexiko beschrieb er, wie sich die Kultur der Bewohner in Abhängigkeit von den Bedingungen der natürlichen Umwelt entwickelt hatte; in Peru beschäftigten ihn Sprache und Kultur der Inka.[1] Tief beeindruckt notierte Goethe 1797: »Die Gebrüder von Humboldt waren gegenwärtig, und alles der Natur Angehörige kam philosophisch und wissenschaftlich zur Sprache.«[2]
Der Humboldt’schen Praxis, die auf das Beobachten, Sammeln und Erforschen tieferer Zusammenhänge gerichtet war, begegnen die Berliner Kuratoren des aktuellen ethnologischen Spektakels mit Ignoranz. Nichts kommt bei ihnen philosophisch, wissenschaftlich oder geschichtlich zur Sprache. In der frostigen Betongruft des Humboldt Forums, in die das prächtige Luf-Boot eingesargt wurde, erfährt der Betrachter fast nichts über dessen Funktionsweise, nichts über die technischen Finessen, die Bedeutung der Ornamente, die Herstellung des Kitts zur Abdichtung der Planken, nichts über das Leben und die grandiosen nautischen Fähigkeiten der Erbauer, die mit solchen Booten seit Jahrtausenden Hunderte Meilen über den Pazifik segelten und gegen die Winde kreuzten. Gemessen an diesem Schiff sind die allenfalls mit Treibsegeln ausgerüsteten Rudergefährte der Phönizier, Griechen oder Wikinger plumpe Vorstufen der Seefahrt. Das Luf-Boot gehört zum Weltkulturerbe.
Auch liest der Interessierte in diesem düsteren Gelass nichts über die deutsche Kolonialgewalt, nichts über die räuberischen Praktiken des Hamburger Handelshauses Hernsheim und dessen Mitinhaber Max Thiel. Letzterer beschaffte das Prachtboot; sein Kompagnon Eduard Hernsheim verkaufte es ein Jahr später an das Berliner Museum für Völkerkunde.
Bis zum Erscheinen des vorliegenden Buches behaupteten die Verantwortlichen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), das Luf-Boot sei 1903 auf redliche Weise gekauft worden. Einen Beweis dafür gibt es nicht. Dann änderten sie ihren Wortgebrauch. Jetzt heißt es: Das einzigartige Exemplar vormetallzeitlicher Schiffsbaukunst sei erworben worden. Diesem weniger präzisen Verb begegnet man jetzt im Humboldt Forum auf Schritt und Tritt. Unbedacht übernahmen die Kuratoren damit das Lügendeutsch der Kolonialzeit. So forderte der Hamburger Reeder Adolph Woermann 1883 die »Erwerbung eines Küstenstriches in West-Afrika zur Gründung einer Handelskolonie«. Er meinte das bald vom Deutschen Reich »erworbene« Kamerun. Als die Deutsche Kolonialgesellschaft in Person des extrem gewalttätigen Carl Peters (genannt »Hänge-Peters«) 1888 weitere »Erwerbungen« in Ostafrika betrieb und dafür in Berlin Schutzbriefe begehrte, kommentierte Otto von Bismarck: »Was heißt Erwerbung? Ein Stück Papier mit Negerkreuzen darunter!«[3] Es stimmt: So wie die Kolonien wurden auch die nach Deutschland verbrachten ethnologischen Schätze erworben – sprich: irgendwie angeeignet.
Die für jede Provenienzforschung zentralen Museumsinventare schweigen zu den Erschaffern und Eigentümern des mehr oder weniger zufällig Zusammengesammelten. In aller Regel nennen sie lediglich die in Kolonialgebieten aktiven europäischen Verkäufer und Schenker oder die Hehler: also Auktionshäuser und auf »Kuriositäten der Naturvölker« oder »Tribal Art« spezialisierte Händler. Kaum jemand legte Wert darauf, die Namen und Adressen derer zu notieren, denen all diese Dinge abgeluchst oder mit Gewalt entwunden wurden.
In den Online-Präsentationen des Berliner Ethnologischen Museums werden die europäischen Übereigner unter dem harmlos erscheinenden Begriff Sammler zusammengefasst. Bereits hier verschwinden die Informationen über Schenker und Verkäufer, die in den handschriftlichen Inventaren fast lückenlos aufgeführt sind. Das materielle Interesse der Verkäufer liegt auf der Hand, das der sogenannten Schenker sollte nicht verschwiegen werden: Sie verschafften sich mit ihren Gaben Handelsvorteile, einen guten Ruf, Anerkennung, Eintritt in die höheren Sphären der Gesellschaft, Orden und schöne Titel, wie zum Beispiel den des Konsuls – ein Titel, den sich sowohl Eduard Hernsheim als auch Max Thiel mit Hilfe verschenkter Ethnologica erkauften.
Anders als die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sprach Eduard Hernsheim niemals von einem Kauf, sondern umschrieb den Aneignungsvorgang vieldeutig und nebulös: Das wundervolle Boot »ging später in meine Hände über«. Man bedenke, was im letzten Drittel des 19. und im 20. Jahrhundert alles in andere deutsche Hände überging – sei es unter kolonialistischen, nationalsozialistischen oder sozialistischen Vorzeichen.
Dank einer auf meine Anfrage hin vorzüglich restaurierten Akte aus dem 2009 eingestürzten Kölner Stadtarchiv steht seit Juni 2021 fest, wann sich Hernsheim und Thiel das Boot aneigneten. Sie taten das bereits 1902 – nicht erst 1903. Erbsenzählerei? Nein. Der kleine Unterschied ist deshalb bemerkenswert, weil die beiden Hamburger Südseekaufleute 1902 das gesamte Hermit-Atoll, das ihnen nicht gehörte, an Rudolph Heinrich Wahlen verkauften (siehe Seite 122 – 125). Die Übernahme des Bootes war Teil eines größeren Geschäfts.
Am 25. Juni 1902 schickte Hernsheim dem Direktor des Kölner Rautenstrauch-Joest-Museums, Willy Foy, diese Offerte: »Würde ein 50 Fuß langes, vollkommen geschnitztes und bemaltes Prunk-Canoe aus den Hermit-Inseln, einzig in seiner Art und Zeuge einer vollkommen verschwundenen Kunstfertigkeit der im Aussterben begriffenen Insulaner, Interesse für Sie haben? « Zudem erläuterte Hernsheim in der Vergangenheitsform: »Das Canoe wurde als Heiligtum und größte Sehenswürdigkeit auf den [Hermit-]Inseln aufbewahrt.«
Ein paar Monate später legte er nach: »Ferner übersende ich Ihnen zur Ansicht und evtl. Rücksendung sieben Fotographien des großen Hermit-Canoes, dessen Dimensionen auf der Rückseite des Katalogs angegeben sind. ( … ) Wenn Sie mehr Geldhaben und sich das Unikum sichern können, dann erbitte ich mir Nachricht recht bald, da sich unzweifelhaft Reflektanten dafür finden werden.«[4] Schließlich machte der Berliner Reflektant Felix von Luschan das Rennen. Hernsheim hatte damit geworben, dass diejenigen, die dieses Wunderwerk geschaffen hatten, es »als Heiligtum und größte Sehenswürdigkeit« ihrer Insel bewahrt hatten. Gibt eine Stammesgemeinschaft ihre Heiligtümer freiwillig her? – Allenfalls dann, wenn sie von Kolonialisten 30 Jahre lang bis zur Unkenntlichkeit ruiniert wurde: mittels militärischer Vernichtungszüge, Arbeiterdeportation, eingeschleppter Krankheiten und gnadenloser Ökonomisierung. All das hatten Hernsheim und Thiel ins Werk gesetzt.
Eduard Hernsheim wusste, wie es zur Verelendung der im »Aussterben begriffenen Bevölkerung« von Luf gekommen war. Denn er allein hatte 1882 die mörderische Terroraktion der Kreuzerkorvette Carola und des Kanonenboots Hyäne gegen die Lufleute gefordert. Folglich ist es abwegig, wenn eine Kritikerin meines Buches, die Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin, diese zu einem »durchgeführten Strafkommando« verkleinert. Zudem behauptet sie, daran hätten »Bewohner der Nachbar inseln« mitgewirkt. Abgesehen davon, dass in den rund hundert Seiten umfassenden Berichten der Kaiserlichen Kriegsmarine zu diesem Massaker kein Wort zur Beteiligung von Einheimischen steht, möchte Hauser-Schäublin den Verdacht streuen, die Lufleute seien bösartig gewesen und hätten eine Strafe verdient. Tatsächlich weigerten sich die Lufleute mehrfach, mal mit Gewalt, mal passiv, sich den ökonomischen Interessen des Eindringlings Hernsheim zu fügen. Das war ihr gutes Recht.
Auf ähnliche Weise hatte Hauser-Schäublin 2020 den berüchtigt-mörderischen Beutezug der britischen Soldateska im afrikanischen Königreich Benin relativiert.[5] Um der möglichen Rückgabe der berühmten Benin-Bronzen an Nigeria zu widersprechen, führte sie an, die Herrscher des einstigen Königreichs Benin hätten Sklavenhandel betrieben, Kriegszüge unternommen und Menschenopfer darbringen lassen.
Vieles daran mag zutreffen. Ich behaupte nicht, die Herrscher von Benin oder die Menschen auf der Insel Luf hätten niemals Dinge getan, die schlichtweg böse oder hinterhältig waren. Nur lässt sich mit dem Hinweis darauf der Raub von Kulturgütern nicht legitimieren. Als Deutscher rate ich dringend zur Vorsicht. Denn würden die von Deutschen im 20. Jahrhundert begangenen Großverbrechen das Einbehalten von Kulturgütern rechtfertigen, dann hätten unsere sämtlichen Museen, Kirchen, Schlösser und privaten Sammlungen 1945 von allem Wertvollen auf ewig entblößt werden dürfen.
Noch löst das Wort Raub unter den Museumsleuten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz heftige Abwehr aus. Noch bevorzugen sie weiche Wortgebilde, zum Beispiel »unklare Erwerbsumstände «. Um die Gründe dafür zu verstehen, gebe man den Namen des Beschaffers des Luf-Boots Max Thiel in die Datenbank der Staatlichen Museen zu Berlin (http://smb-digital. de) ein, kombiniert mit der Jahreszahl 1899. Prompt erscheinen 142 wunderschöne Kunstwerke und Gebrauchsgegenstände auf dem Bildschirm – knapp zwei Drittel aller Thiel zugeschriebenen Stücke. Beigebracht hatte er sie laut SPK in Kooperation mit »S. M. S. Möwe, Expedition« von den Admiralitätsinseln.
Die Möwe wurde seinerzeit als Vermessungsschiff eingesetzt, blieb jedoch ein voll ausgerüstetes Kanonenboot. Im August 1899 steuerte sie die zu den Admiralitätsinseln gehörende Insel Pak an, nicht wegen einer ethnologischen oder kartographischen Erkundung, sondern zwecks Strafexpedition – mit an Bord: Gouverneur Rudolf von Bennigsen, ein Scharfmacher erster Güte, dessen Stellvertreter Dr. Heinrich Schnee sowie der Südseehändler Max Thiel als Vertreter des an generalpräventiven Militäraktionen interessierten Handelshauses Hernsheim. Die Details der Vernichtungs- und Plünderungsaktion finden sich auf den Seiten 88 – 90.
Schnee schilderte diese Terroraktion in seinem 1904 veröffentlichten Buch »Bilder aus der Südsee. Unter den kannibalischen Stämmen des Bismarck-Archipels«. Dieses von den Freunden des deutschen Kolonialismus (ohne den originalen Untertitel) neu aufgelegte Werk lesen die verantwortlichen Kuratoren offenbar nicht. Denn mit allergrößter Wahrscheinlichkeit stammen die 142 Objekte, die Thiel seinerzeit dem Völkerkundemuseum Berlin vermachte, von der kleinen Insel Pak. Genau passend wurden die Stücke mit dem Herstellungsdatum »vor 1899« und dem Hinweis auf S. M. S. Möwe katalogisiert. Richtig wäre übrigens S. M. Kb. (= Kanonenboot).
Abgrundtief verlogen ist das Wort »Expedition«, mit dem die SPK den kriegerischen Raubzug auf der Insel Pak verniedlicht. Im beschönigenden Jargon der Zeit müsste es wenigstens heißen: Strafexpedition. Genauer aber: Vernichtungs-, Rache- oder Raubfeldzug. Auch Bennigsen lieferte dem Berliner Völkerkundemuseum Objekte. Diese sind der Insel Pak offiziell zugeordnet und wurden ebenfalls »vor 1899« hergestellt. Allerdings fehlt hier der naheliegende Hinweis auf S. M. Kb. Möwe. Mit etwas Nachdenken, Literatur- und Archivkenntnis kann Provenienzforschung überraschend schnell zu Ergebnissen führen.
Bis heute beschweigt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz den konkreten Zusammenhang zwischen kolonialen Verbrechen und einzelnen Ausstellungsstücken. Während die ethnologischen Museen in Stuttgart, Leipzig oder Köln die Spuren kolonialer Gewaltakte in ihren Sammlungen sichtbar machen, windet sich die SPK noch immer, flüchtet sich in Ausreden und Relativierungen wie diese: »zweifellos« – »aber«; »Bevölkerung dramatisch zurückgegangen«; »aber inwieweit haben die Bewohner: innen von Luf selbstbestimmt gehandelt?«; »Die Forschung ist noch nicht abgeschlossen. Sie soll mit Partner:innen aus Papua-Neuguinea weitergeführt werden.«; usw. usf.[6]
Wie man es anders machen kann, zeigte Waldemar Stöhr, langjähriger Kustos am Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln, bereits vor 44 Jahren. Damals, 1987, beschrieb er die Sammlung Clausmeyer seines Hauses. Diese enthält eine 1,42 Meter große Kultfigur von der Insel Luf. Stöhr gibt an, dass diese von einem Leutnant zur See von Holtzendorff, seinerzeit auf der S. M. S. Carola eingesetzt, während der »für die Bevölkerung verheerenden Strafaktion« 1882/83 auf den Hermit-Inseln erbeutet wurde, und spricht von einem »widersinnigen« »Schlag«, von dem sich »die Bevölkerung nicht mehr erholt« habe.[7]
Derartige Klarheit fehlt im Humboldt Forum. Noch leben dort die alten Lügen. Wie sein Vorgänger Felix von Luschan hatte August Eichhorn als Leiter der Südseeabteilung im Berliner Völkerkundemuseum die Terroraktion von 1882/83 unterschlagen und allerlei Erfindungen über den Untergang der Lufleute verbreitet. In seinem 1929 veröffentlichten Artikel »La mort d’une tribu« (Das Aussterben eines Stammes), der – mit zwei Abbildungen bestückt – vom Luf-Boot handelt, spricht er zwar von äußeren ökonomischen Einflüssen, die negativ auf die Lufleute eingewirkt hätten, stellt jedoch fest, deren starker Überlebenswille sei erst gebrochen worden, als 60 junge, kräftige Männer auf einem Boot zu einem Kriegszug aufgebrochen und nicht wiedergekehrt seien. Erst der Verlust dieser Männer im besten Fortpflanzungsalter habe das Aussterben dieses kraftstrotzenden Stammes bewirkt. Danach sei kein einziges Kind mehr geboren worden.
Eichhorn hätte in mehreren längst gedruckten Texten nachlesen können, dass all das nicht stimmte. Aber darauf kam es ihm nicht an. Er arbeitete an einer Legende, und da sein Text, vermittelt wohl von Carl Einstein, in der surrealistischen Pariser Zeitschrift »Documents« erschien, endete er romantisierend lyrisch verkitscht und verlogen. Hier von mir übersetzt: »Die Palmen werden weiterhin wachsen / Die Korallen sich weiterhin ausbreiten / Doch die schwarzbraunen Menschen entschwinden in das Reich des Todes.«[8] Die hier dargebotene, seit mehr als hundert Jahren eingeübte Mixtur aus Halbwahrheiten und Schutzbehauptungen hält sich bis in die Gegenwart.
Neben den hässlich-blutigen »Erwerbsumständen« sprechen die dürftigen, oftmals auf Maße und Gewicht beschränkten Angaben für die fragwürdigen Provenienzen der Museumsstücke. Für unzählige wunderbare Objekte fehlen neben genauen Ortsangaben zeitliche, funktionale und kulturelle Einordnungen. Die sogenannten Sammler befassten sich seinerzeit allenfalls oberflächlich mit den münd lichen Überlieferungen, Sprachen, Initiationsriten, Festen, Beerdigungszeremonien und Mythen einzelner Papuastämme und Dorfgemeinschaften. Im Unwissen spiegelt sich die Gier, mit der Deutsch-Neuguinea leergesammelt und leergeraubt wurde.
In ihrer Rede zur Eröffnung der ethnologischen Schausammlung im Humboldt Forum fragte die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie am 22. September 2021: »Wer erzählt die Geschichte? Wer ist der Erzähler, und von wem wird erzählt? Wer hat entschieden, dass afrikanische Kunst als ›ethnologisch‹ klassifiziert wird? Wer hat das Recht, den anderen auszustellen?« Anschließend drehte Adichie den Spieß um. Sie zitierte die Frage »Wohin gehören die Schätze Afrikas?«, die sie als Titel über einem deutschen Meinungsartikel gelesen hatte, und konterte: »Stellen wir uns vor, die Überschrift würde lauten: ›Wohin gehören Deutschlands Schätze?‹.«[9] Spielt man diesen hypothetischen Gedanken durch und stellt die Verhältnisse zwischen Papua-Neuguinea und Deutschland vom Kopf auf die Füße, ergibt sich folgende Situation:
In Port Moresby, der Hauptstadt des Staates Papua-Neuguinea, steht neben dem großen Papuanischen Nationalmuseum ein pompöses Museum für Europäische Ethnologie. In der Abteilung Germanoslawische Siedlungsgebiete entdeckt der Betrachter die Himmelsscheibe von Nebra, betitelt als »Sonne- Mond- und- Sterne- Platte, Metall«; ein paar Schritte weiter hängt ein Bordellbild von George Grosz, präsentiert als »germanoslawisches Fruchtbarkeitszeremoniell, Ölfarbe auf Leinwand«. Interessierte Papuas erläutern ihren Kindern: »Putzig müssen sie gewesen sein, diese Urvölkchen und Stammesgemeinschaften Germanoslawiens. Manche Sachen haben sie wirklich gut hingekriegt, und das mit einfachsten Mitteln und in diesem abscheulich kalten Klima; nicht unbegabt, die Indigenen, die früher im heutigen Deutschland lebten, aber ausgestorben sind.«
In der Eingangshalle des papuanischen Museums für Europäische Ethnologie steht – so wie heute das prächtige Luf-Boot in Berlin – als besonderes Prunkstück das einzige weltweit erhaltene Werk des begnadeten spätgotischen Holzschnitzers Tilman Riemenschneider: ein fragmentarisch erhaltener Altar, der ehedem die kleine Kirche eines Dorfes zierte, das heute zu Rothenburg ob der Tauber gehört. Papuanische Kolonialtruppen hatten dieses Werk vor 150 Jahren mitgenommen und später an das heimatliche Museum verkauft. Die fein geschnitzten, teilweise beschädigten Figuren zeigen die Kreuzigung Christi. Allerdings sind sie nur sehr sparsam beschrieben: »Schnitzwerk, Menschenopferkult, vor 1870; Nordmitteleuropa (Germanoslawien), Lindenholz; Höhe 174 cm, Breite 113 cm, Tiefe: 47 cm; Gewicht: 94,3 kg.« Exakt so sind die allermeisten Objektbeschreibungen der ethnologischen Sammlungen im Humboldt Forum zusammengestoppelt: ignorant und nichtssagend. Dem zum Trotz erfinden die Verantwortlichen auf ihrer Homepage, die Südseesammlung zeichne sich durch eine »meist sehr genaue Dokumentation« aus. Eine haltlose Schutzbehauptung!
So liest man zum Beispiel über eine mit besonders schönen Schnitzereien verzierte riesige Trommel: »Max Thiel, Sammler; vor 1902; Melanesien (Großregion), Admiralitätsinseln (Inselgruppe), Manus (Insel); Holz, geschnitzt; Objektmaß: 89 × 262 × 75 cm.«[10] Zu welchem Zweck die Trommel wie benutzt wurde, bleibt ein Geheimnis. Auf der großen Insel Manus werden noch heute an die 20 Sprachen gesprochen, also auch unterschiedliche Kulturen gelebt. Das Ethnologische Museum Berlin ist nicht in der Lage, diese Trommel einem bestimmten Ort und Kulturkreis zuzuordnen. Über die zahlreichen Terroraktionen, die von deutschen Kriegsschiffen gegen die Inselvölker von Manus – unter tätiger Mithilfe der Firma Hernsheim – unternommen wurden, schweigen die online zugänglichen Präsentationen.
Nehmen wir weiterhin hypothetisch an, im Jahr 2030 fragt die Direktorin des städtischen Museums in Rothenburg ob der Tauber im Museum für Europäische Ethnologie von Port Moresby höflich an, ob sie das einzige noch erhaltene Kunstwerk des lokalgeschichtlich so bedeutsamen Bildhauers Riemenschneider zurückbekommen könne. Nach mehrjährigem Drängen erhält sie 2036 diesen Brief:
»Wie Sie unserem Internationalen Bulletin entnehmen können, haben wir unser Museum im Kontext umfassender diskursiver Prozesse bereits vor fünf Jahren umbenannt. Es trägt jetzt den Namen GLOBAL. Human Arts. Heritage. Anhand des so erarbeiteten Narrativs gleichberechtigter Diversität verstehen wir uns als Akteur*innen transglobaler und transepochaler Kultur- und Wissenschaftspolitik. So gesehen greifen die von Ihnen angeschnittenen Fragen früherer Translokationen wichtiger Objekte und sogenannter ›Restitution‹, hier an die Middle Franconian source society (mittelfränkische Herkunftsgesellschaft) in Rothenburg o.d.T., viel zu kurz. Wir begreifen unsere Sammlungen als Teile des Welterbes, die allen Besucher*innen und Wissenschaftler*innen im Sinne von shared heritage offenstehen. Selbstverständlich fliegen wir Sie gerne nach Port Moresby ein. Wir sind Ihnen dankbar, wenn es uns mit Ihrer Hilfe gelingt, Ihre indigen-europoide Perspektive nachhaltig-dialogisch und inklusiv in unser Projekt ›Mosaike der Menschheit‹ einzubeziehen. Unsere Middle-Franconian-Spezialist*innen sowie die Ethikbeauftragte wünschen sich nichts mehr als Ihren Besuch und das kooperative Forschen mit Ihnen als einem Menschen aus der Herkunftsregion.«
Leider ist diese glatte Art des Drumherumredens nicht erfunden, weder von mir noch von Bénédicte Savoy, die das quellenstarke und elegant geschriebene Buch »Afrikas Kampf um seine Kunst«[11] ebenfalls 2021 veröffentlicht hat. Ergänzt um die Floskel »Gespräche auf Augenhöhe führen«, lässt sich derartiges Abwehrgerede zum Beispiel im Rotary Magazin vom September 2021 nachlesen. Dort wird vom Leiter der Ethnologischen Sammlungen im Humboldt Forum, Lars-Christian Koch, über die angeblich »auf der Höhe der Zeit neu inszenierte und kuratierte Schau« gesagt: Zwar würden »die hier vorhandenen Objekte reisen müssen«, wenigstens gelegentlich. Dabei sollen sie »uns allen« zu einem »besseren Verständnis einer gemeinsamen, über Jahrhunderte verflochtenen globalen Geschichte« verhelfen, und zwar in »gleichberechtigter Diversität«: »Dieser multiperspektivische Blick gehörte von Anfang an zum Konzept dazu, ist diesem gewissermaßen eingeschrieben.«[12]
Keine Frage, Betrüger und Betrogene haben miteinander zu tun, desgleichen Räuber und Beraubte, Kolonialherren und kolonial Versklavte, Mörder und Ermordete. In »gleichberechtigter Diversität« miteinander »verflochten« sind sie nicht. Auch gibt es nicht eine »gemeinsame Geschichte«. Die Erfahrungen mit derselben Geschichte und die damit verbundenen Erinnerungen sind nicht selten extrem unterschiedlich.
Seit die allgemeine Diskussion um kolonialistisch angeeignetes Kulturgut wieder engagiert und temperamentvoll geführt wird, sprechen die Repräsentanten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gerne von den intensiven Beziehungen, die man »längst« zu den sogenannten Ursprungsgesellschaften unterhalte, auch zu Papua-Neuguinea. Dass es damit nicht weit her ist, lässt sich aus dem Ausstellungskatalog ersehen, den der australische Ethnologe und Kurator Barry Craig vor gut zehn Jahren zu den Meisterwerken im New Guinea National Museum herausgegeben hat. Darin findet sich viel über die Probleme, die der Sammlung durch den massenhaften Raub von Kunstschätzen entstanden sind, jedoch nichts über Kontakte zu deutschen Museen.
Zum Rückkauf auf dem internationalen Kunstmarkt reicht das Budget nicht aus. Raubkunst aus der Südsee ist teuer. Das Museum von Papua-Neuguinea verfügt über Fotografien melanesischer Boote, auch über das eine oder andere Paddel und verzierte Bootsschnäbel. Doch ein Auslegerkanu, das es in seinem kunstvollen Bau und Erhaltungszustand nur entfernt mit dem Berliner Prachtboot aufnehmen könnte, sucht man dort vergebens. Aus der gesamten Manus-Provinz, zu der die Admiralitätsinseln und die Westlichen Inseln, damit auch das Hermit-Atoll samt Luf, gehören, finden sich laut Inventar von 2010 lediglich 190 Objekte im Bestand des Museums. Deutsche ethnologische Museen, allen voran das in Berlin, verfügen über Tausende Kunstwerke, kultisch bedeutsame Masken sowie grandios verzierte Alltagsgegenstände von den Inseln der heutigen Provinz Manus. Mit Hilfe dieser Bestände ließe sich der so offenkundige Mangel im Nationalmuseum von Papua-Neuguinea sofort beheben.[13]
Derzeit behaupten Vertreter der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, es gebe keine Anfragen aus Papua-Neuguinea zur Rückgabe aus deutschen Museen.[14] Das stimmt so nicht. Denn schon unmittelbar vor der Unabhängigkeit 1975 forderte der erste Premierminister von Papua- Neu guinea, Michael Somare, die internationale Öffentlichkeit auf, verschlepptes Kulturgut zu repatriieren. »Wir haben jetzt«, so führte er aus, »ein Nationalmuseum und eine Kunstgalerie, die unser Erbe bewahren. Doch einige unserer wertvollsten Kunstschätze befinden sich außerhalb unseres Landes. Ich bitte Sie alle, mit uns zusammenzuarbeiten, damit der Geist und die Seelen unserer Ahnen in ihre Heimat zurückkehren können. Für uns sind unsere Masken und Kunstwerke lebendige Geister mit festem Wohnsitz.«[15]
Australien gab einiges zurück. In Deutschland folgte damals nicht eines der zahlreichen ethnologischen Museen diesem Aufruf. Das kann und sollte sich ändern. Es geht dabei nicht um die kompletten Sammlungen, aber doch um Tausende Stücke, die für das kulturelle Gedächtnis der Bürger und Bürgerinnen von Papua-Neuguinea viel bedeuten. Anders als etwa im Fall von Nigeria steht die Verständigung mit den politischen und kulturellen Institutionen des Landes noch am Anfang. Das gilt erst recht für gesellschaftliche Gruppierungen, die daran arbeiten, wichtige Zeugnisse der eigenen Geschichte wiederzugewinnen, um damit, nicht zuletzt, den inneren Zusammenhalt des noch immer fragilen Staates zu festigen.
Die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für Papua-Neuguinea und meine erfolglosen Versuche, mit der Brüsseler EU-Botschaft des Landes und dem Direktor des Nationalmuseums in Port Moresby in Kontakt zu treten, sprechen dafür, dass sich die Beziehungen mit der ehemaligen Kolonialmacht Deutschland erst langsam entwickeln werden. Das mag noch viele Jahre oder Jahrzehnte dauern. Ein Drängen von deutscher Seite ist nicht geboten. Aber die deutschen ethnologischen Museen, die Bundesregierung und engagierte Einzelpersonen sollten stets die Bereitschaft zur vorbehaltlosen Zusammenarbeit signalisieren. Wichtig bleibt, die Inventare der Museen ins Netz zu stellen: zunächst in originaler handschriftlicher Form, aber bald in leicht lesbarer Maschinenschrift. Ferner müssen englische Fassungen erstellt werden und Konkordanzen für die wechselnden geographischen Bezeichnungen. Unter öffentlichem Druck hat sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz im August 2021 zu diesem Schritt entschlossen.[16] So können Interessierte in Papua-Neuguinea lesen, wie ihre Kulturschätze einst nach Berlin gelangten und dort bis auf Weiteres als Welterbe gezeigt und erforscht, jedoch nicht länger als deutsches Eigentum betrachtet werden. Stattdessen sollen das Luf-Boot sowie Tausende andere Kunstwerke, Gebrauchsgegenstände und Heiligtümer, Fotografien und Aufzeichnungen aus der ehemaligen Kolonie Deutsch-Neuguinea treuhänderisch verwahrt, erhalten und aufwändig gepflegt werden, bis sich die Nachfahren derer melden, die einst die uralten Hochkulturen der Südsee geschaffen haben.
Ich danke allen, die mich auf kleinere und einen geographischen Fehler (siehe S. 29 – 33) in der Erstausgabe aufmerksam gemacht und mir zusätzliche Informationen und Bilder zugeschickt haben: Irene Albers, Anna-Maria Brandstetter, Katharina Döbler, Johannes Fellmann, Dieter Klein, Hermann Mückler, Wolf- Dietrich Paul und Michael Sontheimer. Die amerikanische Ausgabe dieses Buchs erschien im Frühjahr 2023 unter dem Titel »The Magnificent Boat. The Colonial Theft of a South Seas Cultural Treasure« (The Belknap Press of Harvard University Press).
Berlin, Juni 2023
Fußnoten
[1]
Zit. nach Franz Schnabel, Alexander von Humboldt, München 1995, S. 13, vgl. auch S. 15, 20.
[2]
Goethe, Weimarer Ausg., I/35, S. 71 f.
[3]
Zit. nach Klaus J. Bade, Friedrich Fabri und der Imperialismus der Bismarckzeit, Internetausg., Osnabrück 2005, S. 565.
[4]
Schriftwechsel Foy-Hernsheim, hier Hernsheims Schreiben v. 25. 9. und 3. 10. 1902 und 30. 3.1903; Stadtarchiv Köln, Best. 614, A 308.
[5]
Brigitta Hauser-Schäublin, Warum das Luf-Boot im Humboldt Forum bleiben kann, in Die Zeit v. 15. 7. 2021; Götz Aly, Die alten Lügen leben noch. Eine Antwort auf meine Kritikerin, ebd. v. 29. 7. 2021; Brigitta Hauser-Schäublin, Dieses Blut gehört dem König, in Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 17. 1. 2020. Ähnlich argumentiert Jakob Anderhandt in seinem Aufsatz »Täter, Opfer, Fakten. Zur Debatte über das Luf-Boot im Humboldt Forum« (Museum Aktuell, 9/2021, S. 20 – 23). Anderhandts Hernsheim-Buch verdanke ich viel, aber statt neuer Fakten liefert er in diesem Beitrag lediglich Meinungen. Im Übrigen hat er nicht zum Hernsheim’schen Nebenerwerb Ethnologica-(Raub)Handel geforscht.
[6]
So die für das Luf-Boot zuständige Kuratorin Dorothea Deterts auf S. 66 f. im Begleitheft zur Ausstellung: »macht || beziehungen« (Sept. 2021).
[7]