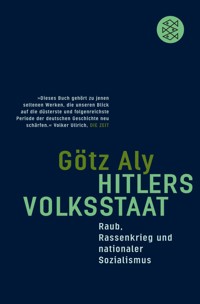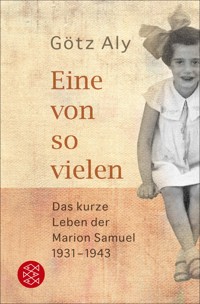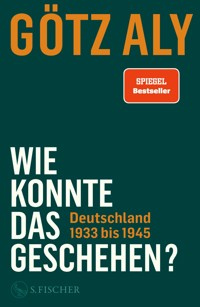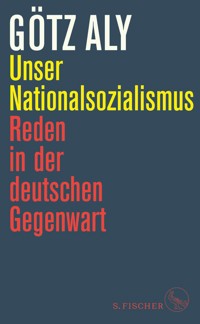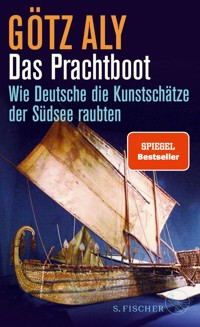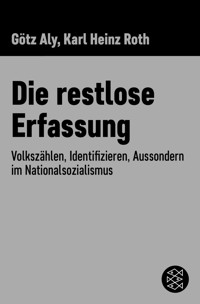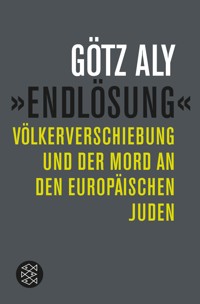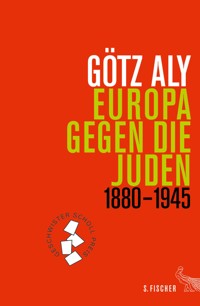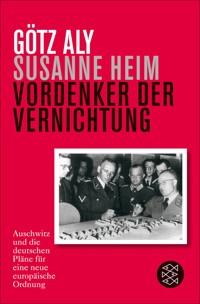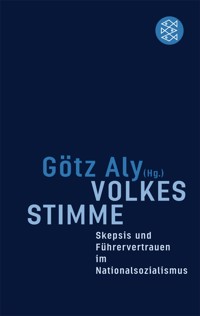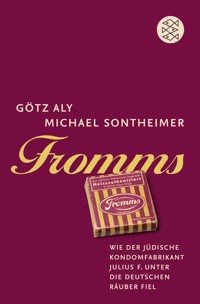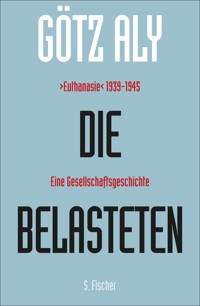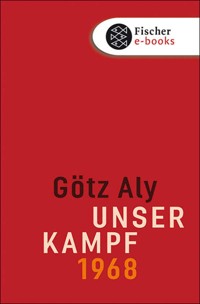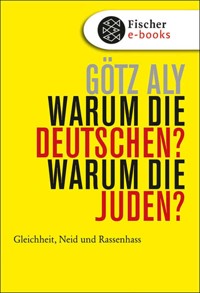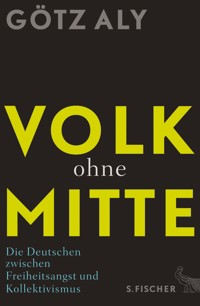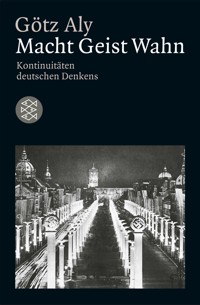
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".
- Sprache: Deutsch
Zweimal endete im 20. Jahrhundert das Zusammenspiel von Macht und Geist im nationalistischen Wahn der Deutschen. Der viel gelesene und viel diskutierte Historiker Götz Aly zeigt in diesem Buch, welche Rolle der Geist dabei spielte: In der Zeit des Nationalsozialismus wurden auf allen Gebieten von Wissenschaft und Forschung und auf allen gesellschaftlichen Ebenen hemmungslos – wie in keiner historischen Phase zuvor – die ehrgeizigsten Projekte begonnen. Aus der spannungsreichen Integration verschiedener, untereinander konkurrierender Interessen gewann der NS-Staat seine enorme, viele Deutsche begeisternde und am Ende mörderische Dynamik. Die Elite dieser zwölf kurzen Jahre bildeten nicht allein fanatisierte SS-Gruppenführer, die mit Fackelzügen Blut-und-Boden-Romantik inszenierten. Daneben setzten junge Akademiker auf Rationalität, Modernisierung und Fortschritt. Sie nahmen ihre Karrierechancen zielbewusst wahr. Die meisten von ihnen blieben nach dem Krieg erfolgreich, und niemand fragte sie, was sie vor 1945 getan hatten. In diesem Buch, das erstmals 1997 erschien, veröffentlichte Götz Aly auch einen Text über die Rolle der Historiker Theodor Schieder und Werner Conze im Nationalsozialismus. Damit erreichte er, dass die im September 1998 auf dem Deutschen Historikertag Versammelten sich, wenn auch widerwillig, erstmals mit der Nazivergangenheit des eigenen Faches und seiner führenden Vertreter auseinandersetzten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Götz Aly
Macht – Geist – Wahn
Kontinuitäten deutschen Denkens
Über dieses Buch
Zweimal endete im 20. Jahrhundert das Zusammenspiel von Macht und Geist im nationalistischen Wahn der Deutschen. Der viel gelesene und viel diskutierte Historiker Götz Aly zeigt in diesem Buch, welche Rolle der Geist dabei spielte: In der Zeit des Nationalsozialismus wurden auf allen Gebieten von Wissenschaft und Forschung, auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens hemmungslos – wie in keiner historischen Phase zuvor – die ehrgeizigsten Projekte auf den Weg gebracht. Aus der spannungsreichen Integration verschiedener, oft untereinander konkurrierender Interessen gewann der NS-Staat seine enorme, viele Deutsche begeisternde und am Ende mörderische Dynamik.
Die Elite dieser zwölf kurzen Jahre bildeten nicht allein fanatisierte SS-Gruppenführer, die mit Fackelzügen Blut- und Boden-Romantik inszenierten. Daneben setzten junge Akademiker auf Rationalität, Modernisierung und Fortschritt und nahmen ihre Karrierechancen im neuen Regime zielbewusst wahr. Die meisten blieben nach dem Krieg erfolgreich, und niemand fragte sie danach, was sie vor 1945 getan hatten. In diesem Buch, das erstmals 1997 erschien, veröffentlichte Götz Aly auch einen Text über die Rolle der Historiker Theodor Schieder und Werner Conze im Nationalsozialismus. Damit erreichte er, dass die im September 1998 auf dem Historikertag Versammelten sich endlich kritisch mit der Nazivergangenheit des eigenen Faches und seiner führenden Vertreter auseinandersetzten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hensinger
Erschienen bei FISCHER E-Books
Veröffentlicht im Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1999
Durchgesehene Lizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung des Argon Verlages GmbH, Berlin
© 1997 Argon Verlag GmbH, Berlin
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403238-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Die Zeit des Nationalismus
Vorbemerkung
Der Jahrhundertprozess
Erich Mielke und die »Bülowplatzsache«
Der lange Weg von Moabit nach Moabit
Recht und Gesetz
Die ersten Verhandlungstage
Ex oriente lux
Elend einer Kaderbiographie
L’affaire d’un seul …
Kleine Fluchten Ost
Sachsenhausen am Vorabend der Einheit
Die Harley oder das Gedächtnis der Stadt
Deutsches Kulturgut in Hohenschönhausen
Der 9. November: Pogrom und Revolution
Der Geruch von Auschwitz
Wertfreie Wissenschaft
Innere Wehrmedizin
Strafanzeige I: Insgesamt habe ich vielen geholfen
Strafanzeige II: Raum für neues Werden
Im Gehirn liegt die Führung
Die Schaffung des Standardgehirns
Forschung zum angeborenen Schwachsinn
Die Verwandlung von Subjekt in Objekt
Zeigen, dass Frauen auch etwas können
Kleine Fluchten West
Freispruch für Theodor Oberländer
Köpfe des deutschen Widerstands
Von Bayern lernen
Wochen für das Leben
Deutsches Normkollektiv
Die Verhinderung von »Bethel-Produkten«
Diagnostisch assoziierte »komplette Idiotie«
Das haben wir in Ulm immer so gemacht
Menschlich ehrlich, medizinisch sauber
Menschen, die lachen und weinen konnten
Herta hat sehr darunter gelitten
Wir kennen keine Liebe mehr
»Friedhofsgemüse« und beschleunigtes Ableben
Wohin mit unseren Altchen?
Das gute teure Gas
Rückwärtsgewandte Propheten
Willige Historiker – Bemerkung in eigener Sache
Ursprünge deutscher Sozialgeschichtsschreibung
Werner Conze und die »Judenfrage«
Die Anfänge deutscher Zeitgeschichtsforschung
Die Entjudung Restpolens
Revision und Revisionismus
Auschwitz: Black box, asiatische Tat
Kommerz und Betriebsklima
Biogas und Bundesbank
Weissmann: Die Banalisierung des Bösen
Goldhagen: Das Universum des Bösen
Rasse, Raum und Reichsgewalt
Erzählen, was nicht erzählbar ist
Arnold Schönberg und das Holocaust-Mahnmal
Biobibliographische Hinweise
Die Zeit des Nationalismus
Eine Buchreihe
Herausgegeben von Walter H. Pehle
Vorbemerkung
Zeitgeschichte wirkt massiv in die Gegenwart hinein, glüht und raucht noch. Ihr Ende, der Zeitpunkt, zu dem sie Geschichte wird, bemißt sich nicht nach einer festen Frist, sondern allein an der Fähigkeit späterer Generationen, die Folgen des Geschehenen zu bewältigen. Die empirische Forschung trägt dazu bei. Die immer noch notwendige Skandalisierung – einzelner Personen, der Banken, der Wehrmacht oder der Historikerzunft selbst – ist dabei nur notwendiges Mittel zum Zweck, gerichtet gegen diejenigen, die es sich in einsichtsarmen Vorstellungen von den »braunen Machthabern« (Hans-Ulrich Wehler) bequem machen, die von der unbefleckten Soldatenehre oder der widerstandsseligen Arbeiterklasse erzählen. Bei allem Streit historisiert der einzelne Forscher die Zeit der nazideutschen Massenverbrechen Schritt für Schritt. Er macht sie kalt, argumentiert für den Geschichtsfrieden, anders gesagt: für das gesellschaftliche Akzeptieren unumstößlicher Tatsachen.
Der Prozeß gegen Erich Mielke, den ich im Eingangskapitel beschreibe, zeigt, daß die politischen Nachbeben der DDR sehr viel schneller abklingen werden als die des Dritten Reichs. Darin liegt ein zentraler Unterschied zwischen dem nazistischen Großdeutschland und dem stalinisierten Kleinstdeutschland. Die gleichsetzende Charakterisierung als erste und zweite Diktatur erklärt wenig und verstellt den Blick auf die Unterschiede beider Systeme. Die DDR war wesentlich weniger gewalttätig; ihre gesellschaftlichen Veränderungen der rechtlichen und sozialen Ordnung gingen allerdings tiefer. Vereinigten sich im Nationalsozialismus alte und neue Eliten zu einem System von äußerster (vernichtender) Effizienz, so trennte sich die DDR – anders als die alte Bundesrepublik – weitgehend von der belasteten Intelligenz und begab sich kollektiv auf den Zweiten Bildungsweg – ein Grund, der zur mäßigen Effizienz dieses politischen Systems führte.
Die Frage nach den Kontinuitäten deutschen Denkens erlaubt die Annäherung an die Frage: Warum wurden die größten Massenverbrechen des 20. Jahrhunderts von Deutschen verübt? Zu diesen Kontinuitäten gehört zum Beispiel die programmatische Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Sie zieht sich von Bismarck über Ebert zu Hitler und weiter bis zu Kohl und Honecker. Daraus folgten die Überbetonung des Kollektiven, des Gemeinschaftlichen und die Geringschätzung der individuellen Freiheit. Der deutsche Hang zum ideologischen Egalitarismus findet im Rassismus eine durchaus logische Ergänzung. Dem Herrenvolk versprach das NS-Programm ein Mehr an Gleichheit, wenn schon nicht die Abschaffung der Klassenschranken, so doch die leichtere Überwindbarkeit. Die nationalsozialistische Revolution war der Versuch einer rassisch begründeten Eroberungs-, Raub- und Vernichtungspolitik zugunsten aller als arisch definierten Menschen. Heinrich Himmler sprach vom »Sozialismus des guten Bluts«. Dem staatlich gewollten Haß gegen das Fremde, gegen diejenigen, die nicht zum deutschen Normkollektiv gezählt wurden, entsprach die Sorge um das Volkswohl im Inneren.
So erklärt sich die Attraktivität für eine Vielzahl ganz unterschiedlich geprägter deutscher Intellektueller. Sie verschmolzen Macht, Geist und Wahn zu dem, was wir heute als NS-Gewaltverbrechen bezeichnen.
Berlin, im April 1999
Götz Aly
Der Jahrhundertprozess
Erich Mielke und die »Bülowplatzsache«
Gegen den Beschuldigten hätten sich wahrlich andere Vorwürfe erheben lassen. Ganz offensichtlich, so schien es zunächst, machte es sich die Berliner Staatsanwaltschaft 1991 hinter einem Ladenhüter bequem: Seit der Tat waren sechzig Jahre verstrichen; sie hatte sich anno 1931, am 9. August gegen 20.15 Uhr zugetragen. Damals waren die beiden Polizeihauptleute Paul Anlauf und Franz Lenk unweit der KPD-Zentrale erschossen worden. Ort des politisch motivierten Verbrechens war der Berliner Bülowplatz, später in Horst-Wessel-, dann in Rosa-Luxemburg-Platz umbenannt.
Übergeht man den Zeugen Arnold Munter und seine begreiflicherweise wenig präzise Aussage, so lebte 1992 niemand mehr, der den Hergang des Geschehens aus eigener Anschauung hätte berichten können. Die Staatsanwaltschaft behalf sich daher mit Urkunden. Sie mußten jeden erdenklichen Zweifel herausfordern – aufgrund ihres Alters, insbesondere aber wegen der Umstände ihrer Entstehung in den Jahren 1933/34. Dennoch eröffneten die zuständigen Berliner Gerichte das Verfahren. Vom 9. Februar 1992 an verhandelten fünf Richter der 23. Großen Strafkammer des Landgerichts Berlin, zwei Staatsanwälte, eine Nebenklägerin und drei Verteidiger über die mögliche Schuld des 83jährigen Angeklagten – Erich Mielke. Das geschah mindestens alle zehn Tage, so gebietet es die Strafprozeßordnung, höchstens jedoch zweimal wöchentlich, maximal eineinhalb Stunden – so verlangten es die medizinischen Sachverständigen. Der Prozeß dauerte mehr als zwanzig Monate. Er wurde – trotz aller Vorbehalte – zur lohnenden, im besten Sinn prozessualen Besichtigung der politisch-ideologischen Vexierbilder unseres Jahrhunderts.
Am 26. Oktober 1993 verkündete der Vorsitzende Richter Dr. Theodor Seidel schließlich das Urteil: sechs Jahre Haft für den Mörder Erich Mielke. Am 10. März 1995 bestätigte der Bundesgerichtshof den Schuldspruch.
Der lange Weg von Moabit nach Moabit
Erstmals verhandelt wurde die »Bülowplatzsache« im Juni 1934 – also knapp drei Jahre nach den Morden im »Jahre II der Nationalen Revolution«. Entsprechend den damaligen Ermittlungen hatten Erich Mielke und ein Mann namens Erich Ziemer das Verbrechen »vorsätzlich und mit Überlegung« begangen. Beide hatten sich, soviel konnte als sicher gelten, 1931 in die Sowjetunion abgesetzt. Doch obwohl die mutmaßlichen Haupttäter flüchtig waren, fand der sogenannte Bülowplatzprozeß statt. Er richtete sich gegen 15 angebliche Mittäter und Helfershelfer. Nach zehn Verhandlungstagen verhängte das Gericht mehrere Zuchthausstrafen und drei Todesurteile.
Die Grundlage des Urteils bildeten »Geständnisse« von verhafteten Kommunisten. Mit welchen Methoden solche Aussagen damals erzwungen wurden, bedarf unter Fachleuten keiner weiteren Erörterung, schien aber zu Beginn des Mielkeprozesses weder dem Gericht noch der Öffentlichkeit bekannt zu sein. So behauptete beispielsweise Jürgen Busche in der »Süddeutschen Zeitung«, die Richter und Staatsanwälte seien in den Jahren 1933/34 »keineswegs so schnell und rigoros in den Dienst der Diktatur genommen worden, wie man sich das im nachhinein vorstellen mag«; daher sei es nicht erlaubt, die Vorgehensweise »des damaligen Gerichts pauschalen Zweifeln grundsätzlicher Art auszusetzen«. Was und wen immer Busche mit solchen Generalistenweisheiten meinte, für das Bülowplatzverfahren treffen seine Sätze gewiß nicht zu.
Denn der Prozeß um die beiden ermordeten Polizeioffiziere war Teil einer juristischen Abrechnung mit der verhaßten Weimarer Demokratie, gleichzeitig diente er, denkt man an die »Röhm-Affäre«, der Ablenkung von den Gewalttaten der neuen Machthaber. Den Anklägern und Richtern ging es, folgt man dem »Völkischen Beobachter«, um »Rotmord« und darum, daß die 1931 »von einem Juden und einem Halbjuden« geführte sozialdemokratische Polizei in Sachen »Bülowplatz« lasch oder gar nicht ermittelt habe.
Noch deutlicher wird der politische Hintergrund in den Karrieren der beteiligten Juristen. So wechselte der mit den Ermittlungen und der Anklageerhebung im Mordfall »Anlauf/Lenk« betraute Staatsanwalt Dr. Helmut Jaeger wenig später zur Anklagebehörde am neu geschaffenen Volksgerichtshof. Jaeger starb in den siebziger Jahren als angesehener, anscheinend unbescholtener Mann, zuletzt hatte er als Senatspräsident am Oberlandesgericht München gewirkt. Der Vorsitzende Richter des Bülowplatzprozesses, Dr. Walter Böhmert, wurde vier Wochen nach dem Abschluß des spektakulären Verfahrens zum Vorsitzenden Richter am Berliner Sondergericht III ernannt. Zu seinen besonderen Zuständigkeiten gehörte die Aburteilung von »Judenhelfern«. Er verantwortete bis 1945 Dutzende justitiell verbrämter Morde. In einem Dienstzeugnis vom 1. Dezember 1936 steht: Böhmert hat »im Sommer 1934 den Prozeß betreffend Ermordung des Polizeihauptmanns Anlauf in ausgezeichneter Weise und mit vollstem Verständnis für die staatlichen Belange geleitet. Auf Grund des so begründeten Vertrauens …« Der »Völkische Beobachter« schwärmte: Landgerichtsdirektor Böhmert »ist einer der energischsten Richter Berlins« und schon »unter der Systemregierung höchst positiv wegen seines Vorgehens gegen die Rechtsanwälte Litten und Löwenthal aufgefallen« (die beide viele Kommunisten zu ihren Mandanten zählten). Demgegenüber hatte das liberale Berliner »8-Uhr-Blatt« am 18. Oktober 1932, also in den letzten Wochen der Weimarer Demokratie, berichtet: »Es scheint, daß jetzt auch einzelne Richter in den zackigen Ton der SA verfallen wollen. Jedenfalls hat man diesen Eindruck bei Herrn Landgerichtsdirektor Böhmert.«
In gewissem Sinn hatte Jürgen Busche im Februar 1992 also recht: Diese Juristen waren »keineswegs rigoros in den Dienst der Diktatur genommen« worden – vielmehr taten sie aus innerster Überzeugung genau das, was das Dritte Reich von ihnen erwartete.
»Die Sonne bringt es an den Tag«, so lautet eine schöne Volksweisheit, die die wilhelminischen Baumeister in die Fassade des Moabiter Kriminalgerichts hatten einmeißeln lassen. Sie legt die Vorstellung nahe, daß das gleißende Licht der Strafverfolgung am Ende die Wahrheit zutage fördern werde. Im Mielkeprozeß gelang das durchaus. Aber nicht allein mit den üblichen Mitteln der Justiz, sondern auch deshalb, weil zwei historisch gebildete Journalisten, die eigentlich nur über den Prozeß hatten berichten wollen, Beweismittel aufstöberten, auf die kein Staatsanwalt gestoßen wäre. Der eine war Jochen von Lang, der während der Hauptverhandlung an einem Fernsehfilm zur Biographie Mielkes arbeitete; der andere war der Autor.
Als Gerichtsreporter der »taz« hatte ich zunächst versucht, das Verfahren als judikatorische Nazi-Altlast zu entsorgen und dessen Einstellung zu erreichen. Doch dann wurde ich – infolge fortgesetzter Nachforschungen und ganz gegen meine ursprüngliche Intention – zum Akteur, nämlich zum Beweismittel der Anklage, denn im März und im Mai 1993 fand ich im Moskauer Kominternarchiv Dokumente, die Mielke belasteten. Ich veröffentlichte sie, stellte die Kopien der Nebenklägerin zur Verfügung und bekundete als Zeuge die Übereinstimmung mit den Originalen. (Der Vorsitzende Richter würdigte die Aussage in der mündlichen Urteilsbegründung mit der Bemerkung: »Der Zeuge Dr. Aly war ein Glücksfall der Wahrheitsfindung.«)
Recht und Gesetz
Den publizistischen Flankenschutz für den zweiten Prozeß um die Morde auf dem Berliner Bülowplatz hatte Jochen von Lang mit seinem Buch »Erich Mielke – Eine deutsche Karriere« (Berlin 1991) in zunächst etwas problematischer Weise besorgt. Von Lang erweckte darin den Eindruck, als hätte sich in der deutschen Polizei und Justiz zwischen 1931 und 1934 so gut wie nichts verändert. Während er in anderen Büchern die politische Abteilung (Ia) der preußischen Polizei als Keimzelle der Gestapo beschrieben hatte, plauderte er in dem Mielke-Buch – vorgeblich aus »Verantwortung vor der Geschichte« – von einer harmlos-professionellen Polizeiabteilung, die nicht ein einziges Mal so genannt wird, wie sie damals schon hieß: Geheimes Staatspolizeiamt. In einem Aktenstück, das von Lang seinem Buch wohl eher aus Versehen als Faksimile beigab, steht beispielsweise: »Auf dieses Geständnis hin gelang es, (Max) Matern in seiner Wohnung festzunehmen und ihn nach einigen Tagen zu einem teilweisen Geständnis zu veranlassen.« In dürrem Polizeideutsch verrät das Schriftstück zumindest die Möglichkeit, eher aber die hohe Wahrscheinlichkeit von Folter. Doch tilgte von Lang in seinem Text genau diesen Hinweis und suggerierte die Spontaneität und Freiwilligkeit der Aussage: »Kaum war Matern festgenommen, gestand auch er bereitwillig, was er wußte. Er bestätigte, daß der Genosse Erich Mielke sich zur Rolle des Attentäters freiwillig gemeldet hatte …«
Den Haftbefehl gegen Mielke und Ziemer erließ das Amtsgericht Berlin-Mitte am 23. April 1933. Grundlage waren die Aussagen verhafteter, in die Tat offenbar involvierter Kommunisten. Sie waren vier Wochen zuvor nicht etwa von der Polizei, sondern vom SA-Sturm 102 festgenommen worden, den der zum »Hilfspolizisten« ernannte Scharführer Albrecht Kubick leitete. Wie gravierend die Rechtsverstöße waren, die sich Kubick bei seinen »Ermittlungen« und Festnahmen in der »Mordsache Lenk/Anlauf« zuschulden kommen ließ, war bald aktenkundig.
So vermerkte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft im Oktober 1934, daß Kubick, der schon »aus anderen Sachen bekannt« sei, selbst gefangene Frauen »schwer mißhandelt« und mit ihnen »geradezu Allotria getrieben« habe. Dabei habe er auch »Schmucksachen und dergleichen« beiseite geschafft. Am 21. August 1934 wurde Kubick von der Gestapo »hinsichtlich seiner Tätigkeit bei der Berliner Polizei« im Jahre 1933 wegen Unterschlagung vernommen: Er hatte die Harley-Davidson des ebenfalls in der Bülowplatzsache beschuldigten, aber flüchtigen Wilhelm Peschky »als sein Eigentum betrachtet«.
1948 schilderte der Kommunist Wilhelm Krug vor der Berliner Kriminalpolizei, wie er im September 1933 von einem Kriminalassistenten Pohlenz verhaftet wurde. Seine Aussage zeigt, mit welchen Techniken die juristischen Grundlagen auch für den Bülowplatzprozeß geschaffen wurden. Krug berichtete: »Ich wurde nun mittels PKW zur Prinz-Albrecht-Straße transportiert und in einem Zimmer des zweiten Stockwerks längere Zeit befragt – nach 15 Genossen, welche ich zwar zum Teil kannte, was ich aber bestritt. Dabei wurde ich von Pohlenz dermaßen in rohester Weise mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und wenn ich zu Boden sackte mit den Füßen getreten. Ich mußte dann mein Gesicht reinigen und wurde zum Columbiahaus nach Tempelhof gebracht. Hier wurde ich durch einen gewissen Kubick vernommen. Von Kubick wurde ich mittels eines langen Gummiknüppels mißhandelt, weil ich keine Genossen verraten wollte. Ich bin an diesem Tage im Keller des Columbiahauses mit Lederpeitschen zweimal geschlagen worden, im Auftrag von Kubick durch ein Sonderkommando. Die Folterungen waren so ungeheuerlich, daß ich nachmittags vor Verzweiflung einen Selbstmordversuch unternahm, indem ich mir mittels einer Glasscherbe die Pulsadern beider Arme aufschnitt.«
Die protokollierten Aussagen, auf die sich der Mielkeprozeß sechzig Jahre später zunächst stützte, hatten Männer wie Kubick 1933/34 aus den Gefangenen herausgeprügelt. Der Einfachheit halber ließen die Staatsanwälte 1991 die Anklageschrift, die ihre Amtsvorgänger 1934 in der Registratur abgelegt hatten, fotokopieren.
Die ersten Verhandlungstage
Protestfolklore vor den Portalen des Kriminalgerichts: »Freiheit für Erich Mielke«, »Hände weg von den Grenzschützern und von Honecker«, »Schluß mit diesem obszönen Prozeß«, fordern Plakate, fordert eine Frau per Megaphon namens einer Organisation »Spartakist«, die sich der Vierten (trotzkistischen) Internationale zurechnet. Im Gebäude Fernsehkameras. »Lassen Sie den Schöffen durch!« Der Arzt bleibt stecken, sein Reanimationsgerät verfängt sich zwischen eingekeilten Reportern. Doch dann treten die fünf Berufs- und Laienrichter und ihre vorsorglich bestellten Ersatzleute ein. Hinter der Balustrade, in einer Panzerglaskabine, die man auf dem Höhepunkt der Baader-Meinhof-Zeit eingebaut hat, soll der Angeklagte sitzen. Sichtbar ist nichts als ein brauner Lederhut. Der Mann hat auf einem grünlich gepolsterten Senatsmöbel Platz nehmen müssen, den Kopf vornüber auf das Aktenpult gelegt. Manchmal schwankt er bedenklich, doch dann –»Sind Sie Erich Mielke?« – spricht er ein lasches »Ja«. Zweimal fühlt der Bereitschaftsarzt ihm den Puls. »In Ordnung? Wir verhandeln weiter!«
»Kann so ein Mann ruhig schlafen?« fragt »Bild« am Morgen des ersten Verhandlungstages und bleibt die Antwort schuldig. Aber wir waren dabei. Alpträume schüttelten ihn, mal träumte es ihm russisch, mal deutsch, dann wieder französich und spanisch. »Jetzt hängen sie mir auch das noch an!« delirierte der Schlafende. »Ich, seit eineinhalb Jahren in den Klauen der Klassenjustiz …« Das flache Murmeln schwoll an: »Ich, der immer treu gearbeitet und für unsere Sache gekämpft hat, ich soll nun Verbrecher sein?! Ein Mensch wie ich, der doch nur wollte, daß alles in Ruhe und Ordnung vor sich geht … Nein! Cretino, Provokateur, fous le camp! Alles Lug und Trug! Nitschewo: Ich liebe euch doch alle, alle, alle.«
Im Gerichtssaal träumt der Angeklagte weiter: »Ich kann nicht mehr!« –»Ick will hier raus!« entringt es sich ihm in bestem Berlinerisch. Mielkes Pflichtverteidiger Hubert Dreyling, der Wert auf die Mitteilung legt, er sei FDP-Mitglied, begründet seinen Einstellungsantrag damit, daß die Tat nicht als Mord, sondern allenfalls als Totschlag zu werten und daher unzweifelhaft verjährt sei. Hilfsweise führt Dreyling aus, daß auch der zweite, 1947 vom Amtsgericht Berlin-Mitte erlassene Haftbefehl gegen Mielke, der nach Ansicht der Staatsanwaltschaft die Verjährung unterbrach, niemals rechtswirksam wurde, da er nicht – wie zwingend erforderlich – von einem Richter, sondern von einem sogenannten Hilfsrichter unterzeichnet worden ist. Dieser Hilfsrichter konnte 1947 im Sowjetischen Sektor Berlins in aller Naivität deshalb einen Haftbefehl gegen Mielke erlassen, weil der 1942 ergangene Führererlaß zur »Vereinfachung der Rechtspflege im Kriege« noch galt.
Was die Verteidiger nicht wußten und daher nie als Argument für die Verjährung anführten, ist dies: Am 15. Oktober 1937 verzichtete der deutsche Staat auf die strafrechtliche Verfolgung Mielkes. Damals setzte die Gestapo den Gesuchten – irrtümlich, denn er war in Spanien – auf die makabre Sammelliste jener »in der Sowjetunion verhafteten Reichsdeutschen, welche auf Grund ihrer kommunistischen und staatsfeindlichen Betätigung im In- und Auslande zur Ausbürgerung vorgeschlagen werden«, weil »deren Rückkehr nicht erwünscht ist«. Über »Mielke, Erich« heißt es dort: »Ist an der Erschießung der Polizeihauptleute Anlauf und Lenk beteiligt gewesen.« Ganz offensichtlich machte die Gestapo diese deutschen Kommunisten zu Staatenlosen, um Stalins GPU das Mordgeschäft jenseits diplomatischer Verwicklungen zu erleichtern.
Am zweiten Prozeßtag, dem 17. Februar 1992, hat das öffentliche Interesse bereits nachgelassen. Nach 35 Minuten unterbricht Prozeßintendant Theodor Seidel den Moabiter Historienschwank. Der in der Doppelrolle des Kannitverstan und des eingebildeten Kranken großartige Volksschauspieler Erich Mielke mimt den Ungehaltenen, fehlt ihm doch sein wichtigstes Requisit. »Man hat mir«, mault er aus den Tiefen der Versenkung, »meinen Hut geklaut.« Zweimal hustet er sodann, einmal wird sein Blutdruck gemessen und ein internistisches »Okay« über die Rampe gerufen.
So könnte man die Hauptverhandlung gegen Erich Mielke beschreiben, ginge es wirklich um eine Posse. Bekanntlich ist in Berlin-Moabit nicht jenes Ekel aus dem Nachtreich des Bösen angeklagt, der Herr über Tausende Agenten, Hunderttausende Spitzel und Wanzen. Systematisches staatliches Unrecht scheint der Berliner Justiz eher Beißhemmungen als zupackende Anklagelust zu verursachen.
Zu verhandeln wäre die Rolle des Ministeriums für Staatssicherheit: die Unterdrückung, Funktionalisierung und Bevormundung des Menschen durch den Menschen; der permanente Versuch, Individualität und persönliche Freiheit zu enteignen; den einzelnen regelrecht zu verstaatlichen. Ein solches Verfahren dürfte nicht allein offensichtliche Kapitalverbrechen in den Mittelpunkt stellen, vielmehr müßte dabei die alltägliche Gegenwart, die totalitäre Realität »Stasi« prozessual erörtet und nachgezeichnet werden.
Aber statt des Mannes, der den Staat intim und Intimität staatlich machte, steht ein anderer vor Gericht. Ein 23jähriger, noch unreifer Arbeitsloser aus dem Berliner Wedding. Formalrechtlich haben die beiden Herren mit demselben Namen, Geburtsdatum und Fingerabdruck nichts miteinander zu tun. Doch die Lage ist noch unübersichtlicher. Auf der Anklagebank duckt sich ein Dritter, noch nicht einmal der Schatten des jugendlichen oder erwachsenen Mielke. Dort hockt ein selbstmitleidiger deutscher Mann, gebrochen nicht vom Alter, sondern weil ihm die Insignien der Macht entrissen wurden, weil er ohne Spießgesellen und Satrapen, ohne Uniform und Orden bestenfalls zum ideologischen Pflegefall taugt.
In den medizinischen Gutachten, die der Wahlverteidiger Gerd Graubner in den Prozeß einführt, liest sich das so: Der Patient leide am »Zusammenbruch seiner politischen und sozialen Werte«, seine (überdurchschnittlichen) Altersgebrechen seien bis zum Herbst 1989 »in seinem Arbeitsmilieu kompensiert« gewesen, danach »trat Dekompensation durch den Verlust des Arbeitsplatzes ein«. Eben deshalb, so folgern die Gutachter, »ist es ausgeschlossen, daß er ein langwieriges Verfahren durchstehen kann«.
Was bleibt, ist Spekulation: Der 23jährige Mielke wird einer von vielen gewesen sein, einer, für den die Hoffnung auf ein besseres Leben identisch war mit dem Sieg der proletarischen Revolution über die verrotteten, krisengeschüttelten Verhältnisse der Zeit; einer, der in der Partei Heimat und Orientierung fand, auf Aktionismus abfuhr, sich einer kruden »Propaganda der Tat« verschrieb. »Links, links, links«, sang der junge Mielke, »hier wird nicht gemeckert, hier gibt es Dampf, denn was wir spielen, ist Klassenkampf – nach blutiger Melodie.« Moderner ausgedrückt: »Macht kaputt, was euch kaputtmacht!«
Mielke repräsentiert ein Denken, das das Leben des einzelnen im Namen einer besseren Welt geringachtet und es, falls »erforderlich«, zerstört. Dafür steht die Nebenklägerin Dora Zimmermann, die letzte noch lebende Tochter Anlaufs. Für diese Frau – eine Ostberlinerin – gibt es eine plausible und gerechtfertigte Kontinuität, die es für das Gericht nicht geben darf: »Ich wußte«, so sagt sie, »daß er der Mörder meines Vaters war. Es war schlimm für mich, als er nach dem Krieg seine widerwärtige Karriere machte.«
Frau Zimmermann überreicht in der Hauptverhandlung den Tschako ihres Vaters zum Beweis dafür, daß er hinterrücks durch einen Kopfschuß niedergestreckt wurde. Sie tritt damit der Behauptung des zweiten Wahlverteidigers Jürgen Wetzenstein-Ollenschläger entgegen, der am ersten Verhandlungstag vorgetragen hatte, Anlauf sei von vorn – also nicht heimtückisch – erschossen worden. Auch die gerichtsmedizinischen Gutachten von 1931 widerlegen den Anwalt. Aber seine Einwände gegen die NS-Justiz bleiben: »Die restlose Ausrottung des inneren Feindes«, so zitiert er den Aufsatz, den ein Landgerichtsdirektor im Mai 1933 in der »Deutschen Juristenzeitung« veröffentlichte, »gehört zur deutschen Ehre. An ihr kann der Richter durch großzügige Auslegung der Strafprozeßordnung teilnehmen.«
Wetzenstein-Ollenschläger ist in Ostberlin ansässig. Sein Kollege Wolfgang Vogel hat ihm den Fall übergeben. Wetzenstein wurde 1942 in Oberfranken geboren, ging nach einer Druckerlehre offenbar aus politischer Überzeugung in die DDR und studierte dort. Später stieg er zum Richter, dann zum Direktor am Bezirksgericht Berlin-Lichtenberg auf. Er hat politische Urteile auf dem Gewissen, unter anderem das gegen Vera Wollenberger.
Nach wenigen Tagen holt Wetzenstein diese Vergangenheit ein: »Du Schwein, verdammtes Schwein du, ich krieg’ dich«, so stürzt eine Dreißigjährige auf ihn zu und zerrt an seiner Krawatte. Die Frau hat auf ihre Weise recht. »Gestern beim Mielkeprozeß«, berichtet »Super« anschließend, »hat eine zierliche kleine Frau (1,50 m) getan, was Millionen nachempfinden können: Sie hat einen Großen des SED-Regimes, einen Stasi-Richter, verprügelt. Sie wurde von eben diesem Stasi-Richter als 16jährige zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt.« Laut »BZ« fragt »Kornelia«: »Warum darf so ein Mann immer noch Anwalt sein?«
Die Berliner Justizsenatorin Jutta Limbach reagiert prompt. Nur Stunden später erhält Wetzenstein –»Vertraulich! Verschlossen!« – ein Schreiben ihrer Verwaltung »Betr.: Rücknahme der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft«. Nach dem Einigungsvertrag wurden diejenigen ostdeutschen Rechtsanwälte nicht überprüft, die vor der Wiedervereinigung und gar vor der Wende (wie Wetzenstein, der möglicherweise zum Nachfolger von Wolfgang Vogel aufgebaut werden sollte) ihre Zulassung erhielten. Wenige Tage nach dem Übergriff der Kornelia Voigt verschwindet Jürgen Wetzenstein-Ollenschläger spurlos – bis heute. Er verfügt, so munkelt man in Berlin, über den Zugang zu geheimen Konten der früheren Staatssicherheit.
Am dritten Verhandlungstag hat der Staatsanwalt, Karlheinz Dalheimer, das Wort. Die tödlichen Schüsse auf den unter Kommunisten verhaßten Vorsteher des 7. Polizeireviers (Alexanderplatz), Paul Anlauf, seien vorsätzlich und aus mehreren niedrigen Beweggründen abgegeben worden. Lenk starb nur deshalb, weil er Anlauf zufällig begleitete. Mit der vorsätzlichen Mordtat habe man zum einen Rache für den am Vortag von der Polizei erschossenen Arbeiter Fritz Auge üben, zum anderen »die Vertreter des ungewollten Weimarer Staates« treffen wollen. Politische Motivation im Zusammenhang mit Mord sei aber stets als niedrig anzusehen, es sei denn, sie ist durch den Artikel 20 des Grundgesetzes gedeckt. Das dort formulierte Recht auf Widerstand könne der Angeklagte für sich aber nicht in Anspruch nehmen, da sich die Tat absichtsvoll gegen ein demokratisches Staatswesen richtete.
Auch habe die Alliierte Kommandantur schon im Oktober 1945 »die sachliche Unabhängigkeit der Richter« bestätigt und in aller Regel geachtet – daher sei der neuerliche Haftbefehl aus dem Jahr 1947 rechtlich einwandfrei. Allerdings beurteilt Dalheimer die Verwertbarkeit der 1933/34 getätigten Ermittlungen zurückhaltend: Wenn sich im Verlauf der Hauptverhandlung zeige, daß die damaligen Praktiken den »heutigen Vorschriften nicht genügen«, so sei dies bei der Würdigung der Beweismittel zu berücksichtigen.
Nach dreißig Minuten zieht sich die Kammer zur Beratung zurück –»vielleicht bis heute nacht«, wie der Vorsitzende bemerkt. Die Richter entscheiden sich, wie »Bild« schon vor dem nächsten Prozeßtag zu entnehmen ist, für die Argumente der Staatsanwaltschaft. Die Verjährung habe gelegentlich »geruht«, sei es durch das »Ende der deutschen Rechtspflege am 8. Mai 1945« oder weil die Sowjetische Militäradministration die Akten 1947 kurzerhand einbehielt und so die weitere Verjährung bis 23. Februar 1990 »hemmte«. Dann folgt eine kurze Verlesung der Anklage: »Der Arbeiter Erich Mielke wird angeklagt, am 9. August 1931 den Polizeihauptmann Anlauf getötet zu haben …«
»Nazi-Anklage« schimpfen Dreyling und die Mehrheit der Zuschauer. »Die Aussage von Beweismitteln«, hält Seidel dagegen, »kann erst nach Prüfung der Beweismittel gewürdigt werden.« Der Hinweis entspannt das Verhandlungsklima: Staatsanwälte und Verteidiger fangen an, einander zuzuhören, das Gericht pariert das Dauerfeuer der Anträge mit differenzierender Geduld, und selbst der Angeklagte beginnt, seinem Fall aufrecht, fast neugierig zu lauschen: Es geht um die Spannung zwischen Wahrheitsfindung einerseits und Rechtsgarantien andererseits. Nur teilweise weist die 23. Strafkammer den Antrag des Verteidigers Stefan König zurück, der das Mandat des verschwundenen Wetzenstein übernommen hat. König, der mit einer beachtlichen Arbeit über die Rolle von Rechtsanwälten im Dritten Reich promoviert hat, verlangt, keines der Protokolle aus den Jahren 1933/34 zu verlesen, weil die Vernommenen in ihren »elementaren Rechten« beschränkt und nicht hinreichend oder überhaupt nicht von Verteidigern ihrer Wahl beraten worden seien. Immerhin beschließt das Gericht, die (polizeilichen) Aussagen des 1934 angeklagten Michael Klause – die Stütze der alten Anklage – nicht zu verwerten, da Klause nach seiner Verhaftung zunächst in einer sogenannten SA-Unterkunft untergebracht und »mit hoher Wahrscheinlichkeit mißhandelt wurde«.
Weitergehende Anträge weist das Gericht zurück. Wie die Staatsanwälte sehen auch die Richter insbesondere die Aussagen des 1934 zu vier Jahren Zuchthaus verurteilten Johannes Broll als unverdächtig an. Broll war 1932 von der KPD zur NSDAP übergetreten und hat sich – so vermutet das Gericht – aus freien Stücken geäußert. Aber stand nicht auch er unter Druck? Lenkte er vielleicht von der eigenen Tatbeteiligung ab? Übertrieb er, um seinen neuen Kumpanen einen Gefallen zu tun? Nannte er Mielke und Ziemer nur deshalb, weil er wußte, daß sie nicht greifbar waren, ihn nicht in Widersprüche verwickeln konnten?
Ex oriente lux
Die Urkunde schien nebensächlich, die Verlesung fast überflüssig: Es handelte sich um eine Notiz aus der deutschen Emigrantenzeitung »Pariser Tageblatt«, veröffentlicht während des Bülowplatzprozesses im Juni 1934. Nach dieser Meldung hatten sich im Exil die »wahren Täter« zu den Morden bekannt, zwei Männer mit den Namen Mielke und Ziemer.
Der vorsichtige Stolz, mit dem Theodor Seidel den Zeitungsartikel als nicht NS-kontaminierte Urkunde in die Verhandlung eingeführt hatte, verflog rasch: »Selbstverständlich«, wandte die Verteidigung ein, »mögen die beiden das damals so gesagt haben; solche Erklärungen waren in der Geborgenheit des Exils nicht unüblich; so half man damals den Freunden und Genossen, die in das mörderische Räderwerk der NS-Justiz geraten waren …«
Ich war gerade aus Moskau zurückgekehrt, wo ich zwei Wochen vor jenen Erörterungen als Historiker zur deutschen Judenpolitik im Sonderarchiv gearbeitet hatte. Als Journalist sprach ich bei dieser Gelegenheit im Archiv der KPdSU und Komintern vor, das mittlerweile die etwas behäbige Bezeichnung »Zentrum zur Bewahrung zeitgenössischer Dokumentationen« führt. Beim Stichwort »Mielke« zeigte man sich nicht uninformiert. Doch kühlte die Freude über den – prinzipiell erwünschten – Westbesuch bei einigen Gesprächspartnern merklich ab, als ich das Thema und die möglichen Fundstellen näher erklärte. Nein, die Unterlagen der Kontrollkommission der Kommunistischen Internationale und die der Vertretung der KPD bei der Komintern könne man nicht vorlegen. Mal hieß es, solche Überlieferungen gebe es überhaupt nicht, mal, sie seien ungeordnet. Die an deutschen Lehnwörtern reiche russische Sprache hatte seit kurzem das schöne Wort »Datenschutz« inkorporiert. Schließlich hieß es: »Wir können die Materialien nicht vorlegen, da es sich um eine außerrussische Angelegenheit handelt, über die nur die Nachfolgerin der KPD, nämlich die PDS, befinden« könne. (Den Benutzungsantrag, den ich bald darauf an den damaligen Parteivorsitzenden Gregor Gysi richtete, blieb trotz mehrerer Nachfragen bis heute unbeantwortet.)
Am Ende einigten wir uns im März 1992 auf die Einsicht in die schriftlichen Hinterlassenschaften der »Lenin-Schule«. Dort, in der Komintern-Schule zur Ausbildung von Berufsrevolutionären, wurde Erich Mielke von 1932 bis 1934 zum kommunistischen Kader geformt – sein Deckname »Paul Bach«. Nach der Schüler-Personalakte »Mielke-Bach« befragt, antwortete einer der Archivare nach längerem Suchen und Diskussionen im Hintergrund, sie sei nicht da –»KGB«, fügte er murmelnd hinzu. Dafür aber gab es die Personalakte »Ziemer« alias »Georg Schlosser«.
Dort fanden sich – ex oriente lux – zwei handgeschriebene Lebensläufe. Am 6. März 1932 schrieb Ziemer: »August 1929 wurde ich zu den P.S.S.-Gruppen [Partei-Selbstschutz] im U.B. Nord [Unterbezirk Berlin-Wedding/Reinickendorf] zugezogen. Ende 1930 wurde ich dort Leiter einer Normalgruppe (5 Mann). Wir führten die übl. Arbeit der Gruppen durch (Selbstschutz, K.-L.-Haus-Wache [Karl-Liebknecht-Haus], Demonstrationen, einz. Aktionen, Waffenreinigung und -transport usw.). Letzte Aktion Bülowplatz … Wegen der Bülowplatzgeschichte wurde ich von der Partei vorsichtshalber nach der S.U. geschickt … Die Hauptangaben dieses Lebenslaufes kann Genosse Hans Kippenberger, M.d.R., bestätigen.«
Noch deutlicher formulierte Ziemer in einem Entwurf, den ein anderer mit Rotstift korrigiert und entschärft hatte: »Schon im August 1929 wurde ich zur Terrorgruppenarbeit zugezogen. Ich lernte dort über Pistolen (08, Ortgis, Mauser), Gewehr 98. Die Arbeit war: Schutz von Versammlungen und Demonstrationen, Waffen- u.Munitions-Reinigung und Transport, Wachen im K.-L.-Haus, einzelne Kampagnen usw. Ende 1930 wurde ich Gruppenführer einer Normalgruppe von 5 Mann. Meine letzte Arbeit für die Gruppe war die Bülowplatzsache, die ein anderer Genosse und ich zusammen ausführten.«
Vor dem Hintergrund dieser Dokumente wurde klar, daß die Selbstbezichtigung von Mielke und Ziemer während des Bülowplatzprozesses im Jahr 1934 zumindest im Fall Ziemer den Tatsachen entsprach. Naheliegend war, daß sich in der Personalakte, die die Lenin-Schule über Mielke angelegt hatte, ganz ähnliche Lebensbeschreibungen finden würden. Immerhin schrieb Mielke in einem Lebenslauf aus dem Jahr 1951, den Jochen von Lang veröffentlicht hatte, er sei seinerzeit »wegen der Bülowplatzsache von der KPD in die S.U. geschickt« worden. Daher beantragte die Nebenklägerin Dora Zimmermann, die in der »taz« vom 21. März 1992 veröffentlichten Lebensläufe und Tatbekenntnisse Ziemers als Beweismittel in den Prozeß einzuführen.
Aber nicht nur in Moskau fanden sich neue Dokumente, auch in Potsdam. Die Angestellten des SED