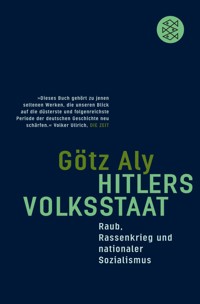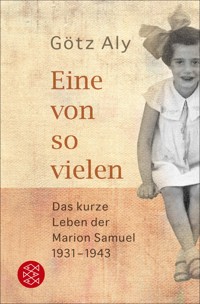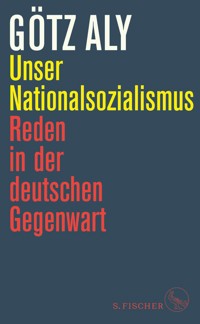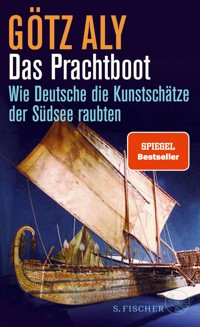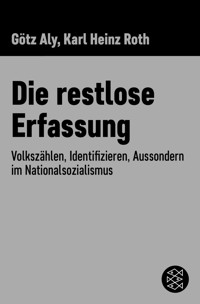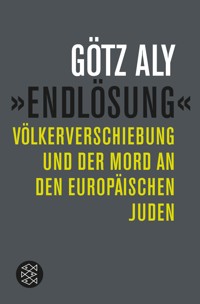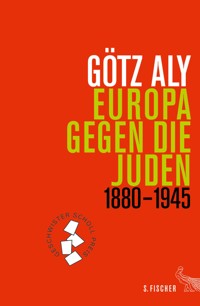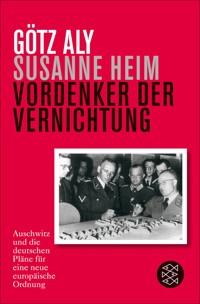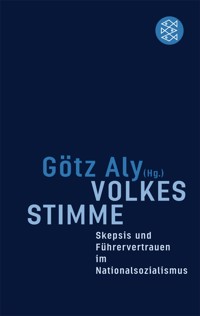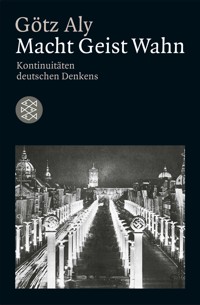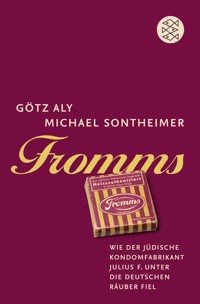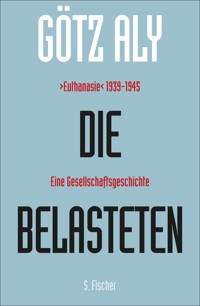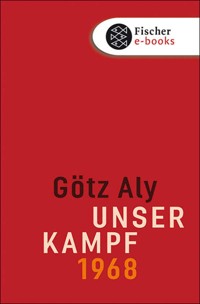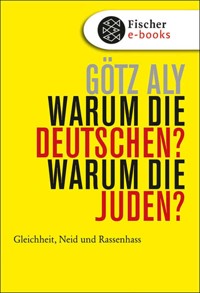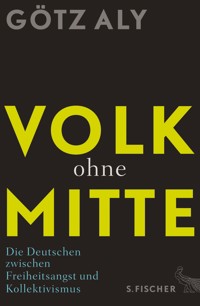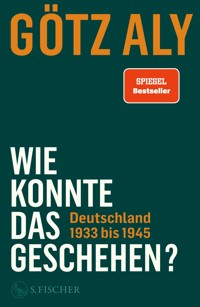
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Götz Aly zählt zu den bekanntesten Autoren zur Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust – hier stellt er die zentrale Frage: Wie konnte das geschehen? In einer schweren Krise wurde die NSDAP 1932 zur mit Abstand stärksten Partei gewählt. Bald konnte sie die Macht übernehmen und auf wachsende gesellschaftliche Zustimmung bauen. Hitler brauchte den Krieg – das Volk fürchtete sich davor. Dennoch terrorisierten schließlich 18 Millionen deutsche Soldaten Europa. Wie kam es dazu? Warum beteiligten sich Hunderttausende an beispiellosen Massenmorden? Die Antwort ist vielschichtig. Die NSDAP versprach den Deutschen Aufstieg und Wohlstand, zugleich hielt man die Menschen in Bewegung, keine Atempause, keine Zeit zum Nachdenken, so ging es Richtung Krieg. Als der Glaube an einen Sieg nachließ, wurde aus der Volksgemeinschaft eine Verbrechensgemeinschaft. Jeder konnte wissen, welche Schuld die Deutschen auf sich luden, die Angst vor dem, was nach einer Niederlage geschehen würde, wurde bewusst geschürt. Götz Aly schildert in einer fesselnden Erzählung die Herrschaftsmethoden, mit denen die NS-Machthaber Millionen Deutsche in gefügige Vollstrecker oder in vom Krieg abgestumpfte Mitmacher verwandelten – und von denen nicht wenige beängstigend aktuell sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1006
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Götz Aly
Wie konnte das geschehen?
Deutschland 1933 – 1945
Über dieses Buch
In einer schweren Wirtschaftskrise wurde die NSDAP zur mit Abstand stärksten Partei gewählt. Im Januar 1933 ergriff Hitler die Macht und errichtete einen gesellschaftlich gestützten Schurkenstaat. Warum wurden Millionen Deutsche zu aktiven oder stillen Mitmachern? Warum beteiligten sich Hunderttausende an beispiellosen Massenmorden? Warum terrorisierten 18 Millionen deutsche Soldaten Europa vom Nordkap bis zum Kaukasus? Auf diese Fragen gibt Götz Aly Antworten. Er zeichnet ein einzigartiges Panorama der damaligen deutschen Gesellschaft und der gewöhnlichen wie der abgründigen Herrschaftstechniken Hitlerdeutschlands.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Götz Aly ist Historiker und lebt in Berlin. Für seine Bücher wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Heinrich-Mann- und dem Ludwig-Börne-Preis. 2018 erhielt er für »Europa gegen die Juden 1880–1945« (S. Fischer) den Geschwister-Scholl-Preis. In »Wie konnte das geschehen?« bündelt er seine jahrzehntelangen Forschungen zu einer großen Gesamtdarstellung Hitlerdeutschlands und der Machttechniken der Nationalsozialisten.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
ISBN 978-3-10-490690-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Die Frage aller deutschen Fragen
1 Wie konnten all diese Verbrechen geschehen?
2 Hinweise zu den Quellen und zur Lektüre
I Antisemitismus und soziale Mobilität
1 Völkermorde der Jungtürken, ein Vorbild
2 Die NSDAP, Partei der Aufstiegsfreudigen
3 Soziales Emporstreben – Quelle des Neids
4 Wer gehört zur Unterrasse, wer zur Oberrasse?
II Auf dem Weg zur Machtübernahme
1 Hitler als Kanzler der »Inneren Einheit«
2 Motive: »Warum ich Nationalsozialist wurde«
3 Die Revolte der Jungen gegen die Republik
4 Akademisch befeuerte Vernichtungswünsche
5 Der protestantische Tanz um das Braune Kalb
III Hitler festigt seine soziale Basis
1 Mieten-, Kündigungs- und Pfändungsbremse
2 Der Deutsche Sozialismus, eine Alternative
3 Die Einzelgewerkschaften elegant eingegliedert
4 Stilles Mitmachen wird 1945 zu Widerstand
5 Die Wahlerfolge der NSDAP 1933 und 1935
IV Im Friedensglück dem Krieg entgegen
1 Tempo: Die tödliche Logik politischer Raserei
2 Die »Partei der Jugend« führt ihr »junges Volk«
3 Kleriker zermürben, katholische Milieus zerstören
4 Hitler und Göring reden 1936 offen vom Krieg
5 Totalitärer Sozialkapitalismus – ein Albtraum
V 1938: Zwischen Angst und Hoffnung
1 Volksnah, autoritär und illiberal demokratisch
2 Aktion, Aktion, Aktion: Leben wie im Kino
3 Goebbels: Die Stimmung zur Siedehitze steigern
4 Enteignung der Juden für die Kriegskasse
5 Die nihilistische Schweinerei namens Rasse
VI 1939: Raubkrieg statt Staatsbankrott
1 Das Volk an schwerste Belastungen gewöhnen
2 Beginn einer mörderischen Konkursverschleppung
3 Die meisten Deutschen fürchten den Krieg
4 Hitler verheimlicht dem Volk riesige Schulden
5 Kriegsangst und Kampfeswillen, ein Paradox
VII Mit Brot und Spielen in den Krieg
1 Die Herrschaft über die »Masse der Mitte«
2 Das kann doch einen Landser nicht erschüttern
3 Genießen und profitieren im Paradies der Räuber
VIII 1940: Sieghaft, mörderisch und ratlos
1 Parallelaktionen Gnadentod und Heim-ins-Reich
2 Das Morden gelingt, das Umsiedeln scheitert
3 Hitler weiß nicht, wie es weitergehen soll
IX Der Russlandfeldzug scheitert schnell
1 Leningrad vom Erdboden verschwinden lassen
2 In der Heimat: Bangen, Hoffen und Galgenhumor
3 Von der Wehrmacht wild herumgewirbelt
4 Ende Juli 1941 steht Hitler vor dem Nichts
5 Bischof Galen stoppt die Euthanasiemorde
X Der Weg in die Verbrechensgemeinschaft
1 Goebbels erfindet die deutsche Kollektivschuld
2 Schuldumkehr: »Alljudas Vernichtungspläne«
3 Judenmorde: »phantastisch, aber durchzuführen«
4 Der Weltkrieg ist da – »Finis Germaniae«
5 Lösung der Judenfrage »in letzter Konsequenz«
XI Die Deutschen und der Judenmord
1 Ein Volk wird in die Mitwisserschaft gezogen
2 Soldaten reden und schreiben über Verbrechen
3 Lebensmittel »für 1,2 Millionen Juden entfallen«
4 Die Deutschen »im dumpfen, blöden Schlaf«
5 Kraft durch Furcht wird Kraft durch Todesangst
6 Mehr als 35000 Todesurteile gegen Deutsche
XII Höllentempo, Terror, Tod und Teufel
1 Ziellos kämpfend in den sicheren Untergang
2 Himmler bringt wankende Gauleiter auf Linie
3 Massenmorde als Mittel zum politischen Zweck
4 Das erzwungene Ende großdeutscher Raserei
5 Besinnungslos, doch von sich selbst befreit
Was geschah, kann wieder geschehen
1 Hitler nutzte weit verbreitete Mittel der Macht
2 Aus einer Menschheitskatastrophe lernen
3 Der Schoß bleibt ewig fruchtbar doch, aus dem das kroch – nicht nur in Deutschland
Abkürzungen
Literaturverzeichnis
Ungedruckte Quellen
Gedruckte Quellen
Personenregister
In dankbarer Erinnerung an Raul Hilberg (1926–2007), Hans Mommsen (1930–2015), Walter Pehle (1941–2021) und Yehuda Bauer (1926–2024)
Das Ölgemälde »Die Sieben Todsünden« [1]schuf Otto Dix (1891–1969), nachdem er im Frühjahr 1933 seine Professur an der Akademie für Bildende Künste in Dresden verloren hatte. Das Hitlerbärtchen der tückischen, vor Neid gelb angelaufenen Zentralfigur ergänzte er 1947. (Staatliche Kunsthalle Karlsruhe)
Die Frage aller deutschen Fragen
Die Frage nach der Genese, nach dem »Wie war es möglich?«, wird wohl die einzige sein, die noch an uns gerichtet, zu der vielleicht noch etwas zu sagen sein wird.
Felix Hartlaub (1913–1945), 30. Mai 1944
Warum begeisterten sich seit 1932/33 viele Zehnmillionen Deutsche für Adolf Hitler, der in allen Wahlkämpfen versprochen hatte, als Erstes die republikanische Verfassung zu zerstören? Wie gelang es der von ihm geführten Regierung von 1933 an, die vielen Skeptiker in den Zustand halbwegs zufriedener Passivität und später in Regungslosigkeit zu versetzen? Wie wurden so viele Deutsche in den folgenden Jahren zu aktiven, gefügigen oder stillen Mitmachern, zu Ideengebern, Organisatoren, Helfershelfern und Vollstreckern des Massenmordens? Warum kämpften Millionen deutsche Soldaten bis zum letzten Tag, obwohl ein Sieg längst unmöglich geworden war? »Wie in aller Welt hat dieses Volk so enden können?« Das fragte der 1933 ins Exil gejagte Wilhelm Röpke (1899–1966) im Winter 1944/45.
Obwohl die Literatur zur NS-Zeit täglich um eine Vielzahl von Veröffentlichungen zunimmt, immer gründlicher alle möglichen Detailprobleme ausleuchtet, ist die zentrale Frage aller deutschen Fragen »Wie konnte das geschehen?« in Vergessenheit geraten. In den folgenden zwölf Kapiteln soll versucht werden, Antworten auf diese eine Frage zu geben. Sie sollen zur Diskussion und zum weiteren Nachdenken anregen.
Auf das Thema gebracht hat mich vor bald 30 Jahren meine jüngste Tochter. Sie war damals 16 Jahre alt und fragte von sich aus, ob wir gemeinsam die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen besuchen könnten. Das taten wir. Gegen Ende meinte sie: »Sag’ mal, und bei all dem war Opa irgendwie dabei?!« Ich antwortete: »Ja – irgendwie auch.« Dieser Opa, Ernst Aly (1912–2007), kann guten Gewissens als unbedeutender Mitläufer gelten. Er hatte es mit mir nicht leicht, wurde aber im späteren Alter relativ gesprächig. Hin und wieder erzähle ich auf den folgenden Seiten auch von ihm, nicht um mich von meinem Vater zu distanzieren, sondern um an einigen Stellen zu zeigen, wie sich das Große im Kleinen spiegelte. Auf manche Spiegelungen bin ich erst während der Arbeit an diesem Buch gestoßen. Warum wurde Oberleutnant Aly als nur halbwegs genesener, nicht mehr kriegsverwendungsfähiger Schwerverwundeter im Sommer 1943 für fünf Wochen ins ehemalige Olympische Dorf bei Berlin kommandiert? Dieses und noch ein zweites biographisches Rätsel ließen sich lösen und mit der großen Staats- und Kriegsgeschichte verbinden.
Nach dem Abitur absolvierte Ernst Aly 1932 bis 1934 eine kaufmännische Lehre bei der Mez AG in Freiburg i.Br. (»eine jüdische Firma«, wie er später zu betonen pflegte). Ein Studium kam während der Krisenzeit nicht in Frage. Anschließend arbeitete er für Mez ein Jahr lang in Berlin, dann studierte er – dank eines Stipendiums – relativ kurz an der Deutschen Kaufmannsschule in Hamburg. Anschließend diente er, obwohl als weißer Jahrgang dazu nicht verpflichtet, ein Jahr beim Infanterieregiment 12 (Halberstadt) und beendete die Militärzeit im Oktober 1936 als Offiziersanwärter. Damit war das fehlende Studium gemäß damals gültiger gesellschaftlicher Normen hinreichend kompensiert.
Im Januar 1937 folgte er der Anfrage eines Freundes und wurde Heimbau-Referent der Gaujugendführung in der Saarpfalz. Seinen Antrag zur Aufnahme in die NSDAP stellte er im Sommer desselben Jahres. Als Soldat wurde er kurz im Frankreichfeldzug eingesetzt, später diente er von Dezember 1942 bis Mitte Februar 1943 für ein paar Wochen an der Ostfront. Er wurde beim ersten Gefecht schwer verwundet, blieb nur sehr eingeschränkt kriegsverwendungsfähig und leitete von Anfang 1944 bis Kriegsende die Kinderlandverschickung im Sudetenland. Das war die verantwortungsvollste berufliche Position, die er jemals bekleidet hat. Die Erfahrung, plötzlich vor einer riesenhaften Aufgabe zu stehen, teilte der Einunddreißigjährige mit Hunderttausenden Altersgenossen. Im Sudetenland musste er ständig improvisieren und schließlich die ihm anvertrauten 15000 Mädchen und Jungen vor der heranrückenden Front zurückführen.
Alle diese Aufgaben erledigte mein Vater mit Schwung und Erfolg. Mit Morden und Kriegsverbrechen hatte er nichts zu tun, mehrfach davon gehört sehr wohl. Darüber sprach er erst spät und stückchenweise. Zweifellos bildete auch er eine der vielen kleinen Stützen Hitlerdeutschlands. Die Kinderlandverschickung (KLV) rettete im Bombenkrieg vielen das Leben, und es gibt nicht wenige positive Berichte darüber, auch Dankschreiben an ihn. Aber: Die aus dem Apparat der Hitlerjugend hervorgegangene KLV war eben auch eines jener tückischen Instrumente, mit denen die NS-Regierung die weitgehende gesellschaftliche Atomisierung vorantrieb. Sie nahm den Eltern unmittelbare Sorgen ab, hielt sie auf Trab und gefügig. Alle waren beschäftigt, schrieben Briefe hin und her und funktionierten.
Renate Bandur, die von Berlin mit ihrer Klasse nach Spindlermühle im Riesengebirge verschickt worden war, beschreibt in ihrem Buch sehr plastisch, wie vergleichsweise angenehm es dort 1944 unter der Ägide von Ernst Aly zuging. Ihre Berichte decken sich mit seinen Erzählungen. Ihm oblag es, den Schulunterricht, die Unterbringung in beschlagnahmten Hotels, die Versorgung mit Essen und die ärztliche Betreuung zu gewährleisten. In seinen Worten: »In diesen Tag- und Nachteinsätzen habe ich Lehrerinnen und Lehrer, Führerinnen und Führer, Ärzte, Verwalter, Hauseigentümer und Pfarrer kennengelernt, die ihre ganze Kraft und Fürsorge den zeitweilig über 15000 Jungen und Mädchen gaben.« Vom tschechischen Hilfspersonal berichtete er, die gemeinsame Arbeit habe bis zum Schluss vorzüglich geklappt.
Während jüdische Kollegen häufig über ihre Verwandtschaft schreiben, ist das unter nichtjüdischen deutschen Historikern unüblich. Manche befürchten womöglich, sie könnten mit Beispielen aus der eigenen Lebenswelt ihre fußnotenstolze Objektivität einbüßen. Die älteren, noch von der Hitlerjugend geprägten, dann auch als Flakhelfer oder Soldaten eingezogenen Historiker hätten über sich selbst schreiben müssen. Einem so produktiven Kollegen und Freund wie Hans Mommsen (1930–2015), der privat viel und innerlich bebend über die komplizierte Geschichte seines Vaters sprach, hätte das vermutlich gutgetan (Kapitel III/2). Auch in meiner Generation gibt es Kollegen, mit denen ich lange und eng zusammengearbeitet habe, die mir erst Jahrzehnte später erzählten, die Eltern seien 1939 in eine arisierte Villa an der Heidelberger Schlossbergstraße eingezogen und man besitze die wunderschönen Jugendstilmöbel noch immer, oder, ein anderer Fall, der Vater habe als Direktor eines bedeutenden oberschlesischen Metallbetriebs Arbeiter aus dem benachbarten Außenlager des KZ Auschwitz eingesetzt. Der Historiker Per Leo hat die Familiengeschichte in der Form des Romans »Flut und Boden. Roman einer Familie« (2014) präsentiert. Familiäre und lebensgeschichtliche Hintergründe beeinflussen und fördern die historiographische Auseinandersetzung mit Hitlerdeutschland noch immer in vielfältiger Weise. Im Übrigen erreichen jeden deutschen Zeithistoriker häufig Fragen von Angehörigen der ersten, zweiten und nun schon der dritten Nachkriegsgeneration, die unbedingt wissen möchten, was die Väter oder Großväter, seltener die Mütter und Großmütter, in der NS-Zeit getan, nicht getan oder verbrochen haben.[1]
Fußnoten
[1]
© VG Bild-Kunst, Bonn 2025
1Wie konnten all diese Verbrechen geschehen?
Die Nähe erklärt das weit verbreitete Bedürfnis nach maximaler Distanz. Die Menschheitsverbrechen der Hitler-Jahre begingen Deutsche, die in der Regel weder vorher noch nachher kriminell handelten, Menschen auch, die sich intellektuell und moralisch kaum von uns Heutigen unterschieden. Sie stammten aus allen Schichten der Bevölkerung. Gut ausgebildete Musiker und Juristen wurden ebenso zu Massenmördern wie Polizisten, Büroangestellte, Bauern, Fach- oder Hilfsarbeiter. Gegen alle Fakten bleibt es eine beliebte Fiktion, die Anhänger und Funktionäre des Nationalsozialismus seien hauptsächlich »desorientierte Kleinbürger« gewesen oder hätten zumindest einer eingrenzbaren sozialen Kohorte angehört. Die Freunde solcher Zuschreibungen suggerieren, man könne eine bestimmter Umstände halber besonders mörderische Gruppe historisch dingfest machen und aus der Gegenwart exkommunizieren. Die Versuche, die Verbrechen Hitlerdeutschlands auf möglichst kleine oder wenigstens genau umrissene soziale Milieus zurückzuführen, lassen sich als menschliche Anstrengungen zur Reduktion von Schuld und Verantwortung ohne weiteres verstehen. In den geschichtlichen Tatsachen finden sie keinerlei Stütze.
Der Nationalsozialismus verschmolz Staat und Gesellschaft zunehmend, doch kennzeichnete ihn – verglichen etwa mit dem Herrschaftssystem Stalins – ein hohes Maß an innerer Pluralität. Hitler setzte nicht auf absolute Linientreue, nicht allein auf die Minderheit strammer, hundertfünfzigprozentiger Parteigenossen und Gefolgsleute. Gewiss standen Hunderttausende Parteigenossen vielen Exzessen innerlich fern, andererseits taten sich Vordenker und Förderer, Soldaten, Offiziere und Generäle als loyale und hilfreiche Diener des Mordregimes hervor, die der Partei niemals angehörten. Indirekt begünstigte der Verzicht auf das Einfordern blinder Gefolgschaft den Vernichtungsterror. Die Stillen, die Harmlosen, die fünfzig- oder achtzigprozentigen Unterstützer bildeten den Boden, auf dem die Politik der Lügen und des Aufrüstens gedieh. Die mit Hilfe ungedeckter Kredite errichteten Prunk- und Zweckbauten sowie die gleichfalls ohne solide finanzielle Grundlage ausgestreuten sozialen Wohltaten wirkten schnell integrativ. Sie erzeugten das bald weit verbreitete Gefühl, man gehe besseren Zeiten entgegen. Auf dem so geschaffenen, zu keinem Zeitpunkt festen Boden entwickelte sich zum einen die Staatsloyalität einer wachsenden Mehrheit, zum anderen die Politik innerer und bald nach außen gerichteter Expansion. Sie stellte jeden Einzelnen vor immer größere Aufgaben, verlangte immer schnellere Anpassungsleistungen, mobilisierte riesenhafte menschliche und materielle Ressourcen und Reserven zu weithin negativen Zwecken, während sich konkrete, wirklich erreichbare Ziele des im Krieg ständig gesteigerten Aktivismus schon bald im Ungefähren, schließlich im Unsichtbaren verloren.
Wie konnte es gelingen, für den Zweiten Weltkrieg mehr als 18 Millionen deutsche Soldaten zu mobilisieren, die Europa von Warschau bis zum Nordkap und zum Kaukasus, von Leningrad bis Nordafrika und Rhodos mit beispielloser Gewalt überzogen? Auf welchen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Grundlagen entfaltete Hitlerdeutschland seine ungeheuerlich zerstörerische Dynamik? Wie konnten sich seit 1933 – beginnend in der Situation extremer ökonomischer Schwäche, gesellschaftlicher wie politischer Wirren – derart starke negative Energien zusammenballen und dann mit unvorstellbarer Wucht entladen? All das geschah in einer historisch, selbst lebensgeschichtlich extrem kurzen Zeit von nur zwölf Jahren. Wobei die Kernzeit lediglich acht Jahre betrug: Von 1933 bis Ende 1934 musste sich die neue Staatsmacht konsolidieren; von 1943 bis zum Mai 1945 vollzog sich die blutig verzögerte, jedoch unabwendbare Niederlage. Generalisierend lässt sich sagen, bis 1939 wurden die durch und durch negativen Energien im trügerischen Schein allgemeinen Aufschwungs gespeichert und sodann in beispiellosen Eroberungs-, Raub- und Vernichtungskriegen zur Explosion gebracht.
Für die Antwort auf die Frage »Wie konnte das geschehen?« müssen vor allem die Entstehung und die Auswirkungen politischer, gesellschaftlicher und militärischer Dynamiken dargestellt werden. In ihrem Buch »Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben« schreiben die Historiker Sönke Neitzel und Harald Welzer über die innere Situation in Hitlerdeutschland, diese müsse als »hochintegrativer gesellschaftlicher Prozess betrachtet werden, der Ende Januar 1933 begann und mit der endgültigen Niederlage im Mai 1945 zu Ende ging«. Die sofort einsetzende »ungeheuer beschleunigte Praxis der Ausgrenzung« verband sich mit den gleichfalls sofortigen »vielen sinnfälligen symbolischen und materiellen Aufwertungen« derer, die dazugehören sollten. Und das war die Mehrheit: »Daraus«, so Welzer und Neitzel, »schöpfte das nationalsozialistische Projekt seine psychosoziale Attraktivität und Durchschlagskraft.« Es geht im Folgenden daher nicht um die möglichst akribische Geschichte einzelner Institutionen und Verbrechenskomplexe. Vielmehr soll untersucht werden, wie sich in einer geschichtlich nicht ungewöhnlichen Situation Triebkräfte anreicherten (und weiterhin anreichern können), die am Ende zu den von den Deutschen begangenen, arbeitsteilig geförderten Verbrechen führten.
Der Philosoph und Zeitdiagnostiker Oswald Spengler (1880–1936) hatte die »nationale Umwälzung« herbeigesehnt. Das hinderte ihn nicht, die politische Technik der Machtentfaltung im Juli 1933 zutreffend zu analysieren: Er bezeichnete sie als seltsamen »Wirbel von Stärke und Schwäche«. Die Wörter Wirbel, Schwäche und Stärke verweisen auf zentrale Elemente der Politik und Propaganda, Volksführung und Volksbetäubung im nationalsozialistischen Deutschland. Wobei Spengler sich im Sommer 1933 noch kein Bild von den äußerst zerstörerischen Kettenreaktionen hatte machen können, die aus dieser Konstellation folgten: Tempo, Tempo, im Volk Siedehitze erzeugen, extreme, mit Ängsten verbundene innere Spannung, gefolgt von kurzer Entspannung und abermals künstlich erzeugter und gewollter Hochspannung. Auf solche Weise ließen sich die Verhältnisse durcheinanderwirbeln und starke Sogwirkungen entfesseln. Schnelligkeit galt Joseph Goebbels (1897–1945) als »Mutter des Erfolges«.[1]
In den folgenden zwölf Kapiteln thematisiere ich, nicht immer chronologisch, wie die Massenbasis des nationalsozialistischen Staats entstand und mit welchen – wechselnden und einander ergänzenden – Methoden sie stabilisiert wurde. Eine wichtige Rolle spielen soziale Aufstiegsversprechen und -wünsche, ebenso die ungeheure Beschleunigung des Lebens, die ständige Mobilisierung zwischen Angst und Hoffnung, Frieden und Krieg, Selbstvergottung und Selbstvernichtung.
Nicht zuletzt rücke ich die Alters- und Sozialstruktur der NSDAP-Mitglieder in den Blick, die Folgen hemmungsloser Staatsverschuldung, ebenso die Gefühls- und Stimmungsschwankungen im Krieg. Nicht ausgelassen werden zahlreiche Prozesse und massenhafte Ermittlungen gegen katholische Priester und Laienbrüder, die sich an Minderjährigen sexuell vergangen hatten. Damit soll im Zusammenhang dieses Buches nicht die katholische Kirche schlechtgemacht, sondern gezeigt werden, wie die NS-Führung zielgenau an diesem Punkt ansetzte, um die beachtliche Widerständigkeit vieler Katholiken, ihrer Priester und Bischöfe erfolgreich zu brechen. Desgleichen müssen die Mittel einbezogen werden, mit denen es Gewerkschaftern, Sozialdemokraten und auch zuvor überzeugten Kommunisten 1933/34 erleichtert wurde, sich relativ bequem in die neuen Verhältnisse einzufinden. Dabei ist der nur punktuelle, wohldosierte und fürs Erste bald nachlassende Terror zu berücksichtigen. Wegen der in gewerkschaftlichen, sozialistischen und sozialdemokratischen Kreisen zur Wahrheit erhobenen, jedoch unrichtigen Behauptung, die Gewerkschaften seien am 2. Mai 1933 komplett zerschlagen worden, beansprucht dieser Abschnitt etwas mehr Platz.
Den evangelischen Landeskirchen gehörten damals zwei Drittel der deutschen Bevölkerung an. In ihrer Mehrheit mussten die deutschen Protestanten weder mürbe gemacht noch mit besonderen Angeboten für den Nationalsozialismus gewonnen werden: Schon vor 1933 wählten sie die Partei Hitlers mehr als doppelt so häufig wie Katholiken. Im zweiten Teil des Buches, der die Zeit des Krieges behandelt, stehen die Beschleunigung des Lebens, das höchst agile Management der Staatsführung und die sozialintegrative Wirkung der von Deutschen begangenen Großverbrechen im Zentrum.
Nicht selten werden Handlungs- und Verhaltensweisen dargestellt, die jeder kennt: Nützlichkeitserwägungen, das Ausgleichen widerstreitender Interessen zum Nachteil Dritter, das Konsolidieren prekärer Situationen mittels Partizipation und materieller Umverteilung, das Überwinden kollektiver Selbstzweifel mit Hilfe der Selbsterhöhung der eigenen Großgruppe zur besonders edlen Wertegemeinschaft, verbunden mit der Herabwürdigung angeblicher, stets kollektivistisch definierter Gegner. Mit solchen politischen Mitteln lässt sich eine verbesserte soziale Integration der eigenen Großgruppe günstig beeinflussen. Im Fall Hitlerdeutschlands handelte es sich um die als biopolitisch wertvoll erachteten Deutschen. Das waren die allermeisten. Nicht unaktuell erscheint auch der Umstand, dass sich der Nationalsozialismus als identitäre Massenbewegung präsentierte, die für das Ende erlittener Demütigungen eintrat, Denkmäler stürzte, Straßen umbenannte und ihre Anhänger als per se bessere Menschen qualifizierte, denen die Zukunft gehöre.
Ohne Frage arbeitete Hitlers Regierung mit politischen Techniken, die – in milderer Form – weiterhin in Gebrauch sind: die Manipulation von Informationen, die Zerstörung öffentlicher Räume, in denen gesellschaftliche Angelegenheiten frei diskutiert werden können; die Politik ungedeckter Staatsschulden; soziale Geschenke an die Massen bei zunehmend autoritärer Staatsführung; das Entfachen von Vorurteilen und Hass gegen geeignete und klar erkennbare Minderheiten, generalverdächtige Personen und Institutionen. All das geschah im Zeichen eines hektischen, am monströsen Anschwellen der Gesetzes- und Verordnungsblätter messbaren Aktionismus, der Schwindelgefühle erzeugte und das Nachdenken lähmte.
Dazu passte die inhaltliche Unbestimmtheit des nationalsozialistischen Programms. Es ist irreführend, wenn noch immer von »der Naziideologie« gesprochen wird. Die gab es nicht. Tatsächlich handelte es sich um wechselnde, situativ modifizierte politische Programme. Sie folgten den Grundideen des Machtgewinns und des Machterhalts. Auch existiert kein genuin nationalsozialistischer Antisemitismus. Jedoch erkannten die Führer der NSDAP früh, wie leicht ihnen der Programmpunkt »Kampf gegen jüdische Vorherrschaft« eine weit über den engeren Kreis ihrer Gefolgsleute hinauswachsende Zustimmung verschaffen würde. Daraus ergab sich später die Möglichkeit, dem Volk auf Kosten erst mit Berufsverboten belegter und dann enteigneter Juden einige Vorteile zu verschaffen. Auch mit Hilfe des gemeinsam begangenen und Stück für Stück gesteigerten Unrechts gelang es, die Mehrheit der eigenen Bevölkerung in die Gefolgschaft zu bugsieren, seit 1941 in eine zunehmend fester verbundene und schließlich an die eigene Führung gekettete Gemeinschaft des Verbrechens.
Der ins Exil getriebene Politikwissenschaftler Franz Neumann (1900–1954) ging 1942 davon aus, der Nationalsozialismus besitze »keine eigene politische Theorie«, und die Ideologien, die er benutze oder bei Bedarf fallen lasse, seien »nichts weiter als arcana dominationis«, also Herrschaftstechniken. Der US-amerikanische Humanwissenschaftler W.E.B. Du Bois (1868–1963), der in den 1890er Jahren in Berlin studiert hatte und 1936 mehrere Monate durch Deutschland reiste, sprach von der »neuen Weltanschauung des Hitlertums«. Diese Weltanschauung »ist ein noch wachsendes, sich entwickelndes Gedankengut, dem eine ständig zunehmende Zahl von Deutschen mit verkrampfter Begeisterung folgt«. Verkrampft? Was ahnten, was fürchteten die Menschen? Du Bois konstatierte nach dreieinhalb Jahren Nationalsozialismus, mittlerweile würden neun von zehn Deutschen Hitler unterstützen. Doch habe das für sie selbst etwas Unheimliches. Es sei, so Du Bois, ein merkwürdiges Deutschland entstanden – »schweigsam, nervös und bedrückt«, nur im Flüsterton sprechend.[2]
Aus den skizzierten Faktoren entstand zunächst eine eigentümliche Mischung aus »Kraft durch Freude und Erfolg«, dann im Krieg – angesichts ständig wachsender Risiken – ein sozialer Kitt aus »Kraft durch Unentrinnbarkeit und Furcht«. Das Arrangieren solcher politischen Situationen bedarf keiner spezifischen Ideologie. Die Grundelemente, mit deren Hilfe Hitlerdeutschland seine zerstörerischen Kräfte entfaltete, sind altbekannt und finden sich zum Beispiel in dem 1933 von Otto Dix gemalten Kommentar – in dem Gemälde »Die Sieben Todsünden«. Tückisch und misstrauisch schielend, gelb vor Neid (Invidia) hockt das »Scheusal«, wie Thomas Mann Hitler nannte, im Zentrum des Bildes auf der raffgierigen, vermeintlich ewig zu kurz gekommenen Hässlichkeit Geiz (Avaritia). Links lauert ein germanisch behörnter Wüterich, den Dolch zum Stoß gegen jeden noch so harmlosen Widersacher erhoben: Er verkörpert den Zorn (Ira) – »die rachsüchtige, kreuzigende Kreatur aller Zeiten«, wie Ernst Bloch (1885–1977) in seinem Aufsatz »Hitlers Gewalt« die eigenen Münchner Erfahrungen mit Revolutionen, Putschversuchen und Konterrevolutionen 1924 zusammenfasste.
Dahinter steht die ewig gleichgültige, anpassungsgeübte, gedankenfaule Trägheit (Accidia), das Volk, dargestellt als todbringender Sensenmann: die Augenhöhlen leer, die linke Brust aufgerissen, statt des pulsierenden Herzens klafft dort ein Loch, bewohnt von einer Kröte. Hitler bezeichnete den von ihm gelenkten, für den Erhalt seiner Herrschaft so wichtigen Hauptteil seines Volkes als »Masse der Mitte« (Kapitel VII.1). Die drei sichtbaren Gliedmaßen der opportunistisch tänzelnden, blick- und richtungslosen Accidia sind eher halbherzig zum schlapp angedeuteten Hakenkreuz formiert, die Hände mit weißen Handschuhen vor Blut geschützt. Wer im tödlichen Geschäft so viel Umsicht walten lässt, wird seine Hände hernach in Unschuld waschen, sich und allen anderen weismachen wollen, man sei stets sauber geblieben und habe von allem nichts gewusst.
Neben den Bösewichten naht mit geöffneten, rötlich vaginalisch ausgeformten Schenkeln einladend die Wollust (Luxuria). Lüstern, am Mund mindestens ein syphilitisches Geschwür, lockt sie zum schnellen, die Folgen ignorierenden Genuss. Oben rechts über der luziferischen Szenerie thront die selbstsüchtige Völlerei (Gula). Unersättlich in sich hineinfressend, das Maul weit aufgerissen, grapscht sie nach allem und jedem, kann niemals genug vom Arisieren und Rauben kriegen. Links daneben die Superbia (der Hochmut), eine betont hochnäsig dargestellte Person unbestimmten Geschlechts und sozialen Rangs, die sich als besonders gelungenes Exemplar des arischen Edelvolkes dünkt. In ihrem Gesicht prangen Ausschläge und Pockennarben, an die Stelle des Mundes malte Dix den Schließmuskel des Afters – ein rassenreines Arschgesicht.
Gewiss kannte Otto Dix das berühmte Tafelbild »Der Tisch der Weisheit«, auch »Die Sieben Todsünden« genannt, das Hieronymus Bosch (um 1450–1516) geschaffen hatte. »In der abstoßendsten Vulgarität« rückte der niederländische Maler den Zorn und die Gefräßigkeit ins Zentrum, wie der Kunsthistoriker Wilhelm Fraenger (1890–1964) schrieb: »Sie stellen sich als vierschrötige, feiste Klötze dar, die wie mit Lastern vollgestopfte Säcke wirken.« In Boschs Accidia, dargestellt als vornehme Bürgersfrau, die sich zum Kirchgang herausgeputzt hat, sieht Fraenger den »Seelenzustand des Absinkens in stumpfe Lethargie«. Sie ist »fix und fertig angezogen, (…) kommt aber nicht vom Fleck«: »Sie ›willwankt‹«, wie das Schweizerdeutsch eine solche zugleich wollende und nicht-wollende, vorwärtsstrebende und zurückschreckende Verfassung nennt. Willwänkig ist das dazugehörende, kraftvoll beschreibende Adjektiv.[3]
Wir werden noch sehen, welche politische Rolle die Wutbürger und die ewigen Neidhammel in Hitlerdeutschland spielten, die schulterzuckenden, trägen Opportunisten, die Raffgierigen, die Hochmütigen, die für jede Bestechung empfänglichen Geizhälse und diejenigen, die den kurzen Freuden militärisch-siegesgewisser Adrenalinausschüttungen und anschließender Besuche im Landserbordell zugetan waren. Selbstverständlich mischten sich die von der NS-Führung zielsicher als Lockmittel genutzten sieben Hauptsünden in jedem einzelnen Deutschen ganz unterschiedlich.
Die Frage »Wie konnte das geschehen?« – Hitler, how could it happen? – spielt seit mehr als 40 Jahren in allen meinen Büchern eine zentrale Rolle. Am Beispiel der Statistiker, Standesbeamten und Registratoren in den Meldeämtern habe ich zusammen mit Karl Heinz Roth die »restlose Erfassung« zum Zweck der Herrschaftsstabilisierung untersucht. Im Fall der Euthanasiemorde rückte ich das Verhalten der Mordorganisatoren genauso ins Zentrum wie das der Angehörigen; in dem gemeinsam mit Susanne Heim verfassten Buch »Vordenker der Vernichtung« geht es um die stützende Rolle akademisch gebildeter Eliten, um deren Wohlgefühl, wenn sie von der Theorie zur Praxis schreiten, von den Mächtigen gehört und politisch wirksam werden können.
In dem Buch »Endlösung« stehen die selbstgeschaffenen Zwänge im Mittelpunkt, die sich aus den Projekten zur ethnischen Homogenisierung ergaben, dem Heim-ins-Reich der Volksdeutschen, der Vertreibung und Zwangsumsiedlung von Elsässern, Polen, Slowenen und anderen Bevölkerungsgruppen. Daraus folgte dann die Frage: Wohin mit den Juden, dieser Minderheit par excellence (Hannah Arendt)? Dieses Buch verifiziert mit Hilfe bis dahin wenig benutzter historischer Dokumente der Zwangsumsiedler, die früh von Raul Hilberg (1926–2007), Martin Broszat (1926–1989) und Hans Mommsen entwickelte These, die nationalsozialistische Judenpolitik sei nicht einem vorgefassten Plan gefolgt, sondern habe sich situativ entwickelt und radikalisiert.
Mein Buch »Hitlers Volksstaat« behandelt die sozial- und finanzpolitischen Techniken, mit denen die NS-Führung das Volk, die Soldaten und die Heimatfront, also vor allem die Frauen, bei Laune hielt. Das gelang mit Hilfe sozial ausgleichender Gerechtigkeit (etwa im Fall der Lebensmittelzuteilungen im Krieg), mittels verschleierter Staatsschulden, rücksichtsloser Enteignung von Juden und Polen sowie gut organisierter kriegerischer Raubzüge. Bleiben noch die beiden Bücher zum Antisemitismus »Warum die Deutschen? Warum die Juden« und »Europa gegen die Juden«. Sie erzählen vom Sozialneid auf die geistig und wirtschaftlich schnell voranstürmenden Juden und dem daraus entstehenden modernen, wirtschaftlich und sozial basierten, folglich für politische Parteien programmatisch anschlussfähigen Antisemitismus.
Das vorliegende Buch stützt sich auch auf frühere Ergebnisse meiner Forschungen, folgt jedoch einer ganz anders gestellten Frage: Wie gelang es der deutschen Führung, die stets prekäre Einheit von Volk und Führung zwölf Jahre und drei Monate lang zu wahren? Das gelang nicht nur trotz aller Verbrechen, sondern – wie zu zeigen sein wird – auch wegen dieser Verbrechen. Die zentralperspektivisch angelegten Kapitel handeln von den Herrschaftstechniken Hitlers, seiner engeren Mitarbeiter und Vertrauten, von den vielfältigen, den weichen, harten und hochkriminellen, stets in Kombination angewandten Methoden des Gewinnens, Ausübens und Erhaltens von Macht. Nicht alle, aber viele der dafür angewandten Mittel erscheinen für sich genommen harmlos. Erst in der Kombination und besonderen Intensität entfalteten sie ihre spezifische Wirkung, die alle rechtlichen, moralischen und religiösen Normen sprengte.
2Hinweise zu den Quellen und zur Lektüre
Die Voraussetzungen für die vorliegende Studie haben sich dank der zahlreichen Spezialforschungen und Dokumentationen zum Nationalsozialismus in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend verbessert. Das quellentechnisch belegbare Wissen zur Judenverfolgung, zum Primat der Politik über die Ökonomie, zu den Fragen des inneren sozialen Zusammenhalts oder den Stimmungsschwankungen in der Bevölkerung ist wesentlich dichter geworden. Dasselbe gilt hinsichtlich der Entscheidungsabläufe in den politischen und militärischen Führungszirkeln. Dank vielfältiger empirischer Studien gerieten frühere Versuche, die hitlerdeutschen Jahre in sogenannte Faschismustheorien, wahlweise in pauschalisierende Begriffe wie Diktatur oder Totalitarismus zu bannen, mit Recht in Vergessenheit. Inzwischen sind Hitlers Reden vor 1933 vom Münchner Institut für Zeitgeschichte (IfZ) ediert. Im Internet lassen sich zahlreiche Quellen, Aufsätze und Hinweise auf Bücher leicht und schnell finden.
In den folgenden Kapiteln spielt Joseph Goebbels aus zwei Gründen eine wichtige Rolle. Zum einen als Minister für Volksaufklärung und Propaganda. Heute würde man ihn als Director eines ständig wachsenden Executive committee of communications and political branding bezeichnen, der – gestützt auf mitdenkende, hochmotivierte und kreative Multimediateams – Tag für Tag das politische Wording und Framing festlegt, nachjustiert, es an die jeweiligen, häufig wechselnden Lagen anpasst, das ständige Schwanken oder nur geringfügige Oszillieren der Volksstimmung im Auge behält und zu beeinflussen versucht.
1939 arbeiteten in dem neu errichteten, für damalige Verhältnisse riesigen Ministerium 2000 Bedienstete, hinzu kamen die Reichspropagandaämter der NSDAP. Goebbels leitete den gesamten Apparat, den des Staats und den der Partei. Geschaffen worden war das Ministerium im März 1933 mit einem Erlass von Reichspräsident Hindenburg. In seiner Verordnung vom 30. Juni 1933 definierte Hitler dessen vielfältige Zuständigkeiten und Aufgaben: die »geistige Einwirkung auf die Nation, die Werbung für Staat, Kultur und Wirtschaft, die Unterrichtung der in- und ausländischen Öffentlichkeit«.[1]
Goebbels ist neben Hitler die zentrale Figur dieses Buches: Er diente seiner Partei von 1926 bis 1945 als Gauleiter von Berlin, von 1930 bis 1945 als Reichspropagandaleiter, von 1933 bis 1945 steuerte er zudem das auf ihn zugeschnittene Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda; vor allem aber hinterließ er ein voluminöses Tagebuch. Da er zu den dauerhaften, regelmäßigen und zeitweise engsten Gesprächspartnern Hitlers zählte, bilden seine Notate eine wichtige, fast komplett erhaltene Quelle für die zentralen politischen Entscheidungen jener Jahre. Die 29 Bände seiner Tagebücher liegen mittlerweile in digitaler Form vor. Die Edition dieser für die Forschung so bedeutenden Quellen ist der jahrzehntelangen Arbeit und Geduld von Elke Fröhlich, ihren Mitarbeitern am IfZ und damit auch den jeweiligen Direktoren zu verdanken.
Zusätzlich erleichtern die immer besser verzeichneten Archivbestände die Arbeit, ebenso das Deutsche Zeitungsportal – Deutsche Digitale Bibliothek. Die vielfältigen Einzelstudien zum Nationalsozialismus erlauben es, schnell und unkompliziert Informationen über die Sozialstruktur und das Lebensalter von NSDAP-Kreisleitern, Besatzungsfunktionären in Polen oder KZ-Wachleuten und anderes mehr zu gewinnen. Benutzt habe ich vor allem die glänzend ausgestattete, fachkundig geleitete Bibliothek der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin.
Die Rechtschreibung folgt auch in den Zitaten den derzeit gültigen Regeln. In Teilzitaten passe ich Flexionen gelegentlich meiner Satzkonstruktion an; kurze erklärende Einfügungen innerhalb der Zitate setze ich in runde Klammern; kursiv gedruckte Wörter oder Textpassagen entsprechen stets einer Hervorhebung im Original. Seinerzeit gebräuchliche Begriffe wie Judenfrage, Führer, Arisierung, Blutschutz, Mischling, entjuden, Arier usw. setze ich, von Ausnahmen abgesehen, nicht in Anführungszeichen, sondern vertraue dem Urteilsvermögen meiner Leserinnen und Leser. Die Namen von Städten, Regionen und Staaten schreibe ich in der seinerzeit gebräuchlichen Form und ergänze sie nur dann um spätere Bezeichnungen, sofern Unklarheiten vermieden werden sollen. Kiew bleibt Kiew, Leningrad wird nicht zu St. Petersburg.
Die bis 1933 in Deutschland ansässigen Juden waren zu mehr als 80 Prozent deutsche Staatsbürger, also Deutsche, und nicht selten stolz darauf. Dennoch spreche ich aus praktischen Gründen immer wieder vereinfachend von Deutschen und Juden. Sofern es dabei um deutsche Juden geht, möge der verständige Leser das mitdenken. Das generische Maskulinum diskriminiert meines Erachtens niemanden. Mir kommt es jedenfalls seltsam vor, wenn der Autor Hitler im Katalog der Staatsbibliothek zu Berlin mittlerweile als »Hitler, Adolf, 1889–1945 (VerfasserIn), …« geführt wird. Die Doppelform Jüdinnen und Juden unterschlägt die eineinhalb Millionen Säuglinge, Kleinkinder, Kinder und Jugendlichen, die im Holocaust von deutschen Massenmördern deportiert und dann erschossen oder mit Hilfe von Giftgas getötet wurden. Außerdem macht die habituelle Nennung der männlichen und der weiblichen Formen (Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen, Mörder und Mörderinnen, Rassistinnen und Rassisten) die Sprache unbequem, sperrig und wenig elegant.
Häufig spreche ich von deutschen anstatt von nationalsozialistischen Tätern. Damit sind nicht alle Deutschen gemeint, aber doch sehr viele, meist arbeitsteilig Agierende oder nur passiv Schulterzuckende, die weder überzeugte Anhänger noch Gegner Hitlers waren. Hinter inzwischen allgegenwärtigen Sätzen wie »Die Nationalsozialisten errichteten das Vernichtungslager XY« und »dort ermordeten die Nationalsozialisten soundso viele hunderttausend Menschen« verschwinden die vielen deutschen Gleichgültigen, Mitmacher, Helfer und Helfershelfer aus dem geschichtlichen Blickfeld. Ich halte es insoweit mit Thomas Mann, der dazu im März 1945 schrieb:
Unmöglich, von den misshandelten Völkern Europas, von der Welt zu verlangen, dass sie einen reinlichen Trennungsstrich ziehen zwischen dem »Nazismus« und dem deutschen Volk. (…) Die Welt ist durch fünf Jahre eines von Deutschland entfachten, leidens- und opfervollen Krieges gegangen, und in diesem Krieg hatten die Gegner Deutschlands es vom ersten Tage an mit der ganzen deutschen Erfindungsgabe, Tapferkeit, Intelligenz, Gehorsamsliebe, militärischen Tüchtigkeit, kurz, mit der gesamten deutschen Volkskraft zu tun, die als solche hinter dem Regime stand und seine Schlachten schlug.[2]
Hitlers Buch »Mein Kampf« zitiere ich nach der gut durchsuchbaren, weil nicht in Frakturschrift gedruckten, 851.–855. Auflage (München 1943), die als PDF im Internet steht. Weil verschiedene Teilausgaben der Tagebücher von Joseph Goebbels erschienen sind, gebe ich nur das Datum des jeweiligen Eintrags an. Fast immer beziehen sich die Einträge auf den Vortag, weshalb das Datum im Haupttext von dem in der Fußnote meist um einen Tag abweicht. Für Zitate aus der 14 Bände umfassenden Edition »Hitler. Reden, Schriften, Anordnungen. Februar 1925 bis Januar 1933« nenne ich das Datum und die Dokumentennummer, da ich diese wie auch die Edition der Goebbels-Tagebücher in digitalen Versionen benutzt habe. Ungedruckte Quellen wie zum Beispiel das Tagebuch von Hermann Voss werden am Anfang des Literaturverzeichnisses separat nachgewiesen.
Ich danke allen, die mich bei meiner Arbeit unterstützt und gefördert, mit mir diskutiert und gestritten haben. Darüber hinaus und vor allem gilt mein Dank den vielen, die jahrzehntelang an den Grundlagen arbeiteten und noch immer arbeiten, die auch das vorliegende Buch ermöglichten: Archivare, Editoren geschichtlicher Urkunden, Autoren, die wichtige Einzelfragen untersucht haben, ebenso den Lexikographen, ob sie nun geschichtliche Grundbegriffe bearbeiten oder Einträge für Wikipedia schreiben. An Letzteren wird gerne die unterschiedliche Qualität bemängelt. Solche Mängel bestehen offenkundig. Nur finden sich dieselben Probleme auch in hochvornehmen gebundenen Ausgaben. Wer das nicht glaubt, schaue sich in dem von Otto Brunner, Werner Conze und Reinhart Koselleck herausgegebenen Werk »Geschichtliche Grundbegriffe« den schmalbrüstigen, offenbar in letzter Minute aufgenommenen Eintrag zum Begriff »Antisemitismus« an. Die für die Sozialgeschichtsschreibung und eben auch für den Verlauf und die Gewaltausbrüche des 20. Jahrhunderts außerordentlich wichtigen Begriffe »Aufstieg, sozialer« oder »Mobilität, soziale« kommen darin überhaupt nicht vor.
Im Sinne von Raul Hilberg (1926–2007) benutze ich Adjektive des Abscheus oder innerer Empörung nicht. Fast nicht – manchmal geht es nicht anders. Typische, noch immer gern gebrauchte, stets pejorativ oder distanzierend verstandene Wörter wie »völkisch«, »Scherge«, »Diktatur«, »charismatisch«, »Wahn«, »wahnhaft«, »Rassenlehre« oder »Rassentheorie« sucht man in der 1350 Seiten langen, 1991 erschienenen deutschen Ausgabe von Hilbergs Hauptwerk »Die Vernichtung der europäischen Juden« vergeblich. Hitler heißt bei ihm durchweg Hitler – nicht »der Diktator«. Das in aller Regel als Schimpfwort verwendete Wort »Ideologie« kommt bei ihm zweimal vor und dort sinnvoll. Hilberg bevorzugte die sachliche Bezeichnung Programm. Wörter wie »nationalsozialistische Weltanschauung« oder »Weltanschauungskrieg« entstammen dem auf Vernebelung ausgelegten Wortschatz Hitlers. In einer wissenschaftlichen Analyse können sie zitiert, aber nicht zu erklärenden Zwecken benutzt werden.
Weil die Zeit des Nationalsozialismus langsam, aber unaufhaltsam von der »jüngsten deutschen Vergangenheit« in die entferntere Neuere Geschichte hinübergleitet, setze ich hinter die meisten Personennamen bei der ersten Nennung die Lebensdaten. Die Zugehörigkeit zu durchaus unterschiedlichen Alters- und Erfahrungskohorten spielt für die vielen aktiven Nationalsozialisten und deren Helfer keine geringe Rolle, ebenso für die Leisetreter, Gegner und Opfer. In vielen Fällen möchte man wissen, ob und, wenn ja, wie lange die jeweilige Person die Kriegsjahre überlebt hat.
Meine Antworten auf die Frage »Wie konnte all das geschehen?« bleiben fragmentarisch. Andere mögen sie ergänzen und einzelne Faktoren anders gewichten, dabei aber eines bedenken: Wie jede geschichtliche Epoche müssen auch die zwölf kurzen hitlerdeutschen Jahre mit Hilfe der gängigen, für andere Epochen angewandten historiographischen Methoden untersucht werden. Wer die Frage »Wie konnte das geschehen?« beantworten und daraus Konsequenzen für die Zukunft ableiten möchte, sollte die NS-Zeit nicht dämonisieren, sondern die Voraussetzungen, Herrschaftspraktiken und Dynamiken so genau wie nur möglich beschreiben.
Berlin, April 2025
Götz Aly
Deutsche Gymnasiasten 1938 bei einem Ausflug nach Kassel. [1]Während einer Rhön-Wanderung im Vorjahr hatten sie laut Klassenchronik immer und immer wieder diesen damals wohlbekannten Ohrwurm im Kanon geschmettert: »O Herr, gebt uns den Moses wieder / (…) Lass wiederum das Meer sich teilen, / …«
IAntisemitismus und soziale Mobilität
Deutschland den Deutschen! Heraus mit dem Gesindel! Wir wollen für unser deutsches Volk eine judenreine deutsche Kultur, Produktion und Politik.
Joseph Goebbels, 1928
Im Jahr 1923 interessierten sich Hitler und seine noch junge völkische Bewegung für die Ausrottung einer bedeutenden, wirtschaftlich erfolgreichen und geistig voraneilenden Minderheit: für den Völkermord an Hunderttausenden Armeniern im Osmanischen Reich zwischen 1915 und 1917. Die von türkischer Seite genannten nationalidentitären Gründe leuchteten der in München schon recht starken Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ein: Das eigene Volk sollte von Menschen »gereinigt« werden, die seit einigen Jahrzehnten und zunehmend als »Fremdkörper« eingestuft worden waren, zugleich eröffnete sich damit die Chance, eine überdurchschnittlich wohlhabende Minderheit komplett zu berauben.
Damals lebte in München Dr. Siegfried Lichtenstaedter (1865–1942), der als Oberregierungsrat in der bayerischen Rechnungskammer arbeitete und Hitlers politische Radaugruppe von Anfang an genau betrachtete. Als »Beamter und zudem Jude« konnte er bis 1932 nur unter wechselnden Pseudonymen über den in Deutschland schnell zunehmenden Antisemitismus schreiben. Dieser äußerte sich einerseits lautstark, andererseits durchdrang er auf leise Weise noch schneller alle Schichten der Bevölkerung.
In Hitlers stark entwickeltem Wunschdenken war seine Parteizeitung Völkischer Beobachter (VB) bereits 1921 »in die Reihe der großen Zeitungen eingetreten«.[1] Eine volksnahe, soldatisch-kämpferische, gelegentlich auch autodidaktisch gestelzte Sprache kennzeichnete das Blatt, dessen Erscheinen hin und wieder wegen Volksverhetzung und republikfeindlicher Bestrebungen untersagt wurde. Zum Umkreis des VB gehörte 1923 die Zeitung Heimatland mit dem Untertitel »Vaterländisches Wochenblatt. Organ des Deutschen Kampfbundes«. Die Polizeidirektion München stufte sie als »Ersatzblatt des Völkischen Beobachters« ein, sofern dieser wegen staatsgefährdender Umtriebe gerade verboten war. Nebenbei erscheint ein Hinweis zur damaligen Hyperinflation angebracht: Die Ausgabe der Zeitung Heimatland vom 15. Oktober 1923, aus der im Folgenden zitiert wird, kostete pro Exemplar 25 Millionen Mark.
Fußnoten
[1]
Klassenchronik der 1932 im Gymnasium der Stadt Vacha eingeschulten Klasse/Johann-Gottfried-Seume-Gymnasium Vacha
1Völkermorde der Jungtürken, ein Vorbild
In dieser Ausgabe stand der letzte und meinungsstarke Bericht einer sechsteiligen Serie zum Thema »Mustapha Kemal Pascha (Atatürk) und sein Werk«. Der harmlose Titel verhüllte, worum es ging: um die Verherrlichung des von türkischen Truppen und Milizen 1915/16 begangenen Völkermords an einer Million armenischer Männer, Frauen und Kinder. Dem einen Genozid folgte 1921/22 der nächste, allerdings in gänzlich anderer Konstellation. Auf den 1921 begonnenen, britischerseits unterstützten und sehr blutig geführten Aggressionskrieg Griechenlands gegen die Türkei reagierten die Soldaten der Angegriffenen mit Massenmorden an der großen griechisch-christlichen Minderheit in den türkischen Küstenregionen.
Der Bericht erschien am 15. Oktober 1923, knapp vier Wochen vor dem Hitler-Ludendorff’schen Putschversuch vom 9. November. Der Verfasser, Hauptmann Hans Tröbst (1891–1939), hatte den jungtürkischen Truppen als militärischer Berater gedient. Aus eigener Anschauung berichtete er: »Die im Kampfgebiet wohnenden Fremdstämmigen mussten fast ausnahmslos über die Klinge springen, ihre Zahl ist mit 500000 nicht zu gering angegeben.« Wie der Augenzeuge Tröbst hervorhob, vollzogen die Schlächter ihre Massaker »ohne Unterschied des Alters und des Geschlechts«. Auch die »fremdstämmige Bevölkerung« im türkischen Hinterland wurde nicht verschont. Diese »erhielt von der Regierung eine einmonatige Frist zur Auswanderung«: »Was sie besaß, musste sie an Ort und Stelle zurücklassen.« Faktisch trieben türkische Truppen und Milizen – darunter auch kurdische – vollständig beraubte Menschen massenhaft in die syrische Wüste, metzelten nicht wenige nieder und lieferten die anderen dem Hungertod aus. Nur wenige überlebten.
Tröbst empfahl den von ihm geschilderten planvollen Massenmord als Vorbild, gefolgt von dem kaum verdeckten Hinweis auf die deutschen Juden: »Die Türkei hat den Beweis geliefert, dass die Reinigung eines Volkes im größten Stil von Fremdkörpern jeder Art sehr wohl möglich ist.« Allerdings sei eine solche »völkische Reinigung« an Willensstärke und an den Einsatz des eigenen Lebens gebunden. Das gelte besonders für die politischen Führer:
(Sie) müssen sich bewusst sein, dass sie dabei um ihren Kopf spielen. Dieses Bewusstsein wird ihnen die Fähigkeit geben, alle ihnen Entgegenarbeitenden rücksichtslos und für immer unschädlich zu machen, mögen weiche Gemüter dabei noch so sehr über Grausamkeit, Barbarei und Schlimmeres zetern. Diese Unschädlichmachung muss in einer Form erfolgen, dass sie eine endgültige und jedermann in die Augen springende ist.
All das solle, so Tröbst, aus Gründen der Zweckmäßigkeit und um moralische Skrupel zu unterdrücken sowie Angst und Schrecken zu verbreiten, möglichst schnell und umstandslos geschehen.
Offenbar hatte Hitler bereits den ersten der sechs Artikel über Mustapha Kemal gelesen, denn er ließ am 7. September 1923 bei Tröbst wegen eines Treffens anfragen: »Herr Hitler würde sich sehr freuen, wenn Sie ihm am kommenden Dienstag über Ihre Erlebnisse berichten. (…) Was Sie in der Türkei miterlebt haben, ist das, was auch wir einmal tun müssen, um uns frei zu machen.« Ob ein solches Treffen zustande kam, muss offenbleiben.
Auf Deutschland gemünzt, lautete Tröbsts »große Lehre« aus dem türkischen Exempel: »Einheitsfront, völkische Reinigung und eine wahre freiwillige Armee, das sind heute die Grundlagen für die nationale Wiedergeburt eines Volkes.« Daraus folgte die rhetorisch gestellte Frage »Wann kommt der Retter unserem Lande, der diese Forderung der Stunde in die Tat umsetzen wird?«, ergänzt um den an die Funktionäre und Parteigänger der NSDAP gerichteten Appell zu unbedingter Entschlossenheit: »Kameraden! Schließt die Reihen! Unsere Stunde wird kommen!« Fest steht, dass Hans Tröbst am gescheiterten Putsch vom 9. November 1923 in München teilnahm. Der Leiter der Zeitung Heimatland, Hauptmann Wilhelm Weiß (1892–1950), hatte ihn im Auftrag von General Erich Ludendorff (1865–1937) kurzfristig und per Eilbrief zum Putsch eingeladen.
Siegfried Lichtenstaedter las die völkischen Zeitungen und Verlautbarungen regelmäßig. Im Fall dieses Artikels entschlüsselte er, was zwischen den Zeilen stand: »Die 600000 Juden des Deutschen Reiches und die 200000 Juden Deutsch-Österreichs sollen totgeschlagen und ihre Güter den ›Ariern‹ gegeben werden. Hierzu bedarf es aber einer neuen Ethik. Diese lehrt: Die ›Fremdstämmigen‹ (= Fremdreligiösen), die im Vaterlande leben, darf und soll man totschlagen und ihrer Habe berauben.«[1]
In seinem bald nach dem gescheiterten Putsch in der Haft begonnenen und 1925/26 veröffentlichten politischen Bekenntnisbuch »Mein Kampf« benutzt Hitler eine derbe Sprache. Zur Absonderung und Sterilisierung von »Syphilitikern, Tuberkulösen, erblich Belasteten, Krüppeln und Kretins« empfiehlt er »barbarische« Maßnahmen. Zwar seien diese für »die unglücklich davon Betroffenen« schwer zu ertragen, gereichten aber der »Mit- und Nachwelt« zum Segen. Unter rassenpolitischen Vorzeichen vergröbert er, was angesehene Professoren schon länger in gepflegtem Deutsch verbreiteten. Demnach führe »Blutsvermischung« meistens zu »Rassensenkung« und lasse »jene eitrigen Herde« entstehen, »in denen die internationale jüdische Volksmade gedeiht und die weitere Zersetzung endgültig besorgt«. Deshalb gelte es, die »Vergifter« unseres Volkes »auszurotten«. Hitler verklärt derartiges Ausrotten zum »inneren Freiheitskampf« und konkretisiert: Um den »äußeren Freiheitskampf« nach der Schmach des Versailler Friedensdiktats von 1919 siegreich zu führen, bedürfe es vorab der »Vernichtung« all derer, die im Krieg Profite angehäuft und dann die Niederlage zu ihrem Vorteil genutzt hätten. Mal direkt, mal indirekt kündigt der Parteiführer an, er und seine Gefolgsleute würden, sobald sie an die Hebel der Macht gelängen, mit »rücksichtsloser Brutalität« gegen »den internationalen Weltjuden« vorgehen.[2]
Für den seit 1930 exponentiell ansteigenden Erfolg Hitlers waren volkstümliches Auftreten sowie Gewaltdrohungen gegen bestimmte Gruppen und Personen, kombiniert mit positiven Zielen für die als arisch definierte Mehrheit, ausschlaggebend. Eine solche doppelgesichtige Agitation verschaffte und verschafft revolutionären oder kriegerischen Aktionen Popularität. Die Anführer solcher Massenbewegungen versprechen, mit kalkulierter Gewalt ließen sich einige Entwicklungsstufen überspringen, um so das Lebensglück der eigenen Großgruppe nach einer Phase des kurzen entschlossenen Kampfes zu erhöhen und dauerhaft zu sichern.
Von Anfang an sollten massenhafte Zwangssterilisierungen die künftige Volksgesundheit festigen, um Krankheiten, die erblich bedingt seien, endgültig zu überwinden. Der Begriff Rassenreinheit stand für das Ziel einer starken, homogenen, in sich geschlossenen Volksgemeinschaft – frei von Zwietracht und gesellschaftlicher Spaltung. Einerseits präsentierte Hitler seine politische Agenda oftmals in wüstem Ton, andererseits konnte er damit rechnen, dass die mit der Rassenhygiene angeblich verbundenen positiven Wirkungen für das geistige, seelische und körperliche Gedeihen künftiger Generationen weit über rechtsradikale Kreise hinaus auf Zuspruch stießen.
Das betraf auch seine weiteren Standardthemen wie »Der Einfluss fremder Mächte«, »Die innere Zerrissenheit der Deutschen«, »Das Übel der Arbeitsscheuen und Alkoholiker«, »Die Ermöglichung des sozialen Aufstiegs kraft Leistung«, »Die undurchsichtige und zerstörerische Rolle des internationalen Finanzkapitals«, »Die Überwindung des Schandfriedens von Versailles«, »Die Lösung der Judenfrage«, »Die Lösung der Arbeiterfrage« oder »Das Recht auf Notwehr«. Die je nach Publikum und Lage angepasste Mischung aus den genannten Elementen eröffnete der NSDAP seit 1930 die Möglichkeit, in den Hochburgen der SPD, der KPD und – in geringerem Umfang – unter den Wählern der katholischen Zentrumspartei erfolgreich für ihre Ziele zu werben.
Der im Verborgenen wirkende, damals und später kaum beachtete jüdische Zeitdiagnostiker Siegfried Lichtenstaedter veröffentlichte in den Weimarer Jahren mehr als ein Dutzend Texte. 1926 begegnete er dem auflodernden Antisemitismus noch mit Ironie. Seine damals publizierte Satire »Der jüdische Gerichtsvollzieher« spielt in Anthropopolis, der München recht ähnlichen Residenzstadt eines Landes namens Anthropopolitanien. Dort bekennen sich ein Prozent der Einwohner zur jüdischen Religionsgemeinschaft. Die prinzipiell rechtschaffenen Bürger benötigen in ihrer Stadt nur einen Gerichtsvollzieher und besetzen diese Stelle wie üblich mit dem besten Bewerber. Die Wahl fällt auf einen Juden. Weshalb das Gerichtsvollzieheramt nun zu hundert Prozent in jüdische Hand gerät – eine in Anthropopolitanien für jedermann ersichtliche Ungerechtigkeit. Neben vielen anderen Figuren, die den verdrucksten oder leisen, den intellektuell aufgeschäumten oder grölenden Antisemitismus verkörpern, lässt Lichtenstaedter auch die auf Meinungsführerschaft und Skandalisierung erpichten Kommentatoren der anthropopolitanischen Medienwelt auftreten und immer radikaler werden. Gegen Ende der Geschichte schreibt einer von ihnen einen Leitartikel zur nun virulent gewordenen Judenfrage und findet zu folgenden Schlusssätzen:
Wenn auch durch eine unbegreifliche Nachsicht Gottes dereinst Israel im Schilfmeer gerettet und seine Gegner ertränkt wurden, so kann recht wohl in unserer Zeit auch der umgekehrte Fall eintreten: dass Israel unschädlich gemacht, dagegen seine Gegner – richtiger: seine Opfer – gerettet werden. Es gibt noch andere Meere als das Schilfmeer; es gibt außerdem Flüsse, auch in unserem anthropopolitanischen Lande, mit genügendem Wasser, um das ganze Volk Israel unschädlich zu machen!
Wenige Jahre später summten und sangen Millionen Hitlerjungen, BDM-Mädel, SA- und SS-Männer den Ohrwurm: »Die Juden ziehn dahin, daher. / Sie ziehn durchs Rote Meer. / Die Wellen schlagen zu. / Die Welt hat Ruh.« Der in Bayern lange hochangesehene, aber 1982 wegen Rechtsradikalismus verstoßene Spitzenjournalist Franz Schönhuber (1923–2005) berichtete 1992, er habe das Lied mit zwölf Jahren bei der Hitlerjugend gelernt, und fügte hinzu: »Jeder Deutsche, der heute über sechzig ist, hat das gesungen.«
Von diesem Lied gab es Varianten. Eine davon (»O Herr, gebt uns den Moses wieder …«) hatte bereits Theodor Herzl (1860–1904) im österreichischen Zell am See in einer Badekabine gelesen (»die Wände voll antisemitischer Inschriften«) und am 29. Juli 1895 in seinem Tagebuch dokumentiert. Auf diese Version griffen die sehr munteren Schülerinnen und Schüler einer Klasse des Johann-Gottfried-Seume-Gymnasiums im westthüringischen Vacha zurück. Sie berichteten in ihrer Klassenchronik, wie sie 1932, »im Jahr des Entscheidungskampfes der NSDAP«, in die Sexta aufgenommen wurden, und erzählten dann von ihrem Weg zum Abitur.
Hier interessiert der anekdotisch gehaltene Bericht über einen herbstlichen Ausflug in die Rhön im Jahr 1937: »Unterwegs sangen wir dann mehrstimmig das schöne Lied ›O Herr, gebt uns den Moses wieder‹«, das, wie in der Schulchronik dokumentiert, so weitergeht: »Auf dass er seine Stammesbrüder / Heimführe ins gelobte Land. / Lass wiederum das Meer sich teilen / und lasse seine Wassersäulen / Feststehen wie ’ne Felsenwand, / Und wenn in dieser Wasserrinne / Die ganze Judenschaft ist drinne, / O Herr, dann mach die Klappe zu, / Und alle Völker haben Ruh.« Dabei blieb es nicht. Unter der »dirigierenden Hand« des Schülers Hermann Wolle »wurde dieser ›Choral‹ auch in Vacha noch einige Male wiederholt«.[3]
Fünf Jahre später zitierte Polizeimeister Fritz Jacob (1893–1976) in einem Brief die Version »Die Juden ziehn dahin, daher …«. Jacob arbeitete damals als Bezirksoberleutnant in der ukrainischen Stadt Kamenez-Podolsk (Kamjanez-Podilskyj). Noch vor seiner Ankunft waren dort Ende August 1941 mindestens 16000 von der ungarischen Polizei abgeschobene jüdische Männer, Frauen und Kinder erschossen worden. Nicht jedoch die einheimischen Juden. Deren Liquidierung stand noch aus. Am 21. Juni 1942 schrieb Jacob dem ihm persönlich bekannten SS-General Rudolf Querner (1893–1945): »Es waren keine Menschen, sondern Affenmenschen. Nun, wir haben von den hier allein in Kamenez-Podolsk lebenden Jüdlein nur noch einen verschwindenden Prozentsatz von den (ursprünglich) 24000 (Juden). Die in den Rayons lebenden Jüdlein gehören ebenfalls zu unserer Kundschaft. Wir machen Bahn ohne Gewissensbisse. Und dann: ›… die Wellen schlagen zu, die Welt hat Ruh‹.« Einige Wochen zuvor hatte Jacob mitgeteilt: »Es wird hier natürlich gehörig aufgeräumt, insbesondere unter den Juden.«
Wer war dieser Fritz Jacob? Er wurde 1893 in Großröhrsdorf (Ostsachsen) geboren. Nach der Volksschule erlernte er das Weberhandwerk, übte jedoch den Beruf nicht aus, sondern arbeitete wegen der besseren Bezahlung als Ungelernter. 1913 wurde er Soldat, geriet 1915 schwer verwundet in französische Gefangenschaft und verblieb dort bis Anfang 1920. Danach übernahm ihn die Sächsische Landespolizei, setzte ihn zunächst in Dresden ein, später in Schmorkau, Chemnitz und Zittau. 1933 trat Jacob der NSDAP bei. 1939 stieg er zum Ausbilder für Sport und Strafrecht an der Gendarmerie-Schule Ebersbach (Sachsen) auf, 1941 absolvierte er einen Offizierskurs an der Militärakademie Bad Ems. Anschließend fand er als Chef des Gendarmeriepostens im deutsch besetzten Kamenez-Podolsk Verwendung und vollendete damit, obwohl er nur über einen Volksschulabschluss verfügte, einen durchaus typischen sozialen Aufstieg.
Im deutsch besetzten Teil der Sowjetunion verfügte der Polizeioffizier Jacob über die Macht, Menschen in großer Zahl zu ermorden und die christliche Mehrheitsbevölkerung eines Gebietes mit etwa einer Viertelmillion Menschen brachial unter Kontrolle zu halten. In den 1960er Jahren ermittelte die bundesdeutsche Justiz gegen ihn. Das Verfahren wurde wegen Befehlsnotstands eingestellt. Von 1951 bis zu seiner Pensionierung arbeitete Jacob im niedersächsischen Brake als höherer Polizeibeamter.
Weil die judenfeindliche Stimmung 1929 überall spürbar zugenommen hatte, verzichtete Siegfried Lichtenstaedter nun auf das Stilmittel der Satire. Stattdessen kennzeichnete er die Lage ganz unverstellt: »Die Juden sind Feinde des deutschen Volkes und müssen daher mit allen Mitteln bekämpft werden. Dieser Zweck ist heilig und heiligt die Mittel.« Einer solchen betont unterkühlten Feststellung, niedergeschrieben zu einem Zeitpunkt, als die NSDAP noch als Splitterpartei galt, entsprachen die etwas später vom Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens umfassend gesammelten Zitate von Propagandisten der NSDAP, zum Beispiel diese:
Wartet nur, SA-Kameraden, nur noch ein paar Wochen und Ihr dürft die Juden in die Spritzenhäuser sperren, so recht dicht zusammen, dass sie stehen wie die Heringe. Dann ein paar Zentner Viehsalz dazwischen. Aufgemacht wird nicht. Und dann mögen sie pökeln, bis das euch abgezapfte Blut und Schweiß euch zurückgegeben ist. (Aus der Rede des NSDAP-Reichstagsabgeordneten Dr. Martin Löpelmann [1891–1981], gehalten am 21. August 1931 in der Schlossbrauerei Berlin-Schöneberg.)
Denkt Euch in diese Situation hinein. Der Mann, der dem jüdischen »Vorgesetzten« wegen seiner antijüdischen Einstellung und Betätigung Rede und Antwort stehen soll, ist ein Polizeibeamter und steht vor seinem Peiniger, ausgerüstet mit seiner geladenen Dienstpistole … (Aus Der Freiheitskampf, Tageszeitung der NSDAP für den Gau Sachsen, vom 7. November 1931.)
Wir werden die bankgewaltigen Judenlümmel greifen, sie in Güterwagen stecken, plombieren und sie über die Grenze abschieben. Verweigert man im Auslande die Annahme, dann bringen wir sie auf die im Hamburger Hafen liegenden Leerschiffe. Die Nordsee ist ja unendlich weit. (Aus der Rede des ostpreußischen NS-Gauredners Paul Gillgasch [1897–1947], gehalten im März 1932 in Saalfeld/Ostpr.)[4]
2Die NSDAP, Partei der Aufstiegsfreudigen
Schon in der »Kampfzeit«, also lange vor 1933, setzte Hitler seine Gauleiter stets persönlich ein und suchte ausnahmslos solche aus, die den Aufstiegswillen mit ihm teilten. Sie alle erreichten höhere soziale Stellungen als ihre Eltern mit Hilfe der sozialen Mobilisierungsbeschleuniger Bildung, Krieg, Ehrgeiz, demokratischer Revolution von 1918 und nationalsozialistischer Revolution von 1933. Das lässt sich am Beispiel von zwölf nach dem Zufallsprinzip herausgegriffenen, alphabetisch aufeinanderfolgenden Kurzbiographien veranschaulichen:
Hinrich Lohse (1896–1964), evang., Sohn eines Kleinbauern in Mühlenborbek: Handelsschule, kaufmänn. Angestellter, 1925–1945 Gauleiter von Schleswig-Holstein, 1941–1944 zudem Reichskommissar für das Ostland (Baltikum und Teile von Belarus).
Alfred Meyer (1891–1945), evang., Sohn eines Regierungsrats in Göttingen: Gymnasium, Offizier, Studium der Nationalökonomie, Promotion, Zechenbeamter, 1930–1945 Gauleiter von Westfalen-Nord, 1941–1945 zudem Staatssekretär im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete.
Wilhelm Murr (1888–1945), evang., Sohn eines Schlossermeisters in Esslingen: Volksschule, kaufmännische Lehre, Angestellter, Vizefeldwebel, 1928–1945 Gauleiter von Württemberg-Hohenzollern.
Martin Mutschmann (1879–1947), evang., Sohn eines Schlossers in Hirschberg (Saale): Bürgerschule, Handelsschule, kaufmännische Lehre, Angestellter, Gründung eigener Unternehmen, 1925–1945 Gauleiter von Sachsen.
Carl Röver (1889–1942), evang., Sohn eines Kaufmanns in Lemwerder (Oldenburg): Mittelschule, kaufmännische Lehre, Angestellter (1911–1913 in Kamerun), selbständiger Manufakturist, 1928–1942 Gauleiter von Weser-Ems.
Bernhard Rust (1883–1945), kath., Sohn eines Zimmermanns aus dem Eichsfeld, geboren in Hannover: Gymnasium, Studium der Philologie, Gymnasiallehrer, 1925–1940 Gauleiter von Hannover-Nord (später: Süd-Hannover-Braunschweig), 1933/34–1945 zunächst preußischer, dann Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.
Fritz Sauckel (1894–1946), evang., Sohn eines Postassistenten in Haßfurt: nach der 4. Klasse vom Gymnasium abgegangen, Ausbildung zum Seemann, Matrose, 1922–1923 Besuch der Ingenieurschule, 1927–1945 Gauleiter von Thüringen, 1942–1945 zudem Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz (insbesondere von Zwangsarbeitern).
Franz Schwede (1888–1960), evang., Sohn eines Försters in Drawöhnen (Memel): Volksschule, Maschinenschlosser, Maschinistenmaat, Bordkommando auf SMS Kaiser Wilhelm II., 1918 Maschinisten-Deckoffizier, bis 1920 in englischer Kriegsgefangenschaft, technischer Betriebsleiter, 1934–1945 Gauleiter von Pommern.
Gustav Simon (1900–1945), kath., Sohn eines Bahnbeamten in Mahlstatt-Burbach: Volksschule, Lehrerseminar, Studium der Volkswirtschaft, Diplomhandelslehrer, Studienreferendar, 1931–1945 Gauleiter von Koblenz-Trier (später: Moselland).
Jakob Sprenger (1884–1945), evang., Sohn eines Landwirts in Oberhausen (Rheinpfalz): Progymnasium, Telegraphenschule, Oberpostinspektor, 1927–1945 Gauleiter von Hessen-Nassau-Süd (später: Hessen-Nassau).
Julius Streicher (1885–1946), kath., Sohn eines Volksschullehrers in Fleinhausen: Volksschule, Lehrerseminar, Aushilfslehrer, Hauptlehrer, 1930–1940 Gauleiter von Mainfranken (später: Franken).
Emil Stürtz (1887–1945), evang., Sohn eines Landarbeiters in dem ostpreußischen Dorf Wieps: Volksschule, Oberrealschule, Seemann, Soldat, Kriegsinvalide, Kraftfahrer, 1936–1945 Gauleiter von Brandenburg (später: Kurmark/Mark Brandenburg).[1]
Häufig wird unterstellt, die Führer der NSDAP entstammten einer von sozialen Erschütterungen bedrohten unteren Mittelschicht, die in abwertender Tonlage gerne als kleinbürgerlich bezeichnet wird. Das stimmt nicht. In ihrer Gesamtheit repräsentierten die Funktionäre des NS-Staats die aus der jeweils tieferen in die nächsthöhere Schicht Drängenden. Sie vertraten nicht die Absteiger oder Abstiegsbedrohten, sondern diejenigen, die vorankommen wollten: hochmotivierte Menschen, die angesichts des wirtschaftlichen und politischen Durcheinanders, das die Weimarer Republik seit 1929 kennzeichnete, um ihre Zukunftschancen bangten und deshalb umso mehr nach oben drängten und zäh an ihren Ambitionen festhielten.
Der Gauleiter der Rheinpfalz, später der Saarpfalz und dann – nach der Vergrößerung seines Territoriums um Teile Lothringens – der Westmark, hieß Josef Bürckel (1895–1944). Er war der Sohn eines Bäckers im pfälzischen Dorf Lingenfeld, bestand nach der Volksschule die Aufnahmeprüfung für die Lehrerbildungsanstalt in Speyer und nahm 1914 bis 1916 als Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teil. Anschließend arbeitete er zehn Jahre lang als Dorflehrer. Er kannte die Nöte der einfachen Leute und sprach deren Mundart. Als nationaler Sozialist polemisierte er gegen »Arbeitsschinder«, »Börsenhyänen«, »kapitalistisches Bonzentum«, gegen »Mietwucher«, »Preistreiberei«, gegen »Ausbeuter«, die Menschen nur »als Nummern« oder »wie Maschinen« behandeln, und gegen »Volksschädlinge« aller Art. Mit den Repräsentanten der evangelischen Kirche pflegte der katholisch getaufte Bürckel einvernehmlichen Umgang, solange sie an der Devise festhielten »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist – und Gott, was Gottes ist«. Infolge der Krise konnten die Weinbauern der Pfalz ihren Wein nicht mehr absetzen. Dort herrschte um 1930 Armut in einem Ausmaß, das man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Auch deshalb setzten die Menschen auf den Nationalsozialismus. Und dieser brachte ihnen zunächst Vorteile. Die Politik der Autarkie eröffnete den Winzern Absatzmärkte im Inland; im Oktober 1935 erfand Bürckel die Deutsche Weinstraße – ein Projekt, um den Fremdenverkehr und den Verkauf der Landesprodukte zu fördern, den Menschen die Perspektive auf eine bessere Zukunft zu geben. Die Idee funktioniert bis heute. Bürckel selbst errang zwischenzeitlich eine Reihe klangvoller Titel: Reichskommissar für die Rückgliederung des Saargebiets, Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich, Reichsstatthalter der Westmark, Chef der Zivilverwaltung in Lothringen. Am 26. September 1944 starb Josef Bürckel infolge von Alkoholabusus und Überarbeitung.
Beispielhaft seien neben den Gauleitern 31 Ortsgruppenleiter des 1935 an Deutschland zurückgegliederten Saarlandes genannt. Weil dieses Gebiet infolge des Versailler Vertrags für mindestens 15 Jahre von Deutschland abgetrennt worden war, trat man dort erst verzögert der Partei Hitlers bei. Die Berufsstruktur der dortigen Kreisleiter entsprach dem, was heutzutage mit dem Attribut »Mitte der Gesellschaft« etikettiert wird: fünf Lehrer, zwei Bahnbeamte, zwei Schuldirektoren, ein Regierungsrat, neun andere Angehörige des öffentlichen Dienstes, drei Landwirte, zwei Arbeiter, ein Arzt. Zwölf von ihnen waren vor dem 31. Dezember 1932 der NSDAP beigetreten, 19 danach, ihr Altersdurchschnitt lag 1935 bei 37 Jahren.[2]
Die NSDAP zog den Landarbeitersohn an, der Facharbeiter werden wollte, den Arbeitersohn, der es zum Techniker gebracht hatte, den Handwerkersohn, der es als Werkstudent unter erheblichen Mühen zum Volljuristen schaffte, die Bahnschaffnertochter, die Volksschullehrerin werden wollte, die Bauerntochter, die den Modeberuf der Stenotypistin ergriff, um aus der dörflichen Enge in die Großstadt zu entfliehen. Die NS-Bewegung nahm die Ziele, Unsicherheiten und Ängste derer auf, die infolge des Kriegs und dank der sozialen Mobilisierung in der Weimarer Republik in Bewegung geraten, aus den als zu statisch empfundenen Milieus ihrer Elternhäuser ausgebrochen waren oder ausbrechen wollten, das Neue, das Höhere, Interessantere und beruflich Erfüllende suchten.
Die so Definierten umfassten viele Millionen Menschen, insbesondere jüngere. Sie alle folgten einer von der Weimarer Republik und den Roaring Twenties befeuerten klassenübergreifenden Drift nach oben. Der besondere Witz bestand darin, dass die massenhaft Emporstrebenden von ganz verschiedenen Ebenen der sozialen Pyramide aus starteten und ihr Augenmerk auf unterschiedliche, jedoch stets in der sozialen Hierarchie etwas höher gelegene Nahziele richteten. Soziologisch verband diese ständig fluktuierende und wachsende Großgruppe gerade nicht die Klassenzugehörigkeit, sondern die Lust, die Klassengrenzen zu überschreiten. Auf diese Weise wurden die Klassenschranken in zwei Richtungen heruntergesetzt: Die Neuaufsteiger stießen vertikal nach oben vor und verbanden sich horizontal mit Lebenspartnern, die weit häufiger als in den Jahrzehnten zuvor aus einer darunter- oder darüberliegenden sozialen Schicht stammten.
Diese für sich genommen positive, dank der demokratischen Revolution stark beschleunigte Entwicklung wurde in der NS-Programmatik und -Propaganda mit großem Erfolg aufgegriffen. Anders als Kommunisten, Linkssozialisten oder strikt bürgerliche Parteien förderte die NSDAP das durch äußere Umstände ausgebremste individuelle Verlangen nach einem besseren gesellschaftlichen Status. Zudem bot sie den vielen Halt, die auf ihrem Weg nach oben von Statusunsicherheiten geplagt wurden. Diese Konstellation machte die Idee der Volksgemeinschaft automatisch attraktiv. Sie entsprach dem Bedürfnis, beim Verlassen tradierter sozialer Milieus mit gleichermaßen mobilisierten Menschen eine dem Neuen und der Zukunft zugewandte Gemeinschaft zu bilden und gesellschaftliche Orte zu schaffen, an denen die jeweilige Herkunft eine vergleichsweise geringe Rolle spielte. Insofern folgte die Selbstdefinition der NSDAP als gesellschaftlich übergreifende gesamtdeutsche Bewegungspartei einem tatsächlich vorhandenen Bedürfnis sehr vieler damaliger Deutscher. Die entsprechenden Programmpunkte, das relativ geringe Alter ihrer Mitglieder und Funktionäre, kurzum: ihr politisches Profil, unterschied die NSDAP von den anderen Parteien der Weimarer Republik wesentlich.
Allgemein sprach Hitler 1942 von der »sittlichen Pflicht« eines jeden Vaters, »dass es seinen Kindern besser gehe, als es ihm einst in der Jugend ergangen sei«. Das hieß für ihn und die »führenden Männer«, kommenden Generationen »das Elend und das Leid« zu ersparen, welches »sie selbst einst durchmachen mussten«. Ein kleines, jedoch leicht messbares Segment im Millionenheer der Aufstiegsfreudigen bildeten die Abiturienten. Hatten zu Anfang des 20. Jahrhunderts noch 80 Prozent der preußischen Abiturienten ihre Reifeprüfung an einem humanistischen Gymnasium abgelegt, fiel deren Anteil nach 1919 auf 32 Prozent. Die neuen, weniger elitären Konkurrenzanstalten, die Realgymnasien und Oberrealschulen, genossen bevorzugte Förderung, und das mit Erfolg: 1929 stellten die Kinder von unteren und mittleren Beamten, Angestellten, Handwerkern und kleineren Landwirten etwa zwei Drittel der Schüler an höheren Bildungsanstalten. Diese jungen Leute, die dank des republikanischen Fortschritts jeweils als Erste ihrer Familie das Abitur erlangten und dann zum erheblichen Teil in akademische Gefilde vorstießen, fühlten sich in der neuen sozialen Rolle noch unsicher. Sie waren nicht mit Büchern aufgewachsen. Sie hatten Akkordeonspielen gelernt, nicht Klavier, sie tranken Bier und wussten wenig von Wein, vertrieben sich die Zeit mit Skat und Schafkopf, nicht mit Schach. Generell zweifelten sie mehr oder weniger stark an ihren Fähigkeiten, die Herausforderungen des Studiums zu meistern – ein Grundgefühl, das die Weltwirtschaftskrise bald ins schwer Erträgliche steigerte.