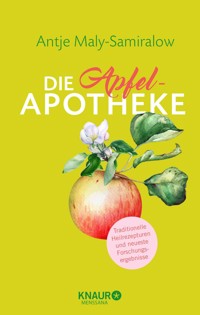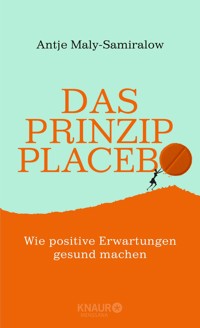
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur MensSana eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Gesund durch Zuversicht Placebos sind die Pillen, die nicht wirken? Nur ein Täuschungsmanöver der Ärzte? Mit dieser weitverbreiteten Auffassung räumt Antje Maly-Samiralow radikal auf. Die Journalistin legt mit "Das Prinzip Placebo" das erste populärwissenschaftliche Faktenbuch vor, das verblüffende Zusammenhänge zwischen der Psyche und der Heilkraft des Körpers aufdeckt. Denn die Wissenschaft beweist: Auch alle, die Placebos einnehmen, können profitieren, wenn ihr Gehirn auf den Heilerfolg konditioniert wird. Was heilt, ist unter anderem die Zuversicht. Und die kann wirkmächtige Placebo-Effekte hervorrufen. Negative Suggestionen hingegen können Nocebo-Effekte entfachen, mit zum Teil verheerenden Folgen für die Gesundheit der Betroffenen. Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse zeigt die Autorin Möglichkeiten auf, wie jeder seine Gesundheit selbst positiv beeinflussen und unnötige Nocebo-Effekte vermeiden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Antje Maly-Samiralow
Das Prinzip Placebo
Wie positive Erwartungen gesund machen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Placebos sind die Pillen, die nicht wirken? Nur ein Täuschungsmanöver der Ärzte?
Mit dieser weitverbreiteten Auffassung räumt Antje Maly-Samiralow radikal auf. Die Medizinjournalistin legt mit »Das Prinzip Placebo« das erste populärwissenschaftliche Faktenbuch vor, das verblüffende Zusammenhänge zwischen der Psyche und der Heilkraft des Körpers aufdeckt. Denn die Wissenschaft beweist: Auch alle, die Placebos einnehmen, können profitieren, wenn ihr Gehirn auf den Heilerfolg konditioniert wird.
Was heilt, ist unter anderem die Zuversicht. Und die kann wirkmächtige Placebo-Effekte hervorrufen. Negative Suggestionen hingegen können Nocebo-Effekte entfachen, mit zum Teil verheerenden Folgen für die Gesundheit der Betroffenen.
Die Autorin zeigt Möglichkeiten auf, wie jeder seine Gesundheit selbst positiv beeinflussen und unnötige Nocebo-Effekte vermeiden kann
Inhaltsübersicht
Einleitung
Ungünstige Prognosen schlecht verpackt
Patienten berichten
Warum Angehörige und Freunde Hoffnung zerstören
Der versprochene Tod – ein grausames Nocebo-Phänomen
Voodoo-Tod
Placebo – Nocebo – ist was?
Das Placebo
Der Placebo-Effekt
Die Placebo-Analgesie
Der Nocebo-Effekt
Suggestionen – Die Macht der Worte
Kommunikation in der Medizin
Medizinerjargon
Erhöhte Aufmerksamkeit während einer OP
Verneinung, Verharmlosung, Verunsicherung
Nocebo-Effekte durch falsche Überzeugungen
Direkte Negativsuggestionen
Positive Suggestionen
Wie ich wieder schlafen lernte
Vertrauen befeuert Placebo-Effekte
Auf ein Wort
Die ausgestreckte Hand – nonverbale Kommunikation
Ohne einfühlsame Mediziner keine Placebo-Effekte
Placebo-Effekte als Teil des Therapieerfolgs
Die Herzflüsterer
Placebos senken den Blutdruck
Selbst der Magen reagiert auf Placebos
Auch Parkinsonpatienten profitieren von Placebo-Effekten
Ein gereizter Darm reagiert sogar auf »offene« Placebos
Verbesserte Wirkung von Migränepräparaten
Ausgeschlafen durch Placebos
Geht es auch ohne Placebos?
Schmerzen mögen keine Placebos
Schmerz ist eine lange Kette von Signalen
Die körpereigene Schmerzapotheke
Weniger Schmerzen in der Sippe
Schmerzen anders und neu bewerten
Tango statt Fango
Die Psychologie des Placebo-Effekts
Wenn das Glöckchen klingelt, gibt es Futter
Die konditionierte Immunantwort
Konditionierte Immunantwort bei Allergien
Was nichts kostet, ist nichts wert
Teure Zuckerpillen wirken besser als billige
Professoren haben das größere Placebo-Potential?
Je schmerzhafter, desto wirksamer?
Andere Zeiten, andere (Placebo-)Werte
Wie schaffe ich mir meine eigenen Placebo-Effekte?
Innere Bilder können Placebo-Effekte schaffen
Entspannung ist immer gut
Nocebos lauern überall
Zu Risiken und Nebenwirkungen …
Von Killerviren und Gluten-Unverträglichkeiten
Wie viel Placebo ist zulässig?
Literaturempfehlungen
Dank
Einleitung
Es ist schon sehr lange her, so lange, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, wie alt ich war, als es mir zum ersten Mal widerfuhr: Alle um mich herum hatten eine ordentliche Erkältung, husteten und niesten aus Leibeskräften. Ich dachte mir, wenn das so weitergeht, stecken sie mich an und ich werde auch krank. Prompt begann meine Nase zu kribbeln, der Hals fing an zu kratzen, und keine 24 Stunden später hatte ich eine handfeste Erkältung. Nachdem sich dieser Vorfall noch mehrere Male wiederholt hatte und ich jedes Mal, wenn ich fürchtete, krank zu werden, geradezu darauf warten konnte, tatsächlich zu erkranken, kam mir der Gedanke, dass es einen wie auch immer gearteten Zusammenhang zwischen meiner Angst und der sich darauf einstellenden Erkrankung geben müsse. Irgendwann fiel mir auf, dass sich dieses Phänomen nicht allein auf harmlose Erkältungen beschränkte. Egal, was ich mir ›herbeidachte‹, der Mechanismus war immer der gleiche. Ich empfand eine nicht unerhebliche Abscheu gegenüber einer bestimmten Erkrankung und ihrem Erscheinungsbild. Je unangenehmer und unansehnlicher das jeweilige Gebrechen zutage trat, desto größer war meine Angst, in einen ähnlich schlimmen Zustand zu geraten. Ich malte mir regelrecht aus, wie es mir damit ergehen würde, und litt unter Symptomen, die ich – noch – nicht hatte. Doch das mit den Symptomen war nur eine Frage der Zeit, denn die stellten sich erwartungsgemäß ein.
Nun könnte man meinen, ich sei ausgesprochen hypochondrisch veranlagt. Nun, vielleicht war ich das zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich. Irgendwann sprach ich mit einem Hautarzt über dieses merkwürdige Phänomen. Ich vertraute ihm alle mir bis dahin bewusst gewordenen Symptome an und erzählte von meiner Vermutung, dass ich mir diese mehr oder weniger selbst verschuldet ins Haus geholt hätte. Er lachte und erzählte mir von seinen Erfahrungen. Während seiner Studienzeit habe er einige Kommilitonen erlebt, denen es wie mir ergangen sei, nur viel drastischer. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Medizinstudenten Symptome einer Krankheit entwickeln, mit der sie sich gerade eingehend beschäftigen. Dabei schien die Intensität der Auseinandersetzung ausschlaggebend dafür zu sein, ob und wie stark die gefürchteten Symptome zutage traten. Ob besonders ängstliche Menschen eher dazu neigen, konnte er nicht mit Bestimmtheit sagen, vermutete es aber. Die Ausführungen meines Dermatologen waren mir seinerzeit zumindest ein kleiner Trost. Ich dachte, wenn selbst angehende Mediziner Opfer ihrer Vorstellungskraft werden können, bin ich zumindest nicht allein mit diesem Problem, auch wenn dieses Wissen mir nicht half, den Teufelskreis zu durchbrechen, in dem ich festzustecken schien. Irgendwann verfiel ich auf die Idee, den Spieß einfach umzudrehen. Wenn man durch negative Gedanken erkranken kann, müsste man sich doch genauso gut durch positive Gedanken gesund denken können, reimte ich mir in meiner laienhaften Vorstellung zusammen.
Fortan versuchte ich, meine Angst vor den Krankheiten anderer Leute an die Leine zu nehmen. Stattdessen habe ich mir eine Art innere Chuzpe zugelegt, die mich heute weitestgehend davor schützt, immer und immer wieder in die gleiche Falle zu tappen. Wenn ich beispielsweise bei winterlichen Temperaturen leicht bekleidet nach draußen gehe, weil ich etwas aus dem Auto holen will, denke ich nicht etwa: »Geh bloß schnell wieder rein, sonst wirst du noch krank …«, sondern vielmehr: »Oh, das ist ganz schön kalt, aber das härtet ab.« Falls Sie sich an dieser Stelle in der Hoffnung wiegen, in diesem Buch Tipps für garantiert erkältungsfreie Winter zu finden, muss ich Sie enttäuschen. Auch ich habe nach wie vor meine Infekte und anderen Wehwehchen. Auch mein Immunsystem liegt bisweilen darnieder und lässt Viren und Bakterien freies Spiel. Aber ich bin deutlich seltener krank als früher, und ich konnte auch ein paar Krankheiten, die bereits zu chronifizieren drohten, aus meinem Leben verbannen. Heute habe ich eine deutlich bessere Vorstellung davon, was es mit positiven und negativen Erwartungshaltungen auf sich hat und welchen Einfluss sie auf die Gesundheit nehmen können.
So können positive Gedanken und Erwartungen Placebo-Effekte auslösen. Wenn man beispielsweise erwartet, dass Kopfschmerzen nach der Einnahme einer Tablette zurückgehen, obgleich die Pille, die man gerade geschluckt hat, nur ein Scheinmedikament ist und folglich keine pharmakologisch relevanten Substanzen im Spiel sein können, und der Kopfschmerz trotzdem abklingt, hat das in erster Linie mit der positiven Erwartung zu tun, die man mit der Einnahme der Tablette verbunden hat. Mit anderen Worten, allein die Vorstellung, dass die Tablette hilft, führt dazu, dass sie tatsächlich helfen kann. Je stärker man davon überzeugt ist, dass die Tablette helfen wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kopfschmerzen auch wirklich abklingen.
Im Umkehrschluss kann die Erwartung eines negativen Szenarios genau dieses herbeiführen. Wenn man beispielsweise eine Tablette gegen Magenschmerzen einnimmt und davon in Kenntnis gesetzt wird, dass dieses Medikament zwar Magenschmerzen erfolgreich beheben kann, man aber damit rechnen müsse, einen leichten Schwindel zu entwickeln, so ist es durchaus möglich, dass einem nach Einnahme der Tablette schwindelig wird, obwohl diese Nebenwirkung frei erfunden ist. Allein die Vorstellung, die Magentablette könne Schwindel hervorrufen, kann dazu führen, dass der Boden zu tanzen beginnt und man sich ganz schnell setzen muss. Von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen zu sprechen ist wissenschaftlich nicht ganz korrekt, aber es trifft die Sache doch im Kern. Das Wort »erwarten« sagt ja nichts anderes, als dass man einen in der Zukunft liegenden Zustand vorwegnimmt und davon ausgeht, dass er eintritt. So sprechen Wissenschaftler von der »antizipatorischen« Schmerzerwartung. Wenn man fürchtet, das Bohren beim Zahnarzt könne weh tun, und geradezu darauf wartet, dass der Schmerz jeden Moment einsetzt, nimmt man das Schmerzerlebnis vorweg, das heißt, man antizipiert es. Man geht davon aus, dass es so kommen wird. Tja, und damit wären wir auch schon bei der sich selbst erfüllenden Prophezeiung.
Ich hatte das Glück, vor einigen Jahren bei der Vorbereitung eines Filmprojekts die Placebo-Forscherin PD Dr. med. Karin Meissner kennenzulernen, die an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München forscht und lehrt. Sie gewährte mir erste Einblicke in das weite Feld der Placebo-Forschung und half mir, meine persönlichen Erwartungshaltungen und deren Folgen besser zu verstehen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn die eigenen laienhaften Ahnungen und Vorstellungen, die man über Jahre gehegt hat, plötzlich wissenschaftlich erklärbar werden und man in seinen schemenhaften Vermutungen bestätigt wird. Seit dieser Unterhaltung mit meinem Dermatologen, der von den »angehexten« Erkrankungen seiner Kommilitonen berichtete, wusste ich ja, dass nicht wenige Menschen unter ihren Erwartungen leiden, nicht zu reden von all denen, die durch eine tendenziöse Berichterstattung in den Medien verunsichert werden und plötzlich Symptome entwickeln, von denen sie am Vortag in der Zeitung gelesen haben.
Daher keimte in mir der Wunsch, das Wissen um Placebo- und Nocebo-Phänomene zusammenzutragen, um all denen, die, wie ich seinerzeit, Krankheiten aus dem Nichts heraus entwickeln, zu zeigen, dass man negative Erwartungen sehr wohl auch in positive umwandeln kann. Die Placebo-Forschung zeigt eindrücklich, welchen Einfluss Erwartungen und erlernte Verhaltensmuster auf den Verlauf und das Ergebnis einer Therapie haben können. Je besser Wissenschaftler verstehen, welche Mechanismen dem Placebo- wie auch dem Nocebo-Effekt zugrunde liegen, desto gezielter können sie Hilfestellung geben, um beispielsweise die Wirkung von Medikamenten zu verbessern. Deutsche Wissenschaftler haben sich in der weltweiten Placebo-Forschung einen hervorragenden Ruf erarbeitet.
Als ich mich mit dem Gedanken trug, dieses Buch auf den Weg zu bringen, war mir nicht vollends bewusst, in welche Bereiche die Forschung bereits vorgestoßen ist und welche verblüffenden Erkenntnisse mittlerweile vorliegen. Wenn mein Plan aufgeht, dürften Sie, liebe Leserinnen und Leser, nach der Lektüre dieses Buches ein besseres Verständnis für Ihre eigene Krankengeschichte haben und möglicherweise in der Lage sein, diese ein klein wenig selbst zu beeinflussen. Abgesehen davon, hoffe ich, Ihnen so viel mit auf den Weg geben zu können, dass Sie sich künftig nicht mehr von Angst auslösenden Schlagzeilen und negativen Prognosen ins Bockshorn jagen lassen. Denn wenn von Nocebo die Rede ist, sind es nicht immer nur die eigenen negativen Erwartungen, die krank machen können. Mitunter fühlen sich andere Menschen berufen, uns Krankheiten einzureden. Auch der Beipackzettel, der in jeder Tablettenschachtel steckt, hat durchaus das Potential, Sie so weit zu verunsichern, dass die beschriebenen Risiken und Nebenwirkungen tatsächlich Gestalt annehmen.
Ungünstige Prognosen schlecht verpackt
Es ist gut zehn Jahre her, dass ich mich einer Routineuntersuchung unterzog, obwohl ich erst Mitte dreißig war und eigentlich nicht wusste, warum dies notwendig sein sollte. Aber mein Hausarzt riet mir dazu, und ich folgte seinem Rat. Als er mit dem Ultraschall meine Galle durchleuchtete, stieß er auf kleine Gewächse. Ich erinnere mich noch ziemlich genau an seine Worte. Noch bevor er die Knötchen in ihrer Größe vermessen hatte, sprach er von einer potentiell notwendigen Gallen-Operation. »Das könnten Polypen sein, und wenn die mal entarten, dann muss die Galle raus, bevor dort ein Krebsgeschwür entsteht.« Ich war so perplex, dass es mir die Sprache verschlug. Heute vermute ich, dass ich unter Schock stand und gar nicht in der Lage war, angemessen nachzufragen, um die Diagnose ins rechte Licht rücken zu lassen.
Anstatt mich sachgerecht aufzuklären, ließ mein Arzt seinen Vermutungen weiter freien Lauf. Er fragte mich, ob er nicht ein paar Tumormarker ermitteln lassen solle, wo er doch ohnehin schon Blut abgenommen habe, »… nur um auf Nummer sicher zu gehen«. Er hatte mir innerhalb weniger Minuten zweimal vor Augen geführt, ich könne ein Krebsgeschwür in der Galle haben oder zumindest in absehbarer Zeit entwickeln. Ich weiß noch wie heute, dass es ein warmer Sommertag war. Ich weiß auch noch, welches Kleid ich trug. Und ich weiß noch ziemlich genau, dass ich am Abend dieses Tages ausgehen wollte. Nach dieser Diagnose war mir nach allem Möglichen zumute, nur nicht nach Amüsement. Ich wusste gar nicht, wohin mit meiner Angst.
Die Erhebung irgendwelcher Tumormarker habe ich seinerzeit abgelehnt. Das war wohl weniger eine rationale als vielmehr eine intuitive Reaktion. Mein Arzt hatte nämlich noch ein paar ähnlich gelagerte Diagnosebeispiele zur Hand. Er berichtete von einem jungen Mann, dem er ebenfalls aufgrund kleiner Polypen in der Galle zur Operation geraten hatte. Nach dem Eingriff stellte sich jedoch heraus, dass die vermeintlich gefährlichen Gewächse alles andere als gefährlich waren und der Mann seine Galle für nichts und wieder nichts verloren hatte. Vielleicht wollte mein Arzt damit zum Ausdruck bringen, dass solche Polypen nicht gefährlich sein müssen. Vielleicht wollte er seine verunglückte Prognose relativieren. Vielleicht schwante ihm, dass er zu schwarz gemalt hatte.
Was auch immer er sagen wollte, faktisch hatte er seine Diagnose in falsche Worte gekleidet und mich in einen Zustand schlimmster Verunsicherung versetzt. Aus heutiger Sicht hätte ich mir eine Zweitmeinung einholen müssen. Ich weiß heute nicht mehr zu sagen, warum ich das nicht tat. Es bedurfte einer geradezu ungeheuerlichen Fehldiagnose, die er in ähnlich ungeschickte Worte kleidete, bis mir aufging, dass dieser Arzt nicht gut für mich sein konnte.
Nur wenige Monate nach besagter Gallengeschichte kam ich, nachdem ich bereits einen halben Tag in der Notaufnahme eines Münchner Klinikums verbracht hatte, mit einem heftigen Drehschwindel in seine Praxis. Ohne mich zu untersuchen, orakelte er, ich hätte vermutlich eine Entzündung im Gehirn, die er mit einer mehrtägigen Cortison-Infusion zu kurieren gedenke. Meine laienhafte Vermutung, dass der Schwindel von einem eingeklemmten Nerv herrühren könne – ich hatte zu dem Zeitpunkt fürchterliche Schmerzen im Schulter-Nacken-Bereich und konnte den Kopf kaum drehen –, schlug er glatt in den Wind. Als ich ihn fragte, wie er denn zu der Überzeugung gelangt sei, ich könne eine Entzündung im Gehirn haben, wo er mich doch noch nicht einmal untersucht habe, sagte er mir wörtlich: »Das kommt bei Frauen Ihres Alters ziemlich oft vor.« Daraufhin verließ ich seine Praxis und habe sie nie mehr betreten. Der Schwindel war tatsächlich die Folge eines eingeklemmten Nervs. Ich ging noch am selben Tag zum Orthopäden meines Vertrauens, der mir eine Spritze in die schmerzende Schulter gab. Kurz darauf klang der Schwindel ab.
Seit nunmehr zehn Jahren lebe ich mit den Polypen in meiner Galle. Zweimal im Jahr lasse ich sie von meinem Hausarzt überprüfen. Auch er hat mich darauf hingewiesen, dass man diese Gewächse im Auge behalten und die Galle gegebenenfalls entfernen müsse, falls die Polypen eine bestimmte Größe überschreiten oder sich vermehren. Aber im Gegensatz zu seinem Kollegen hat er mir keine Angst eingejagt. Er hat mich sachlich über die Risiken und Behandlungsmöglichkeiten solcher Gallenpolypen aufgeklärt. Bislang sind sie weder gewachsen, noch haben sie sich vermehrt. Und sollte es doch eines Tages so sein, weiß ich, was mich erwartet. Ich bin darauf vorbereitet und habe keine Angst vor einem möglichen Eingriff, weil mir die Notwendigkeit einer solchen Operation im Ernstfall bewusst sein wird.
Nun war ich seinerzeit in der glücklichen Lage, die für mich richtigen Konsequenzen aus den Vorkommnissen zu ziehen, und bin letztlich gestärkt aus der Situation hervorgegangen: gestärkt in dem Bewusstsein, dass Ärzte nicht immer auf der Basis stichhaltiger Befunde urteilen, sondern mitunter Meinungen und Vermutungen äußern und lieber auf Statistiken vertrauen, anstatt ihren Patienten zuzuhören; bestärkt auch in der Überzeugung, dass man sich solchen Meinungen nicht aussetzen muss. Hierzulande haben Patienten das Recht auf freie Arztwahl. Nun lebe ich in München, deren Bewohner sich über einen Mangel an Fachärzten wahrlich nicht beklagen können. Mir ist sehr wohl bewusst, dass Menschen vor allem in ländlichen Gegenden froh sind, überhaupt einen Facharzt in ihrer Nähe zu wissen. Trotzdem sollten sie sich nicht ins Bockshorn jagen lassen und im Zweifelsfall eine längere Anfahrt in Kauf nehmen. Wenn man sich als Patient schlecht beraten oder behandelt fühlt, ist das Vertrauensverhältnis, die Beziehung zwischen Arzt und Patient, möglicherweise so weit gestört, dass eine sinnvolle und zielführende Betreuung und Therapie erschwert, wenn nicht sogar unmöglich werden.
Ich habe mich damals relativ schnell von dem Schreck, den mein Hausarzt mir mit seinen Tumormarkern und Krebsgeschwüren eingejagt hat, erholt und keinen nennenswerten Schaden davongetragen. Die Entscheidung gegen eine Gallen-OP und die fragwürdige Cortison-Therapie zur Behandlung einer nicht existenten Hirnentzündung fiel mir möglicherweise auch deshalb so leicht, weil im Fall der Galle kein akuter Handlungsbedarf bestand, ich folglich nicht sofort reagieren musste, und im Fall des Drehschwindels die Diagnose des Arztes so abstrus klang, dass ich ihm Gottlob nicht auf den Leim gegangen bin.
Aber es gibt Situationen, die keine längeren Bedenkzeiten lassen und eine schnelle Entscheidung erfordern. Jede Frau, die sich aufgrund einer späten Schwangerschaft prädiagnostischen Maßnahmen unterzieht, um sicherzugehen, dass keine Gendefekte vorliegen, weiß um die Unsicherheit, die mit diesen Maßnahmen einhergeht. Unterschwellig ist immer ein Fünkchen Angst im Spiel. Schließlich möchte jede werdende Mutter ein gesundes Kind zur Welt bringen. So erlebte es auch eine Bekannte von mir.
Als sie zusammen mit ihrem Mann in die Frauenklinik ging, um die Befunde einer Fruchtwasseruntersuchung zu besprechen, brach ihre Welt zusammen. Eine Krankenschwester fühlte sich berufen, die Ergebnisse auszuwerten, und erklärte den werdenden Eltern, die Werte sähen nicht gut aus und sie müssten damit rechnen, ein Kind mit offenem Rücken zu bekommen. Was das bedeutet und welche Folgen ein offener Rücken nach sich ziehen kann, ließ die Krankenschwester offen. Der künftige Vater zweifelte die Einschätzung der Krankenschwester an und ließ sich die Untersuchungsergebnisse aushändigen. Damit ging das Paar zur betreuenden Gynäkologin, deren Meinung anders ausfiel. Zwar lagen die Werte tatsächlich am Rand des grünen Bereichs, aber die Eltern brauchten sich keine Sorgen zu machen. Die Frauenärztin klärte die Eltern auch darüber auf, dass man eine solche Entwicklungsstörung, so sie denn eintreten sollte, behandeln kann. Damit hatte die Gynäkologin alle Ängste und Zweifel behoben, so dass meine Bekannte ihre Schwangerschaft genießen und sich auf ihr Kind freuen konnte. Dieses Kind ist heute 25 Jahre alt und kerngesund. Was wäre gewesen, wenn die Mutter keine Zweitmeinung eingeholt und auf das Urteil der Krankenschwester vertraut hätte? Man mag es sich nicht ausmalen. Allein die Zeit, die bis zum Termin bei der Gynäkologin verstrichen ist und die die Schwangere mit Zweifeln und Ängsten verbringen musste, war eine unnötige Tortur für sie, für ihren Mann und für das Kind in ihrem Bauch. Besagte Krankenschwester hat vermutlich keinen Gedanken daran verschwendet, was sie mit ihren unüberlegten Worten angerichtet hat. Und wer weiß schon, wie vielen anderen Frauen sie in ähnlicher Weise die Freude an der Schwangerschaft vergällt hat.
Nun muss man sich als Patient natürlich darüber im Klaren sein, dass jede diagnostische Maßnahme einen Befund zum Ergebnis haben kann. Der ärztlichen Aufklärungspflicht gemäß müssen Mediziner Patienten aufklären, was dies im konkreten Fall bedeutet, welche Behandlungsoptionen bestehen und was passieren kann, wenn Patienten eine Therapie ablehnen. Wer unbedingt wissen will, wie es um ihn steht, und sich regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen unterzieht, muss auch damit leben können, wenn diese ein negatives Ergebnis hervorbringen. Vor diesem Hintergrund sollten Patienten sich genau überlegen, ob sie wirklich wissen wollen, welche potentiellen Risiken sie in sich tragen – mit Betonung auf potentiell –, bevor sie zum Screening gehen. Das ist eine Verantwortung, der sich Patienten stellen müssen. Mediziner hingegen sind in der Verantwortung, Aufklärungsgespräche so zu führen, dass Patienten nicht unnötig verunsichert werden.
Mein erster Hausarzt hätte mir auch schonender beibringen können, dass ich die Polypen habe, ohne gleich von Krebs sprechen zu müssen. Meinem zweiten Hausarzt ist das ja auch gelungen. Dass die Krankenschwester, die meiner Bekannten die Hiobsbotschaft vom offenen Rücken ihres Kindes überbracht hat, überhaupt nicht kompetent war, die Ergebnisse einer Fruchtwasseruntersuchung zu analysieren, mag auf den personellen Notstand in dieser Klinik zurückzuführen sein. Die betreuende Gynäkologin hat meine Bekannte indessen nach allen Regeln ärztlicher Kunst aufgeklärt und den kurzeitigen Schaden behoben. Ich habe diese Beispiele bewusst gewählt, weil sie zeigen, was Ärzte, Therapeuten, aber auch Krankenschwestern und -pfleger mit Worten anrichten können. Aber die Beispiele zeigen auch, wie verantwortungsvoll Menschen in medizinischen Berufen mit Worten umgehen können und damit unnötigen Schaden von ihren Patienten abwenden.
Auf den folgenden Seiten lasse ich Patienten zu Wort kommen, die ebenfalls beide Varianten erlebt haben. Mitunter wurden sie jedoch massiv verunsichert und verängstigt. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere Mediziner in den geschilderten Fällen wieder, und vielleicht tragen die Fallgeschichten dazu bei, dass der ein oder andere Arzt seine Worte künftig sorgfältiger wählt.
Patienten berichten
Welche Seelenqualen falsche und unbedacht geäußerte Prognosen bei Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch auslösen können, schildert eine junge Mutter, die mir ihre Leidensgeschichte anvertraut hat.
Seit meiner Jugendzeit litt ich unter starken Schmerzen und Kreislaufproblemen vor und während meiner Menstruationsblutung. Einmal mussten meine Eltern mich deswegen sogar in die Notaufnahme bringen. Vonseiten der Ärzte wurden meine Beschwerden stets als »normal« abgetan. »Viele Frauen haben das Problem«, bekam ich oft zu hören. Ich wurde älter und wollte gern ein Kind haben. Doch ich wurde nicht schwanger. Mit Mitte 30 beschloss ich, mich einer Bauchspiegelung zu unterziehen, um Klarheit zu bekommen. Was ich im Zuge dieser Untersuchung erfahren habe, erschütterte mich in meinem Grundvertrauen in die deutsche Ärzteschaft.
Nach dem Eingriff, noch im Aufwachraum, beugte sich unvermittelt eine Ärztin über mich und erklärte mir, dass ich eine starke Endometriose habe und daher auf natürlichem Weg niemals schwanger werden würde. Ich war noch ganz benommen, hatte Schmerzen und fühlte mich wie vor den Kopf geschlagen. Erst einige Zeit später konnte ich die Anmaßung dieser Frau richtig einordnen. Was wusste sie von mir und meinem Körper, dass sie sich erlaubte, mir eine derart hoffnungslose Prognose zu präsentieren – und das zu einem Zeitpunkt, als ich dringend Unterstützung und gute Worte gebraucht hätte. Im Nachhinein betrachte ich es als Glück, dass meine Wut auf diese Ärztin stärker war als die Angst, die sie mir zunächst eingejagt hatte. Nachdem mir zwei Optionen zur Behandlung der Endometriose vorgeschlagen wurden, die nicht für mich in Frage kamen – ich hatte die Wahl zwischen der Einleitung der Wechseljahre, was meinen Kinderwunsch vereitelt hätte, und einer Operation, was keine dauerhafte Lösung gewesen wäre –, beschloss ich, nach einem für mich geeigneten Weg zu suchen. Ich fand eine Ärztin, die das Krankheitsbild der Endometriose sehr erfolgreich therapiert.
Schon nach drei Monaten Behandlung ließen meine Beschwerden deutlich nach. Ich hatte kaum noch Schmerzen und keine Kreislaufprobleme mehr und: wenige Monate später wurde ich schwanger, auf natürlichem Weg! Wenn ich auf die vielen Jahre zurückblicke, in denen ich nach jedem Eisprung gehofft und gebangt hatte, ob es wohl dieses Mal klappen würde, und unendlich traurig war, wenn die Monatsblutung wieder einsetzte, werde ich noch immer wütend. Ich frage mich, warum Ärzte, vor allem Medizinerinnen, die doch um die Not einer Frau mit Kinderwunsch wissen sollten, so arglos mit ihren Worten umgehen. Und warum werden Frauen wie ich, die nicht innerhalb des von der Medizin vorgegebenen engen Zeitrahmens schwanger werden, als Sterilitätspatientinnen bezeichnet? Das Wort »steril« hat einen völlig hoffnungslosen, endgültigen Beiklang. Ich hätte von den MedizinerInnen erwartet, dass sie mich beraten, dass sie sich meiner annehmen und dass sie mir Mut zusprechen, anstatt mich zu verunsichern. Rückblickend glaube ich, dass es das Geschäft mit der Angst ist, was da betrieben wird. Wenn man Frauen erklärt, sie können nicht auf natürlichem Weg schwanger werden, dann kommt für diese Frauen eben nur die Reproduktionsmedizin in Frage, die man mir ja auch als einzig mögliche Lösung vorgeschlagen hatte.
Karin Adler-Enzel
Auch der folgende Bericht eines jungen Patienten mit der Diagnose Multiple Sklerose zeigt, welchen Schaden achtlose Prognosen anrichten können.
Ich war 26 Jahre alt, als ich die Diagnose Multiple Sklerose bekam. Ich hatte keine Ahnung, was es mit dieser Krankheit auf sich hat. Die junge Neurologin, die mich damals behandelte, drückte mir ein Buch in die Hand mit den Worten: »Lesen Sie sich das mal durch. Dann wissen Sie, was auf Sie zukommt.« Nach der Lektüre habe ich so ziemlich alle Symptome entwickelt, die in dem Buch beschrieben waren. Die Bilder von Patienten im Rollstuhl hatten sich in mein Gehirn eingegraben. Seither lebte ich in der Angst, auch irgendwann im Rollstuhl zu sitzen. Während eines Klinikaufenthalts wurde diese Angststarre, in der ich mich mittlerweile befand, noch verstärkt: Außer mir und einer Mitpatientin waren alle Menschen auf der Station auf Hilfe angewiesen. Sie konnten sich weder allein fortbewegen noch sich versorgen. Die Bilder dieser Menschen habe ich lange nicht aus dem Kopf bekommen. Als ich die Klinik endlich verlassen konnte, verabschiedete mich die leitende Stationsschwester mit den Worten: »Wir sind ja froh, dass Sie noch in einem solchen Zustand sind.« Niemand, aber auch wirklich niemand hat mir damals Mut zugesprochen oder mich über einen positiven Verlauf der Krankheit aufgeklärt, den es ja schließlich auch gibt. Gott sei Dank bin ich irgendwann an eine Ärztin geraten, die genau das getan hat: Sie hat mich beruhig, mir Mut gemacht und gezeigt, dass man mit dieser Erkrankung ganz gut leben kann. Wäre ich früher an diese Frau geraten, hätte mir das viel Leid erspart, unnötiges Leid! Ich habe immer noch MS. Seit der Erstdiagnose sind 23 Jahre vergangen, aber ich sitze nicht im Rollstuhl. Ich kann mich normal bewegen und mich allein versorgen, auch wenn es gute und weniger gute Tage gibt, auch wenn der Winter meinen Gelenken zusetzt und Regentage nach wie vor nicht meine besten sind. Aber ich frage mich, warum Ärzte, Physiotherapeuten und Krankenschwestern meine Situation zusätzlich belasten mussten, anstatt mich aufzubauen. Ich frage mich auch, warum sie meiner Familie ›reinen Wein einschenken mussten‹, bis diese mich nicht mehr als Bruder oder Sohn, sondern nur noch als Kranken gesehen und behandelt hat. Ich bin aber nicht MS, sondern ein Mensch, der mit dieser Krankheit lebt; das ist ein Unterschied, ein großer Unterschied!
M.P.
Ich habe den Neurologen Prof. Dr. Rüdiger Seitz – ärztliche Leitung der Neurologischen Abteilung im LVR-Klinikum Düsseldorf, Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf –, der u.a. Patienten mit Multipler Sklerose behandelt, gefragt, wie man als Mediziner Prognosen über den Verlauf einer Krankheit vermitteln kann, ohne Patienten jede Hoffnung zu nehmen.
»Wenn es sich um eine Krankheit handelt, wie die MS, bei der definierte medikamentöse Behandlungen zur Verfügung stehen und sogar früh behandelt werden sollte, ist die Diagnose zu benennen. Auch ist der Patient darauf hinzuweisen, dass es Informationsmaterial für Patienten gibt, das ihm am besten zusätzlich zu dem aufklärenden Arzt-Patient-Gespräch auch auszuhändigen ist. Die Prognose ist entsprechend dem gegenwärtigen Kenntnisstand zu vermitteln; bei der MS kann dem Patienten z.B. gesagt werden, dass die Krankheit überwiegend günstig verläuft und die Prognose wegen der modernen Therapieverfahren heute insgesamt günstiger zu beurteilen ist. Eine spezifische Prognose für den Patienten (z.B. in x Jahren sind Sie nicht mehr gehfähig) ist zu vermeiden; denn dies ist durch nichts gestützt.«
Wenn die Ankündigung einer Gehunfähigkeit, die im Klartext ein Leben im Rollstuhl nach sich ziehen würde, durch nichts gestützt ist, warum lassen sich Therapeuten und Ärzte dann dazu hinreißen, solche für die Patienten traumatischen Szenarien in den Raum zu stellen? Was beabsichtigen sie damit? Wem soll damit geholfen sein? Oder sind es am Ende nur unbedacht dahingesagte Sätze?
Warum Angehörige und Freunde Hoffnung zerstören
Die Geschichte dieses jungen MS-Patienten zeigt deutlich, dass Menschen nicht nur mit Worten Unheil anrichten können, sondern auch durch nonverbale Kommunikation, etwa mittels Mimik oder durch ihre grundsätzliche Haltung gegenüber dem Patienten. Was diesem jungen Mann widerfahren ist, passiert vielen Patienten mit schweren Erkrankungen, vor allem Krebspatienten. Freunde und Familienangehörige sprechen den Kranken ständig auf sein Leiden an. »Wie geht es dir?« bezieht sich nicht mehr auf das Lebensgefühl, die familiäre Situation oder berufliche Erfolge und Misserfolge, sondern einzig und allein auf den Krankenstatus. Ein Mensch, der an Multipler Sklerose, an HIV oder an Krebs erkrankt ist, will nicht ständig an seine Erkrankung erinnert werden. Das tut schon die Erkrankung selbst mit all den Symptomen, die sie im Schlepptau führt.
Freunden und Angehörigen ist dies möglicherweise nicht bewusst, und hinter ihren Worten steckt ganz gewiss keine schlechte Absicht. Aber wenn sie einen schwerkranken Menschen sorgenvoll anschauen und die trostlose Situation auch noch mit einem »Ach du Armer!« krönen, vermitteln sie ihm letztlich, dass sie nicht an seine Heilung glauben. Damit verurteilen sie den Kranken zur Krankheit und möglicherweise auch zum Tod. Vielleicht sollten Angehörige und Freunde schwerkranker Menschen sich für einen Moment in die Situation des anderen versetzen und sich fragen, ob sie es als hilfreich empfänden, würde man sie so behandeln und – salopp formuliert – ›abschreiben‹.
Wie gefiele es Ihnen, wenn sich Ihr soziales Umfeld peu à peu verabschiedete, bis sie ganz allein wären mit der Krankheit und dem Versuch, gesund zu werden. Schwerkranke Menschen – sprechen wir ruhig von einer Krebserkrankung – haben genug damit zu tun, mit den Symptomen fertig zu werden. Sie haben mit Schmerzen, Bewegungsstörungen und anderen erheblichen Einschränkungen zu kämpfen, vertragen das Essen nicht, haben Verdauungsstörungen und schlafen schlecht. Dazwischen werden sie von den eigenen Zweifeln geplagt, ob sie das alles schaffen und nach abgeschlossener Therapie wirklich wieder die Alten sein werden. Was diese Patienten brauchen, sind Hoffnung und Menschen, die willens und in der Lage sind, ihnen Hoffnung zu geben und sie zu unterstützen. Die Therapie, für die sie sich entschieden haben, kann nur wirken, wenn die Erkrankten an den Sinn der Therapie glauben. Wenn ihnen jedoch permanent vermittelt wird, dass sie ohnehin bald sterben müssen, welchen Zweck kann eine Therapie dann noch erfüllen? Ich habe mich oft gefragt, warum gerade Krebspatienten dazu neigen, ihre Erkrankung geheim zu halten und lediglich den engsten Familienkreis einzuweihen. Mitunter wissen noch nicht einmal die Kinder, dass Mutter oder Vater Krebs haben. In Vorbereitung auf dieses Buch habe ich mit mehreren Krebspatienten über diesen Aspekt gesprochen. Interessanterweise verhalten sich tatsächlich viele so defensiv, weil sie nicht bemitleidet werden wollen und nicht ständig über ihre Erkrankung reden möchten. Sie bemühen sich um Normalität. Sie versuchen, aus dem Loch der Niedergeschlagenheit, der Zweifel und der Ängste herauszukrabbeln, und werden von anderen immer wieder hineingestoßen.
Eine Frau, die an Brustkrebs erkrankt war, erzählte mir, wie sehr es sie belastet hat, dass die Menschen in ihrem Umfeld sich ihr gegenüber merkwürdig verhielten und sie wie eine Aussätzige behandelten. »Menschen, mit denen man vorher normalen Umgang gepflegt und über Gott und die Welt gesprochen hat, wissen plötzlich nicht mehr, wie sie mit dir umgehen sollen. Plötzlich merkst du, dass sie dir aus dem Weg gehen und schon mal die Straßenseite wechseln, nur, um dir nicht begegnen zu müssen. Das hat mir manchmal mehr zugesetzt als die Krankheit selbst. Stünde ich heute noch einmal vor der Wahl, ich würde niemandem davon erzählen.«
In einem Fall beschrieb es ein Angehöriger so: »Meine Frau wollte irgendwann keinen Besuch mehr im Krankenhaus empfangen. Arbeitskollegen und Freunde kamen, um sich von ihr zu verabschieden.« Man kann nur ahnen, wie diese Frau sich gefühlt haben mag. Auch wenn der Vergleich hinken mag, so scheinen solche Szenen doch einer kollektiven Verbannung gleichzukommen. Alle scheinen sich darüber einig zu sein, dass die oder der Kranke im Bett bald nicht mehr unter ihnen weilen wird.
Eine Dame, in deren Nachbarschaft ich eine Zeitlang lebte und die ebenfalls an Krebs erkrankt war, erzählte mir eines Tages, wie gut es ihr getan hätte, dass ich sie nicht auf ihre Krankheit angesprochen habe. Ich wusste, dass sie Krebs hatte, weil ich sie öfter ohne Perücke gesehen hatte. Sie erzählte mir auch, wie oft ihr Gegenteiliges passiert ist, wenn wildfremde Menschen im Supermarkt oder auf der Straße hinter ihrem Rücken getuschelt und sich über ihre Erkrankung ausgelassen hätten. »Das tut einem schon weh. Die Leute behandeln einen, als hätte man etwas verbrochen«, kommentierte sie die demütigenden Begegnungen.
Es ist nicht verwunderlich, wenn Krebspatienten ihre Krankheit verschweigen, um sich vor den Reaktionen anderer zu schützen. Die persönlichen Berichte Betroffener zeigen deutlich, dass sie sich einen anderen Umgang mit ihnen und ihrer Krankheit wünschen. Vielleicht ist es an der Zeit, ein anderes Verständnis für Patienten und ihre Situation zu entwickeln, um den Heilungsprozess nicht zu torpedieren, sondern diese Menschen in ihrem Bemühen, wieder gesund zu werden, zu unterstützen. Die größte Verantwortung in diesem Zusammenhang kommt vermutlich Medizinern, Therapeuten und Pflegepersonal zu. Neben den engsten Angehörigen sind sie nicht nur Ansprechpartner, sondern vielmehr noch Vertrauens- und Bezugspersonen.
Die bisher wiedergegebenen Patientenberichte haben gezeigt, wozu negativ formulierte Prognosen führen können. Wenn Ärzte sich jedoch zum Richter über Leben und Tod aufschwingen, stellt sich die Frage, ob sie ihren Patienten im Zweifelsfall nicht mehr Schaden zufügen und eine Heilung sogar verhindern.
Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin glücklich verheiratet und habe zwei wunderbare Kinder. Im letzten Frühjahr unterzog ich mich einem chirurgischen Eingriff, weil der Verdacht auf ein Lebergeschwür bestand. Nach der Operation stand die versammelte Ärzteschaft an meinem Bett und sah recht betreten drein, so als täte ich ihnen furchtbar leid. Schließlich teilte man mir mit, dass ich einen Tumor am Mastdarm sowie Metastasen in der Galle hatte und dass die Lymphknoten befallen waren. Nachdem mir über mehrere Tage niemand sagen konnte, was das für mich konkret bedeuten würde, fragte ich den Arzt, der mich operiert hatte. Seine Antwort: »Also so viel ist sicher: Sie werden an diesem Krebs sterben. Wenn Sie Glück haben, in zehn Jahren, wenn Sie Pech haben, in drei Monaten.«
Das hatte gesessen. Aber es kam noch besser. Ich begann eine Chemotherapie. Nach der ersten Kontrolluntersuchung letzten Herbst erklärte mir der Onkologe: »Denken Sie jetzt nicht mehr in Jahren, sondern nur noch in Monaten. Ich kann Ihnen nur raten, Ihre Angelegenheiten zu regeln und Ihr Testament zu machen.« Ich sagte dem Mann, dass ich auf jeden Fall dabei sein wolle, wenn mein jüngster Sohn sein Abiturzeugnis in Händen hält. Daraufhin schaute er mich zweifelnd an und sagte: »Wenn das im Frühjahr stattfindet, könnten Sie vielleicht noch dabei sein.«
Das war ganz schön ernüchternd und vor allem so unumstößlich. Ich war schon im Begriff, einen Brief an meinen Sohn zu schreiben, den er am Tag seiner Zeugnisübergabe hätte öffnen sollen. Mein Sohn ist 13 Jahre alt und wird frühestens in fünf Jahren Abitur machen. Beim Treffen mit meinem Psychoonkologen erzählte ich von meinem Vorhaben und von dem Urteil des Onkologen. Der Psychoonkologe half mir wieder mental auf die Füße. Er beruhigte mich und gab mir wieder ein bisschen Hoffnung. Er sagte mir, dass es keine unheilbaren Krankheiten gebe und dass die Möglichkeit der Heilung immer bestehe.
Und ich sage heute, die Hoffnung stirbt zuletzt! Ich will leben, und ich will meinen Sohn strahlen sehen, wenn er das Abi geschafft hat. Und wann ich von dieser Welt gehe, darüber befindet kein Onkologe und auch kein Chirurg. Das ist das Einzige, was sicher ist. Ich habe das Glück, dass meine Familie mir den Rücken stärkt, dass mein Mann und meine Kinder alles für mich tun und vor allem, dass sie mit mir zusammen an meine Heilung glauben.
H.K.
Eine Bekannte erzählte mir von ihrem Mann, der ebenfalls an Krebs erkrankt ist. Als er die Nebenwirkungen der Chemotherapie nicht mehr ertragen konnte und seinem Onkologen mitteilte, er wolle die Therapie abbrechen oder zumindest aussetzen, sagte der ihm klipp und klar, dass dies sein Todesurteil sei und dass er ihm keine zwei Monate mehr gebe, wenn er die Therapie nicht wie besprochen fortführen würde. Die Ankündigung des Onkologen lag zum Zeitpunkt unserer Unterredung ein gutes Jahr zurück. Wie mir meine Bekannte kürzlich versicherte, geht es ihrem Mann zusehends besser. Sie leben von einem Tag zum nächsten. Er hat seine Ernährung umgestellt und ein paar andere Dinge verändert. Die Prophezeiung des Arztes hat sich nicht erfüllt, obwohl der Schrecken seiner Worte lange tief saß.
Es war die Pflicht dieses Onkologen, den Mann meiner Bekannten über die Konsequenzen eines Therapieabbruchs aufzuklären. Aber es ist ein Unterschied, ob man darauf hinweist, dass der Tumor ohne Chemotherapie möglicherweise aggressiv wächst und die Überlebenschancen dadurch verkürzt werden können, oder ob man apodiktisch ein Todesurteil fällt.