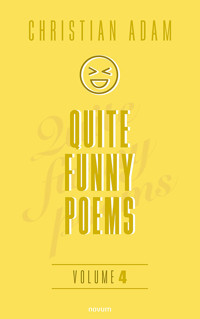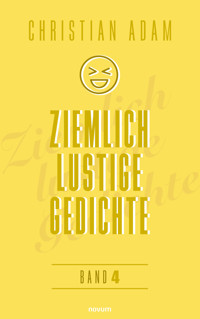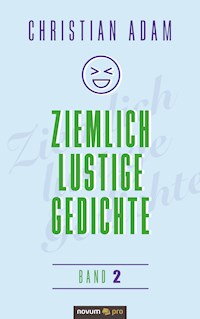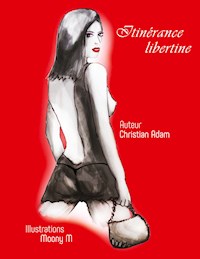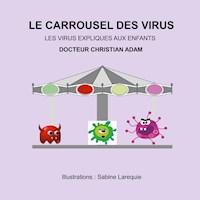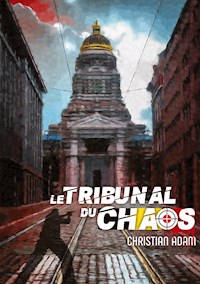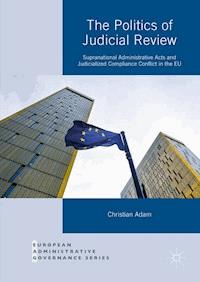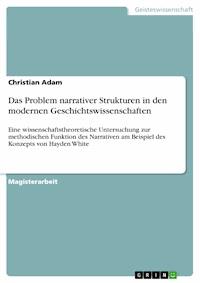
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Philosophie - Theoretische (Erkenntnis, Wissenschaft, Logik, Sprache), Note: 1,0, Philipps-Universität Marburg (Institut für Philosophie), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Rolle der Erzählung in den Geschichtswissenschaften. Anhand einer Auseinandersetzung mit dem Geschichtstheoretiker Hayden White wird untersucht, welche Bedeutung bestimmte Formen der Darstellung für historisches Wissen haben. Zugleich wird Whites Narrativismus auf seine Geltung und Rechtfertigung hin befragt. Narrativität verweist auf drei Problemfelder, die sich in den Geschichtswissenschaften stellen: Erstens, inwiefern Erklärungen in der Erforschung der Geschichte möglich sind. Zweitens, wie sich der Forschungsgegenstand der Geschichtswissenschaften bestimmen lässt. Und schließlich, wie es um den Anspruch von Historikern steht, wahre Aussagen über die Vergangenheit zu machen. Diese Fragen sind in dieser Auseinandersetzung mit Hayden White methodisch leitend und führen hin zu einer Rekonstruktion seiner Position als möglicher Antwort auf die Frage: „Was meinen wir, wenn wir von der ‚Geschichte’ reden?“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundkonzepte der Erklärung in der Geschichtswissenschaft
2.1. Die „Covering-Law-Theory” von C.G. Hempel
2.2. Die Intentionalistische Erklärung: von Wrights Handlungsmodell
2.3. Narrative Sätze: A.C. Danto
2.4. Narrativität als „kognitives Instrument“: Louis O. Mink
3. Die Rekonstruktion von Hayden White
3.1. Die konzeptuelle Matrix der Historiographie: Metahistory
3.1.1. Erklärung durch Erzählstruktur: Eine Typologie literarischer Gattungen
3.1.2. Formale Erklärungsmodelle
3.1.3. Erklärung durch ideologische Struktur
3.1.4. Die Konstitution des historischen Gegenstandes: Whites Tropologie
3.2. Zusammenfassung und Problemausblick
4. Konzepte der Narrativität
4.1. Geltungskriterien des Erzählens
4.1.1. Das Verhältnis von Moral und Erzählung
4.1.2. „Objektivität“ als Ästhetizismus und Utopieverbot
4.1.3. Ereignis und Erzählung I: Strukturalistische Elemente bei White
4.1.4. Ereignis und Erzählung II: White und Ricœur
4.2. Geltungsprobleme der Narration
4.2.1. Narrativisierung als gewalttätiger Akt
4.2.2. Narration als Fiktionalisierung
4.2.3. Whites Narrativismus als „Negativer Positivismus“
5. Perspektiven einer methodischen Reflexion
5.1. Kritik: White stellt sich dem Objektivitätsproblem nicht
5.1.1. Rüsens disziplinäre Matrix der Geschichtswissenschaft
5.1.2. Objektivität in der Geschichtswissenschaft
5.2. Perspektive auf einen methodischen Begriff von Narrativismus
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Der amerikanische Geschichtstheoretiker Hayden White vertritt seit seinem Hauptwerk Metahistory die These, dass geschichtliche Darstellungen hauptsächlich als literarische Texte verstanden werden müssen. Das Werk von White lässt sich nicht einfach als Theorie der Geschichtswissenschaft charakterisieren. Seine Arbeiten sind vor allem von einem moralischen Anspruch geprägt. Indem er die unausgesprochenen vor- und außerwissenschaftlichen Bedingungen der modernen Geschichtswissenschaft und vielleicht sogar des Umgangs mit der Geschichte überhaupt expliziert, fordert White ein, dass sich die Geschichtswissenschaft auf ihre Rolle als Sinnstifterin einlässt und diese Aufgabe als Teil der Fachdisziplin sieht. Es ist Hans Kellner, einem Schüler von White, bedingt zuzustimmen, der über Metahistory sagte: „Metahistory is a moral text which can authorize itself only by declaring the freedom of moral choice, in the face of the great determinisms of our time“.[1] White ist kein reiner Philosoph der Geschichte und Wissenschaftstheoretiker der Historie. Er ist auch ein Historiker des Mittelalters und der Renaissance, der sich in die Tiefen der Archive gewagt hat. Seine Arbeiten zu den „Klassikern“ der Historie sind nicht nur theoretische Arbeiten zur Methodologie und Systematik der Geschichtswissenschaften, denn Geschichte ist für White auch ein Problem des Bewusstseins.[2] So beginnt White die Einleitung von Metahistory: „This book is a history of historical consciousness in nineteenth-century Europe, but it is also meant to contribute to the current discussion of the problem of historical knowledge.“[3] In dieser Arbeit steht der zweite Aspekt im Vordergrund. Hayden White wird als Theoretiker der Geschichte und der Geschichtswissenschaft behandelt. Und als solcher wird White nach Geltung und Rechtfertigung seines Narrativismuskonzepts befragt.
Eine Untersuchung zum Problem von narrativen Strukturen in den modernen Geschichtswissenschaften muss sich der mehrdeutigen Verwendung des Begriffs stellen. Narrativität verweist zum einen auf das Erklärungsproblem, zum anderen auf die Bestimmung des Forschungsgegenstandes der Geschichtswissenschaften. Damit ist die Frage verbunden, welche Geltungsansprüche die Geschichtswissenschaften haben und inwiefern diese zu rechtfertigen sind. Der Begriff der Narrativität soll anhand von Hayden White insbesondere im Verhältnis zum Problem der Gegenstandsbestimmung untersucht werden, also als mögliche Antwort auf die Frage: „Was meinen wir, wenn wir von der ‚Geschichte’ reden?“ Nachdem Whites Konzept des Narrativismus dargestellt und problematisiert wurde, wird untersucht, wie sich dieses Konzept methodisch nutzen lassen kann.
Auf das Erklärungsproblem wird in Kapitel 2 eingegangen. Das Erklärungsproblem kreist um die Frage, ob und wie Erklärungen für historische Phänomene möglich sind, die gleiche Geltung wie naturwissenschaftliche Erklärungen beanspruchen können. Mit dieser Forderung sah sich die moderne Geschichtswissenschaft mit dem Aufkommen der positivistischen Wissenschaftstheorie am Ende des 19. Jahrhunderts konfrontiert. Mit naturwissenschaftlichen Erklärungen ist das positivistische Modell der Erklärung gemeint, wie es beispielsweise in der Covering-Law-Theory von C. G. Hempel und P. Oppenheim formuliert wurde (Kap. 2.1). Die klassische Gegenposition zur positivistischen Auffassung von Erklärung ist die hermeneutische Position, die die Aufgabe der Geschichtswissenschaft vor allem in dem Verstehen von Handlungen sah.[4] Die intentionalistische Variante dieser Richtung sah im Forschungsgegenstand der Geschichtswissenschaft, der Vergangenheit der menschlichen Handlungen, das Merkmal, das Erklärungen in der Geschichtswissenschaft qualitativ von den Naturwissenschaften unterscheidet. Als Vertreter der intentionalistischen Position wird G. H. von Wright behandelt, weil sich an ihm aus wissenschaftstheoretischer Sicht die Kritik an dem positivistischen Schema und die Probleme der intentionalistischen Position gut herausarbeiten lassen (Kap. 2.2). Die Narration ist in diesem Zusammenhang als Erklärungsmodell diskutiert worden, das eigenständig neben der Kausalerklärung nach positivistischem Verständnis steht und als Erweiterung des intentionalistischen Erklärungsbegriffs begriffen werden kann. Als Vertreter dieser Position wird A. C. Dantos Konzept der „narrativen Sätze“ behandelt (Kap. 2.3). Eine leitende Frage von Kapitel 2 ist, ob die Erzählung als sinnvolle Alternative zur Covering-Law-Theory und zum intentionalistischen Erklärungsmodell gedacht werden kann. Der Narrativitätsbegriff erhielt durch L. O. Mink eine entscheidende Bedeutungserweiterung (Kap. 2.4). Mink verband die Narrativität mit dem Problem der Gegenstandsbestimmung der Geschichtswissenschaften. Er sah die Narrativität nicht nur als Erklärung, sondern auch als Bedingung für die Erkenntnis von Geschichte. Narrativität ist damit von einem Erklärungsmodell zu einem Erkenntnismittel geworden.
Hayden Whites Geschichtstheorie baut auf dieser Bestimmung von Narrativität als Erkenntnismittel auf und versucht, indem er eine Neubestimmung des geschichtswissenschaftlichen Forschungsgegenstandes vorzunimmt, aus den Geltungsproblemen der Erklärungs-Debatte herauszukommen. Den Hauptteil meiner Arbeit bildet erstens die Rekonstruktion von Whites Geschichtstheorie in Kapitel 3 und zweitens eine Untersuchung von Whites Narrativitätskonzept in Kapitel 4.
In Kapitel 3 soll Whites Modell zur Analyse von geschichtlichen Werken rekonstruiert werden. Die Rekonstruktion bezieht sich dabei vor allem auf die Einleitung von Metahistory, in der die Grundpfeiler von Whites Analysemodell, sowie sein Begriff von Geschichtswissenschaft deutlich zum Ausdruck kommen. Sein Ausgangspunkt liegt in der Analyse von narrative Strukturen in der Historiographie. Es lassen sich zunächst drei Grundthesen ausmachen: Texte bilden keine Bedeutungseinheit; zweitens: Texte verweisen nicht auf eine außerhalb liegende Realität in Form von geschichtlichen Fakten; drittens: historische Geschehnisse liefern von sich aus keine Bedeutungs- oder Erzählstruktur.[5] Am Ende der Rekonstruktion wird eine Skizze der Geltungsprobleme, die bei Whites Ansatz entstehen, entworfen.
Die Untersuchung von Whites Narrativitätsbegriff in Kapitel 4 konzentriert sich vor allem auf Geltungskriterien und Geltungsprobleme, die White in der Geschichtswissenschaft verortet und durch einen narrativen Ansatz lösen möchte. Im ersten, analytischen Teil, wird dargestellt, wie White Narrativität im Verhältnis zu normativ-moralischen (Kap. 4.1.1), objektiven (Kap. 4.1.2) und kognitiven (Kap. 4.1.3) Geltungskriterien sieht. Im zweiten Teil wird der Narrativismus von White bezüglich seiner Geltung problematisiert und kritisiert (Kap. 4.2). Dabei wird sich zeigen, dass White keine kognitiven Ansprüche in seinem Narrativismus formulieren kann und das Problem der Objektivität in ein ästhetisches transformiert. Schließlich soll dafür argumentiert werden, dass White sich damit um jeglichen Anspruch auf wissenschaftliche Erkenntnis für die Geschichtswissenschaft bringt.
In Kapitel 5 wird eine Perspektive auf eine mögliche Neuformulierung von Whites Narrativismus unter Berücksichtigung der in Kapitel 4.2 vorgebrachten Geltungsprobleme gegeben. Dazu wird auf die von Jörn Rüsen vorgeschlagene „disziplinäre Matrix der Geschichtswissenschaft“ als einem Wegweiser für eine Wissenschaftstheorie der Geschichtswissenschaft Bezug genommen, um aufzuzeigen, wie Narrativität mit wissenschaftlichen Geltungsansprüchen vereinbart werden könnte (Kap. 5.1). In einem Teilschritt wird speziell auf das Problem der Objektivität eingegangen (Kap. 5.1.2). Der letzte Teil des Kapitels besteht in einer Zusammenfassung der Probleme und Lösungsansätze und endet in einer Lösungsperspektive (Kap. 5.2). Die Frage ist, ob Whites Narrativismuskonzept, trotz der angesprochenen Probleme, als wissenschaftstheoretischer Begriff genutzt und methodologisch für die Geschichtswissenschaften fruchtbar gemacht werden kann.
In zwei Aufsatzsammlungen finden sich die wichtigsten Ausführungen zu Whites Verständnis der modernen Geschichtswissenschaft und seine theoretischen Überlegungen zu Stellenwert und Funktion von Erzählstrukturen in der Repräsentation von Wissen über die Geschichte.[6] Whites Werk ist in den wesentlichen Punkten kontinuierlich geblieben. In The Content of the Form argumentiert White unter deutlicher Bezugnahme auf den französischen Strukturalismus, insbesondere Roland Barthes. Die Untersuchung dieses Einflusses ist vor allem deswegen fruchtbar, weil bestimmte Kerngedanken zur Narrativität bei White durch eine „strukturalistische“ Neuformulierung besser zur Geltung kommen und die Schwierigkeiten im Narrativitätsbegriff leichter identifizierbar werden. Daher konzentrieren sich die Ausführungen zum Begriff der Narrativität im Wesentlichen auf Aufsätze aus diesem Band.
2. Grundkonzepte der Erklärung in der Geschichtswissenschaft
Damit man das Problem der Narrativität in den modernen Geschichtswissenschaften behandeln kann, ist es zunächst notwendig, auf einige zentrale Positionen in der Diskussion, auf der White aufbaut, einzugehen. Whites Narrativismus stellt in gewisser Form eine Antwort auf die Auseinandersetzung um den Status von Erklärungsmodellen in den Geschichtswissenschaften dar.
In den Geschichtswissenschaften wurde die Diskussion um geeignete bzw. „wissenschaftliche“ Erklärungsmodelle prinzipiell zwischen zwei Positionen ausgetragen. Die eine Richtung fand ihren prominentesten Vertreter in C. G. Hempel. Seine These ist, dass das „deduktiv-nomologische Modell“ zur Erklärung in den experimentellen Naturwissenschaften auch für die Erklärung historischer Phänomene in der Geschichtswissenschaft anzuwenden sei, oder implizit angewendet wird.[7]
Die als Reaktion auf diese Forderung entstandene Position macht das Element der Geschichte als Geschichte der menschlichen Handlungen stark und vertritt die Ansicht, dass die Sachverhalte, die in der Geschichtswissenschaft zu erklären sind, nicht unter die Kategorie der Kausalerklärung fallen. Das „intentionalistische“ Erklärungsmodell von G.H. von Wright versucht, die Vergangenheit als eine Reihe von Handlungsergebnissen zu rekonstruieren.[8]
Ein Problem bei von Wrights Ansatz ist, dass er die Natur der Relation des praktischen Syllogismus nicht bestimmen kann. Es ist keine kausal-logische Relation, wie sie in Form der Covering-Law-Theory vorgestellt ist. Verschiedene Geschichtstheoretiker sehen in narrativen Strukturen die besondere Relation von historischen Ereignissen zueinander. A. C. Danto hat die besondere Erklärungsart der Geschichtswissenschaften in „narrativen Sätzen“ gesehen.[9] L. O. Mink hat diesen Ansatz radikalisiert, indem er die Narration nicht nur als eine ausgezeichnete Form der Erklärung sieht, sondern ihr eine sehr viel umfassendere Bedeutung zumisst. Die Erzählung ist für Mink das „kognitive Instrument“ zur Erkenntnis geschichtlicher Zusammenhänge überhaupt.
Diese Bestimmung der Narrativität wird der zentrale Grundgedanke für Hayden White. So nimmt er in seinem Hauptwerk Metahistory Minks Narrativismus auf und legt allen Formen der Erklärung und der Strukturierung in historischen Darstellungen eine narrative Struktur zugrunde. Indem er die grundsätzliche Entscheidung für ein bestimmtes Erklärungsschema auf das Problem der textlinguistischen Präfiguration des historischen Gegenstandes verlegt, verschiebt er das Geltungsproblem von Aussagen und Urteilen über die Geschichte.[10]
In der Geschichtswissenschaft gibt es viele Beispiele, in denen sich die großen Debatten nicht um Tatsachen oder Quellen drehte, sondern um methodische Grundfragen, die sich zwischen diesen Polen aufspannen. Zu nennen ist vor allem der „Historikerstreit“.[11] Andere Beispiele sind die „Schuldfrage“ des 1. Weltkriegs, oder „Ursachen“ des deutschen Sonderwegs.[12]
2.1. Die „Covering-Law-Theory” von C.G. Hempel
Das deduktiv-nomologische Modell von C.G. Hempel und P. Oppenheim bildet einen wichtigen Hintergrund für die geschichtstheoretische Diskussion.[13] Die von William Dray als „Covering-Law-Theory“[14] bezeichnete Theorie bildet den Grundpfeiler für ein positivistisches Modell, das metaphorische oder erzählstrukturelle Momente als genuine Erklärung aus der Geschichtswissenschaft ausschließen möchte. Hempel argumentiert in dem Aufsatz The Function of General Laws in History dafür, dass auch Erklärungen in der Geschichtswissenschaft vom Typ der kausalen Erklärung sind und versucht damit ein einheitliches Erklärungsmodell für Natur- und Geistes- und Sozialwissenschaften zu etablieren.[15] Nach dieser Theorie besteht die Aufgabe der Geschichtswissenschaften dann darin, allgemeine Gesetze auch für die Geschichte zu identifizieren, unter die einzelne geschichtliche Phänomene subsumiert und damit erklärt werden.[16]
Eine wissenschaftliche Erklärung besteht für Hempel aus drei Teilen: Das zu erklärende Ereignis oder Phänomen E, sowie eine Reihe von Ereignissen Cn und schließlich eine Gruppe von universellen Hypothesen, mit deren Hilfe man das Eintreten von E aus dem Eintreten von Cn ableiten kann.[17] Diese Schlussform gilt laut Hempel nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern würde auch in den Geschichtswissenschaften zur Anwendung kommen, denn
„historical explanation, too, aims at showing that the event in question was not ‚a matter of chance,’ but was to be expected in view of certain antecedent or simultaneous conditions.“[18]
Hempel unterstellt, dass in geschichtswissenschaftlichen Darstellungen die universellen Hypothesen meist unausgesprochen bleiben und dass es meist auch nicht gelingt, sie vollständig zu explizieren. Erklärungen in den Geschichtswissenschaften würden in der Regel auch auf Wahrscheinlichkeiten statt auf Gesetzen beruhen, auf „probability hypotheses“ statt universellen Hypothesen.[19] Doch sei die Erklärungsform im Prinzip identisch mit jener in den Naturwissenschaften. Insofern, obwohl die Erklärungen unvollständig sind, würden in den Geschichtswissenschaften Erklärungsskizzen gegeben, die durchaus, wie in den Naturwissenschaften durch empirische Befunde ausgefüllt werden können.
„A scientifically acceptable explanation sketch needs to be filled out by more specific statements; but it points into the direction where these statements are to be found; and concrete research may tend to confirm or to infirm those indications“.[20]
Damit möchte Hempel genuine von Pseudo-Erklärungen absetzen, die zwar anscheinend diesem Anspruch genügen, aber bei näherer Prüfung nicht durch Beweise gestützt werden.
Hempel grenzt sein Erklärungsmodell ab von der „method of empathic understanding“, die er für keine, bzw. eine nicht-wissenschaftliche Form des Erklärens hält.[21] Er meint damit die hermeneutische Methode der Einfühlung in die Akteure der Geschichte. Dies sei nur ein heuristisches Mittel, dem oftmals psychologische Hypothesen unterliegen würden, das zwar eine Form von Verstehen oder Plausibilität hervorrufe, jedoch keinen Erklärungswert habe. Die Attraktivität dieser Methode liege in dem Gebrauch von „persuasive metaphors“, die einen Schluss scheinbar plausibel erscheinen lassen.[22] Hempel lehnt diese Form des Verstehens und Erklärens ab, denn wie in jeder empirischen Wissenschaft basieren die Erklärungen der Geschichte darauf, „wether it rests on empirically well confirmed assumptions concerning initial conditions and general laws.“[23] Und diesem Anspruch würde die hermeneutische Methode nicht genügen.
Hempels Vorschlag rief eine Vielzahl von Einwänden hervor.[24] In diesem Kontext ist relevant, dass das Konzept der Narrativität sich gegen den Anspruch der Einheit der Wissenschaften richtete und gerade eine eigenständige Form der Erklärung bzw. der wissenschaftlichen Methode darstellen soll. In gewisser Hinsicht ist aber gerade die unscharfe Rede von „Ereignissen“, die bei dem deduktiv-nomologischen Erklärungsschema vorausgesetzt wird ein problematischer Bereich. So zählen beispielsweise Handlungsmotive als kausale Antecedensbedingungen, die es so möglich machen, von der kausalen Erklärung einer Handlung zu sprechen. Nach Hempel und Oppenheim bilden daher teleologische Erklärungen keine eigene Klasse, sondern fallen im Prinzip unter die Klasse der kausalen Erklärungen.[25] Von Wright hat diese Rede von Motiven, bzw. Intentionen kritisiert und unternimmt es, die teleologische Erklärung als eigenen Erklärungstyp wieder stark zu machen.
2.2. Die Intentionalistische Erklärung: von Wrights Handlungsmodell
G. H. von Wright hat in „Erklären und Verstehen“ eine handlungstheoretische Neubegründung des deduktiv-nomologischen Ansatzes geleistet. Von Wright hat einen Vorschlag zur Rekonstruktion des Handlungsbegriffs gemacht, der für ihn die Grundlage für Erklärungen in den Geschichtswissenschaften bildet. Von Wright charakterisiert Handlungen durch drei Aspekte: Erstens durch das faktische Ergebnis der Handlung, zweitens durch die Zuschreibung einer Intention und drittens durch den Kontext der Handlung.[26] Für die Rekonstruktion von Handlungen greift er zurück auf das Schema des praktischen Syllogismus. Die Grundfigur lautet:
„(PS) A beabsichtigt, p herbeizuführen.
A glaubt, dass er p nur dann herbeiführen kann, wenn er a tut.
Folglich macht sich A daran a zu tun.“[27]
Er entwickelt eine detailliertere Version dieses Schemas, um den Schluss vor Argumenten der Art, dass äußere oder innere Umstände gefunden werden können, die die Konklusion falsifizieren, abzusichern. Mit anderen Worten:
„Thus we are presented with a schema of practical argument, and a concrete example of a practical argument, in which every possibility of explaining or understanding the falsity of the conclusion has been eliminated.“[28]
Der wichtigste Punkt dabei ist, dass sich die Intention gerade über längere Zeiträume hinweg nicht ändert.[29]
Von Wright behauptet, dass es sich beim praktischen Schluss um das „Schema einer ‚auf den Kopf gestellten‘ teleologischen Erklärung“ handelt.[30] Eine teleologische Erklärung habe die Form „Jenes geschah, damit das eintrete“, während kausale Erklärungen die Form haben: „Das geschah, weil sich jenes ereignet hat“.[31] Eine Handlung ist nach von Wright ein „Verhalten“, dem Intentionalität oder ein „intentionaler Charakter“ zugeschrieben wird. Damit wird die Intention einer völlig anderen Kategorie zugeschrieben, als den äußerlichen Zuständen, die etwa als Bedingung in einer Kausalanalyse identifiziert werden.
Den Zugang zum konkreten Verstehen einer Handlung gewinnt man über die Kenntnis der Lebensbedingungen und der allgemeinen kulturellen Umstände, in denen sich jemand bewegt.[32] Von Wright unterscheidet zwei Arten von Regeln oder „Normen“, die entscheidend für das Verstehen und das Erklären von Handlungen sind: zum einen Normen, die bestimmte Handlungen erlauben, verbieten, gebieten etc., zum anderen Handlungsregeln. Zur Unterscheidung nennt er sie primäre und sekundäre Normen.[33] Angewandt auf die teleologische Erklärung in Form des praktischen Schlusses tragen die Verhaltensnormen, soweit sie uns bekannt sind, dazu bei, ein Verhalten als intentional zu verstehen. Die Handlungsregeln dagegen bieten eine Erklärungsgrundlage für Handlungen.[34]
Diesen „methodologischen Individualismus“ [35] überträgt von Wright auf die Erklärung von geschichtlichen Ereignissen. Seine Grundidee ist, das teleologische Handlungsschema auf sogenannte „kollektive Handlungen“ zu übertragen.[36] Um Phänomene wie Demonstrationen zu verstehen und zu erklären, müsse man aus den Intentionen der einzelnen beteiligten Handelnden das gemeinsame Ziel „extrapolieren“ können.[37] Es wird aber nicht klar, wie von den individuellen Akteuren einer Menschenmasse eine gemeinsame Intention gefunden werden sollte, die diese Masse zu einer Demonstration macht. Daran zeigt sich, dass der methodische Ansatz des intentionalen Erklärungsmodells für einen der wichtigsten Kernbereiche der Geschichtswissenschaft nicht hinreicht.
Von Wright sieht in der Geschichtswissenschaft drei Erklärungsmodelle verwendet, das sind kausale, teleologische und quasi-kausale Erklärungen. Kausale Erklärungen beschreiben gewisse Naturereignisse, wie die Zerstörung einer Stadt durch einen Vulkanausbruch. Diese spielen für Historiker aber eine untergeordnete Rolle.[38] Quasi-kausale Erklärung beantworten Fragen, wie die nach der Ursache des 1. Weltkriegs. Von Wright rekonstruiert die Ereignisketten, z.B. von der Erschießung des österreichischen Thronfolgers bis zur Kriegserklärung Österreichs so, dass der praktische Schluss zur Erklärung der Ermordung den „motivationalen Hintergrund“ für weitere praktische Schlüsse bildet.[39] Diese Erklärungsketten seien aber nur quasi-kausal, weil ihnen kein allgemeines Gesetz zugrunde liegt.