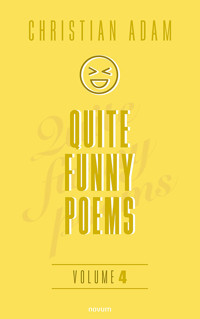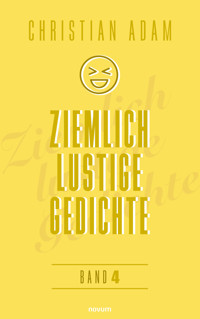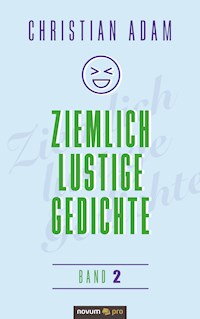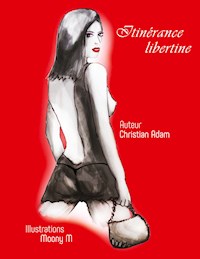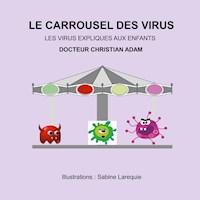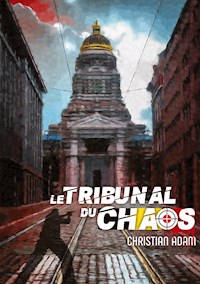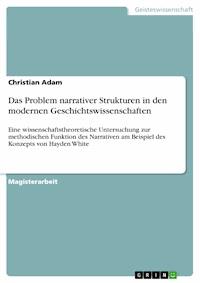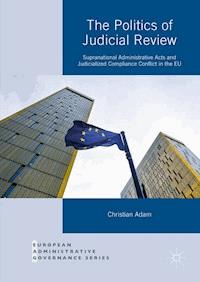10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was die Deutschen wirklich lasen. Dass sich die Deutschen Mein Kampf millionenfach in die Bücherregale stellten, dass ein Band wie Darüber lache ich noch heute. Soldaten erzählen heitere Geschichten mehr als zwei Millionen Mal über den Ladentisch ging, das erwartet man für diese Zeit. Doch wer hätte gedacht, dass – wer wollte – in den Dreißigern noch Huxleys Brave New World lesen konnte, Werner Bergengruens durchaus kritisches Buch Der Großtyrann und das Gericht häufig gekauft wurde, dass aus gerechnet Wind, Sand und Sterne von Antoine de Saint-Exupéry, der sich als Pilot aktiv am Kampf gegen die Nazis beteiligte, während des Kriegs ein großer Erfolg in Deutschland war und mitnichten verboten? Dass die in der DDR so beliebten Heiden von Kummerow von Ehm Welk unter der Nazi-Diktatur entstanden und zum Bestseller wurden? Dass Lichtenberg, Rilke, Goethe und selbst Ernst Jünger massenhaft gelesen wurden.Die Buchbranche boomte, trotz der Vertreibung unzähliger Autoren, trotz brennender Bücher und Verbotslisten, gerade im Krieg. Zahlreiche Autoren erreichten mit ihren Werken riesige Auf lagen. Die meisten sind – zu Recht – heute vergessen. Viele aber waren auch in den fünfziger Jahren noch Publikumslieblinge. Manche liest man noch heute. Christian Adam untersucht, wie Bücher unter den Nazis entstanden und wie sie sich – manchmal auch gegen den Willen der Machthaber – zu Bestsellern entwickelten, und welche Bücher wirklich gelesen wurden. Er stellt die politischen Institutionen und Protagonisten vor, die um die Oberhoheit über die Bücher rangen – kurz: er schreibt die Geschichte der Bestseller in der düstersten Epoche der deutschen Vergangenheit, und öffnet damit einen neuen Blickwinkel auf die Mentalität der Deutschen zwischen 1933 und 1945.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
» Buch lesen
» Danksagung
» Das Buch
» Der Autor
» Impressum
Inhalt
»Himmel lass mich nur kein Buch von Büchern schreiben!«
Sichten, vernichten – lenken, fördern
Literaturpolitik im Zeichen des Hakenkreuzes
Machtergreifung und Bücherverbrennung – Gleichschaltung des Kulturbetriebs: das Propagandaministerium entsteht – Berufsverband mit Anschlusszwang: die Reichsschrifttumskammer – Dauerclinch um die Kulturhoheit: Rosenberg, Bouhler, Rust, Ley – Die Indizierung des unerwünschten Schrifttums – Verbote und Empfehlungen: Die Lenkungsinstrumente – Eine Zensur findet (nicht) statt – Die Folgen für die Verlagslandschaft – Prinzipien totalitären Handelns: Vom Verbot der Kunstkritik bis zur Reglementierung der Leihbücherei
Bestseller in finsterer Zeit
Ihre Geschichte und ihre Leser
Vom Bookman zum Spiegel: Eine kleine Geschichte der Bestsellerliste – »Volkhafte Dichtung« vs. Bestseller: Was gut ist, setzt sich durch – »Über 1 Million«: Die Wiedergeburt des Bestsellergedankens aus dem Geist des Kriegs – Leserwünsche unterm Hakenkreuz: Ansätze zu einer Marktforschung – Vom individuellen Lektüreerlebnis zur Leihbücherei
Hitlers und Goebbels’ Bettlektüre
Der bevorzugte Lesestoff der Nazi-Prominenz
Ein Besuch beim ›Führer‹ und seine Folgen: Karl-May-Fieber – Hitlers Lesehunger im Spiegel seiner Zeitgenossen – Der ›Führer‹ tankt auf: Lesefrüchte einer Jugend – Heinrich Himmlers education sentimentale – Alfred Rosenberg, Hermann Göring, Albert Speer: Ideologe, Machtmensch, Technokrat – Hanns Johst, Barde der SS und Präsident der Reichsschrifttumskammer, empfiehlt – »Das tut so gut!«: Dr. Goebbels entspannt sich
Die 10 erfolgreichsten Buchtypen im Dritten Reich
1. Auf dem Boden der Tatsachen:Hier beginnt der Inhalt
Populäre Sachbücher
Beispielloser Erfolg eines Rohstoffromans: Schenzingers Anilin – Propaganda par excellence: Anton Zischka – Denkmal für einen Helden: Robert Koch – Diesel: »Eines der aufregendsten Bücher der letzten Zeit!« – Beinhorn–Rosemeyer, Traumpaar des NS-Jetset – »Könige der Herzen«: die Görings – Von Kneipp-Kur bis FKK: Lebenshilfe auf Erfolgskurs – Wunschkonzert: Bücher im Medienverbund
2. Die Farbe des Geldes:
Das NS-Propaganda-Schrifttum
Das ›Buch der Bücher‹: Hitlers Mein Kampf – Vom Konkurrenten zum ›Vordenker‹: Rosenbergs Mythus – Die ›Nummer 12‹ der NSDAP: Philipp Bouhler – Dr. med. Ahlswede: Geister-Schreiber im Dollar-Paradies – ›Unser Doktor‹: Joseph Goebbels als Journalist und Buchautor – Weiche Propaganda in Reinkultur: Die Reemtsma Cigaretten-Bilderalben – Von Auflagenmillionären und »gewerblicher Bienenzucht«
3. Im Westen was Neues:
Konjunktur der Kriegsbücher
Vom Schützengraben an den Schreibtisch – Frontkämpfer in Hitlers Diensten: P. C. Ettighoffer, Werner Beumelburg, Hans Zöberlein – Über die Fronten hinweg: Die deutsch-französische Liebesgeschichte von André und Ursula – Geschäfte mit dem Heldentod: Von Kaisers Korvettenkapitän Fritz Otto Busch zu Hitlers U-Boot-Kommandant Günther Prien
4. Lachendes Leben, lustiges Volk:
Humor und Komik
Maulkorb für den ›Führer‹? Die Bestseller von Heinrich Spoerl – Amüsantes von der Stange: Banzhafs lustige Sammlungen aus dem Hause Bertelsmann – Harmlose Unterhaltung? Wilhelm Busch, Ludwig Thoma oder O. E. Plauen im Kriegseinsatz – Vom KZ-Insassen zum Erfolgsautor: Ehm Welk und die Heiden von Kummerow
5. Von A(rzt) bis Z(ukunft):
Das moderne Unterhaltungsbuch, seine Themen und Autoren
Geschichte einer jungen Ärztin: Angela Koldewey – Bilderbücher für Verliebte: Reinhold Conrad Muschler, Dinah Nelken – Gesellschaftsromane am Abgrund: Hans Fallada 185 – Georg von der Vring: Die Spur der Kriminalromane 189 – Zurück in die Zukunft: Hans Dominik und Co.
6. Wa(h)re Volksliteratur:
Karl May, Courths-Mahler und die Helden der Schmökerhefte
Sogar der ›Führer‹ liest Karl May! – Die literarische Halbwelt von Hedwig Courths-Mahler bis Ludwig Ganghofer – Feindbild ›Pulp Fiction‹ – Jugendgefährdung anno 33: Sun Koh, der Erbe von Atlantis – Ein ›Neger‹ verschwindet: Die schleichende Anpassung an den Zeitgeist – Im Auftrag von Partei und Wehrmacht: Schmökerhefte als Propagandavehikel – Biene Maja, Heidi, Lederstrumpf: Kleiner Ausflug zum Kinder- und Jugendbuch
7. Fremde Erzählkunst:
Bestseller aus dem Ausland
Auf der schiefen Bahn: Der Schweizer John Knittel und seine Via Mala – »Erschreckend hohe Zahl von Übersetzungen« – Ein schottischer Arztroman: A. J. Cronins Zitadelle – »Bucherfolge wie einen Motor konstruieren«: Vom Winde verweht – Nordische Autoren: Trygve Gulbranssen und Knut Hamsun – Der Tod des kleinen Prinzen: Antoine de Saint-Exupéry
8. Im Schatten der Klassiker:
Die gehobene Literatur
Zwischen Herrschaftssicherung und Anarchie: Von Lichtenberg zu Goethe – Kultbücher der Kriegsgenerationen: Rilkes Cornet und Flex’ Wanderer zwischen beiden Welten – Hesse, Frisch, Bergengruen: Aus dem Dritten Reich in den Literaturkanon der Nachkriegszeit – Fin-de-siècle: Bindings Opfergang, Carossas Das Jahr der schönen Täuschungen – Vom »Wunsch-« zum »Glückwunschkind«: Ina Seidel – Die Königsdisziplinen: Dramatik und Lyrik im Bestsellerformat von Hanns Johst bis Eugen Roth
9. Blut ohne Boden:
Die Erfolge national(sozial)istischer Autoren
Einmal Großstadt und zurück – das Leben der Kuni Tremel-Eggert – Barb. Roman einer deutschen Frau oder Wie der typische NS-Bestseller entstand – Die Vorgeschichte: Gustav SchröersHier beginnt das Inhaltsverzeichnis Weg vom Heimatroman zum Blubo-Epos – Der Stichwortgeber: Hans Grimm mit Volk ohne Raum – Dichter und Deuter der ›Bewegung‹: Hanns Johst, Hans Friedrich Blunck, Will Vesper – Der Nachruhm der Heimatdichter: Josefa Berens-Totenohl, Felicitas Rose
10. Feldgrau schafft Dividende:
Lesefutter für den Krieg
Zielgruppe Wehrmacht: Die Feldpost des Völkischen Beobachters – Lesehunger und Bücherboom im Krieg – Wie kam das Buch zum Landser? Von der Bücherspende der NSDAP bis zur Zentrale der Frontbuchhandlungen – Lesestoff für den Vernichtungskrieg: Autoren und Themen – Verkaufsschlager mit versteckter Botschaft: Ernst Jüngers Auf den Marmorklippen
Die Spur der Bestseller
Vom Schulbuch zur Heimatdichtung – Taschenbuch und Normvertrag: Schritte zu einem modernen Buchmarkt – Von Literaturverfilmungen und Fernseh-Rezensionen: Das Buch im Spiegel der Medien – Sieg oder Niederlage: NS-Literaturpolitik vom Ende her betrachtet – Stiller Triumph der Aufmüpfigkeit?
Anhang
Ausgewählte Bestseller und ihre Auflagen – Anmerkungen – Bibliografie – Abbildungsnachweis – Register der Personen, Titel und Institutionen – Danksagung
[Menü]
»Himmel lass mich nur kein Buch von Büchern schreiben!«
Warum ich dem Ausruf Georg Christoph Lichtenbergs am Ende doch nicht gefolgt bin? Die Antwort steckt in einem handschriftlichen Eintrag in einem der Bücher meines Vaters, das dieser aus seinen Jugendjahren in meine Zeit herübergerettet hat: »Nur der erwirbt sich die Welt, der um sie kämpft!« Diese Widmung war von meinem Großvater für seinen heranwachsenden Sohn wohl Anfang der vierziger Jahre verfasst worden. 1944 dann sollte mein Vater, knapp 18 Jahre alt, tatsächlich noch hinausziehen, um – in Hitlers Wehrmacht – ›um die Welt zu kämpfen‹. Dass es nicht sein Krieg war, ging dem jungen Mann rasch auf. Er hatte Glück und überlebte. Mich berührte diese Widmung später sehr. Was konnte meinen Großvater dazu gebracht haben, seinem Sohn ein solches Motto ans Herz zu legen? In solchen Zeiten?
Beim Buch, das meinem Vater gewidmet worden war, handelte es sich um Karl Aloys Schenzingers Anilin, einem der – wie ich viel später erfahren sollte – echten Erfolgsbücher der Nazi-Zeit. Noch andere Entdeckungen machte ich als jugendlicher Leser in Vaters Bücherschrank. Da standen die in grünes Leinen gebundenen Bände von Hans Dominik: Altertümliche Science-Fiction-Geschichten, in nur schwer lesbarer Fraktur gesetzt. Manche Helden fand ich ebenso befremdlich wie die Bösewichter, aber ich las trotzdem weiter. Auch an die Geschichte von den beiden Hitlerjungen, die Abenteuer in Brasilien1 erlebten, kann ich mich gut erinnern. Am Ende des Buches folgen sie dem Ruf in die Heimat, denn dort werden sie gebraucht – in Hitlers Wehrmacht. Nicht zuletzt diese Erlebnisse lenkten meinen Blick auf die Bücher im Dritten Reich. Dabei vor allem auf die Werke, die tatsächlich in großer Zahl verbreitet und gelesen wurden: die der Massenliteratur.
Der verbrannten und verfemten Literatur sind – zu Recht – schon viele und wichtige Bücher gewidmet worden. Sie hatten nicht zuletzt die Aufgabe, das Todesurteil, das die Nazis vielfach verhängten, zu widerrufen. Sie ließen Bücher und Autoren erneut ins Bewusstsein treten, die ansonsten der Vergessenheit anheimgefallen wären.2 Oder wollen in einem verdienstvollen Editionsprojekt die Originaltexte einem breiten Publikum wieder zugänglich machen.3 Mittlerweile können wir also recht genau sagen, welche Bücher und Autoren im Dritten Reich mit Sicherheit nicht erwünscht waren.
Dagegen muss, wer sich auf die Suche nach dem massenhaft verbreiteten und gelesenen ›Schrifttum‹ aus nationalsozialistischer Zeit macht, nach wie vor mit zahlreichen blinden Flecken kämpfen. Eine Überblicksdarstellung gibt es nicht. Dabei hatten schon die Zeitgenossen erkannt, dass ein Blick auf die massenhaft gelesene Literatur wichtige Erkenntnisse bringen kann: »Ich sagte mir, wenn ein Wälzer von über 1000 Seiten, 1930 erschienen, es auf 350 000 Exemplare gebracht habe, dann müsse er irgendwie charakteristisch für das Denken seiner Zeit sein. Woraus ich die Berechtigung vor mir selber schöpfte, den Band zu lesen.«4 Mit diesen Gedanken hatte sich Victor Klemperer noch 1944 zur Lektüre von Ina Seidels Wunschkind motiviert. Und in der Tat führt die Frage, welche Bücher unterm Hakenkreuz tatsächlich in großen Stückzahlen produziert, vertrieben und gelesen wurden, in einen Kernbereich der deutschen Mentalitätsgeschichte.
Warum aber kam es nach 1945 zu einer eher zögerlichen Auseinandersetzung mit dem Thema? Zum einen hatte man sich aus verständlichen Gründen auch beim Blick auf den Buchmarkt zunächst den Geschichten der Opfer des NS-Regimes gewidmet. Erst nach und wurden Fragen zum Buchmarkt im Dritten Reich oder zu den Produktions- und Rezeptionsbedingungen von Literatur unterm Hakenkreuz gestellt. So ist die erste umfangreiche, alle greifbaren Aktenüberlieferungen einbeziehende Studie zur Literaturpolitik im Dritten Reich5 noch keine zwanzig Jahre alt! Ohne eine genaue Kenntnis der Rahmenbedingungen von Textproduktion in dieser Zeit verboten sich bestimmte Fragestellungen aber von selbst. Erschwert hat den Blick auf den Massenmarkt zudem die Tatsache, dass sich für diese Phänomene zunächst keiner so richtig zuständig fühlen mochte. Wenn man sich auf literaturwissenschaftlicher Seite etwa mit Texten aus diesen Segmenten befasste, was seit den sechziger Jahren verstärkt geschah, dann oft aus ideologiekritischem Blickwinkel. Es wurde dann danach gefahndet, welchen politischen Interessen oder Vernebelungsaktionen Massenliteratur gedient haben mochte. Zunächst wurde meist von den publizierten Texten selbst ausgegangen. Informationen zu den Autoren oder den Marktbedingungen waren teils nicht vorhanden oder spielten für die spezifische Fragestellung nur eine untergeordnete Rolle. Aber diese Studien waren keine Sackgassen, im Gegenteil, es waren nötige Schritte einer Annäherung an bestimmte Phänomene des Literaturmarktes.6
Zugleich unterlag der Begriff ›Literatur‹ von jeher einem steten Wandel.7 Im vorliegenden Buch wird er in seiner allgemeinsten Bedeutung verwendet und soll die Gesamtheit des Geschriebenen und Gedruckten umfassen, eben auch nicht-fiktionale Texte wie Sachbücher, Dokumentarisches oder Propagandaschriften, um nur einige zu nennen.
Am Beispiel des Sachbuches zeigt sich, dass auch die Auseinandersetzung mit dieser Textsorte noch vergleichsweise jung ist. Sachbücher stellten aber zwischen 1933 und 1945, ähnlich wie heute, einen beträchtlichen Teil der am Buchmarkt gehandelten Produkte. Ohne den Blick auf Nicht-Fiktionales bliebe der Eindruck vom Buch-Massenmarkt jener Jahre unvollständig und irreführend. Erst 1978 erschien mit Ulf Diederichs »Annäherung an das Sachbuch« ein längerer Text, der bis heute immer wieder als Ausgangspunkt genommen wird und erstmals auch die ›Tatsachen-Literatur‹ oder die Fachbuchdiskussion im Dritten Reich im Überblick zeigte. Eine umfassendere Beschäftigung mit dem Gegenstand ist immer noch in vollem Gange.8
Es gab immer wieder neue, die Diskussion anregende Aufsätze oder Publikationen, die Teilbereiche der Massenliteratur im Dritten Reich betrachteten und die wichtige Einzelaspekte erstmals ins Bewusstsein rückten.9 Erst mit einer stärkeren Verbindung von kultur-, literatur- und medienwissenschaftlichen Ansätzen kam der Buchmarkt in seiner Gesamtheit mit all seinen Produkten, Akteuren und Gesetzmäßigkeiten besser ins Blickfeld.
Im vorliegenden Buch soll die Literatur der Zeit aus der Sicht der Leser betrachtet werden, die damals im Deutschen Reich unter der nationalsozialistischen Herrschaft lebten. Ich habe die Werke in Augenschein genommen, die tatsächlich in großer Zahl gedruckt, gekauft und gelesen wurden. Dabei habe ich mich von einem sehr breiten Literaturbegriff leiten lassen, der Bild-Text-Bände und Tatsachenromane ebenso mit einbezieht wie Ratgeber oder Groschenhefte. Das Gros der massenhaft verbreiteten Literatur im Dritten Reich sollte erfasst werden. Rein willkürlich habe ich eine Auflagenhöhe von zirka 100 000 Exemplaren festgelegt, von der an ein Werk als ›Bestseller‹ in die Betrachtung einbezogen wurde.
Bei der Durchsicht meiner rund 350 Texte umfassenden ›virtuellen Bestsellerliste‹ (ein Auszug daraus findet sich im Anhang, S. 323–325) kristallisierten sich rasch zehn ›Buchtypen‹ heraus, die als besonders erfolgreich immer wieder und in unterschiedlichen Schattierungen zu finden waren. Diese müssen keinen literaturwissenschaftlichen Kriterien genügen, sollen dafür aber den Kategorien möglichst nahekommen, mit denen Leser, Käufer, Buchhändler und andere Akteure am Buchmarkt in jenen zwölf Jahren bestimmte Werke etikettierten. Dabei sind viele Grenzen fließend, etwa wenn Sachbücher oder Tatsachenromane oft nahtlos ins Propagandaschrifttum übergehen. Manche Bücher und Autoren wären auch unter anderen Aspekten zu verhandeln gewesen. Insofern sind viele Zuordnungen subjektiv gefärbt und gehorchen der Willkür des Erzählers. Das gilt auch für die Vollständigkeit der Darstellung, die ich nur insofern angestrebt habe, als die wichtigen Texttypen und Strömungen exemplarisch vertreten sein sollten. Ich habe Wert darauf gelegt, möglichst interessante Geschichten um Bücher und Autoren erzählen zu können. Bereits Altbekanntes tritt deshalb eher in den Hintergrund.
Den zehn wichtigsten Buchtypen und ihren Autoren und Lesern wendet sich der Hauptteil des Buches zu. Eingangs habe ich versucht, mich den Bücherfreunden – den prominenten wie den unbekannten – anzunähern und die literatur- und buchmarktpolitischen Rahmenbedingungen zu schildern, unter denen Autoren, Verleger und Leser lebten. Über die greifbaren statistischen Ermittlungen von Leserwünschen und -zahlen sowie die Lektüreerlebnisse einzelner ganz ›normaler‹ Leser hinaus, werden im Folgenden auch prominente Erinnerungen hinzugezogen. Vor allem Menschen, die damals oder später selbst beruflich mit Büchern zu tun hatten, geben Erzählungen über ihre bevorzugte Lektüre oder einzelnen prägenden Erfahrungen mit Literatur in ihren Memoiren oder Tagebüchern oft breiten Raum. Zu Wort kommen werden neben anderen Ernst Jünger, Joachim C. Fest, Marcel Reich-Ranicki, Heinrich Böll und Günter Grass.
Eine in jeder Hinsicht einzigartige Quelle bilden die Tagebuchaufzeichnungen von Victor Klemperer. Hier liest einer wie besessen, dem Bücher ein Lebenselixier sind. Zu seinen Lektüreeindrücken fertigte er detaillierte Aufzeichnungen an. Für Victor Klemperer, der sich zur Aufgabe gemacht hatte, die LTI , die Lingua Tertii Imperii, die Sprache des Dritten Reiches zu dokumentieren und zu analysieren, waren Bücher Quelle und Steinbruch zugleich. Der ›Jude Klemperer‹, den die Nationalsozialisten zusammen mit seinen Leidensgenossen zum Untermenschen erklärt hatten, den sie vernichten wollten, und den sie im Falle des Dresdner Philologen nur ›schonten‹, weil er mit einer ›Arierin‹ verheiratet war, die ihren Mann nicht im Stich ließ, las aus Berufung alles, was ihm an Gedrucktem in die Hände fiel, von Unterhaltungsromanen bis zum wissenschaftlichen Werk. Da die Juden sukzessive von der Teilnahme am normalen gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden sollten, war die Lektürebeschaffung nur unter größten Schwierigkeiten und mit Gefahr verbunden möglich. Hier las und lebte einer, der an das Land der Dichter und Denker geglaubt hatte. Der Holocaust musste diesen Glauben nachhaltig erschüttern.
Der, den viele Nationalsozialisten ausgelöscht wissen wollten, kommentierte die geistigen Elaborate ihrer Literatur scharfzüngig bis zum bitteren Ende des Regimes. Seine Stimme, sein Urteil, seine klare Sprache werden jedem, der sich heute durch die Literatur des Dritten Reiches hindurcharbeiten muss, hell strahlendes Leuchtfeuer im häufig unheilvoll wabernden Sprachnebel der Zeit sein. Klemperer konnte sein Werk LTI . Notizbuch eines Philologen nach dem Ende der Nazi-Herrschaft vorlegen. Seine Tagebücher wurden viele Jahre nach seinem Tod zu einem veritablen Bestseller, die mehr und direkter als manche nüchterne wissenschaftliche Studie vom Verbrechen an den europäischen Juden erzählen. Ein Bestseller, der seine Leser ganz tief berührt. Vielleicht ist die Geschichte von Victor Klemperer und seiner Frau im Nachhinein betrachtet einer der kleinen Triumphe der Menschlichkeit über die Barbarei der Jahre 1933 bis 1945.
Mit der Geschichte der Bestseller im Dritten Reich will ich keine zu Unrecht vergessenen ›Perlen‹ zu Tage fördern, auch wenn mancher Text vielleicht einen zweiten Blick verdient. Die Geschichte der Bestseller ist die Negativform, das Gegenstück zur Geschichte der verbrannten und verbannten Bücher und Autoren, eine in jedem Fall spannende und vielleicht auch erhellende Geschichte vom Leben in einer Diktatur und im Idealfall an mancher Stelle sogar das Missing Link zu Erscheinungen des Buchmarktes jenseits der vermeintlichen Zäsuren von 1933 und 1945.
[Menü]
Sichten, vernichten – lenken, fördernLiteraturpolitik im Zeichen des Hakenkreuzes
Machtergreifung und Bücherverbrennung
Am 10. Mai 1933 brannten vielerorts im Deutschen Reich die Scheiterhaufen. Von der NS-Ideologie begeisterte Studenten hatten in den Bibliotheken ihrer Universitäten und anderswo die Literatur zusammengetragen, die sie für vernichtenswert hielten. Heinrich Mann und Erich Kästner, Sigmund Freud und Erich Maria Remarque waren nur einige, deren Bücher, begleitet von den lauthals proklamierten ›12 Thesen wider den undeutschen Geist‹, ins Feuer geworfen wurden. In Berlin trat sogar der Propagandaminister selbst vor die Menge. Obwohl die landesweite Aktion nicht von der NSDAP direkt organisiert worden war, machte er sich diese Bühne zu Nutze.
Der 10. Mai setzte das Signal für eine beispiellose Umwälzung des Buch- und Literaturmarktes. Alle mit dem Buch beschäftigten Institutionen und Personen wurden erfasst und gleichgeschaltet. Die besten Autorinnen und Autoren sowie die profiliertesten Verleger wurden entmündigt oder ins Exil getrieben. Es fand ein Aderlass ohnegleichen statt. Die Welt der Bücher war nach 1933 nicht mehr dieselbe wie zuvor – so könnte ein Versuch lauten, die Ereignisse vom Mai 1933 und ihre Folgen zusammenzufassen.
Der Literaturmarkt blieb auch in der Zeit nach 1933 privatwirtschaftlich organisiert. Die Vielzahl der Verbotslisten, die von verschiedenen Institutionen herausgegeben wurden, zeigte vor allem eines: Es gab keine flächendeckende, allumfassende Zensur und Kontrolle von Schriftstellern und Verlagen. Bis weit in die dreißiger Jahre hinein konnten sogar ausländische Titel aus Frankreich, England oder Amerika wie etwa Antoine de Saint-Exupérys Wind, Sand und Sterne, Aldous Huxleys Brave New World oder Margaret Mitchells Vom Winde verweht verkauft und gelesen werden.10 Viele ausländische Schriftsteller zählten zu den Bestsellerautoren im nationalsozialistischen Deutschland. Die NS-Literaturpolitik wirkte sich in vielen Bereichen modernisierend auf den Buchmarkt und seine Institutionen aus. Die Welt der Bücher blieb auch nach der Machtübernahme der Nazis bunt und vielfältig, manche persönliche oder wirtschaftliche Erfolgsgeschichte konnte über 1933 und 1945 hinweg fortgeschrieben werden – dies ist ein denkbarer zweiter Versuch, die Geschichte des deutschen Buchhandels nach der Bücherverbrennung zu erzählen.
Mai 1933 in Hamburg: NSDAP-Mitglieder transportieren beschlagnahmte Bücher ab. Hier wie in ganz Deutschland war die Bücherverbrennung der Startschuss für gewaltige Eingriffe in den Buchmarkt.
Beide Versionen der Geschichte von Büchern und Menschen in Deutschland nach 1933 stehen hier mit gleichem Recht nebeneinander. Für einzelne Episoden beider Berichte finden sich Argumente und Belege. Die Welt ließ sich auch nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten nicht allein in Schwarz und Weiß einteilen, sondern wies viele Zwischentöne und Schattierungen auf. Dies macht die Beschäftigung mit der Literatur im Dritten Reich bis heute schwierig, aber lohnenswert. Lässt sich auch über 60 Jahre nach Kriegsende noch Neues über Bücher in jenen Jahren sagen? Die Antwort lautet Ja.
Auch wenn der Literaturmarkt weiterhin privatwirtschaftlich organisiert war, es keine allumfassende Vorzensur gab – die Bücher, die nach 1933 in Deutschland erscheinen konnten, kann man nur beurteilen und verstehen, wenn man weiß, unter welchen Bedingungen Autoren, Verleger und Leser in jenen Jahren lebten und arbeiteten oder zu ihren Büchern kamen. Die nationalsozialistische Kulturpolitik und die literaturpolitischen Maßnahmen, die das Regime in den Folgejahren ergriff, müssen genau unter die Lupe genommen werden. Thomas Manns Verdikt, dass Bücher, die von 1933 bis 1945 überhaupt gedruckt werden konnten, weniger als wertlos und nicht gut in die Hand zu nehmen seien, hat einen Teil der Auseinandersetzung mit der Literatur der NS-Zeit geprägt. Der eingeschränkte Blick der Literaturwissenschaftler auf die Buchproduktion jener Jahre wirkte sich zudem hinderlich aus. Sich mit dem zu befassen, was nachweislich Hunderttausende lasen, galt und gilt vielfach bis heute als ›unfein‹. Viele erfolgreiche Texte jener Jahre wurden unter der Rubrik Trivialliteratur verbucht und abgehakt. Alle Bücher, die sich im weitesten Sinne der Sachliteratur zuordnen lassen, wurden von Literaturwissenschaftlern gleich gar nicht behandelt, obwohl sie die Mehrzahl der jährlich erscheinenden und erschienenen Texte ausmachten.
Wenn wir uns auf die Medien einlassen, die in den Jahren 1933 bis 1945 in Deutschland erreichbar waren, die Bücher lesen, die der Propagandaminister las, die Filme sehen, die vom ›Führer‹ gelobt wurden, oder die Zeitungen zur Hand nehmen, die die Masse der ›Volksgenossen‹ kaufte, muss das mediale Bild, das sich dabei rekonstruieren lässt, immer wieder relativiert und mit anderen Positionen abgeglichen werden. Es gibt keine voraussetzungslose Beschäftigung mit dem Dritten Reich. Wir können das NS-Regime nur von seinem Ende her wirklich verstehen.
Gleichschaltung des Kulturbetriebs: das Propagandaministerium entsteht
Kann man im Hinblick auf die Literatur im Dritten Reich von einer ›erfolgreichen Gleichschaltung‹ sprechen? Diese Frage wird sich erst am Ende dieses Buches beantworten lassen. Die Behauptung, der ganze Literaturmarkt sei ja ›gleichgeschaltet‹ gewesen, das heißt der Einzelne hatte ohnehin keine Entscheidungsfreiheit, war allzu oft nur billige Entschuldigung für das eigene Verhalten. Der genaue Blick dient also hier, wie anderswo auch, nicht der Verharmlosung, sondern im Gegenteil der Präzisierung unserer Urteile über jene Zeit.
Die Nationalsozialisten setzten mit ihrer Kulturpolitik nach der Machtübernahme nicht völlig voraussetzungslos ein. Erfahrungen in der Regierungsverantwortung konnte die NSDAP schon von Januar 1930 an sammeln, als mit Wilhelm Frick ein erstes Parteimitglied Minister in der thüringischen Landesregierung wurde. Als Chef des Innen-Ressorts oblag ihm dort die »Bekämpfung von Schmutz in Wort und Bild«11 . Das aus der Weimarer Zeit stammende »Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften« sollte insbesondere im Hinblick auf die Trivial- und Jugendliteratur noch bis zu seiner Aufhebung im Jahr 1935 die Grundlage für vielerlei Eingriffe in den Literaturmarkt bieten.12
Innerhalb der Partei hatte es schon in den zwanziger Jahren verschiedene Personen und Institutionen gegeben, die sich mit kulturellen Angelegenheiten im weitesten Sinne befassten. Auf dem Parteitag in Nürnberg 1927 war der Kampfbund für deutsche Kultur unter der Leitung von Alfred Rosenberg gegründet worden. Der Kampfbund koordinierte zum einen die Angriffe auf das literarische Establishment der Weimarer Zeit, zum anderen wollte er die nationalsozialistische Bekenntnisliteratur und völkische Autoren fördern. Alfred Rosenberg, der selbst ernannte ›Chefideologe‹ der ›Bewegung‹ und Autor des Mythus des 20. Jahrhunderts, kämpfte zeitlebens um entscheidenden Einfluss auf alle kulturellen Bereiche des neuen Staats. Wichtige Befugnisse im Bereich der Kulturpolitik lagen auch bei der Reichspropagandaleitung der NSDAP. Hier befasste man sich, seit 1929 unter der Leitung von Joseph Goebbels, in verschiedenen Abteilungen mit Propaganda, Film, Rundfunk, aber auch der Volksbildung.
Mit Goebbels und Rosenberg waren bereits vor 1933 zwei der mächtigsten Gegenspieler auf den Plan getreten, die die Auseinandersetzungen innerhalb der NS-Kulturpolitik während der zwölf Jahre des ›Tausendjährigen Reichs‹ entscheidend prägen sollten. Weitere Akteure, mit eigenen Interessen, Vorstellungen und vor allem eigenen Eitelkeiten kamen später noch dazu. Es gab wohl kaum einen anderen Herrschaftsbereich, auf den das Wort vom Kompetenz-Wirrwarr, das die NS-Herrschaft geprägt habe, so zutraf wie auf die Literaturpolitik.
Traditionell – und das galt auch für die von den Nazis als ›Systemzeit‹ geschmähte Weimarer Republik – hatten in Deutschland die Länder im kulturellen Bereich das Sagen. Nach der Machtübernahme versuchte man viele Zuständigkeiten auf zentralstaatliche Stellen zu konzentrieren. Hinzu trat der Herrschaftsanspruch der Partei, den ihre Funktionäre auf alle Ebenen des Daseins ausdehnen wollten.13
Mit dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (RMVP) schufen sich die Nationalsozialisten ein gänzlich neues Instrument, mit dem alle Bereiche der Kultur und Öffentlichkeit beherrscht werden sollten. Mit dem bis dahin wenig erfolgreichen Schriftsteller, aber umso umtriebigeren Propagandisten Goebbels trat einer der einflussreichsten Funktionäre für den gesamten Bereich des gedruckten Wortes in den Ring. Nun hatte er ein eigenes Ministerium im Rücken, das bis heute die bekannteste mit der Literaturlenkung befasste Institution im Dritten Reich ist und auch damals eine der einflussreichsten Stellen war. Goebbels selbst sah seine Dienststelle als das einzige genuin nationalsozialistische Ministerium. Sein Haus nahm in seinen Augen eine Vorreiterrolle ein, wenn es darum ging, im praktischen Handeln zu zeigen, was nationalsozialistische Verwaltung bedeute. »Das Ministerium soll Presse, Rundfunk, Film, Theater und Propaganda in einer einzigen, großzügigen Organisation vereinigen. Der Reichspressechef Funk ist von mir zum Staatssekretär ausersehen«14 , so schrieb der designierte Propagandaminister am 6. März 1933 in sein Tagebuch. Nur kurze Zeit später, am 13. März, wurde er von Hindenburg vereidigt. Immer wieder betonte Goebbels, dass das RMVP mit der herkömmlichen Ministerialbürokratie nichts gemein habe. Im Nachrichtenblatt des Ministeriums wandte er sich im Mai 1933 energisch gegen alle überkommenen Formen der Verwaltungstätigkeit: »Ich mache darauf aufmerksam, daß ein so schwerfälliger Betrieb einem Ministerium, das erst vor wenigen Wochen gegründet wurde, schlecht zu Gesicht steht. Ich habe auch nicht die Absicht, einen derartig überbürokratisierten Betrieb in meinem Amt einreißen zu lassen. Ich ersuche alle Mitarbeiter, dieses Unwesen und diese grotesk wirkende Unsitte unverzüglich abzustellen und erwarte, daß dieser bloße Hinweis genügt, um jedem Mitarbeiter wieder zu Bewußtsein zu bringen, daß wir in einer Revolution stehen und es ruhig künftigen Generationen überlassen dürfen, diese Revolution zu bürokratisieren.«15 Den frühen Lippenbekenntnissen des Ministers zum Trotz: Das Propagandaministerium wuchs sich schnell zu einem Bürokratieriesen mit über 1000, meist jungen Mitarbeitern aus, die in der Regel auch Parteigenossen waren.
Erstaunlicherweise gab es im Ministerium zunächst keine Abteilung, die sich ausschließlich mit Literatur befasste. Im ersten Geschäftsverteilungsplan aus dem Jahr 1933 wurden Themen wie ›nationale Literatur‹ oder ›Verlagswesen‹ noch von der Hauptabteilung Propaganda mitbetreut.16 Erst im Oktober 1934 erfolgte die Gründung einer eigenen Abteilung Schrifttum, die unter anderem für die »Pflege und Förderung des deutschen Schrifttums«, die Reichsschrifttumskammer (RSK) und die Deutsche Bücherei in Leipzig zuständig war. Auch personell blieb die Schrifttumsabteilung im Vergleich mit anderen Dienststellen schwach bestückt. Ihr nachgeordnet, teilweise aber mit den gleichen Mitarbeitern besetzt, war die Reichsschrifttumsstelle, die seit 1939 als »Werbe- und Beratungsamt für das deutsche Schrifttum« beim RMVP firmierte. Während die ›kulturpolitischen Führungsaufgaben‹ beim Ministerium lagen, hatte das Werbe- und Beratungsamt vor allem fördernde Maßnahmen auf dem Buchmarkt durchzuführen. Das Amt wurde immer dann aktiv, wenn das Ministerium eher im Hintergrund bleiben wollte. Hier wurden Empfehlungslisten für Sortimenter und Bibliotheken erarbeitet, Buchausstellungen und Tagungen vorbereitet oder Autorenlesungen organisiert. So initiierte diese Stelle zum Beispiel die Aktion »Die sechs Bücher des Monats«, in der ausgewählte Neuerscheinungen, aber auch »wertvolles Schrifttum aus früherer Zeit«17 beworben werden sollten. Die Sortimenter bekamen unverlangt einen Werbeaufbau nebst der monatlich wechselnden Beschriftung und Bebilderung angeliefert und sollten sich für den Erfolg der Bücher einsetzen.
Es gelang Goebbels und seinen Leuten auf diese Art, im Laufe der Jahre zu einer der wichtigsten Instanzen im Bereich der Literaturlenkung zu werden. So habe man im Krieg die gesamte Buchzensur im Arbeitsbereich der Schrifttumsabteilung zusammengefasst. Die »Führungsrolle des Propagandaministeriums«18 für den Sektor der Buchpolitik war aber nie unumstritten und blieb bis zum Ende des Dritten Reichs stets umkämpft.
Berufsverband mit Anschlusszwang: die Reichsschrifttumskammer
Die Errichtung einer Reichskulturkammer durch Gesetz vom 22. September 1933 war ein weiterer tiefer Einschnitt in den Kulturbetrieb gleich zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft. Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda wurde darin ermächtigt, die Kulturschaffenden aller Bereiche in einer berufsständischen Organisation zusammenzufassen. Neben seinem Ministeramt war Goebbels in Personalunion Präsident der Kammer. Die Reichskulturkammer und ihre Einzelkammern für Film, Musik, Rundfunk, Theater, Presse, bildende Künste und Schrifttum waren in gewisser Weise der verlängerte Arm des Propagandaministeriums.19 Was nicht hieß, dass dadurch die Zuständigkeiten klarer geregelt gewesen wären.
Für alle Kulturschaffenden bestand Mitgliedszwang. Wer nicht in die Kammer aufgenommen wurde, durfte fortan seinen Beruf nicht mehr ausüben. Typisch für eine Organisation in der NS-Zeit war die Zusammenfassung der unterschiedlichsten Interessengruppen einer Branche unter einem Dach. Die RSK war für alle Personen zuständig, »die von der Urproduktion der Dichtung angefangen, bis zum gewerblichen Vertrieb am Schrifttum arbeiten«20 . So fanden sich Autoren, Verleger, Buchhändler, Buchhandelsvertreter, Büchereiinhaber und Bibliothekare in einem Verband vereint.
Die Nichtaufnahme in oder der Ausschluss aus der Reichsschrifttumskammer, z. B. von jüdischen oder aus politischen Gründen missliebigen Autoren, kam einem Berufsverbot gleich. Zwar gab es zunächst keinen eindeutigen ›Arierparagraphen‹ im Reichskulturkammergesetz, also keine Bestimmung, auf deren Basis man jüdischen Mitbürgern eine Mitgliedschaft hätte kategorisch verweigern können. Allerdings wurden die vorhandenen Bestimmungen mehr und mehr so ausgelegt, dass spätestens ab 1935 auch eine Frontkämpferbiografie oder der Status einer Kriegerwitwe die jüdischen Mitglieder nicht mehr vor Ausschluss aus der Kammer und somit vor einem Berufsverbot schützte.21
Etwa zur selben Zeit wie das Kulturkammergesetz, am 4. Oktober 1933, war das Schriftleitergesetz erlassen worden, das mit ähnlichen Methoden und Ausschlusskriterien nicht genehme Journalisten aus der schreibenden Zunft herausdrängte.
Vom Mitgliedszwang in der Reichsschrifttumskammer befreit waren lediglich Gelegenheitsschriftsteller und Verfasser wissenschaftlicher Werke. Und gerade unter den ›Teilzeitautoren‹ wollten viele dazugehören. Sie versprachen sich von der Mitgliedschaft in der Kammer einen Prestigegewinn, gewissermaßen eine staatliche Anerkennung ihres Tuns. So zum Beispiel Stanislaus Bialkowski, im Hauptberuf Sachbearbeiter in einem Flugzeugwerk, nach Feierabend Autor von Science-Fiction-Romanen wie Leuchtfeuer im Mond oder Start ins Weltall. Er kämpfte mit allen Mitteln gegen seinen Ausschluss aus der Kammer, der schließlich wegen eines nicht fristgemäß abgegebenen Ariernachweises erfolgte. Auch der späte Parteieintritt im Jahr 1940 konnte den Autor da nicht mehr retten. Obwohl seine Bücher von vermeintlicher NS-Ideologie strotzen, hieß es im Propagandaministerium über seine Werke: »Die Bücher von Bialkowski werden sämtlich negativ beurteilt«22 . Wer nicht in die Kammer aufgenommen wurde, konnte nur in Ausnahmefällen, wie etwa Erich Kästner, mit einer Sondergenehmigung weiterarbeiten. Oder er bekam, wenn er zum Beispiel nur einmalig als Autor tätig wurde, einen Befreiungsschein ausgestellt.
Über die Zwangsmitgliedschaft in der Kammer sollte letztlich alles, was inhaltlich zu kontrollieren war, kontrolliert werden. Wenn nur noch zuverlässige ›Volksgenossen‹ Autoren, Verleger, Buchhändler oder Bibliothekare sein konnten, dann müsse – so die Überlegung – eine Vorzensur im Verlagswesen überflüssig sein. Dies war und blieb einer der Grundsätze der NS-Literaturpolitik: Zensur sollte, wenn sie denn stattfand, möglichst unsichtbar bleiben. Die Zensierten wurden dazu angehalten, den Zensur- oder Lenkungsvorgang so darzustellen, als folgten sie der eigenen Eingebung. Die Schere im Kopf entwickelte sich – wie noch zu zeigen sein wird – zu einem der wichtigsten Instrumente der Meinungssteuerung.
Die Gründung der Reichskulturkammer war einer der geschickten Schachzüge Goebbels’, um im Bereich der Kultur eine Monopolstellung zu errichten. Er verschaffte sich damit vor diversen Konkurrenten Vorteile. Mit einer berufsständischen Organisation der Kulturschaffenden geriet er in Konflikt mit Robert Ley, der mit seiner Deutschen Arbeitsfront »alle schaffenden Deutschen« in der größten NSDAP-Massenorganisation zusammenfassen wollte. Kompetenzstreitigkeiten mit dem Innenministerium waren ebenfalls angelegt, das noch aus der Zeit der Republik gewisse zentrale Funktionen im Kulturbereich wahrnahm. Zugleich konnte die Gründung der Kammer auch als eine Kampfansage an Alfred Rosenberg gesehen werden.
Die Reichsschrifttumskammer wurde, wie die anderen Einzelkammern auch, von einem Präsidenten geführt. Zunächst hatte dieses Amt Hans Friedrich Blunck inne, ein völkisch-konservativ orientierter Schriftsteller, der zu den erfolgreicheren Vertretern seiner Zunft zählte.23 1935 wurde er von Hanns Johst abgelöst, der der Kammer bis zum Ende der NS-Herrschaft vorstand.
Parallel dazu wurde die Schrifttumsabteilung im Ministerium im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut. Zeitweilig wurde sogar Karl Heinz Hederich, stellvertretender Vorsitzender der Parteiamtlichen Prüfungskommission (PPK), von der später noch die Rede ist, zum Leiter der Abteilung. Goebbels versprach sich davon Einigkeit von Partei und Staat auf dem Gebiet der Schrifttumslenkung. Zudem sollte auch die RSK entpolitisiert werden und Kompetenzen an die Schrifttumsstelle abtreten. Ziel des Ministers war es natürlich, am Ende alle Zuständigkeiten für das Buch in seinem Ministerium zu bündeln.24 Ein Unterfangen, das scheitern musste. Zu viele Akteure tummelten sich auf dem Sektor der Literaturpolitik und versuchten sich hier zu profilieren. Diszipliniert wurden sie weder von Staatsräson noch von Parteigehorsam, zumal es eine ›einheitliche Parteilinie‹ gar nicht gab. Jeder verfolgte seine eigenen Interessen, die zum großen Teil schlicht und einfach ökonomische waren.
Dauerclinch um die Kulturhoheit: Rosenberg, Bouhler, Rust, Ley
Um das literaturpolitische Durcheinander anschaulich zu machen, sollen im Folgenden die wichtigsten Protagonisten, die Einfluss auf den Buchmarkt nehmen wollten, weiter vorgestellt werden. An erster Stelle Alfred Rosenberg. Sein »Amt für Schrifttumspflege beim Beauftragten des Führers für die gesamte weltanschauliche Schulung der NSDAP/Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums«, das in Teilen aus dem Kampfbund für deutsche Kultur hervorgegangen war, hatte sich der Förderung von Büchern verschrieben, die in sein ideologisches Konzept passten. Rosenberg besaß zwar keine exekutive Gewalt, dafür aber in vielen Kreisen der Partei eine gewichtige Stimme. Er verfügte im Laufe der Jahre über einen großen Stab an ehrenamtlichen und hauptberuflichen Lektoren und übte insbesondere über Empfehlungen und Ablehnungen, die in der monatlich erscheinenden Zeitschrift Die Bücherkunde abgedruckt wurden, erheblichen Einfluss aus. Die Druckfahnen der Zeitschrift wurden Rosenberg stets zur Freigabe vorgelegt, in besonders heiklen Einzelfragen wurde seine Meinung direkt eingeholt.
Im Krieg schuf sich Rosenbergs Dienststelle mit der »Büchersammlung der NSDAP für die Deutsche Wehrmacht«, die auch unter dem Namen »Alfred-Rosenberg-Spende« beworben wurde, ein weiteres Betätigungsfeld. Hier sollten private Bücherspenden eingeworben und zu Truppenbüchereien zusammengestellt werden. Ein Nebeneffekt war aus Rosenbergs Sicht, dass man auf diese Weise weiteres ›unerwünschtes Schrifttum‹ insbesondere aus Privathaushalten aus dem Verkehr ziehen konnte. Der Nachteil: Nur ein Bruchteil der gesammelten Werke war überhaupt für eine Weitergabe an die Wehrmacht geeignet. »Es muß auch bei der ehrenamtlichen Mitarbeit der Helfer dafür gesorgt werden, daß wenigstens nicht ausgesprochene Emigrantenliteratur mit dem Stempel ›Alfred-Rosenberg-Spende‹ versehen an die Soldaten verteilt wird«25 , hieß es dazu noch 1944 in einem internen Vermerk in Rosenbergs Dienststelle. Wegen solcher Lieferprobleme musste insbesondere der parteieigene Eher Verlag den Bücherfonds durch Titel aus der eigenen Produktion massiv aufstocken.
Eine weitere eigene Kontrollinstanz mit großer Nähe zu Hitler hatte sich mit der »Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze des nationalsozialistischen Schrifttums«, etabliert. Sie wurde 1934 durch eine Verfügung von Rudolf Hess in seiner Eigenschaft als ›Stellvertreter des Führers‹ gegründet. Ihr Leiter wurde Philipp Bouhler, der in Personalunion auch als Chef der ›Kanzlei des Führers‹ fungierte. Alle Bücher, die »im Titel, in der Aufmachung, in Verlagsanzeigen oder auch in der Darstellung selbst als nationalsozialistisch ausgegeben«26 wurden, waren der PPK vorzulegen. Dies hatte weitreichende Folgen für die Literatur in ihrer Gesamtheit. Bouhler hatte zwar einen im Vergleich zu Goebbels oder Rosenberg ›kleinen Apparat‹, dafür aber große Kompetenzen dank seiner Protektion von oben und seines kurzen Drahts zu Hitler. So konnte er zum Beispiel auch auf den Lektorenstab des Amtes für Schrifttumspflege zurückgreifen. 1941 schließlich entschied Hitler, dass Bouhler im gleichen Maße wie Goebbels auch direkte Anträge auf Beschlagnahmung bereits erschienener Werke bei der Gestapo stellen können solle.
An der PPK lässt sich noch ein anderes Grundprinzip nationalsozialistischer Herrschaft festmachen: Fast nichts geschah allein aus ideologischen Gründen. Besonders dynamisch wurden Prozesse dann, wenn wirtschaftliche und politische Interessen zusammenspielten. Nach der Machtübernahme 1933 war eine Lawine sogenannten Konjunkturschrifttums losgetreten worden, die – so die Parteigewaltigen – eingedämmt werden musste. Denn die wollten nicht nur die Deutungshoheit für ihre Geschichte haben, sondern unbedingt auch die Profite aus diesem Geschäft über den eigenen Parteiverlag, Franz Eher Nachf., einstreichen. Seine Monopolstellung auf diesem Gebiet sollte nicht zuletzt durch die PPK geschaffen und abgesichert werden.
Klein, aber nicht unwichtig war die Außenstelle der PPK bei der Deutschen Bücherei in Leipzig. Die Deutsche Bücherei hatte seit 1913 die Funktion einer Nationalbibliothek inne. Hier wurde sämtliches in Deutschland erscheinende Schrifttum gesammelt. Mitarbeiter der Prüfungskommission erarbeiteten hier das Material für die Nationalsozialistische Bibliographie und konnten zugleich sämtliche Druckschriften im Hinblick auf eine mögliche Vorlagepflicht bei der PPK prüfen, denn alle Verlage hatten hier ihre Pflichtexemplare abzuliefern. Was damals für den Zensor von Nutzen war, kann heute dem an Unterhaltungs- und Populärliteratur Interessierten nur recht sein: Aufgrund ihres umfassenden Sammelauftrags sind die Magazine der Deutschen Bücherei, heute Deutsche Nationalbibliothek am Standort Leipzig, eine umfassende Quelle der Information.
Weitere Institutionen und Akteure auf dem Sektor der Literaturpolitik sollen im Folgenden noch gestreift werden. Auch das am 1. Mai 1934 aus der Taufe gehobene Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung unter seinem Minister Bernhard Rust wollte Einfluss auf das gedruckte Wort im Land nehmen. Explizit hatte Hitler in seinem Gründungserlass Rust nur Kompetenzen hinsichtlich des wissenschaftlichen Büchereiwesens zugewiesen, aber durch seinen Auftrag hatte er auch den entscheidenden Einfluss auf alle Lehrbücher sowie die Büchereien für Lehrer und Schüler in den Schulen.27 Große Breitenwirkung erlangte das Ministerium durch seine Kompetenzen im Bereich der Volksbüchereien. Hier sorgte es in Abstimmung mit der Reichsschrifttumskammer für die ›Säuberung‹ der Bestände und steuerte den Neuaufbau der Bibliotheken. Allerdings gehörte Rust zu den vielen Mitgliedern im Kabinett Hitler, die zwar formal an der Regierung teilhatten, die aber wenig Einfluss hatten und deren Namen heute auch kaum noch bekannt sind. So verlor Rust beispielsweise – lanciert durch das Propagandaministerium – seine Zuständigkeit für die Erarbeitung der Lehrbücher an den Schulen nach 1940 beinahe vollständig an die PPK.
Auch Robert Ley, Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront (DAF), der Nachfolgeorganisation der ausgeschalteten Gewerkschaften, wollte auf Buch und Literatur Einfluss nehmen. Im Rahmen der NS-Gemeinschaft »Kraft durch Freude« wurden in erheblichem Umfang Dichterlesungen organisiert. Auch die Werkbüchereien, also Büchereien, die einzelnen Firmen zugeordnet waren, gehörten in seinen Zuständigkeitsbereich. Hier ging es immerhin um mehrere Tausend kleinere und größere Büchereien mit Millionen von Lesern.
Hinsichtlich seiner Breitenwirkung aber war ein anderer Sektor, auf den Ley zugriff, noch viel bedeutender: die Verlagsbranche an sich. Hier zeigten sich für die Zeit typische Tendenzen. Nicht die Ideologie hatte Priorität, sondern der Profit. Obwohl Ley vorgab, dass »nur mit nationalsozialistischer Anschauung zu vereinbarende Werke« verlegt werden und dass den »Maßnahmen der Regierung« jeweils »besondere Beachtung beizumessen«28 sei, erschienen in den Verlagen seines Herrschaftsbereichs auch Produkte, die kritische Zwischentöne kannten oder ihr Entstehen vor allem ökonomischen Überlegungen verdankten. Das Bekenntnis zum Nationalsozialismus diente Ley vielfach als Feigenblatt, um handfeste wirtschaftliche Interessen zu kaschieren. So wurden von der DAF Buchreihen wie die Wiesbadener Volksbücherei gepflegt oder Bücher unter dem Label Hillgers Deutsche Bücherei herausgegeben, die ganz bewusst an Formate und Umfänge der erfolgreichen Heftreihen der oft verpönten ›Systemzeit‹ anknüpften. Das Themenspektrum reichte dabei von modernen Klassikern à la C. F. Meyer bis zu Werbeschriften für die deutsche Luftfahrt, bei denen Görings Ministerium als Mitherausgeber auftrat. 1942 gehörten zum Verlagsimperium der DAF über 20 Verlage, sieben Druckereien, zwei Buchgemeinschaften und eine Papierfabrik, darunter die so renommierten Häuser Langen-Müller in München und die Hanseatische Verlagsanstalt in Hamburg.29 Den letztgenannten Verlagen verdankte der Buchmarkt jener Jahre eine Vielzahl von Bestsellern und eine Reihe für die Zeit außergewöhnlicher Publikationen.
Dass die NS-Literaturpolitik gescheitert sei, wird man von offizieller Seite kaum zu hören bekommen haben. Dass sie nicht sehr erfolgreich war, konnten ausgewählte Kreise dagegen sogar den Meldungen aus dem Reich des Sicherheitsdienstes der SS entnehmen: »Trotz des weitgehenden Ausbaus der Kulturorganisationen fehlt die einheitliche Kulturplanung. Reichserziehungsministerium, Innenministerium, Propagandaministerium, Dienststelle Rosenberg, die Kulturverwaltungen der Länder und Provinzen, die Kulturämter der Partei, die Reichskulturkammer mit ihren Einzelkammern, die Organisation ›Kraft durch Freude‹, der Dozentenbund, der Studentenbund, die entsprechenden Berufsverbände […] sind im einzelnen bemüht, nationalsozialistische Kulturpolitik und Kulturarbeit zu treiben, ohne daß es bisher gelungen wäre, diese vielfältig wirksamen Kräfte zu einer geschlossenen, in den grundsätzlichen Teilen aufeinander abgestimmten, planend vorausschauenden Kulturpolitik zusammenzufassen.«30
Die Indizierung des unerwünschten Schrifttums
Auch der Sektor der Schrifttumsindizierung war von einem großen Durcheinander bestimmt. »Über 1000 Bücher sind von 21 Stellen im neuen Staate verboten worden!«, so wandte sich ein empörter Buchhändler im Dezember 1933 an das Propagandaministerium. »Es wäre m. E. unbedingt an der Zeit, entweder mit den Verboten grundsätzlich aufzuhören, oder eine Zentralstelle zu schaffen, an die man sich entweder bei Drucklegung eines Manuskripts oder vorher wenden kann, oder die nachträglich bereits erschienene Bücher als einzige offizielle Stelle verbieten kann.«31
Die wichtigste gesetzliche Grundlage für die nationalsozialistischen Säuberungsmaßnahmen bildete die »Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen Volkes«, in der es unter anderem hieß: »Druckschriften, deren Inhalt geeignet ist, die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu gefährden, können polizeilich beschlagnahmt und eingezogen werden.«32 Sie legitimierte das Vorgehen der politischen Polizei gegen unliebsame Literatur. Allerdings gab es noch keine reichsweit einheitliche Regelung, da die Polizeibehörden der Länder zum Teil sehr unterschiedlich agierten. Zwar bemühte sich das Propagandaministerium von Anfang an darum, die Richtlinienkompetenz auf diesem Sektor an sich zu ziehen. Die Bemühungen wurden allerdings erst 1936 durch eine Entscheidung Hitlers gekrönt. In diesem Jahr erhielt Goebbels die lang ersehnte Bestätigung, von nun an federführend auf dem Gebiet der Schrifttumsindizierung zu sein. Bücher durften nun nur noch beschlagnahmt werden, wenn sie auf der von der Reichsschrifttumskammer geführten Liste der unerwünschten Schriften erfasst waren. Neuaufnahmen in diese Liste mussten beim Präsidenten der RSK beantragt werden. Nur in dringenden Fällen durften die Polizeibehörden vorläufige Beschlagnahmungen durchführen.33
Eine der ersten Listen, die traurige ›Berühmtheit‹ durch die Bücherverbrennungen erlangt hatte, verdankte ihre Entstehung eher dem Zufall. Sie war von dem Volksbibliothekar Wolfgang Herrmann zusammengestellt worden und wurde von der Studentenschaft, die unter Zeitdruck ihre Aktionen organisieren mussten, als Hilfsmittel dankbar aufgegriffen.34
Die im Herbst 1935 fertiggestellte Liste 1 des schädlichen und unerwünschten Schrifttums basierte auf bereits älteren Listen zum Beispiel der bayerischen politischen Polizei. Sie war streng vertraulich, ihr Inhalt wurde nicht öffentlich gemacht. Dies sollte zum einen verhindern, dass das Ausland auf die Verbotspraxis eingehen konnte. Zum anderen sollten die Buchhändler zur Kooperation mit den staatlichen Stellen gezwungen werden, die ihnen im Zweifelsfall Auskunft erteilen konnten, und außerdem selbst ein Gespür für das Erlaubte bzw. Verbotene entwickeln. Die Liste 1 wurde später durch weitere Jahreslisten fortlaufend ergänzt und bildete die wichtigste Grundlage für die Verbotspraxis im Dritten Reich. Von 1936 an wurden diese Listen auf Verbotskonferenzen zusammengestellt, an denen unter der Leitung des Propagandaministeriums auch Vertreter der Reichsschrifttumskammer, der Parteiamtlichen Prüfungskommission, des Geheimen Staatspolizeiamtes, des SD-Hauptamtes und des Reichserziehungsministeriums teilnahmen.35
Verbote und Empfehlungen: Die Lenkungsinstrumente
Der zweite wichtige Index war die Liste der für Jugendliche und Büchereien ungeeigneten Druckschriften. Er war zwar ebenfalls bereits 1935 angekündigt worden, wurde aber erst im Oktober 1940 vorgelegt. Aus dieser Liste erfahren wir vor allem, welche Bücher tatsächlich in jener Zeit noch in großer Zahl im Umlauf waren: Denn die schwarzen Listen bildeten freilich ungewollt einen Ist-Zustand ab, der – aus Sicht der NS-Kulturbeauftragten – so bald wie möglich zu beenden war. Auf der vom Propagandaministerium herausgegeben Liste sind allein zehn Seiten lang Edgar-Wallace-Romane aufgeführt, von A. S. der Unsichtbare bis Der Zinker. Über 160 Titel, fast alle zwischen 1927 und 1939 bei Goldmann in Leipzig erschienen. Ein ganzer Verlagszweig wurde dort indiziert.
Gerade die Menge der Titel spricht für die massenhafte Verbreitung der Werke des englischen Autors in Deutschland zu dieser Zeit. Der Hexer war noch im Juli 1939 im Theater am Kurfürstendamm aufgeführt worden. Ein begeisterter Joseph Goebbels hatte sich, nachdem er die Vorstellung besucht hatte, in sein Tagebuch notiert: »Eine tolle Kriminalschwarte.« Dass im Jahr darauf Der Hexer und Neues vom Hexer auf dem Index der jugendgefährdenden Schriften landen sollten, war nicht abzusehen. Noch befand sich Deutschland nicht im Krieg mit seinen europäischen Nachbarn und auch nicht mit dem Mutterland des Krimis. Eine grundlegende Abneigung gegen solche ›Schwarten‹ scheint den Propagandaminister nicht umgetrieben zu haben.
Die weitere Zusammenstellung der Liste lässt darauf schließen, dass ein wesentliches Kriterium der Auswahl der Kampf gegen englische Einflüsse auf dem Gebiet der Kultur war. Auch wenn die Literaturlenker damit in erster Linie englisch klingende Pseudonyme wie Lok Myler (eigentlich: Paul Alfred Müller) oder C. V. Rock (eigentlich: Kurt Walter Röcken) aufs Korn nahmen. Vor allem die immer schon kritisierten Heftchenromanreihen wie Tex Bulwer. Abenteuer im wilden Westen oder, noch erfolgreicher und bekannter, Die Abenteuer des Billy Jenkins wurden mit dieser Liste vom Markt genommen. Damit hielt man eines amtlich fest: Bis zu diesem Zeitpunkt waren sie wirklich massenhaft und überall gelesen worden. Allein von Billy Jenkins erschienen zwischen 1934 und 1939 263 Einzelhefte, ein Schmökerstoff auch für BdM-Mädchen und Hitlerjungen.
Sebastian Losch, Referent im Propagandaministerium und für das Büchereiwesen zuständig, sammelte in einem Artikel im Börsenblatt fleißig Argumente für ein verstärktes Eingreifen in die Unterhaltungsliteratur nach dem Kriegsbeginn. Es sei zu einer »Überschwemmung mit leichter und leichtester Unterhaltungsliteratur«36 gekommen. Die Probleme ergeben sich vor allem dort, wo etwa im Kriminalroman in »unverantwortlicher Weise für englische Lebensart und Gewohnheit« geworben werde. Dies ist die eine Seite: Schließlich befand man sich inzwischen mit England im Krieg. Das Ministerium konnte es nun nicht mehr gutheißen, dass »Einrichtungen des englischen Staates und insbesondere der Polizei […] glorifiziert« würden. Auf der anderen Seite begegnen wir Argumenten, die bis heute die Debatten um schädlichen Einfluss der Medien auf die Jugend begleiten, nur dass Internet und ›Ballerspiele‹ damals noch in weiter Ferne waren. Dennoch warnte Losch, dass vor allem bei Jugendlichen »der Trieb zur Bandenbildung und zur Auflehnung« durch die falsche Lektüre gefördert werden könnte. Befand sich also das Buch und sein Leser unter einer Art Generalverdacht, da er – schlechter kontrollierbar als der Kinobesucher oder Radiohörer – sich im stillen Kämmerlein auch stets seine eigenen Gedanken machen, dem Nazi-Wahn – wenn auch nur auf Zeit – entfliehen konnte?
Liste der für Jugendliche und Büchereien ungeeigneten Druckschriften. Bereits 1935 angekündigt, erschien sie erst mals im Oktober 1940. Sie war deutlichstes Zeichen einer stärkeren Reglementierung der Unterhaltungsliteratur nach Kriegsbeginn.
Als die Liste der für Jugendliche und Büchereien ungeeigneten Druckschriften herausgegeben wurde – und Loschs Artikel gehörte zur propagandistischen Begleitmusik, die diese und ähnliche Eingriffe flankieren sollte –, setzte sie ein deutliches Zeichen einer stärkeren Reglementierung der unterhaltenden Literatur nach September 1939. Auch wenn die Zielgruppe auf Jugendliche und Büchereien eingeschränkt war, kam eine Indizierung auf der Liste einem Totalverbot gleich, zumindest was die weitere Produktion solcher Titel anging. Der Besitz oder das Lesen war dadurch nicht untersagt, aber beides wurde erschwert und diskreditiert. Außerdem durften die Schriften »nicht in Schaufenstern und allgemein zugänglichen Bücherständen öffentlich ausgelegt werden«37 . Wenn man eine Zuspitzung im Verhältnis der Nationalsozialisten zur populären Literatur festmachen will, dann in den Jahren 1939/1940. Diese Anstrengungen auf Seiten des Propagandaministeriums scheinen von dem Wunsch getragen worden zu sein, allzu seichte Ablenkung zu unterbinden und vor allem die Jugendlichen von Helden mit englischem oder englisch klingendem Namen fernzuhalten. Die restriktive Haltung gegen Englischsprachiges wurde mit Kriegsbeginn ohnehin verstärkt, da nun, immer etwa dem Kriegsverlauf folgend, auch die fremdsprachigen Literaturen der ›Feindländer‹ nur noch beschränkt auf dem deutschen Markt toleriert wurden.
Die geschilderten Einschränkungen auf dem Sektor der leichten Unterhaltungsliteratur lassen sich – so einschneidend sie im Einzelfall auch waren – dennoch nicht als generelle Ablehnung solcher Stoffe deuten.
Es waren im Grunde einfachste biologistische Vorstellungen, die die Schrifttumslenker bestimmten: Der Gärtner entfernt das Unkraut, stärkt damit die ihm lieben Nutzpflanzen und beginnt dann, neue Arten zu kultivieren. Ein Problem war nur: Die Radikalität der ›Unkrautvernichtung‹ zog auch alles andere in Mitleidenschaft.
Schon 1934 hatte die Zeitschrift der Leihbücherei mit der Veröffentlichung einer Grundliste für die Leihbüchereien begonnen, die von der Reichsschrifttumsstelle im RMVP zusammengestellt worden war und die »Säuberung der Leihbüchereien« durch Buchvorschläge ergänzen sollte.38 1940 erschien dann die Erste Grundliste für den deutschen Leihbuchhandel und das Werkbüchereiwesen unter dem Titel Das Buch ein Schwert des Geistes39 , weitere Listen sollten 1941 und 1943 folgen.
Die Leihbücherei habe als »einer der großen Umschlagplätze für das geistige Gut des Volkes […] in unserer ernsten Zeit kriegswichtige Bedeutung gewonnen«. Der Leihbuchhändler solle durch diese Zusammenstellung »zum besten deutschen Buch im nationalsozialistischen Sinne« hingeführt werden.40 Zahlreiche weitere empfehlende Listen und Publikationen etwa für das Fachbuch oder das Deutsche Sport-Schrifttum sollten die Förderprogramme begleiten.
Eine Zensur findet (nicht) statt
Es mag angesichts der gewaltigen Eingriffe in den Buchhandel und vor allem der massiven Übergriffe auf missliebige Autoren und ihre Werke und Verleger verwundern, aber es gab zunächst keine flächendeckende Präventivzensur im Dritten Reich. Grundsätzlich konnte (fast) jeder (solange er Mitglied im entsprechenden Berufsverband war) schreiben und publizieren, was er wollte. Auch konfessionelle Verlage durften noch in erheblichem Umfang bis in den Krieg hinein ihre Leserschaft versorgen und sogar jüdischen Verlegern wurden noch, zumindest bis 1938, publizistische Aktivitäten erlaubt. Wie gesagt, ›grundsätzlich‹, aber die Vielzahl der Ausnahmen und Einschränkungen dieser Freiheit zu publizieren verbietet es von selbst, von einem nicht reglementierten Buchmarkt zu sprechen.
So waren jüdische Verleger, die sich einer ›Arisierung‹ – also einem Zwangsverkauf – verweigert hatten, Ende 1935 mit ihren Betrieben aus der RSK ausgeschlossen worden. Sie hatten damit Berufsverbot und ihre Verlagsaktivitäten waren bald nur noch in einer Art Ghetto-Buchhandel möglich: So durfte etwa der erst 1931 gegründete, aber schon sehr profilierte Schocken Verlag eindeutig gekennzeichnete jüdische Schriften für ein ausschließlich jüdisches Publikum produzieren und vertreiben. Erst die Pogromnacht vom 9. zum 10. November 1938 setzte dem ein gewaltsames und unumkehrbares Ende.41
Und es gab weitere entscheidende Ausnahmen: Literaturgruppen und Produktionsformen, die sich schon im Vorfeld einem Genehmigungsverfahren zu unterziehen hatten. Eine betraf, und das hatte erhebliche Auswirkungen auf das Gesicht der Literatur im Dritten Reich, das explizit nationalsozialistische Schrifttum. Dafür bestand eine Vorlagepflicht bei der bereits erwähnten Parteiamtlichen Prüfungskommission, die von der Reichsschrifttumskammer anerkannt wurde. Alle Literatur, die in welcher Form auch immer auf die ›Bewegung‹ Bezug nahm, unterlag somit einer Vorzensur.
Vergleichbares gab es noch für weitere Schrifttumsgruppen. Die betreffenden Zensurinstanzen trugen häufig die beschönigende Bezeichnung ›Beratungsstelle‹. »Die Verleger ausgesprochener Unterhaltungsliteratur, vornehmlich diejenigen, die der ›Vereinigung der am Leihbüchereiwesen interessierten Verleger‹ und der ›Arbeitsgemeinschaft der Verleger für Volksliteratur‹ angehören«, so war im Börsenblatt 1935 zu lesen, »können aufgefordert werden, ihre Neuerscheinungen vor Drucklegung der von der Arbeitsgemeinschaft der Verleger für Volksliteratur errichteten Beratungsstelle […] einzureichen.«42 Mit der Einrichtung dieser Beratungsstelle innerhalb der Reichsschrifttumskammer, die später unmittelbar dem RMVP unterstand, sollte das unterhaltende Schrifttum schon vor Erscheinen geprüft werden. Jan-Pieter Barbian weist am Beispiel des Verlegers Goldmann darauf hin, dass es sich »letztlich um eine Vorlagepflicht« gehandelt habe.43 Eine ähnliche Form der Vorzensur bestand seit dem 1. Juni 1939 für periodisch erscheinende Schriften, was sämtliche Heftromane einschloss.
Jedoch werden alle diese Versuche der Erfassung nie lückenlos gewesen sein, denn so hieß es später im Börsenblatt: »Trotz verschiedener Hinweise auf die Anordnung Nr. 59, Neufassung vom 1. Juni 1939, werden nach Feststellung der Reichsschrifttumskammer immer wieder Schriftenreihen geplant und ohne die erforderliche Zulassung gemäß § 1 dieser Anordnung herausgegeben.«44 Im Falle des prominenten Verlegers Wilhelm Goldmann aus Leipzig führte das massive staatliche Eingreifen dazu, dass dieser seine Verlagsproduktion von Krimi- und Unterhaltungsliteratur komplett auf andere Belletristik und vor allem Sachbücher umstellen musste.
Die staatlichen Buchverbote wurden von Werbemaßnahmen für das erwünschte Schrifttum begleitet. Klebemarke und Plakat mit dem Motto »das Buch ein Schwert des Geistes« vom September 1935.
Ein weiteres Element einer Vorzensur brachte schließlich der Krieg mit sich. Ab Februar 1940 wurde, einer Anweisung Goebbels’ folgend, angeordnet, alle Publikationen, die sich »mit politischen, insbesondere außenpolitischen, wirtschaftlichen und militärischen Fragen befassen, zweckmäßigerweise den jeweils zuständigen Dienststellen rechtzeitig zur Prüfung vorzulegen«45 . Bald mussten solche Bücher schon in der Planungsphase angemeldet werden, außerdem bezog sich die Genehmigungspflicht sogar auf Nachauflagen bereits älterer Werke. Schließlich trat mit dem Krieg eine schon vorher diskutierte Maßnahme in Kraft: Die zentrale Papierbewirtschaftung. Die Verlage mussten sich nun die Papierkontingente für ihre gesamte Produktion, für jeden Titel einzeln, von zentraler Stelle genehmigen lassen. Die Maßnahme wurde immer weiter verschärft, bis schließlich 1941 bei der »Wirtschaftsstelle des deutschen Buchhandels«, einer dem RMVP nachgeordneten Dienststelle, eine Kommission eingerichtet wurde, in der Vertreter des Ministeriums, der RSK, aus dem Wirtschafts- und Erziehungsministerium, dem Oberkommando der Wehrmacht, der Parteiamtlichen Prüfungskommission und dem Hauptamt Schrifttumspflege, also von Rosenbergs Leuten, saßen. Diese entschied einzeln über sämtliche vorliegenden Anträge. So fanden sich im Schatten des Krieges nahezu alle Protagonisten der literaturpolitischen Grabenkämpfe zwangsweise wieder um einen Tisch versammelt.
Die Folgen für die Verlagslandschaft
Die geschilderten massiven Eingriffe in das freie Publizieren hatten nicht nur Folgen für die Autoren, sondern, an einigen Beispielen wurde es schon deutlich, natürlich auch für die Verlagslandschaft insgesamt. Wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen wurden jüdische und politisch missliebige Konkurrenten nach und nach ausgeschaltet. Ein großes Familienunternehmen wie das des Ullstein Verlags, das neben seinem Zeitungsimperium auch erfolgreich Bücher produziert hatte, wechselte unter Zwang den Besitzer: Die Familie Ullstein fand sich fast mittellos im Exil wieder, die immer noch beträchtlichen Gewinne aus Berlin flossen fortan direkt dem Verlagskonzern der NSDAP, Franz Eher Nachf., zu. Im November 1937 wurde die ›Arisierung‹ mit der Umbenennung des Konzerns in Deutscher Verlag abgeschlossen. »Für den Gegenwert eines Bleistiftes«46 , so soll sich der Eher-Direktor und Präsident der Reichspressekammer Max Amann erfreut über den Deal geäußert haben. Der von den neuen Inhabern bestellte Verlagsdirektor musste bis zum Ende des Dritten Reiches monatlich an die Konzernzentrale nach München über die bedeutenden Geschäftsvorfälle rapportieren. Wichtigster Stichpunkt in diesen Berichten waren stets die »Finanzen«, dort hieß es dann, »an den Zentral-Parteiverlag wurden im Monat Juli RM 3 500 000 überwiesen«47 . Das Verbrechen an den jüdischen Inhabern war für die Täter höchst lukrativ. Ähnliches widerfuhr auch kleineren und kleinsten Verlagen: Bekannte Namen und profilierte Verleger und ihre Mitarbeiter verschwanden von heute auf morgen aus der Öffentlichkeit.
»Für den Gegenwert eines Bleistiftes« musste sich die jüdische Familie Ullstein von ihrem traditionsreichen Verlagshaus trennen. Von 1937 an firmierte das dann zum parteieigenen Eher-Konzern gehörende Unternehmen unter Deutscher Verlag.
Etwas anders verlief dieser Prozess beim renommierten S. Fischer Verlag. Hier schaltete sich beizeiten das Propagandaministerium ein: Das wichtige Verlagslabel sollte durch die Enteignung keinen zu großen Schaden nehmen. Die jüdischen Eigentümer, in dem Fall Gottfried Bermann Fischer, der Schwiegersohn des Verlagsgründers, wurden an den Verhandlungen beteiligt und der vormalige Cheflektor Peter Suhrkamp konnte die Geschäftsführung übernehmen. Die bisherigen Inhaber seien, so Jan-Pieter Barbian in seiner Studie zur Literaturpolitik im Dritten Reich, »noch relativ angemessen«48 entschädigt worden. Die Substanz des Verlags wurde nicht zerstört und Bermann Fischer wurde sogar ermöglicht, unter Mitnahme bestimmter im Reich ohnehin verbotener Bücher in Wien einen neuen Verlag zu gründen. Dies war ein zwar prominenter, aber mit Sicherheit keineswegs typischer Einzelfall.
Gleichfalls unter Druck gerieten konfessionelle Verlage, deren Produkte sich dennoch einer stetigen, teilweise sogar wachsenden Beliebtheit erfreuen konnten. So mussten die Spitzel des Geheimdienstes der SS in ihren Meldungen aus dem Reich noch im Juli 1941 konstatieren, dass es einigen katholischen Verlagen gelungen sei, den Produktionsumfang nicht nur zu halten, sondern »sogar noch zu erhöhen«. Zu ihnen gehörten »die bekannten katholischen Großverlage Ferdinand Schöningh, Paderborn, Buzon und Bercker, Kevelaer, und die Bonifatius-Druckerei, Paderborn«49 . Selbst als es im Zuge der Totalisierung des Krieges vermehrt zu Verlagsschließungen kam, blieben die Großen der Branche davon eher unberührt. Prominentestes Beispiel hier ist sicher der C. Bertelsmann Verlag, der, als theologischer Spartenverlag gestartet, im Dritten Reich den Aufschwung zu einem Weltkonzern schaffte, mit Hilfe eines stetig wachsenden Sachbuch- und Belletristik-Segments.
Insgesamt wurde die Verlagsbranche im Dritten Reich von einem gewaltigen Konzentrationsprozess erfasst, der nicht zuletzt durch die Produktion von Großauflagen, zunächst für die Parteigliederungen von der Hitlerjugend (HJ) bis zum NS-Frauenbund, später für die Wehrmacht im Krieg, noch weiter vorangetrieben wurde. Nutznießer dieses Prozesses konnten bereits bestehende Verlage wie Bertelsmann sein, die sich als Lieferanten für Feldpostausgaben etablierten, vor allem waren es aber die der Partei assoziierten Unternehmen: voran der Eher-Konzern sowie das Verlagsimperium der Deutschen Arbeitsfront, der Nachfolgeorganisation der gleichgeschalteten Gewerkschaften. Eher war dabei vom winzigen Verlag des ›Parteiblättchens‹ Völkischer Beobachter Anfang der zwanziger Jahre zu einem Medienriesen herangewachsen.
Das Beschriebene macht eines deutlich: Der kleine, feine unabhängige Verlag musste es in diesen Zeiten schwer haben. Dennoch versuchten Buchhändler, die sich ein Stück Unabhängigkeit bewahren wollten, den Häusern die Treue zu halten, die noch einen Rest des einstmaligen Verlegertums repräsentierten. »Daß uns mit manchen Verlegern wie z. B. Insel, S. Fischer, später Suhrkamp, Lambert Schneider, Goverts, Rowohlt, Piper, Kiepenheuer, Wunderlich, Heimeran u. a. besondere Sympathie verband, brauchten wir nicht zu verbergen«, so erinnerte sich der Berliner Buchhändler Hans Benecke nach dem Krieg. »Manchmal konnte man auch ein offenes Wort riskieren. Gute Zusammenarbeit spielte ebenfalls bei der allmählich wegen der Papierknappheit notwendigen Mengenzuteilung gängiger Titel eine Rolle.«50 Eine außergewöhnliche Geschichte schrieb dabei der erst 1934 gegründete H. Goverts, später Claasen & Goverts Verlag in Hamburg: Er verdankte seinen Aufstieg allein dem Weltbestseller Vom Winde verweht, der 1937 gewissermaßen über Nacht das ganze Unternehmen auf gesunde Füße stellte. Doch solche Geschichten und solche Verlage blieben eher Ausnahmen in der mehr und mehr auf die Wünsche und Vorstellungen der Partei zugerichteten Verlagslandschaft im Dritten Reich.
Prinzipien totalitären Handelns: Vom Verbot der Kunstkritik bis zur Reglementierung der Leihbücherei
Die Freiräume, die an manchen Stellen aufblitzen mögen, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier ein menschenverachtendes, totalitäres Regime am Wirken war. Zwei weitere Beispiele sollen diesen vielstimmig vorgetragenen Anspruch des Regimes, auf alles Einfluss zu nehmen, beleuchten.
Nicht unerhebliche Folgen für den Buchhandel hatte ein Erlass Goebbels’ aus dem November 1936 zum Verbot der Kunstkritik: »An die Stelle der bisherigen Kunstkritik, die in völliger Verdrehung des Begriffes ›Kritik‹ in der Zeit jüdischer Kunstüberfremdung zum Kunstrichtertum gemacht worden war, wird ab heute der Kunstbericht gestellt.«51 Das betraf – wenn auch nicht explizit genannt – das gesamte Buchbesprechungswesen gleichermaßen. Von nun an musste jeder Text dieser Gattung mit vollem Namen gekennzeichnet werden, außerdem sollten die Schriftleiter, die in diesem Bereich tätig werden wollten, mindestens dreißig Jahre alt sein, also über genügend Erfahrung verfügen. »Damit verschwindet ein Krebsschaden des öffentlichen Lebens«,52 so hatte sich Goebbels notiert. Die Kritiker hatten sich nicht den Wünschen des Propagandaministers angepasst – also wurden sie abgeschafft. Nun war allerdings die Buchrezension bereits damals das vielleicht wichtigste Instrument der Buchwerbung gegenüber dem breiten Publikum, das »Tor zur großen Welt«53 , wie auch die Mitarbeiter aus Goebbels’ Ministerium erkannt hatten. Ganz ohne konnte es gar nicht gehen. Erste und vordringliche Aufgabe musste es nun sein, das Genre der Buchkritik oder Rezension im neuen Geiste umzuformen. Eigens zu diesem Zweck wurde eine Zeitschrift ins Leben gerufen: Die Buchbesprechung. Hier wurden programmatische Aufsätze zum Themenkreis präsentiert und beispielhafte Buchbesprechungen aus den verschiedensten Publikationsorganen vom Völkischen Beobachter bis zum Berliner Tageblatt abgedruckt. Rezensionen hatten von nun an vor allem die Aufgabe, mit dem Stoff des besprochenen Werkes vertraut zu machen. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Gefahr, die sich daraus ergab, hatte Goebbels bereits frühzeitig erkannt, aber diskret für sich behalten: »Presse bringt Verbotserlaß Kritik groß aber mit sauer-süßer Miene heraus. Sonst wirkt er in der Öffentlichkeit sehr gut. Nur aufpassen, daß er nicht den Dilettantismus protegiert.«54 Mit seiner Befürchtung sollte er recht behalten, allerdings hatte der Minister damit eine Idee umgesetzt, die nicht allein auf dem nationalsozialistischen Mist gewachsen war. Er bekam Applaus noch aus ganz anderer Richtung, etwa aus den Reihen der Volksbibliothekare. Walter Hofmann, führender Volksbibliothekar und Leiter des Instituts für Leser- und Schrifttumskunde in Leipzig, sah sich mit Goebbels eins, »da wir auf dem grundsätzlichen Boden der Goebbelskundgebung schon seit vielen Jahren versucht haben, echte volksbibliothekarische Buchwürdigung aufzubauen«.55 Würdigung des wertvollen Schrifttums, nicht Kritik des Vorhandenen – darin bildete sich diese ungleiche Allianz von Volksbibliothekar und ›Volksaufklärer‹ Goebbels.
Ähnlich unter Kuratel gestellt wie die vormalige Buchkritik wurde eine in Stadt und Land ansässige Einrichtung der geistigen Grundversorgung: die Leihbücherei. Das Prinzip, ein Buch gegen geringes Entgelt auf Zeit zu entleihen, war in den dreißiger Jahren massenhaft verbreitet. Neben großen Leihbüchereien gab es zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte, bis hin zum Lebensmittelladen um die Ecke, die zusätzlich zu ihrem eigentlichen Warensortiment auch noch Bücher im Verleih anboten. Auch im Kampf um die Kontrolle über die Leihbücherei bildeten sich ähnliche überraschende Allianzen: Bildungsbeflissenen Kreisen und den Verfechtern der organisierten Volksbüchereien war diese Form des Literaturhandels schon vor dem Machtantritt der Nazis ein Dorn im Auge gewesen. Vor allem nach der Weltwirtschaftskrise hatte das Leihbüchereiwesen, nicht zuletzt durch die Massenheere der Arbeitslosen, einen ungeheuren Zulauf gehabt. Die Schätzungen gehen von bis zu 18 000 Leihbüchereien aus, die es 1932 im Gebiet des Deutschen Reiches gab.56 Es sei in dieser Zeit ein Typ des Lesers entstanden, der sich immer auf der Jagd nach dem aktuellsten Buch befinde und »in den Büchern Sensationen sucht«57 . Dieser neue Leser stille seinen Lesehunger vor allem in der Leihbücherei.
Der Leihbuchhandel zog das Interesse der nationalsozialistischen Kulturlenker schon allein deswegen auf sich, weil er Benutzerziffern und eine Verbreitungsdichte aufwies, die von den öffentlichen Volksbibliotheken in der Regel nicht erreicht wurden. Der Reichsverband der Leihbüchereien zeigte sich dem RMVP gegenüber kooperationsbereit, was die zu leistende Erziehungsarbeit und die Aufstellung von Bücherlisten anging, und bekannte sich zum kulturellen Programm des Ministeriums. Schließlich ging der Reichsverband in der Reichsschrifttumskammer auf.58 Jedoch sei »das Verhältnis der nationalsozialistischen Schrifttumsbürokratie zu den Leihbüchereien […] stets ambivalent« geblieben: Der großen Reichweite standen schlechte Ausbildung der Bibliothekare und ein »Mißtrauen« hinsichtlich der »Zusammenstellung der Buchbestände«59 gegenüber.
Den von Seiten der Volksbibliothekare geführten Angriffen gegen die Leihbücherei kann man entnehmen, dass sie als Hort von Kitsch- und Schundliteratur galten. Vor allem die »Sittenromane« würden im gewerblichen Buchverleih die größte Rolle spielen, aber auch der Verleih von billigen Romanheftchen, meist zu kleinen Bänden gebunden, fände dort statt.60 Ebenso wurde die mangelhafte Umsetzung der »Säuberungsaktionen« hinsichtlich der »Literatur des Großstadtliteratentums«61 festgestellt. So seien bei einer Aktion in Gera »243 Bände« sichergestellt worden. Darunter »10 Bände Im Westen nichts Neues […] trotz der gegenteiligen Versicherung des Besitzers«. Viele Gegner und Kritiker der Leihbücherei sahen mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten ihre Zeit gekommen und hofften nun auf Unterstützung in ihrem Kampf durch Staat und Partei.62
Auch aus den Kreisen der Leihbücherei bekannte man sich zur Notwendigkeit von Säuberungen, so etwa der Schriftleiter der Zeitschrift der Leihbücherei Ludwig Hürter: Es gäbe »eine Anzahl sogenannter Leihbüchereien, deren Bücherbestand sehr zu wünschen« übrig ließe. Man erkenne »rückhaltlos die Mißstände«63 auf diesem Sektor an. Zugleich betonte man jedoch die Reformfähigkeit des Gewerbes, der Leihbüchereiberuf sei ein »ausbaufähiger kulturfördernder Beruf«.
Was sich fast schon wie ein Abgesang auf die Leihbücherei insgesamt anhörte, verkehrte sich jedoch nach 1939 ins glatte Gegenteil. Als im Krieg die Buchproduktion schon längst nicht mehr mit dem gesteigerten Lesebedürfnis der Bevölkerung Schritt halten konnte, wurde die Leihbücherei zu einem Mittel, wenigstens eine Grundversorgung der