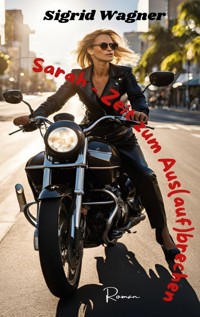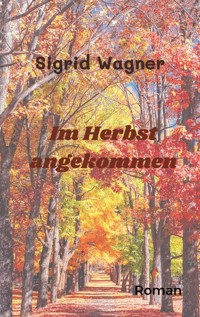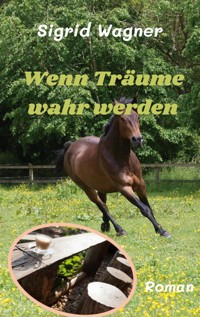9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Lehrer zu sein gehört zu den wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft. Doch Deutschlands Lehrer stehen ihren Schülern in vielen Fällen desinteressiert oder autoritär gegenüber. Sigrid Wagner war selbst über 20 Jahre lang Lehrerin und geht mit ihren Kollegen hart ins Gericht. Anhand erschreckender Beispiele aus ihrem Berufsleben offenbart sie die Defizite in deutschen Lehrerzimmern und kritisiert Inkompetenz, Neid und Mobbing unter den Kollegen sowie Machtmissbrauch, Willkür und Schikane den Schülern gegenüber. Sie meint: Die falschen Menschen werden aus den falschen Gründen Lehrer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Sigrid Wagner
Das Problem sind die Lehrer
Eine Bilanz
Über dieses Buch
Lehrer zu sein gehört zu den wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft. Doch Deutschlands Lehrer stehen ihren Schülern in vielen Fällen desinteressiert oder autoritär gegenüber. Sigrid Wagner war selbst über 20 Jahre lang Lehrerin und geht mit ihren Kollegen hart ins Gericht. Anhand erschreckender Beispiele aus ihrem Berufsleben offenbart sie die Defizite in deutschen Lehrerzimmern und kritisiert Inkompetenz, Neid und Mobbing unter den Kollegen sowie Machtmissbrauch, Willkür und Schikane den Schülern gegenüber. Sie meint: Die falschen Menschen werden aus den falschen Gründen Lehrer.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ZERO Media GmbH, München
Umschlagabbildung Sabrina Adeline Nagel
ISBN 978-3-644-40213-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Ich widme dieses Buch meinen wunderbaren Kindern
Hans Christian, Bernhard, Tobias, Nils und Natalie
In der Schule – Einführung
«Mumien, Monstren, Mutationen», so buhlte in meiner Kindheit der Animateur der Geisterbahn auf dem Jahrmarkt um seine Besucher. Für den Schauder und das Gruseln musste ich bezahlen. Mit der Schulpflicht bekam ich den Horror umsonst.
Massen von Kindern fluteten damals, Anfang der Sechziger, die engen Schulflure – keine Seltenheit in der Generation «Baby-Boomer», der ich angehöre. Wir wurden angebrüllt, geschubst, zusammengestaucht und: geschlagen. Es waren immer dieselben drei Jungs, die, wenn sie sich mal wieder in der Pause geprügelt hatten, im Anschluss im Unterricht vorgeführt wurden – in jeder einzelnen der vier Klassen. Sie mussten sich bäuchlings übers Pult legen, um dann mit dem «apfelgelben Dietrich», so nannte ein Lehrer euphemistischerweise seinen dünnen, gelb angemalten Stock, nach Strich und Faden verprügelt zu werden. Diese Tortur ging minutenlang, und die Schreie der Kinder höre ich noch heute. Wir anderen wurden von unseren Lehrern nach diesem «Schauspiel» gewarnt, dass uns ein ähnliches Schicksal blühen würde wie diesen drei Jungs, falls wir uns nicht benehmen würden.
Ich war damals sieben Jahre alt, und noch heute weiß ich ihre Namen – was zeigt, wie nah mir diese Ereignisse gegangen sind.
Nicht vergessen habe ich auch, dass ich bis zur vierten Klasse nie einen Lehrer gehabt habe, der herzlich gelacht hätte. Die meisten Lehrerinnen wirkten verbittert oder einfach nur böse, schrien uns Kinder regelmäßig an. Aus Angst, etwas falsch zu machen und ihren Zorn auf mich zu ziehen, lernte ich wie eine Wahnsinnige.
Trotz meiner Erfahrungen – oder gerade deswegen – hatte ich schon als Kind den Wunsch zu unterrichten; ich wollte es besser machen als meine Lehrer. Wenn ich mittags aus der Schule nach Hause kam, spielte ich mit Puppen und Teddybären Schule nach, so, wie ich sie mir vorstellte. Ein alter Schuhschrank diente als Tafel, und mein Umgangston mit meinen «Schülern» war freundlich und zugewandt.
Wenn ich eines aus meiner eigenen Schulzeit gelernt habe, dann, dass man Kindern in einer Atmosphäre von Zwang und Angst nichts beibringen kann. Ich überstand die Schulzeit glücklicherweise unbeschadet, doch viele meiner Mitschüler habe ich an Schule und Lehrern zerbrechen sehen.
Nun mag man einwenden, dass das Jahre her ist. Aber: Noch heute wissen die meisten Menschen zahlreiche Gruselgeschichten von strengen, berechnenden, furchteinflößenden Pädagogen zu erzählen. Lehrer haben, allen Initiativen für mehr Anerkennung zum Trotz, keinen guten Ruf: Sie gelten als rechthaberisch, humorlos, kleinlich, selbstherrlich, launisch, wehleidig, geizig, faul und ungerecht. So charakterisieren erstaunlicherweise auch die meisten meiner lieben Kollegen die Angehörigen ihres eigenen Berufsstands – nur sie selbst sind eine rühmliche Ausnahme.
Ich habe mich oft genug dabei ertappt, dass ich, nach meinem Beruf gefragt, nur leise, fast entschuldigend, Auskunft gab. Die Reaktionen waren zu frustrierend: «Ach du meine Güte, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, Sie wirken so sympathisch …» Oder: «Was, Sie sind Lehrerin? Das ist doch kein Beruf, das ist eine Diagnose.» Manchen Menschen merkt man das Unwohlsein in Gegenwart eines Lehrers sogar durch körperliche Reaktionen an: In dem Moment, da sie den Beruf erfahren, weichen sie automatisch einen Schritt zurück, die Schultern gehen hoch, sie wirken angespannt.
Woran liegt es, dass Menschen Lehrern so skeptisch, ja abwehrend gegenübertreten? Warum haben sie derart schlechte Erinnerungen an ihre Schulzeit? Sind das Einzelfälle, Vorurteile, die sich verselbständigt haben, sodass es heute quasi zum guten Ton gehört, auf Lehrer zu schimpfen? Schließlich empfindet sich jeder durch seine eigene Schulzeit als Experte. Aber sind nicht eigentlich die Lehrer die Opfer des Bildungssystems, Spielball der ständigen Reformen?
Ich bin überzeugt: Hier geht es nicht um Vorurteile oder Einzelfälle oder Gefangene des Systems (wobei das die kritisierten Verhaltensweisen befördert, aber dazu später mehr). In fast fünfundzwanzig Jahren als Vertretungslehrerin habe ich mehr Schulen gesehen als festangestellte Lehrer und außerdem Schulsysteme in unterschiedlichen Bundesländern kennengelernt, in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dies und die Erziehung unserer eigenen fünf Kinder haben mir eines klargemacht: Das Problem steht vor der Klasse. Es ist Zeit, dass wir über Lehrer reden.
Der Schulalltag Hunderttausender Kinder wird geprägt von Frauen und Männern, die langweiligen Unterricht machen, die ihre Schüler traktieren, die träge sind. Dabei gibt es auch die anderen: motiviert, begeisternd, zugewandt, idealistisch, neugierig. Meiner Erfahrung nach ist es aber leider nicht die Regel, dass unsere Kinder von solchen Prachtexemplaren durch die Schuljahre begleitet werden. Öfter sind sie Pädagogen ausgeliefert, denen man im Alltag kein zweites Mal begegnen möchte. Es sind jene Mitmenschen, die auch im Privatleben stets ihre eigene Befindlichkeit in den Vordergrund stellen, beim Amt lamentieren, an der Supermarktkasse überheblich den Kopf schütteln, wenn die Kassiererin einen Fehler macht, die im Wartezimmer beim Arzt drängeln. Sucht der Ehemann einer Lehrerin eine Wohnung, bekommt er vom Makler schon mal den guten Rat: «Sagen Sie bloß nicht, dass Ihre Frau Lehrerin ist. Lehrer sind dafür bekannt, dass sie ständig nörgeln und böse Briefe schreiben.»
Die Kinder werden in der Schule häufig kleingemacht. Lehrer lassen ihren Frust an ihnen aus, und so wird die Schule für viele zu einem Ort der Demütigung. Diese Demütigungen hängen ihnen länger nach, als man denkt – auch das wird Thema dieses Buches sein.
Die Frage, warum Lehrer frustriert sind, hängt mit der Frage zusammen, wer überhaupt Lehrer wird. Häufig sind Lehrer, so meine These, Menschen, die im Grunde genommen Angst vor dem Leben haben. Was irritiert dann mehr als eine Meute lachender, überschwänglicher Kinder? Achten Sie mal auf die Körpersprache vieler Lehrer: Nur wenige stehen geerdet vor ihrer Klasse. Dabei brauchen wir körperlich wie seelisch gesunde Lehrer, die dem Leben zugewandt sind, die den Schülern vermitteln können, dass das Beste im Leben noch kommt und sich nicht bereits in der Zeit vor der Einschulung abgespielt hat. Stattdessen studieren meiner Erfahrung nach viele deshalb Lehramt, weil sie nicht wissen, was sie sonst anfangen sollen. Es ist ja auch so ein schön sicherer Job. Das große Ziel der meisten Junglehrer ist die Verbeamtung – und wer kann es ihnen mit Blick auf den Arbeitsmarkt verdenken? Die Verbeamtung ist allerdings das schlechteste Motiv, Lehrer werden zu wollen.
Viele Aspiranten glauben aber auch, dass der Arbeitstag nach dem letzten Schrillen der Schulklingel erledigt ist, nicht wissend, dass er dann eigentlich erst losgeht.
Und dann, das will ich nicht verhehlen, kommt der Druck dazu: durch PISA, den Lehrplan, eine zunehmende Anzahl verhaltens- und lerngestörter Kinder, fordernde Eltern. Nirgends wird so viel geheult wie in Lehrerzimmern. Lehrer sind überfordert, weil sie an der Vielzahl der neuen Anforderungen und einem Mangel an Unterstützung (Stichwort: Inklusion) schier verzweifeln oder sogar zerbrechen. Die Rehakliniken sind voll mit burnoutgeschädigten Lehrern. Nur einer von zehn Lehrern erreicht das normale Rentenalter.
Unsäglicher Frust prägt also den Alltag der Lehrer: weil a) die falschen Menschen Lehrer werden, sie es b) aus den falschen Gründen heraus tun und c) selbst gute Lehrer mit besten Absichten an den vorhandenen Strukturen und den damit im Zusammenhang stehenden Herausforderungen scheitern. Die Folge ist ein Schulklima, das alle Beteiligten in eine negative Grundstimmung versetzt. Vom Hausmeister bis zum Schulleiter: Alle jammern und klagen.
Hinzu kommen die Kämpfe und Gehässigkeiten in den Lehrerzimmern. Hast du nicht das richtige Parteibuch, das die Schule fordert, kannst du gleich wieder gehen. Mobbing, Korruption, Sexismus, Machtspiele und Intrigen nehmen den Platz ein, der für das Wesentliche da sein sollte: die Bildung unserer Kinder. Unsere Söhne und Töchter erwartet eine sich rasant ändernde Welt, mit Herausforderungen, wie sie noch keine Schülergeneration vor ihnen meistern musste. Schüler wie Lehrer müssten sich eigentlich gehörig auf den Hosenboden setzen, um den veralteten Apparat, die «SBI», die «School Before Internet», abzulösen durch etwas Neues.
Stattdessen vermitteln viele Lehrer ihren Schülern, dass Schule Angst, Ungerechtigkeit und Demütigungen bedeutet, mit denen man nun mal zurechtkommen muss – und damit ersticken sie jegliche Wissbegierde, Phantasie und Kreativität im Keim.
Ich behaupte, dass zu viele Lehrer unsere Kinder benutzen, um ihrer eigenen Unzufriedenheit ein Ventil zu verschaffen, getreu dem Motto: «Ich zeige dir mal, wer hier das Sagen hat.» Ein perfides Spiel, das der Schüler nicht gewinnen kann und das ich viele Jahre selbst erlebt habe; im Lehrerzimmer, auf dem Schulhof, bei Konferenzen, bei meinen eigenen Kindern. Ich sage es klar und deutlich: Diese Frauen und Männer haben an unseren Schulen nichts verloren.
Natürlich kann man nicht alle Lehrer über einen Kamm scheren – wer das tut, dem empfehle ich, mal eine Woche in einer Brennpunktschule in Berlin zu unterrichten und sich anzuschauen, was das Gros des Kollegiums dort leistet. Dennoch werde ich in diesem Buch immer wieder zuspitzen; ich will wachrütteln und aufmerksam machen, und dazu muss man manchmal auch polemisch werden.
Das Verharmlosen und Bagatellisieren von Missständen und menschlichem Versagen von Lehrkräften in unseren Schulen war für mich schon immer ein unerträglicher Zustand. Wir haben uns über die Jahre und Jahrzehnte viel zu sehr daran gewöhnt, dass schlechte Lehrer die Lebenswege von Kindern und Jugendlichen maßgeblich negativ beeinflussen können – und das auch tun. Wir nehmen es mit einem Anflug von Ergebenheit in ein scheinbar unausweichliches Schicksal hin, als stünden keine Menschen dahinter, die die Schuld für lebenslange Versagensängste oder falsch geleitete Lebensläufe der ihnen anvertrauten Kinder tragen würden.
Damit möchte ich aufräumen, und dazu muss ich sie manchmal doch über einen Kamm scheren, die Lehrer – wenn der «Kamm» dabei hilft zu sehen, wie sich gute Lehrer von den schlechten trennen, dann möge man es mir an dieser Stelle verzeihen.
Tatsache ist: Es gibt zu viele Lehrer, die unmotiviert sind. Und ich bin nicht mehr bereit, den Grund dafür einzig in den schwierigen Arbeitsbedingungen zu suchen.
Die entscheidende Frage muss doch sein: Was wollen wir als Lehrer erreichen – und wie? Unser Job ist es, so viel wie möglich aus den jungen Menschen herauszuholen. Ihnen Perspektiven aufzuzeigen. Nicht zu sagen: Wenn ihr die Schule absolviert habt, dann seht zu, wer euch einstellt. Sondern zu fragen: Welches Unternehmen möchtet ihr später mal führen?
Es muss ein radikales Umdenken geben, was die Persönlichkeit und Funktion des Lehrers anbelangt – das habe ich auch in einem Artikel im Magazin «Der Spiegel» deutlich gemacht, der Ende 2016 erschienen ist. Und wie nicht anders zu erwarten, musste ich mir daraufhin den Vorwurf der «Nestbeschmutzung» gefallen lassen. Doch glauben Sie mir, die «Nester», die auf den Dächern unserer Schulen zusammengeschustert wurden, könnten dreckiger nicht sein.
Welche abstrusen Vorstellungen über Schule und die richtige Form von Bildung geistern durch die Nation! Jeder Bildungspolitiker oder vermeintliche Bildungsspezialist meint, seinen Senf dazugeben zu müssen: «Unser Schulsystem soll dreigliedrig bleiben, nein, wir brauchen nur noch Gesamtschulen, wir brauchen mehr Durchlässigkeit zwischen den Schulformen, nur noch G8 für Gymnasien, nein, G9 war besser, stellen wir doch G8 oder G9 zur Wahl …»
Immer wieder wird in den Medien die Erfindung eines neuen bildungspolitischen Rads verkündet. Es sind verzweifelte Versuche, eine Struktur in unsere Schullandschaft zu bringen, die allerdings zum Scheitern verurteilt sind, weil sie einen zentralen Aspekt außer Acht lassen. Im Jahre 2018 führen wir immer noch hauptsächlich Diskussionen über Inhalte, Methoden und Ziele, debattieren wir kontrovers, wie man Schule den Anforderungen der sich ständig und rasant verändernden Welt anpassen kann – und vergessen dabei völlig die Person und die Persönlichkeit des Lehrers.
Denn was nützt es, um mal ein anderes Bild zu bemühen, wenn ich ein Restaurant eröffne, es wunderbar einrichte, gute und gesunde Lebensmittel einkaufe, in der Speisekarte durchdachte und raffinierte Gerichte anbiete und dann Köche einstelle, die gerade mal Schinkennudeln auf den Tisch bringen können?
Um eine neue Kultur des Unterrichtens zu kreieren, bedarf es eines neuen Lehrertypus und gleichzeitig der gezielten und effektiven Unterstützung guter Lehrer, die die Zeichen der Zeit erkannt haben, die mit beiden Beinen im Leben stehen und Schule nicht als isolierten «Sperrbezirk» in Sachen Bildung ansehen.
Deshalb schreibe ich dieses Buch, in dem ich von meinen eigenen Erfahrungen als Lehrerin und Mutter von fünf Kindern berichte, aber auch aus Augenzeugenberichten und Unterlagen zitiere, die mir zugespielt worden sind, von Schulleitern, Kollegen, Eltern und Journalisten.
Es wird nicht immer angenehm sein, manches wird unglaublich klingen – aber wir müssen den Tatsachen ins Gesicht gucken, damit sich etwas ändert.
Und dafür wird es höchste Zeit.
Im Klassenzimmer
Die Forderung nach einem neuen Lehrertypus bedeutet Veränderung, in vielerlei Hinsicht – in Bezug auf die Ausbildung, aber auch in Bezug auf das Verhalten des Lehrers. Die Crux: Nichts verängstigt und irritiert Menschen, und damit auch Lehrer, mehr als Veränderung. Sie hängen am Althergebrachten, befürchten, mit Unbekanntem nicht zurechtzukommen, haben Angst vor Versagen, Angst, in den Augen von Kollegen oder Vorgesetzten schlecht dazustehen. Darum ist der Lehrer froh, nach dem Betreten des Klassenraumes die Tür hinter sich schließen zu können, um dort ungestört sein Süppchen zu kochen. Wollen wir ihm doch die Suppe etwas versalzen und werfen einen Blick hinter die Tür, in sein Heiligstes: das Klassenzimmer.
Die Szenen, die ich im Folgenden beschreibe, habe ich selbst erlebt, einige sind mir auch zugetragen worden. Es sind Geschichten über Lehrerkollegen, die von der ersten Schulstunde an die Schwächsten identifizieren und stigmatisieren, und solche, die an den harmlosesten Konflikten im Klassenzimmer scheitern.