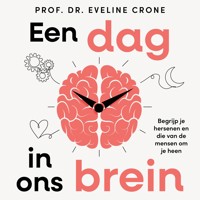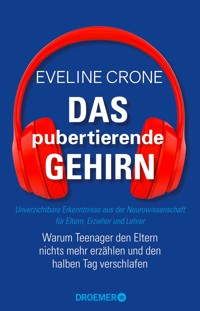
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Komplett überarbeitete und aktualisierte Neuausgabe des spannenden, erkenntnisreichen Ratgebers über die Pubertät. Eveline Crone, Professorin für kognitive Neurowissenschaft, erklärt anhand der neusten Hirnforschung, welchen Umbauprozessen das Gehirn während der Adoleszenz unterliegt - und wie das teils befremdliche Verhalten der Pubertierenden darauf zurückzuführen ist. Früher wurde alles auf die Hormone geschoben, doch seit einigen Jahren steht fest: Während der Adoleszenz wird das menschliche Gehirn noch einmal völlig umgebaut – was das Verhalten der Heranwachsenden über Jahre beeinflusst. In ihrem Buch beschreibt die renommierte Neurowissenschaftlerin Eveline Crone auf ebenso zugängliche wie höchst informative Weise die aktuellen Erkenntnisse der Hirnforschung – und erklärt, warum Pubertierende morgens nicht aus dem Bett kommen, plötzlich nicht mehr mit den Eltern reden wollen und sich in einem Sturm der Gefühle mitunter recht seltsam verhalten. - Vollständig überarbeitete und ergänzte Neuausgabe des erfolgreichen Teenager-Ratgebers - Eveline Crone ist eine preisgekrönte und international anerkannte Professorin für Neurowissenschaft - Ein aufschlussreiches und zugleich beruhigendes Buch für alle Lehrer, Erzieher und Eltern, die ihre Kinder nicht mehr verstehen. - Ein Ratgeber für Eltern mit Teenagern, der für Verständnis wirbt für die Vorgänge im Gehirn der Heranwachsenden
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Eveline Crone
Das pubertierende Gehirn
Warum Teenager den Eltern nichts mehr erzählen und den halben Tag verschlafen. Unverzichtbare Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft für Eltern, Erzieher und Lehrer
Aus dem Niederländischen von Bärbel Jänicke
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Früher wurde alles auf die Hormone geschoben, doch seit einigen Jahren steht fest: Während der Adoleszenz wird das menschliche Gehirn noch einmal völlig umgebaut – was das Verhalten der Heranwachsenden über Jahre beeinflusst. In ihrem Buch beschreibt die renommierte Neurowissenschaftlerin Eveline Crone auf ebenso zugängliche wie höchst informative Weise die aktuellen Erkenntnisse der Hirnforschung – und erklärt, warum Pubertierende morgens nicht aus dem Bett kommen, plötzlich nicht mehr mit den Eltern reden wollen und sich in einem Sturm der Gefühle mitunter recht seltsam verhalten.
Inhaltsübersicht
Vorwort
1 Das adoleszente Gehirn in Bewegung
Was ist mit den Teenagern los?
Was versteht man unter Adoleszenz?
Hormone außer Rand und Band
Ständiger Jetlag
Entwicklung zu einem erwachsenen Mitglied der Gesellschaft
Der Aufbau des Gehirns
Ein Blick unter die Schädeldecke
2 Das lernende Gehirn
Gehirn und Bildung
Der frontale Kortex: Die Steuerung der kognitiven Fähigkeiten
Planung nach einer Schädigung des Gehirns
Ein Blick in das planende menschliche Gehirn
Die Grundprozesse: Arbeitsgedächtnis und Hemmung
Arbeitsgedächtnis
Hemmung: Rechtzeitig stoppen
Flexibilität und Planung: Schnelle Anpassung an ein sich wandelndes Umfeld
Eigenverantwortliches Lernen
Fächerwahl
Sprache: Timing ist wichtig
Zum Schluss: Was macht das Gehirn intelligent?
Zusammenfassung
3 Das emotionale Gehirn
Emotionen im adoleszenten Gehirn
Das Erkennen primärer Emotionen
Die Funktion der Amygdala
Amygdala, Gesichter und Adoleszenz
Komplexe Emotionen: Komplexe Gehirnsysteme
Patienten mit Entscheidungsproblemen
Glücksspiel im Labor
Somatische Marker in der Entwicklung
Risiken und gefährliche Entscheidungen: Ein hyperaktives Emotionssystem
Die Rolle der Basalganglien beim Gewinnen und Verlieren
Hyperaktive Emotionssysteme in der Adoleszenz
Ist die Sensibilität für Belohnungen für irgendetwas gut?
Risikofreudiges Verhalten anregen oder hemmen
Zum Schluss: Frühe versus späte Hirnschädigung
4 Das soziale Gehirn
Sexting und Online-Challenges
Wie verläuft soziale Entwicklung?
Theory of Mind
Das faire und kooperative Gehirn
Akzeptanz und Ablehnung
Verliebtheit
Sozialer Einfluss
Zum Schluss: Die soziale Entwicklung aus evolutionärer Sicht
5 Das Gehirn und seine Möglichkeiten
Flexibles Gehirn, Potenzial im Überfluss!
Clevere User
Sportskanonen
Musikalische Talente
Prosoziale Jugendliche
Politische Impulsgeber
Zum Abschluss
6 Empfehlungen für Eltern, Schule und Politik
Was sollten wir über die Pubertät und die Adoleszenz wissen?
Welche Chancen bietet das Bildungssystem?
Wie können Jugendliche sicher und optimal aufwachsen?
Wie können sich Jugendliche gegenseitig positiv beeinflussen?
Dank
Quellen
Vorwort
Als Das pubertierende Gehirn2008 erstmals veröffentlicht wurde, hoffte ich, dass es vielleicht sechs Monate in den Buchhandlungen liegen würde. Es waren bereits einige Bücher über das Gehirn erschienen, aber die Hirnforschung bei Heranwachsenden in der Adoleszenz war noch weitgehend unerforschtes Terrain. In den meisten Büchern zu diesem Thema ging es um (Erziehungs-)Probleme in dieser Lebensphase, während ich ein Buch über die Möglichkeiten schreiben wollte, die diese Lebensphase bietet. Doch es kam ganz anders! Die Zeit war offenbar reif für einen neuen Blick auf die Adoleszenz. Mein Buch wurde nicht nur von Eltern und Experten massenhaft gekauft, sondern auch von den Jugendlichen selbst – was ich als das größte Kompliment empfand.
Seither hat sich die Hirnforschung im schulischen Bereich und im Erziehungswesen ihre Sporen verdient und zum Verständnis der Chancen und Befindlichkeiten pubertierender Jugendlicher beigetragen. Mein Forschungslabor, das Brain & Development Research Center an der Universität Leiden, arbeitet heute unter anderem mit Schulbehörden, Lehrern, Jugendhelfern, der Bewährungshilfe und Ministerien zusammen. Während Jugendliche in der Vergangenheit vor allem als schwer lenkbar und unberechenbar angesehen wurden, ist man sich heute allgemein bewusst, dass dies nur einen kleinen Teil des Gesamtbildes ausmacht. Wir wissen heute, dass die Gehirne junger Menschen ihnen alle Möglichkeiten bieten, ihre Identität zu entdecken und sich unter der relativen Sicherheit der Obhut von Eltern und anderen Erwachsenen zu entfalten.
Warum also diese Neuauflage nach mehr als zehn Jahren? Zunächst einmal hat sich in der Wissenschaft enorm viel getan. Die Schlussfolgerungen der vorherigen Ausgabe sind nach wie vor gültig, aber es ist eine Vielzahl von Erkenntnissen, zum Beispiel über Belohnungssensibilität, Risikosensibilität und das soziale Gehirn Jugendlicher hinzugekommen.
Die Hirnforschung hat in den letzten Jahren gezeigt, wie das Gehirn nicht nur zur Entwicklung von antisozialem Verhalten, sondern auch zur Entwicklung von prosozialem Verhalten beiträgt, also einem Verhalten, das junge Menschen dazu bringt, einen positiven Beitrag in ihrem Verhältnis zu anderen und der Welt, die sie umgibt, zu leisten. Aber auch die Welt der Heranwachsenden hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. Heutige Jugendliche sind digital natives, sie können sich eine Welt ohne Internet nicht vorstellen. Zudem ist ihre Vorstellung von Geld abstrakter geworden: An vielen Orten der Welt können Jugendliche leichter als je zuvor auf Kredit leben, und eine Bankkarte ist unverzichtbar geworden. Da Teenager heute ständig miteinander in Verbindung stehen, ergeben sich viele Möglichkeiten, ein großes soziales Netzwerk aufzubauen. Junge Leute sind oft die Ersten, die sich mit den neuesten technologischen Entwicklungen auskennen, sie produzieren neue Ideen und Trends und sind damit der Motor für Innovationen.
Gleichzeitig ist ein Großteil des Verhaltens Pubertierender heute nicht anders als früher, in vielen Bereichen sind ihre Befindlichkeiten und Ambitionen gleich geblieben. Ich sammle seit langer Zeit allerhand Wissenswertes, das ich über Jugendliche in den Medien finde. Dabei zeigt sich, dass sich das typische Verhalten von Teenagern in jeder Generation anders manifestiert, sich dabei aber auch erstaunlich gleich bleibt.
In dieser Neuauflage habe ich versucht, möglichst viele neue Erkenntnisse einzuarbeiten und sie damit zu kombinieren, wie wir als Gesellschaft Teenager sehen. Das hat viel Überraschendes zutage gefördert und deshalb habe ich mit großer Freude an dem Buch gearbeitet. Ich hoffe, es wird Sie ebenso überraschen und inspirieren.
1Das adoleszente Gehirn in Bewegung
Was ist mit den Teenagern los?
Warum kommen Jugendliche in der Pubertät nicht aus den Federn? Warum werden Hausaufgaben immer erst in letzter Sekunde gemacht? Warum müssen sie ohne Helm auf ihren Mopeds rasen oder auf schmalen Brücken mit dem Skateboard ihren Hals riskieren und warum kommen sie nie pünktlich nach Hause? Andererseits: Woran liegt es, dass Jugendliche sportlich und kreativ oft so erfolgreich sind? Warum entstehen neue Musikstile und Subkulturen wie die der Hipster oder Skater gerade oft in der Adoleszenz? Welche Rolle spielen die sozialen Medien im Leben Jugendlicher und warum sind Influencer bei ihnen so populär?
Diese Fragen wurden mir in den vergangenen Jahren bei meinen Vorträgen zur Funktionsweise des Gehirns von Pubertierenden in Schulen und andernorts immer wieder von Eltern und Lehrern gestellt. Bei diesen Vorträgen stellte sich heraus, dass Eltern von Heranwachsenden manchmal völlig ratlos sind und nicht verstehen können, warum ihr Kind, das früher vergnügt plaudernd am Küchentisch saß und erzählte, was es in der Schule alles erlebt hatte, sich nun plötzlich in seinem Zimmer einschließt und absolut keine Lust hat, auch nur ein Wort mit ihnen zu wechseln. Es kommt ihnen vor, als hätte das früher so offene Kind eine Metamorphose durchlaufen und läge nun ständig mit seinen Eltern und sich selbst im Clinch. Gleichzeitig werden die Probleme während der Adoleszenz oft übertrieben. Manche meinen, dass alle Teenager in Schwierigkeiten geraten, dabei ist das gewiss nicht der Fall. Die überwiegende Mehrzahl der Jugendlichen durchläuft die Adoleszenzphase ohne größere Probleme, obwohl fast alle von ihnen während dieser persönlichen Suche nach dem Erwachsensein Phasen der Unsicherheit durchleben.
Auch wenn wir alle wissen, dass sich in der Pubertät die Art, wie Jugendliche über sich selbst und ihre Eltern denken, grundlegend verändert, bleibt es doch schwer zu verstehen, warum das geschieht. Eltern werden weniger ins Vertrauen gezogen, Jungen und Mädchen beginnen, sich füreinander zu interessieren, doch jetzt völlig anders als bei ihren Kinderfreundschaften. Alles wird viel komplizierter. Das ist verwirrend für die Eltern, aber vor allem natürlich für die Heranwachsenden selbst. Auch wenn wir diese Veränderungen sehr wohl kennen, bleibt es doch ein Mysterium, was in diesen Köpfen genau vor sich geht.
Im Brain & Development Research Center der Universität Leiden erforschen wir seit fast zwei Jahrzehnten, wie sich das Gehirn in der Adoleszenz verändert. Für diese Studien laden wir Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche sowie junge Erwachsene bis zu 30 Jahren zur Teilnahme an unseren Experimenten ein. Wir lassen sie bestimmte Aufgaben lösen, Computerspiele spielen und stellen Fragen nach ihren Interessen und ihren alltäglichen Aktivitäten. Sie leisten damit einen bedeutsamen wissenschaftlichen Beitrag, denn durch ihre Teilnahme lernen wir mehr über diese besondere Zeit der Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen. Während dieser Untersuchungen machen wir Aufnahmen von ihrem Gehirn – nicht nur, um zu sehen, wie ihr Gehirn aussieht, sondern auch, wie es arbeitet, während die Aufgaben gelöst werden. Wir blicken also direkt unter die Schädeldecke. Wir sehen, wie das Gehirn pubertierender Jugendlicher in der Lage ist, zu planen, kreativ Aufgaben zu lösen, wie diese Jugendlichen ihre Gefühle in den Griff bekommen und Freundschaften schließen. Diese Beobachtungen eröffnen eine völlig neue Sichtweise auf das Verhalten und die Motivationen von Jugendlichen. Sie verhalten sich anders als Erwachsene, weil ihr Gehirn anders arbeitet. In den vergangenen 20 Jahren hat man weltweit viel über die Funktionsweise des Gehirns bei Jugendlichen herausgefunden, und diese Erkenntnisse finden heute auch ihren Weg in die breite Öffentlichkeit. Nicht nur interessierte Eltern und Lehrer machen sich dieses neue Wissen zunutze, auch Lehrpläne berücksichtigen, was die Gehirne Jugendlicher verkraften können. Die Jugendhilfe ist durch das Wissen über die Gehirnentwicklung ebenfalls immer besser informiert. Neue Unterrichtsmethoden berücksichtigen heute beispielsweise immer stärker, was die Gehirne von Teenagern leisten können und was nicht. Auch das Jugendstrafrecht wurde aufgrund der Erkenntnisse der Hirnforschung angepasst. Dies sind wichtige Schritte, weil nun tatsächlich die einzigartigen Möglichkeiten Jugendlicher, aber auch ihre Verletzlichkeiten Berücksichtigung finden.
Gelegentlich werden Forschungsergebnisse auch zu schnell in die Praxis umgesetzt, was schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann, etwa wenn sie nicht angemessen in die Unterrichtsplanung implementiert werden. Und wenn ein Neuromythos erst einmal in die Gesellschaft Einzug gehalten hat, ist es oft schwierig, ihn wieder zu entkräften. Denken Sie nur an den weitverbreiteten Irrglauben, dass wir nur 10 Prozent unseres Gehirns nutzen würden (was jeglicher Wahrheit entbehrt, denn wir nutzen ständig alle Teile unseres Gehirns!).
In dieser Neuauflage meines Buches versuche ich, Schritt für Schritt unsere neuesten Erkenntnisse darzustellen. Ich beschreibe sie in einer Reihe von Kapiteln, die sich auf die verschiedenen Verhaltensaspekte Jugendlicher, auf ihr lernendes, emotionales, soziales Gehirn und dessen einzigartige Möglichkeiten beziehen. Mein besonderes Augenmerk gilt dabei den neuesten Erkenntnissen über die sozialen Medien – einer Herausforderung, der sich gerade die heutige Generation stellen muss. Sie bieten Chancen, bringen aber auch Probleme mit sich.
Das Buch ist nicht als Elternratgeber für den richtigen Umgang mit Pubertierenden gedacht, es möchte vielmehr zu einem besseren Verständnis des Gehirns Pubertierender und der in ihm ablaufenden Veränderungsprozesse beitragen. Sicherlich wird sich das Verhalten Ihres pubertierenden Kindes nicht schlagartig ändern, nachdem Sie das Buch gelesen haben; ein schwieriger Jugendlicher ist nach der Lektüre dieses Buches noch genauso schwierig! Aber vielleicht können Sie danach besser verstehen, warum sich der Teenager so unmöglich benimmt, so unsicher ist oder so schlecht planen kann. Ich werde auch zeigen, dass gerade die Adoleszenz eine Zeit einmaliger Möglichkeiten ist, in der sich Jugendliche noch optimal formen können und ihren speziellen Weg zu ihrem eigenen Platz in unserer Gesellschaft zurücklegen. Das letzte Kapitel schließe ich mit einer Reihe von Anregungen und Empfehlungen für Eltern, Schule und Politik.
Wenn Jugendliche an einer unserer Untersuchungen teilnehmen, beobachten die Eltern oft verblüfft, wie ihr Kind, das eben noch mit einem Gesicht wie sieben Tage Regenwetter schweigend im Auto saß, zu einem Sonnenscheinchen mutiert und fröhlich mit dem Versuchsleiter plaudert. Für Eltern ist das oft verwirrend. Wieso verändert sich die Laune ihres Kindes so schlagartig und warum verhält es sich zu Hause nicht so aufmerksam? Forschern ist diese Reaktion sehr geläufig. Eines unserer wichtigsten Forschungsergebnisse, auf das ich in diesem Buch immer wieder Bezug nehmen werde, ist die Erkenntnis, dass das Gleichgewicht zwischen den Aktivitäten der unterschiedlichen Hirnregionen bei pubertierenden Jugendlichen schnell nach der einen oder anderen Seite kippt. Während man früher nur darüber spekulierte, ob gewisse Hirnregionen bei Jugendlichen noch nicht völlig ausgereift seien, konnten wir nachweisen, dass auch die Kommunikation zwischen den Hirnregionen, die bei Jugendlichen in der Pubertät noch nicht optimal abläuft, von Bedeutung ist. Es kann also sein, dass auf der Fahrt zum Labor eine bestimmte Hirnregion dominant ist, bei der Ankunft aber schon eine andere. Kein Wunder, dass Jugendliche in der Pubertät so unberechenbar sind.
Bevor wir über diese Veränderungen des Gehirns sprechen, müssen wir uns zunächst von einem weitverbreiteten Irrtum über die Adoleszenz verabschieden. Es hält sich hartnäckig das Missverständnis, mit der Jugend sei heute schwerer auszukommen als früher. Doch schon seit Jahrhunderten gelten Jugendliche als leichtsinnig, impulsiv, von Freunden leicht beeinflussbar und ihren Eltern gegenüber respektlos. Denken Sie nur an das klassische Pubertätsdrama Romeo und Julia. In dieser shakespeareschen Liebesgeschichte, die auf einer spätmittelalterlichen Legende beruht, entbrennt Romeo so sehr in Liebe zu Julia, dass er sich trotz der Missbilligung der Eltern weiterhin mit ihr trifft. Und die verwegenen Taten, die darauf folgen, haben nur eines zum Ziel: sich der leidenschaftlichen Liebe hinzugeben. Die Geschichte endet in einem katastrophalen Akt: Julia täuscht ihren Tod vor, um so die Flucht mit Romeo zu ermöglichen. Doch Romeo, der sich offenbar nicht in Julia hineinversetzen kann, denkt, sie sei wirklich tot, und vergiftet sich. Impulsiv und unbesonnen, entspricht er ganz unserer heutigen Vorstellung von der Jugend. Die Geschichte von Romeo und Julia macht deutlich, dass die heutige Generation von Teenagern nicht mehr Probleme verursacht als frühere Generationen; zu allen Zeiten haben Jugendliche diesen Eindruck hinterlassen. Ihr unbesonnenes Verhalten kennzeichnet eher eine bestimmte Entwicklungsphase als eine gesellschaftliche Entwicklung.
Dennoch sieht sich jede Generation vor ihre eigenen Herausforderungen gestellt. Im Mittelalter manifestierte sich pubertäres Verhalten darin, tollkühne Gefechte anzuzetteln, während es zu Zeiten von Romeo und Julia eher in verbotenen Begegnungen zum Ausdruck gekommen sein mag. In den Sechziger- und Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts machte man sich große Sorgen um den Alkohol- und Drogenkonsum unter Teenagern, eine Sorge, die ich auch aus meiner eigenen Jugendzeit in den Neunzigerjahren kenne, als Rauchen auf dem Schulhof noch an der Tagesordnung war. Gegenwärtig berichten die Medien, dass junge Menschen weniger Alkohol trinken, weniger rauchen und später sexuell aktiv werden. Aber täuschen Sie sich nicht: Das Risikoverhalten der Jugend äußert sich heute an anderen Fronten, zum Beispiel in der Nutzung sozialer Medien, dem Austausch persönlicher Informationen oder im Sexting. Junge Menschen teilen oft Informationen miteinander, die wir Erwachsenen lieber für uns behalten. Im Kapitel über das emotionale Gehirn (Kapitel 3) werde ich zeigen, dass dies oft auf ihren großen Optimismus und das Gefühl »Das wird mir nicht passieren« zurückzuführen ist. In Kapitel 4 werde ich auf die sozialen Folgen dieses Verhaltens eingehen.
Die Adoleszenz hat oft einen schlechten Ruf, wenn auch aus unklaren Gründen. Man denkt, dies sei eine Phase, in der Jugendliche nur bockig und ungenießbar seien und Hormone das Sagen hätten. Es ist aber gerade eine Zeit, in der sich die Lernmöglichkeiten, das emotionale Engagement und die Sensibilität für die Meinung Gleichaltriger im näheren Umfeld auf einzigartige Weise verändern. Das lässt sich beispielsweise gut daran erkennen, wie sich Schüler in den USA nach einer Serie von high school shootings für ihre Generation einsetzten. Im März 2018 führte dies nach einer weiteren Schießerei in Florida zu einem großen Aufstand von Teenagern gegen die Waffengesetze in den USA. Die Jugendlichen brachten zum Ausdruck, dass sie nicht in einer Welt aufwachsen wollten, in der es das Gesetz erlaubt, Waffen so problemlos zu erwerben. Im Zuge der Kundgebung protestierten Hunderttausende amerikanischer Jugendlicher in Washington (und gleichzeitig in nicht weniger als achthundert anderen Städten der USA) in einem »Marsch für das Leben«. So versuchten sie, Politiker dazu zu bringen, strengere Waffengesetze einzuführen. Andere junge Leute, die in der Gegend von Washington wohnten, überzeugten ihre Eltern, ihr Haus als Unterkunft zur Verfügung zu stellen, da viele, die an diesem Marsch teilnahmen, noch unter 18 Jahre alt waren und noch kein Hotelzimmer buchen konnten. Diese gemeinsame Anstrengung, die Welt zu einem besseren und sichereren Ort zu machen, zeigt, dass die Jugend wahrlich nicht nur an sich selbst denkt oder keine Ziele hat. Im Gegenteil, sie haben oft einen starken Wunsch, die Welt sicherer und schöner zu machen. In diesem Buch versuche ich, all diese einzigartigen Veränderungen zu beleuchten.
Lange Zeit gehörte die Adoleszenz auch in der Forschung zu den Entwicklungsphasen Heranwachsender, die man am wenigsten verstand, doch das hat sich heute geändert: In den letzten 20 Jahren haben wir große Schritte zu einem besseren Verständnis dieser speziellen Lebensphase gemacht. Die neuen Erkenntnisse sind zum größten Teil der Hirnforschung zu verdanken. Die Anwendung moderner Untersuchungsmethoden ermöglicht es uns heute, das Gehirn in Aktion zu betrachten, was zu spektakulären Erkenntnissen geführt hat.
In diesem Buch möchte ich zeigen, dass die Adoleszenz sehr verständlich wird, wenn man sich die Veränderungen in der Entwicklung und der Organisation des Gehirns sowie den Einfluss der hormonellen Prozesse auf diese Entwicklung vor Augen führt.
Die Veränderungen wirken sich auf die Art und Weise aus, wie Jugendliche (zum Beispiel in der Schule) neu erworbenes Wissen anwenden, mit Emotionen (wie Wut oder Trauer) umgehen und sowohl im täglichen Leben wie auch online soziale Beziehungen (wie Freundschaften) knüpfen. Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Hirnregionen wandelt sich, sie ist nicht mehr breit gefächert, sondern effizient; Nervenbahnen, die früher gewundenen Trampelpfaden glichen, werden nun zu vierspurigen Schnellstraßen. Aufgrund der Gehirnentwicklung ergeben sich in der Adoleszenz Phasen, in denen Neues leichter gelernt wird, und andere, in denen das besonders schwerfällt. Denken Sie nur an das Lernen einer Fremdsprache oder an sportliche oder musikalische Höchstleistungen. Wenn man jung ist, ist es viel leichter, eine Fremdsprache zu erlernen, und Jugendliche sind physisch oft zu besonderen sportlichen Glanzleistungen in der Lage. Wichtige Wachstumsphasen des Gehirns werden von Veränderungen eines zunehmend anspruchsvolleren sozialen Umfelds beeinflusst. Jugendliche entdecken in der Adoleszenz, wofür sie sich begeistern, etwa für einen bestimmten Musikstil oder Influencer, und welche Art der Subkultur ihnen am besten entspricht. All diese Veränderungen haben einen großen Einfluss darauf, wie sie sich selbst sehen, wie sie mit anderen umgehen, welche Ziele und Interessen sie verfolgen und wie sie zu Idealen und Prinzipien stehen.
Was versteht man unter Adoleszenz?
Das Wort Adoleszenz leitet sich von dem lateinischen Verb adolescere ab, das aufwachsen bedeutet. Die Adoleszenz lässt sich am besten als Prozess des Heranwachsens zu einem erwachsenen Mitglied der Gesellschaft beschreiben. Welchen Lebensabschnitt die Adoleszenz bezeichnet, wird kulturell unterschiedlich interpretiert. Im Allgemeinen umfasst sie die Jahre zwischen zehn und zweiundzwanzig. In einer umfangreichen Studie haben Forscher die Zeitspanne der Adoleszenz in mehr als hundert verschiedenen Kulturen – angefangen von sehr »primitiven« bis hin zu sehr modernen Kulturen – verortet. In all diesen Kulturen durchlaufen junge Menschen eine Phase der Adoleszenz. Aber worin sich die Kulturen unterscheiden, ist der Beginn und die Dauer der Adoleszenz. In den westlichen Kulturen beginnt die Adoleszenz am frühsten und dauert am längsten. In diesem Zeitraum erfährt das Gehirn einen außerordentlichen Wachstumsschub. Besonders in der Organisation des Gehirns ergeben sich in dieser Phase einschneidende Veränderungen.
Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass sich das Gehirn aus unterschiedlichen Strukturen mit jeweils eigenen Funktionen zusammensetzt. In den ersten Lebensjahren sind diese Strukturen sehr flexibel. Wenn eine Hirnregion nicht funktioniert, kann eine andere die Aufgaben der geschädigten Region übernehmen. Im Lauf der Entwicklung nimmt diese Flexibilität ab, da die einzelnen Hirnregionen spezifischere Funktionen erhalten. Sie können dann bestimmte Funktionen zwar viel besser erfüllen, sind jedoch nicht mehr so leicht für andere einsetzbar. Ein bekanntes Beispiel für diese Flexibilität stellt die Fähigkeit des Gehirns dar, Ausfallerscheinungen, die durch Epilepsie oder Unfälle ausgelöst werden, zu kompensieren. Epilepsie – eine Krankheit, die manchmal als »Fallsucht« bezeichnet wird – führt zu einer ungewöhnlichen Entladung der Nervenzellen im Gehirn und damit zu vorübergehender Bewusstlosigkeit. Epilepsieanfälle treten manchmal in einer solchen Häufigkeit und Stärke auf, dass die Betroffenen vollkommen handlungsunfähig werden. In diesen seltenen Fällen wird in Erwägung gezogen, die Quelle der Anfälle operativ zu entfernen. Bei Erwachsenen kann eine solche Operation – abhängig davon, welche Region geschädigt ist – zu einem Ausfall bestimmter Funktionen führen, wie den Fähigkeiten, zu sprechen oder »kurzfristige« Informationen zu speichern. Bei kleineren Kindern übernehmen andere Gehirnregionen diese Funktionen viel leichter. In den ersten Jahren kann sogar eine Seite der Hirnrinde (der äußeren Schicht des Gehirns, die für komplexe Leistungen wichtig ist) entfernt werden, weil die andere deren Funktionen übernehmen kann. Zwar werden auch hierbei bestimmte Funktionen beeinträchtigt, doch die Einschränkungen fallen bei Kindern wesentlich geringer aus als bei Erwachsenen. Bei Kindern ist die Plastizität des Gehirns größer, da es sich noch mitten in einem Wachstumsprozess befindet und dementsprechend sehr flexibel ist.
Die lange Wachstumsphase des Gehirns bei Jugendlichen bietet zahlreiche Chancen. Solange die Kommunikationswege im Gehirn noch nicht festgelegt sind, kann noch starker Einfluss auf den Verlauf der Reifung ausgeübt werden. Es ist kein Zufall, dass junge Menschen so viel Zeit in der Schule verbringen: Ihr sich in der Entwicklung befindliches Gehirn ist dazu prädestiniert, Neues zu lernen. Natürlich soll damit nicht gesagt sein, dass sich das Gehirn im Erwachsenenalter nicht mehr verändern würde. Wir können unser ganzes Leben lang Neues lernen, aber für Gehirne, die sich im Wachstum befinden, ist das einfacher. Hierbei ist zu beachten, dass sich nicht alle Bereiche des Gehirns gleich schnell entwickeln. Das Zusammenwirken schneller und langsamer reifender Hirnregionen erklärt viele der typischen Verhaltensweisen Jugendlicher. Wenn beispielsweise die für »emotionale Kicks« zuständige Region schon aktiv wird, während sich der Emotionen zügelnde Bereich noch entwickelt, befinden sich Jugendliche kurzzeitig in einer »Risikophase«, in der sie stärker zu riskanten Aktivitäten tendieren, ohne sie wirklich kontrollieren zu können. Gleichzeitig sorgen diese »undurchdachten« Entscheidungen auch dafür, dass junge Menschen eher bereit sind, Neues auszuprobieren, sich schneller anpassen können oder leichter neue Freundschaften schließen. Diese Entwicklung des Gehirns ist nicht notwendigerweise schlecht oder gefährlich, sie bietet auch viele Möglichkeiten, die eigenen Passionen kennenzulernen und die Welt zu entdecken.
Gleichwohl beschwört das Verhalten von Teenagern immer wieder ungewollt gefährliche Situationen herauf. Vor ein paar Jahren war es bei Jugendlichen beliebt, in den unerwartetsten und peinlichsten Momenten »Der Boden ist Lava!« zu rufen. Die Idee dieses Spiels besteht darin, dass man, sobald »Der Boden ist Lava!« zu hören ist, die Füße so schnell wie möglich vom Boden hebt. Läuft man zum Beispiel durch den Supermarkt, stellt man sich auf eine Kiste oder springt, so schnell man kann, in den Einkaufswagen. Doch in einem Vergnügungspark wäre das beinahe schiefgegangen, als ein Junge als Reaktion auf den Ruf in einer Wildwasserbahn aus einem Boot sprang. Dies ist ein Beispiel für tollkühnes pubertäres Verhalten, bei dem der Spaß mit Freunden Vorrang vor dem Nachdenken über die Konsequenzen des Handelns hat (siehe Kapitel 3, »Das emotionale Gehirn«).
Der berühmte Psychologe Stanley Hall charakterisierte die Adoleszenz schon um 1900 (in Anlehnung an die deutsche Sturm und Drang-Bewegung) als eine von Storm and Stress geprägte Zeit. Drei Merkmale sind in dieser Phase seiner Meinung nach immer vorhanden: Konflikte mit den Eltern, Stimmungsschwankungen und riskantes Handeln. Diese Vorstellung von Storm and Stress hatte einen starken Einfluss auf das Bild, das sich von der Adoleszenz entwickelte. Denn seit dieser Zeit wurde die Adoleszenz endlich als eine einzigartige Lebensphase mit ihren eigenen Problemen und Möglichkeiten anerkannt. Stanley Hall war zudem ein großer Verfechter einer Anpassung der schulischen Situation an die Entwicklung Jugendlicher, was zu seiner Zeit durchaus nicht selbstverständlich war.
Die Storm and Stress-Theorie wurde später jedoch einigen Korrekturen unterzogen, denn die Praxis zeigte, dass Jugendliche in der Adoleszenz nicht nur Kummer und Sorgen haben. Sie sind nicht immer rebellisch und sie haben nicht ständig Konflikte mit ihren Eltern. Einige Jugendliche geraten sogar kaum mit ihren Eltern aneinander. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass die Mehrzahl der Jugendlichen in der Adoleszenz Storm and Stress erleben, ist sehr hoch. Und wenn es in einem Leben überhaupt zu einer Storm and Stress-Phase kommt, dann häufiger in diesem als in jedem anderen Lebensabschnitt.
Hormone außer Rand und Band
Pubertät und Adoleszenz werden oft miteinander verwechselt. Sie sind jedoch deutlich voneinander zu unterscheiden: Die Pubertät ist die erste Phase der Adoleszenz, die Zeit der körperlichen Reifung und der großen hormonellen Veränderungen. Sie umfasst etwa den Zeitraum zwischen dem 10. und dem 15. Lebensjahr und setzt bei Mädchen im Durchschnitt etwa ein bis eineinhalb Jahre früher ein als bei Jungen. Es gibt zwar einige Hinweise darauf, dass sich die Pubertät im Laufe der Geschichte etwas vorverlagert hat, aber bei Weitem nicht so extrem, wie man oft annimmt. Diese Verschiebung wurde unter anderem anhand des Alters festgestellt, in dem die erste Menstruation eintritt. Insbesondere zwischen 1800 (einer Zeit, in der die erste Menstruation mit etwa 17 Jahren eintrat) und 1940 (erste Menstruation mit etwa 13 Jahren) war ein deutlich früheres Eintreten der Menstruation zu verzeichnen. Messungen, die im 20. Jahrhundert durchgeführt wurden, haben jedoch nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt; das Durchschnittsalter variiert im Laufe der Jahre. Das im Vergleich zum 19. Jahrhundert deutlich frühere Eintreten der Menstruation im 20. Jahrhundert hängt wahrscheinlich mit einer besseren Ernährung und Gesundheit zusammen, danach hat sich das durchschnittliche Alter, in dem die Menstruation einsetzt, stabilisiert. Bei Jungen ist der Beginn der Pubertät historisch einfach deshalb viel weniger gut dokumentiert, weil er früher, als man noch keine Hormonwerte bestimmen konnte, viel schwieriger messbar war.
Die Pubertät wird oft als eine schwierige Zeit beschrieben. Das Verb »pubertieren« wird sogar häufig als Synonym für aufmüpfiges Verhalten gebraucht. Dessen ungeachtet ist die Pubertät eine völlig normale Entwicklungsphase, ebenso wie die Kleinkind- und die Kinderzeit. Außerdem lässt sich das Verhalten Jugendlicher in dieser Phase sehr gut anhand der hormonellen Veränderungen und der neuen Verknüpfungen des Gehirns erklären.
Viele Eltern bemerken die Veränderungen ihrer Kinder. Sams Mutter fiel vor Kurzem auf, dass ihr Sohn – ein fröhlicher Dreizehnjähriger mit einem großen Freundeskreis – in letzter Zeit oft unsicher wirkt, obwohl er früher nie Schwierigkeiten hatte, neue Freunde zu gewinnen. Er leidet immer stärker unter Pickeln, und hin und wieder überschlägt sich plötzlich seine Stimme. Die Mädchen in seiner Klasse kichern darüber, was ihn noch mehr verunsichert. Er findet das ärgerlich, denn früher war es ihm egal, was die Mädchen von ihm hielten. Er versteht nicht, warum ihn ihr Benehmen plötzlich so befangen macht. Am liebsten wäre es ihm, alles wäre wieder wie früher, deshalb würdigt er die Mädchen keines Blickes, zieht mit seinen Fußballfreunden los und hofft, so seine Unsicherheit in den Griff zu kriegen.
Die mit Abstand bekanntesten biologischen Veränderungen in der Adoleszenz werden von Hormonen beeinflusst. Diese Veränderungen sind wahrscheinlich deshalb so bekannt, weil sie sich so sichtbar auf das Äußere auswirken: Unter dem Einfluss der Hormone verwandelt sich der kindliche Körper in den eines Erwachsenen.
Bei Mädchen setzt die Pubertät mit etwa zehn Jahren ein und ist von einer Reihe wichtiger körperlicher Veränderungen geprägt: die Mädchen durchlaufen einen Wachstumsschub, die Brüste entwickeln sich, die Hüften werden breiter, Schamhaare und Achselhaare beginnen zu sprießen, und etwa sechs Monate nach dem Beginn dieser äußerlichen Veränderungen setzt zum ersten Mal die Menstruation ein. Bei Jungen ist der Beginn der Pubertät gewöhnlich etwa ein Jahr später erkennbar. Er geht ebenfalls mit einem Wachstumsschub und dem Sprießen von Scham- und Achselhaaren einher, die Geschlechtsorgane wachsen, die Stimme wird tiefer, außerdem entwickelt sich der Bartwuchs.
Das Einsetzen dieser körperlichen Veränderungen geht auf die Ausschüttung von Geschlechtshormonen in den endokrinen Drüsen zurück. Diese Drüsen sind durch Blutbahnen permanent mit einer wichtigen Hirnregion, dem Hypothalamus, verbunden und kommunizieren auf diesem Weg mit ihm ständig über die Höhe der Hormonausschüttung. Der Hypothalamus reguliert den Hormonhaushalt; er misst gewissermaßen das Hormonniveau und signalisiert den endokrinen Drüsen die Höhe der erforderlichen Hormonausschüttung. Die vermehrte Ausschüttung des Gonadotropin-Releasing-Hormons (GnRH) signalisiert das Einsetzen der Pubertät. GnRH wird zwar auch vorher schon produziert, jedoch in so geringem Maß, dass es die Entwicklung der Geschlechtsmerkmale nicht beeinflusst. Erst wenn sich Frequenz und Quantität der GnRH-Ausschüttung steigern, setzt die Pubertät ein.
Schwergewichtigere Kinder kommen durchschnittlich früher in die Pubertät als leichtgewichtigere, und in einigen Kulturen setzt die Pubertät früher ein als in anderen. Wie bereits erwähnt, ist das Durchschnittsalter, in dem die körperliche Erwachsenenreife erreicht wurde, in der westlichen Welt zwischen 1800 und 1940 gesunken, was wahrscheinlich mit der Qualität unserer Ernährung und unseres Gesundheitszustands zusammenhing.
Der Hypothalamus bildet das Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH). Das GnRH stimuliert die Hypophyse, die die Hormonproduktion steuert. Das Hormon Testosteron steigt bei Jungen in der Pubertät zum Beispiel um das Zwanzigfache an (und in geringerem Ausmaß auch bei Mädchen). Hormone bewirken bei Teenagern u.a. eine Veränderung ihres Äußeren.
Die Steigerung der GnRH-Ausschüttung wird also von Signalen des Gehirns initiiert, wobei der Hypothalamus über die Blutbahnen ein Signal an die endokrinen Drüsen sendet, die die Ausschüttung auslösen. Die Hormone arbeiten – mit anderen Worten – nicht eigenständig, sondern in Abhängigkeit von den verstärkenden oder hemmenden Signalen des Gehirns. Außer ihrer Signalfunktion, mit der sie die Entwicklung unseres Körpers steuern, üben die Hormone mittels Kommunikation mit dem Gehirn Einfluss auf unser Fühlen und Denken aus. Sam spürt beispielsweise nicht nur, dass sich sein Körper verändert, er fühlt sich auch anders. Hormone wirken sich hier auf doppelte Weise aus.
Einerseits kann eine Erhöhung des Hormonspiegels dazu führen, dass Zellen in bestimmten Hirnregionen zeitweilig besonders aktiv werden. Dieser hormonelle Einfluss ist jedoch nicht der Pubertät vorbehalten, er besteht auch im Erwachsenenalter. Er kann bewirken, dass wir uns müde und niedergeschlagen fühlen oder besonders gut gelaunt sind.
Andererseits haben Hormone zentrale organisatorische Auswirkungen auf die Hirnentwicklung, und diese ist für die Pubertät durchaus charakteristisch. Denn die Pubertät steuert auch das Tempo der Hirnentwicklung. Was bedeutet, dass junge Menschen, die in der Pubertät weiter fortgeschritten sind als ihre Altersgenossen, auch über mehr Verbindungen im Gehirn verfügen. Das Vorhandensein oder Fehlen eines bestimmten Hormons kann sich dabei nachhaltig auf die Gehirnaktivität auswirken. Bei bestimmten Entwicklungsstörungen setzt die Pubertät bei den betroffenen Kindern nicht ein, weil sich die GnRH-Ausschüttung zu spät erhöht. Diese Erkrankung kann mithilfe einer Hormonbehandlung geheilt werden, bei der zusätzliche Hormone verabreicht werden, um den Mangel auszugleichen. Wird das Hormon, das der Körper normalerweise selbst produziert, in der Phase zugeführt, in der die Pubertät üblicherweise einsetzt, werden die intellektuellen Fähigkeiten des Jugendlichen kaum beeinträchtigt. Wird es jedoch nicht oder zu einem viel späteren Zeitpunkt verabreicht, wirkt sich dies zum Beispiel auf die Fähigkeit der räumlichen Wahrnehmung aus. Die Funktion der räumlichen Informationsverarbeitung wird von einer Hirnregion gesteuert, die im äußeren Bereich des Gehirns liegt, der in der Pubertät noch stark wächst.
Kurz gesagt: Wenn bei Jugendlichen in der Adoleszenz keine hormonelle Umstellung stattfindet (und die Pubertät daher nicht einsetzt), werden sie in bestimmten Bereichen weniger leistungsfähig sein. Zwischen Gehirnfunktionen und Hormonhaushalt besteht also eine wichtige Wechselwirkung: Sie sind aufeinander angewiesen. Wenn das Gehirn den endokrinen Drüsen nicht signalisiert, dass das GnR-Hormon mit seiner Arbeit beginnen soll, beeinträchtigt der damit einhergehende Hormonmangel seinerseits die Entwicklung des Gehirns.
Welchen Einfluss haben diese Hormone denn nun genau auf das Verhalten von Teenagern? Es ist bekannt, dass sich der Körper unter dem Einfluss von GnRH verändert. Diese Veränderungen wirken sich natürlich stark darauf aus, wie Jugendliche sich und andere wahrnehmen. Sam ist sich seines Äußeren nun viel bewusster geworden und achtet stärker darauf, wie sich andere Jungen und Mädchen seines Alters verhalten. Da die Pubertät nicht bei allen im gleichen Alter beginnt, unterscheiden sich Jugendliche in ihrem Äußeren zu Anfang der Pubertät stark voneinander. Während manches Mädchen schon kräftig wächst und sich seine Brüste entwickeln, kann ein anderes von körperlichen Veränderungen noch nichts wahrnehmen. Da bei Mädchen das Einsetzen der Pubertät gewöhnlich eher erkennbar ist als bei Jungen, ist ein Entwicklungsunterschied zwischen den Geschlechtern im Alter zwischen zehn und zwölf sehr bezeichnend.
Der Zeitpunkt, zu dem die Pubertät bei Jungen und Mädchen einsetzt, wirkt sich nachhaltig auf ihre soziale Identität aus. Mädchen leiden darunter, wenn sie früh in die Pubertät kommen; sie werden schneller depressiv und haben häufiger Essstörungen als Mädchen mit einer später einsetzenden Pubertät. Bei »frühreifen« Jungen steigt dagegen das Selbstwertgefühl; sie sind angesehener als Jungen, bei denen die Pubertät später beginnt.
Worin genau der Grund für diese unterschiedlichen Reaktionen liegt, ist bislang unbekannt. Die vermehrt auftretende Depressivität bei Mädchen könnte unmittelbar auf die Hormone zurückzuführen sein, doch höchstwahrscheinlich ist sie eher eine Reaktion auf die hormonell bedingten Veränderungen. Durch die Hormone wandelt sich der Körper der Mädchen, er wird voller und entfernt sich damit immer weiter von dem Schönheitsideal, das oft in den Medien propagiert wird. Eine Sechzehnjährige schreibt auf der Internetseite www.beperkthoudbaar.info (einer interessanten Seite, die das Augenmerk auf die natürliche Schönheit des Körpers lenkt): »Ich bin 1,75 m groß und wiege 70 Kilo, ich bin also absolut nicht zu dick, aber das Fett sitzt an den verkehrten Stellen. Wenn man sich umschaut, sieht man überall schlanke Mädchen in engen Jeans, die ich nicht tragen kann, weil ich sie nicht über meinen Hintern und meine Beine bekomme. In meine Klasse gehen drei andere Mädchen, die schlank sind und hübsche Kleider tragen, die mir nicht passen. Ich würde das Fett an meinen Beinen gern spenden, denn ich habe nichts davon, es macht mich nur unglücklich.«
Das zusätzlich eingelagerte Körperfett kann das Selbstbild früh pubertierender Mädchen stark beeinträchtigen. Sie fühlen sich oft unsicher, weil sie zeitweise mehr wiegen als ihre Altersgenossen. Diäten helfen oft nicht und vermitteln damit zusätzlich das unselige Gefühl, versagt zu haben. Die depressiven Gefühle können bis ins Erwachsenenalter fortbestehen. Bei Jungen wird ein entwickelter Körper hingegen besonders geschätzt, sodass früh Pubertierende an Prestige gewinnen.
Die unmittelbaren Auswirkungen der Pubertät verändern auch die sexuellen Interessen, Fantasien und Aktivitäten, die mit dem Alter der Jugendlichen zunehmen. Studien von Rutgers und SOA AIDS Nederland unter mehr als 20000 Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren zeigen, dass die meisten Jugendlichen im Alter von 12 bis 14 Jahren schon einmal verliebt waren. Allerdings sind nur wenige Jugendliche unter 14 Jahren schon sexuell aktiv (3 Prozent der Jungen und 2 Prozent der Mädchen). Die Hälfte der Jugendlichen hat mit 15 Jahren schon einmal jemandem einen Zungenkuss gegeben. Die Hälfte der Jugendlichen gibt an, mit 16 Jahren zum ersten Mal jemanden unter der Kleidung gestreichelt und mit etwa 17 Jahren nackt mit jemandem geschmust zu haben. Das Alter, in dem die meisten Jugendlichen zum ersten Mal Sex haben, ist achtzehn (Mädchen etwas früher als Jungen).
Interessanterweise kommt es zu allen diesen Formen sexueller Aktivität später als noch im Jahr 2012. Damals hatten Jugendliche mit etwa 17 Jahren zum ersten Mal Geschlechtsverkehr; in fünf Jahren hat sich das also im Durchschnitt um ein Jahr nach oben verschoben. Es gibt auch neue Entwicklungen, die in diese Zeit fallen. Onlinemedien werden häufiger zum Austausch von Nacktbildern (Sexting) genutzt. Jeder achte Jugendliche hat schon einmal ein Nacktfoto von sich an eine andere Person geschickt (2012 waren es nur 5 Prozent). Von der gesamten Teilnehmergruppe gaben 6