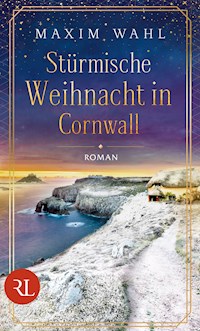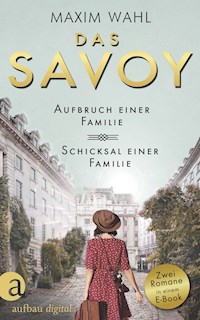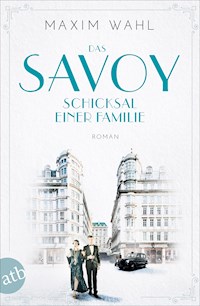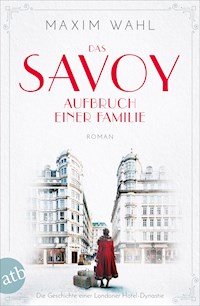
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die SAVOY-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Glanzvolle Zeiten einer Londoner Familiendynastie. England, 1932: Violet ist jung, emanzipiert und am Ziel ihrer Träume: Als eine der ersten weiblichen Autorinnen schreibt sie für die BBC. Als jüngster Spross einer Hotel-Dynastie ist Violet im traditionsreichen Savoy aufgewachsen. Umso mehr fasziniert sie die Dynamik, für die das moderne Medium Radio steht. Plötzlich erleidet Violets Großvater, Patriarch der Familie und Symbolfigur des Savoy, einen Schlaganfall. Er betraut ausgerechnet Violet damit, die Leitung des großen Hotels zu übernehmen. Violet gerät in die dramatische Verstrickung von Ereignissen, deren Ausgang sie nicht abzusehen vermag … Der Auftakt der großen 30er-Jahre-Trilogie über das berühmteste Hotel der Welt. Der zweite Teil der großen SAVOY-Saga erscheint am 10.03.2020.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Ähnliche
Über Maxim Wahl
Hinter Maxim Wahl verbirgt sich ein deutscher Bestsellerautor, der mit seinen zahlreichen Romanen auch international Aufmerksamkeit erregte. Für seine Stoffe sucht sich Maxim Wahl am liebsten große Schauplätze der europäischen Geschichte. Er lebt in Berlin und London, und am allerliebsten im Hotel Savoy.
Informationen zum Buch
Glanzvolle Zeiten einer Londoner Familiendynastie.
England, 1932: Violet ist jung, emanzipiert und am Ziel ihrer Träume: Als eine der ersten weiblichen Autorinnen schreibt sie für die BBC. Als jüngster Spross einer Hotel-Dynastie ist Violet im traditionsreichen Savoy aufgewachsen. Umso mehr fasziniert sie die Dynamik, für die das moderne Medium Radio steht. Plötzlich erleidet Violets Großvater, Patriarch der Familie und Symbolfigur des Savoy, einen Schlaganfall. Er betraut ausgerechnet Violet damit, die Leitung des großen Hotels zu übernehmen. Violet gerät in die dramatische Verstrickung von Ereignissen, deren Ausgang sie nicht abzusehen vermag …
Der Auftakt der großen 30er-Jahre-Trilogie über das berühmteste Hotel der Welt.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Maxim Wahl
Das Savoy
Aufbruch einer Familie
Roman
Inhaltsübersicht
Über Maxim Wahl
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil: London 1932
1 Revolution
2 Der Himmel
3 Oppenheim
4 Späte Zeit
5 Der Klang von Champagner
6 Tauben
7 Butter und Zwiebelduft
8 Die Befürchtung
9 Kamarowski
10 Der Stich
11 Nachfolger
12 Connaghy, Snowdon & Katz
Zweiter Teil
13 Le grand bal
14 Das Rezept
15 Das Pentagramm
16 Die Initialen
17 Schwarzgrau
18 Die letzte Ölung
19 Siebenundvierzig elf
20 Ein gelähmtes Herz
21 Das Ende des Liedes
Dritter Teil
22 Paulo
23 Trudy
24 Wie Wasser in den Händen
25 Heimkehr
26 Das Bildnis
27 Eccentric Club
28 Eine Frage der Liebe
29 Dover – Ostende
30 Zur Lage der Dinge
31 Die Lady vom Savoy
Nachbemerkung
Impressum
Für Steffen K.
Number One In Town
Erster TeilLondon 1932
1Revolution
Die Tür schwang auf. Poliertes Messing und geätztes Glas, dunkle Täfelung aus Mahagoni. Sir Laurence brauchte nicht stehenzubleiben, um die Flecken an den Messinggriffen zu registrieren, das musste heute noch behoben werden. Marmorverkleidete Säulen, halb schwarz, halb Elfenbein, die Goldblatt-Tapete war vor zwei Jahren erst erneuert worden. Über der getäfelten Treppe zog sich ein Fries mit jugendlichen Gottheiten.
Sir Laurence Wilder war der König dieses Palastes und wie so mancher König beschlich er sein Reich mitunter heimlich, ohne erkannt zu werden. Er registrierte, dass es dem Clerk, der die Schwingtür bediente, an Haltung fehlte und dem Butler neben dem Empfang an Aufmerksamkeit. Larrys Chefbutler hätte den Eintretenden längst bemerkt und mit unsichtbarem Wink einen Pagen zu ihm dirigieren müssen, der sich erkundigen würde, ob Zeitungen oder Zigaretten gewünscht seien, vielleicht Theaterkarten. Es gab noch überteuerte Tickets für das Sadler’s Wells, wo Gielgud Was ihr wollt spielte. Doch Mr Sykes, sein dienstältester Butler, hatte den Herren im Leinenanzug mit der Sonnenbrille nicht bemerkt und unterhielt sich stattdessen mit Lady Edith, der Herzogin von Londonderry. Eine Frau mit kohlrabenschwarzem Haar, hängenden Schultern und traurigen veilchenblauen Augen. Larry hätte Lady Edith gern seine Aufwartung gemacht, zog es aber vor, unerkannt zu bleiben. Sein tief in die Stirn gezogener Strohhut und die schwarz getönte Brille machten ihn sozusagen unsichtbar. Jeder kannte Sir Laurence im dunklen Cutaway mit grauer Weste und elfenbeinfarbener Krawatte. Man bewunderte sein stahlgraues Haar, den täglich gestutzten Schnäuzer und die bernsteinfarbenen Augen, scheinbar stets ein wenig feucht, als ob er den Tränen nahe sei. Das kam von der lästigen Augenentzündung, er trug Tropfen zur Linderung in seiner Tasche. Obwohl diese Augen ihm den Anschein von Güte gaben, entging ihnen kein Detail, er war dafür berüchtigt, dass er aus fünfzig Yards Entfernung feststellen konnte, ob ein Bild schief hing.
Larry schlenderte weiter Richtung Treppe. Der Lüster über ihm war ein goldener Ring aus Licht und konkurrierte mit der glitzernden Sonne, die er bei seinem Spaziergang entlang des Strand genossen hatte. Wie albern die englischen Gentlemen mit ihren untergehängten Regenschirmen bei dem herrlichen Wetter ausgesehen hatten. Der Klang der Halle umfing Sir Laurence, kein eindeutiger Akkord, eher ein Anstimmen und Verklingen, das Gläserklirren eines früh bestellten Brandys, das Knautschen der Ledersessel, glänzend von Sattelfett, jenes Geheimmittel, das Larry während seiner Lehrzeit als Page selbst entdeckt hatte. Im Tearoom schwoll das Jazztrio an und ab, je nachdem, ob eilende Kellner die Schwingtür bedienten. Die Geigen aus dem Wintergarten hingen träge in der Luft, er nahm sich vor, das Salonorchester zu ermuntern, endlich das Programm zu wechseln. Niemand ertrug Wiener Kitsch im Frühling. Ein zartes Singen von den Seidenkleidern der Frauen, das Rascheln der Trenchcoats und Schals. Larry erreichte die Treppe.
Spätestens jetzt hätte ihn ein Page oder Hausdiener anhalten und sich höflich erkundigen müssen, was zu Diensten stehe. Niemand durfte einfach so ins Savoy hineinspazieren, der hier nichts zu suchen hatte. Das Savoy war ein Kosmos für sich, der jeden Tag seinen eigenen Sonnenauf- und Untergang erlebte. Hier arbeiteten, bedienten, genossen und vergnügten sich Menschen, die nicht nur aus der ganzen Welt kamen, sondern auch für die ganze Welt standen. Das irische Blumenmädchen, das ein Verhältnis mit dem dalmatinischen Baron hatte, der indische Zigarettenverkäufer und sein Scotch Terrier, die Witwe des amerikanischen Rinderzüchters, die österreichische Gouvernante, der sizilianische Tenor, der jüdische Unterhändler, der einarmige Captain der Royal Airforce, die englische Autorin französischer Liebesromane, der deutsche Diplomat und in Gottes Namen auch die Stenotypistin, die gegen ein Extrahonorar nachts in das Zimmer des Generaldirektors schlüpfte.
Sir Laurence kannte viele von ihnen persönlich, die meisten waren nicht zum ersten Mal hier. Das Savoy war ein Hotel, in das man wiederkam. Für den, der es sich leisten konnte, war es Zuhause. Lloyd George hatte seine Regierung hierher zum Lunch geladen, King George liebte das Chocolate Chunk Shortbread, das im Tearoom gereicht wurde, und Theatergrößen galten erst als solche, wenn sich die Journalisten im gediegenen Clarence Room um sie scharten.
Während Sir Larry auf den Fahrstuhl wartete, drehte er sich noch einmal nach Lady Edith um. Sie war gewiss die schönste Frau, die dem Savoy derzeit die Ehre gab. Ihre Augen standen ein klein wenig zu weit auseinander, ihre Nase war um eine Winzigkeit zu kurz, ihr Mund hatte etwas knabenhaft Trotziges, aber gerade die Summe dieser Unvollkommenheiten verlieh der Duchess etwas Unwiderstehliches. Wenn Lady Edith im Haus war, durfte man damit rechnen, dass noch am selben Tag der Wagen des Premierministers vorfuhr. Meistens betrat Ramsey MacDonald das Savoy durch den Seiteneingang und ließ sich direkt zur Suite der Herzogin bringen. Mit dem Erkerblick auf die Themse galt die Zimmerflucht als die romantischste im ganzen Haus.
Der Fahrstuhl schwebte in die Lobby, der Liftboy öffnete, ohne Sir Laurence ins Gesicht zu blicken. So wurde es den Eleven antrainiert, der Gast sollte sich vom Personal unbeobachtet fühlen. Dieser Liftboy machte eine Ausnahme.
»Guten Morgen, Sir Laurence.« Sein Finger im weißen Handschuh schwebte über dem Armaturenbrett. »Fünfter, wie immer?«
Da er ohnehin erkannt worden war, nahm Larry die Sonnenbrille ab. Wie hieß der Junge noch mal, Emil oder Erich? Ein Deutscher, so viel wusste er, frech, hübsch, schlank. »Wie lange bist du schon bei uns?«
»Im Juli wird es ein Jahr, Sir.«
»Ein Jahr schon, ähm …?«
»Otto, Sir.«
»Ich weiß.«
Korrekt drehte der Junge ihm den Rücken zu. 1931 war Otto ins Savoy gekommen, ein übles Jahr, alles in allem. Die Weltwirtschaftskrise hatte auch vor dem Hotel nicht Halt gemacht. Die Übernachtungen waren zurückgegangen, für die Zimmer ohne Themseblick hatte Laurence die Preise senken müssen. Obwohl die Staatsausgaben drastisch reduziert worden waren, kriegte die Regierung den Schlamassel nicht in den Griff. Man hatte die Renten und das Arbeitslosengeld gekürzt, gewalttätige Streiks waren die Folge gewesen. Nicht nur die Gewerkschaften, sogar die Royal Navy streikte. Der Premierminister, selbst ein Labour-Mann, hatte den Regierungsauftrag zurückgelegt und einen neuen zur Bildung einer nationalen Regierung unter Einbeziehung der Konservativen erhalten, woraufhin ihn seine eigene Partei hinausgeworfen hatte. Im Juli einunddreißig hatte die Bank of England den Goldstandard aufgeben müssen. Seitdem befand sich das Pfund im freien Fall und war abhängig von Angebot und Nachfrage der Devisenbörsen.
Larry musterte den Flakon mit Eau de Cologne in der Kabinenecke. Während der warmen Jahreszeit stand das erfrischende Parfum auf einer winzigen Konsole bereit, daneben Tücher mit dem Monogramm des Hauses. Gewohnheitsmäßig nahm er ein Tüchlein, bediente den Spender und tupfte sich Kölnischwasser in den Nacken.
»Der Flakon muss ausgetauscht werden«, sagte er zu Otto. »Er ist fast leer.«
»Ich werde Mrs Drake Bescheid sagen.« Der Page öffnete die Glastür und das Scherengitter. »Fünfter, Sir.«
»Wann warst du das letzte Mal zu Hause, Otto?«, fragte Larry beim Aussteigen.
»Das ist ewig her, Sir.«
»Woher stammst du?«
»Aus München.«
»Dort ist jetzt einiges los, mit eurem neuen Mann in München, nicht wahr?«
»Was soll denn los sein, Sir?«
Larry nickte dem Jungen zu, wanderte den Korridor hinunter und schloss die Tür zu seinen Privaträumen auf. Wohnen im Hotel, dachte er jedes Mal, wenn er hier eintrat. Wohnen im Hotel.
»Frühstück, Sir Laurence?« Dorothy Pyke marschierte an ihm vorbei. Wieso konnte diese Frau nicht gehen, wie Frauen gingen? Es klang, als ob die Royal Army die Wohnung besetzt hätte.
»Frühstück?« Er zog die Jacke aus. »Es ist halb eins.«
»Lunch also.« Dorothys Kostüm war tailliert und blau gestreift. Als Zugeständnis an den Frühling trug sie heute eine fliederfarbene Bluse.
»Nichts, danke, nur Tee.« In Hemdsärmeln setzte sich Sir Laurence an den Schreibtisch und öffnete die Unterschriftenmappe. »Sagen Sie Mrs Drake, die Messinggriffe an den Eingangstüren müssen poliert werden. Sie soll das Zinkmittel verwenden lassen, sonst sind die Flecken morgen wieder da.«
»Sie müssen mehr essen«, rief Dorothy von nebenan. »Sie sollten wirklich tun, was der Doktor sagt.«
»Der Doktor sagt auch, dass ich was am Herzen hätte. Beides ist Unsinn.« Lächelnd sang Larry vor sich hin: »Kein Herz schlägt treuer als das deine.«
Sein Arbeitszimmer ging nach Westen, der Salon auf den Innenhof. Laurence hatte kein Interesse an dem berühmten London-View des Savoy. Wer den genießen wollte, musste teuer dafür bezahlen.
»Sie dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen.«
Larry blickte auf, da stand sie, Dorothy Pyke, die jüngste Assistentin, die das Savoy je gesehen hatte und die hübscheste. Hochgewachsen, das lange Haar streng nach hinten gescheitelt, verlor es sich am Hinterkopf in lustigen Locken. Bis auf die Lippen schminkte sie sich nicht. Mit der dampfenden Teetasse marschierte sie auf ihn zu.
»Schon fertig, der Tee?« Larry legte den Kopf schief. »Können Sie zaubern?«
»Mr Sykes hat Sie vorhin hereinkommen sehen und hier oben angerufen.«
»Sieh mal an, mein Chefbutler hat also doch Augen im Rücken.«
Dorothy machte kehrt, um die Post zu holen. Sir Laurence trank den ersten Schluck.
***
Bevor Violet Mason das BBC Building verließ, küsste sie Max Hammersmith leidenschaftlicher, als ihr lieb war. Er würde jetzt bald mit ihr schlafen wollen, genaugenommen hatte er schon seit der ersten Zärtlichkeit vor zwei Wochen mit ihr schlafen wollen. Für Violet gab es nichts Inspirierenderes, als für Max Hammersmith zu arbeiten. Niemand verstand sie besser als er. Max war bereit, ihre handwerkliche Unfertigkeit zu dulden, weil er Violets revolutionäre Art liebte, Storys zu erfinden. Die ganze BBC war eine Revolution, das Medium Radio war eine Revolution, und Max brauchte junge Köpfe, verrückte Kreative wie Violet, um die Revolution mit Futter zu versorgen. Wie jung das Medium war, erkannte man nicht zuletzt daran, dass der neue Stammsitz der BBC immer noch nicht fertig war. Man hatte das Gebäude auf dem Portland Place bereits eröffnet, obwohl überall noch gebaut wurde. Dieser Umstand gab Max Gelegenheit, Violet zu küssen.
Nach der Aufnahme in Studio B4 hatte sie sich von den Sprechern verabschiedet, Max begleitete sie zum Fahrstuhl. Bevor sie den Lift erreichten, schob er die Baustellenabsperrung beiseite und zog Violet in den Orchester-Saal, wo nackte Pfeiler und kalter Beton die Prognose zuließen, dass hier noch lange kein Orchester spielen würde. Max nahm die Brille ab, zog Violet in seinen Arm und küsste sie auf den Mund. Max war riesig und obwohl er sich tief hinunterbeugte, musste sie sich auf die Zehenspitzen stellen. Violet brannte lichterloh, weil sie für Max schreiben durfte. Kraftvolle, scharfzüngige Texte verlangte er, Tagespolitik, Dokumentationen, Hörspiele – den Sendungen, die Millionen Menschen täglich vor die Geräte lockten, waren keine Grenzen gesetzt. Aber Violet wollte ihren beruflichen Aufstieg nicht auf diese Weise erreichen. Sie wollte es Max nicht als Geliebte zurückzahlen müssen. Wenn sie einander während der Redaktionssitzungen Stichworte zuwarfen, fühlte sie sich ihm am nächsten. Niemand dachte, niemand sprach schneller als er, niemand durchschaute Zusammenhänge so schonungslos wie Max Hammersmith.
»Ich komme zu spät«, flüsterte sie ihm ins Ohr.
Ohne sie loszulassen, sah er auf die Uhr. »Nein, ich komme zu spät.« Seine Hände glitten über ihre Taille. »Sehen wir uns heute Abend?«
»Ich kann nicht.«
»Was machst du denn an jedem verdammten Abend jedes verdammten Tages?«, knurrte er zärtlich.
»Nur eine Woche noch.«
»Du verzettelst dich, Vi.« Er strich über ihr Haar. »Wie sagte meine Tante Rachel, eine kluge Frau: Man kann nicht mit einem Hintern auf zwei Pferden reiten.«
»Aber sie brauchen mich dort.«
»Wozu? Es ist Shakespeare. Wollen sie, dass du Shakespeare umschreibst?« Als sie nicht antwortete, hob Max ihr Gesicht zu sich. »Ich fange an zu glauben, dass du etwas mit einem dieser nichtsnutzigen Schauspieler hast.«
Sie lächelte. Was für eine absurde Vorstellung. Sie hatte nichts mit einem Schauspieler, das war nicht ihr Problem. »Ich muss jetzt wirklich.« Behutsam zog sie sich zurück.
»Ich auch.« Er ließ sie los.
Sie spürte, er sagte es, um nicht wie ein verliebter Idiot dazustehen. »Dann bis morgen.«
»Ja, bis morgen.«
Max brachte sie zum Aufzug, wartete aber nicht, bis sich die Tür öffnete, sondern schlenderte den Korridor hinunter. Er ist enttäuscht, dachte sie, ich bin nicht ehrlich zu ihm. Spätestens nächste Woche muss ich ihm reinen Wein einschenken.
Violet verließ das Broadcasting House durch den Haupteingang. Die Underground am Regent’s Park war ihr zu weit zum Laufen, also winkte sie ein Taxi heran. Eine Bequemlichkeit wie diese entsprach nicht ihrer Gehaltsklasse, ersparte ihr aber eine Standpauke von Gielgud. John Gielgud, der leuchtendste Stern auf Londons Bühnen, verabscheute Unpünktlichkeit. Er verabscheute auch das neu gebaute Sadler’s Wells Theatre, weil er fand, der Zuschauerraum sehe aus wie eine abgefressene Hochzeitstorte, und die Akustik sei erbärmlich. Trotzdem spielte Gielgud dort Shakespeare.
»Zum Theater am Arlington Way«, rief Violet dem Fahrer zu.
»Am Arlington Way gibt es kein Theater«, antwortete der Mann, ohne sich in Bewegung zu setzen.
»Glauben Sie mir, da steht ein brandneues.«
Alles neu, dachte sie, während der schwarze FX3 stockend anfuhr. Überall ist alles neu, und ich bin die Frau der ersten Stunde. Ich bin genau wie London, konservativ und fortschrittlich zugleich. Konservativ erzogen, mit konventionellen Werten vollgepumpt, die ich gerade über Bord werfe. Das ist gefährlich – vor allem aber ist es herrlich.
»Umfahren Sie Kingscross«, rief sie dem Fahrer zu. »Dort kommt man um diese Zeit schlecht durch. Nehmen Sie die Argyle Street, danach zweimal nach rechts, dann sehen Sie es schon.«
Murrend bog der Mann an der nächsten Kreuzung ab. Trotz der Abkürzung kam Violet zu spät. Sie würde Gielguds Zorn nicht entgehen.
Er trug das traditionelle Kostüm des Malvolio. Wenn John Gielgud Shakespeare spielte, war das nicht traditionell. Gielgud war Avantgarde. Nie hatte man Shakespeares Worte so frisch, so rein, so eindringlich gehört. Während er Violet die Leviten las, musste sie innerlich lachen. Da stand der größte Schauspieler Englands, trug Kniehosen und kreuzweise geschnürte Strumpfbänder und hielt ihr eine Strafpredigt. Andererseits war Gielgud ein Perfektionist, er würde sich nicht länger als zwei Minuten damit aufhalten, eine unbedeutende Dramaturgin zurechtzuweisen. Der Mann funktionierte wie ein Uhrwerk. Er begann die Proben pünktlich auf die Minute und beendete sie noch pünktlicher. Um ein Uhr mittags überkam ihn eine bleierne Müdigkeit, weshalb er sich in seiner Garderobe schlafen legte, selbst wenn das Stück dafür mitten in einer Szene unterbrochen werden musste.
»Bitte entschuldigen Sie, Sir. Es kommt nicht wieder vor«, antwortete Violet so zerknirscht, wie Gielgud es erwarten durfte.
Er nickte huldvoll, die zwei Minuten waren vorbei, Malvolio schritt zum Auftritt. Violet huschte an ihren Platz. Ihr Job war es, das Soufflierbuch stets auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Aufführung war zu lang. Das durfte nicht so bleiben, sonst würde das Publikum die Busse um zehn Uhr nachts nicht mehr erreichen. Selbst Shakespeare würde einsehen, dass man das den Leuten nicht zumuten konnte. Gielgud hatte ganze Passagen gestrichen, heute probten die Schauspieler die neuen Übergänge.
Der Inspizient winkte Violet schon zum zweiten Mal. Über ihr Buch gebeugt, hatte sie es nicht bemerkt. Er machte der Souffleuse ein Zeichen, die stieß Violet an. Als sie aufblickte, machte der Inspizient die Telefon-Geste und zog sich rasch zurück, Gielgud hatte die Unruhe bemerkt.
»Dank sei meinen Sternen!«, rief der Schauspieler mit ausgebreiteten Armen und warf dem Inspizienten gleichzeitig einen strafenden Blick zu. »Ich will gelbe Strümpfe tragen und sie unter den Knien binden, noch diesen Augenblick. Jupiter sei gepriesen!«
Den Rest des Monologs hörte Violet nur noch entfernt. Lautlos war sie durch die Seitentür des Zuschauerraumes geschlüpft und hielt den Telefonhörer ans Ohr.
»Was ist mit Großvater?«, flüsterte sie.
Sir Laurence war kein Mann, wie man sich einen Großvater vorstellte. Violet kannte ihn als Menschen, dem das Vorwärtsstürmen zum Prinzip geworden war. Selbst im Alter eines Patriarchen wirkte Larry jünger als die jungen Männer, die ihn in seinem Reich umgaben. Dieses Reich lag über eine Meile von dort entfernt, wo Violet jetzt überstürzt aufbrach. Mochte Gielgud toben, mochte sie auch ihren Job verlieren, nichts konnte sie daran hindern, zu ihrem Großvater zu eilen.
2Der Himmel
»Wer war als Erstes bei ihm?«
Violet nahm zwei Stufen auf einmal, während Mr Sykes neben ihr ins Keuchen geriet.
»Mrs Drake hat ihn gefunden. Sie kam, um sich wegen der Messingpolitur zu erkundigen.« Mit fliegenden Frackschößen lief der Chefbutler neben Violet die Treppe hoch.
»Und wo ist Dorothy die ganze Zeit gewesen?« Auf dem Treppenabsatz kam ihnen eine Gruppe arabischer Gäste entgegen. Violet wich nicht aus, sondern bahnte sich ihren Weg mittendurch.
Mr Sykes machte eine kurze Verbeugung vor den Männern in den bodenlangen Gewändern. »Seit dem Unglück ist Miss Pyke nicht mehr gesehen worden«, rief er Violet nach.
Sie ließ den Butler hinter sich. Im fünften Stock war die Tür zu Larrys Privaträumen angelehnt, Violet stürmte hinein. Henry und Judy warteten mit bangen Gesichtern im Vorzimmer.
»Der Doktor ist noch bei ihm.« Henry, der Kronprinz, war Violet ans Herz gewachsen. Der fast Fünfzigjährige hatte etwas Knabenhaftes an sich. Er war der einzige legitime Sohn Larrys und damit dessen Nachfolger. Violet bedauerte ihn für diese Bürde. Sie wusste, Henry wartete nicht etwa ungeduldig darauf, dass er an die Reihe kam, sondern in der ängstlichen Gewissheit seiner Unzulänglichkeit. Sein altes Jungengesicht sah blass und eingefallen aus, der strohblonde Haarschopf stand zu Berge.
Violet begrüßte ihn mit einem verwandtschaftlichen Kuss. »Was sagt Dr. Hochsinger zu Larrys Zustand?«
»Wir haben ihn noch nicht gesprochen. Ich dachte nur, da er Papa nicht ins Krankenhaus bringen ließ, ist zu hoffen …«
Er wandte sich zu seiner Frau.
»Wir dachten, dass der Anfall möglicherweise nicht so schwer ist«, vollendete sie seinen Satz.
Judy war eine Frau, die wenig für ihr Äußeres tat und gerade deshalb frisch und natürlich aussah. Um einiges jünger als Henry hätte man sie eher für seine kleine Schwester gehalten.
»Wo war Dorothy, während es passiert ist?«
»Sie wird noch gesucht.« Judy trug ihr Haar zum Dutt geschlungen und versuchte nicht, das beginnende Grau zu übertünchen.
»Wollen wir hineingehen?« Ungeduldig drängte Violet zur nächsten Tür.
»Hochsinger sagt, dass Papa absolute Ruhe braucht.« Henry kam hinter ihr her.
»Larry hat mich anrufen lassen. Er will mich sehen.«
»Weil du sein Liebling bist.« Henry lächelte mit jener Traurigkeit, die sein Leben ausmachte. »Du und Laurence, ihr wart immer wie Kumpane. Du bist ihm ähnlicher, als ich es je sein werde.« Er legte Violet die Hand auf die Schulter.
»Geh hinein«, bekräftigte auch Judy. »Sprich mit Larry und sag uns nachher, was wir für ihn tun können.«
Violet wusste nicht, was sie erwidern sollte. Es stimmte, sie und ihr Großvater waren aus demselben Holz geschnitzt. Sie betrat den Salon. Durch eine Schiebetür getrennt, verlängerte sich der Raum ins Schlafzimmer. Das Bett stand am gegenüberliegenden Ende, Violet hatte einen langen Weg zurückzulegen.
Sir Laurence war ein Mann mit Traditionsbewusstsein, dennoch hatte er alles Altmodische, Überladene und Überzuckerte, alles Viktorianische aus dem Haus verbannt. Nirgends gab es verstaubte Troddeln und gefältelte Samtvorhänge, keine verkitschten Gemälde oder tüddelige Beistelltische. Er liebte die moderne Linie dieses Jahrzehnts. Auch der schwarzweiß getäfelte Deckenbogen, der die Glaskuppel stützte, war ein Sinnbild für Larrys Geschmack. Über ihm gab es nur den Himmel, durch die Kuppel über seinem Bett konnte er die Sterne sehen. Ein mitternachtsblauer Sessel, ein Spiegel im Silberrahmen, eine Nachttischlampe in Form eines Kelches stellten die ganze Einrichtung dar. Das Ananas-Motiv auf rotem Grund, das den Teppichrand schmückte, war das einzig verspielte Detail im Zimmer.
»Wie geht es dir?« Entlang der Ananas lief Violet auf den Großvater zu.
In dem riesigen Bett wirkte er wie ein Kind.
»War es schwer, dich loszueisen?« An der Art, wie er die Hand hob, erkannte sie seine Schwäche.
»Kein Problem.« Sie sank auf den Bettrand. »Was ist passiert?«
»Lächerlich. Mir ist schwarz vor Augen geworden.« Wie um zu beweisen, dass es sich um eine Bagatelle handelte, zog Laurence die Enkelin in seine Arme.
Professor Hochsinger kam aus dem Bad und krempelte die Hemdsärmel herunter. »Absolute Ruhe, Sir Laurence, nicht so viel sprechen.« Er nahm den Rezeptblock aus der Tasche.
»Das ist meine Enkelin.« Larry drückte Violet an seine Brust.
Nachdenklich musterte Dr. Hochsinger den kranken Mann und die junge Frau. »Ich komme heute Abend noch einmal.«
»Wozu? Mir geht es blendend.«
Hochsinger zog den Gehrock an. »Sie haben ein zweiundsiebzigjähriges Herz in Ihrer Brust, Sir Laurence, und es schlägt nicht, wie es sollte. Es geht Ihnen nicht blendend.«
»Violet ist wie Medizin für mich«, lächelte Larry.
»Ich habe Ihnen zur Sicherheit noch eine andere Medizin aufgeschrieben. Man soll sie Ihnen holen. Die Dosierung steht auf dem Rezept.«
»Lassen Sie mich das machen.« Violet nahm den blassblauen Zettel entgegen. Hochsinger war eine Koryphäe. Von ihm wurde behauptet, er hätte mehr Babys adeliger Damen auf die Welt gebracht als jeder andere. »Können Sie mir sagen, was es ist, Professor?«
»Das Herz«, antwortete Hochsinger. »Aber die Ursache liegt woanders. Ich habe Ihrem Großvater Blut abgenommen. Näheres weiß ich heute Abend.« Er schloss seine Tasche, machte eine knappe Verbeugung vor Sir Laurence und verließ das Zimmer. Als er die Vordertür öffnete, traten ihm Henry und Judy entgegen.
»Willst du Henry nicht hereinlassen?«, flüsterte Violet. »Er und Judy machen sich große Sorgen.«
»Ich bin gleich bei euch, meine Lieben. Mir geht es gut, der Professor wird es euch bestätigen.« Larry winkte den beiden zu. »Ich brauche noch einen Moment mit Violet.«
»Lass dir Zeit, Papa«, erwiderte Young Henry.
Sobald sich die Tür geschlossen hatte, verwandelte sich Larrys Ausdruck, alle Heiterkeit fiel von ihm ab, seine Wangen waren fahl, Violet entdeckte dunkle Ringe unter den Augen. »Vi, hör zu. Die tun mir etwas in den Tee.«
»Was meinst du damit?«
»Ich werde vergiftet.«
Violet sank neben dem Bett auf die Knie und umfasste seine Hand. »Wie kannst du das wissen?«
»Es war Dorothy.« Er erwiderte den Druck. »Es muss Dorothy gewesen sein. Sie hat mir den Tee gebracht.«
»Hast du Hochsinger deine Vermutung mitgeteilt?«
»Wo denkst du hin? Ich bin doch nicht verrückt. Niemand darf davon wissen, keine Menschenseele.«
»Wo ist Dorothy jetzt?«
»Keiner weiß es. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt.«
»Bereitet sie immer deinen Tee zu?«
»Meistens.« Er bemerkte Violets zweifelnden Blick. »Ich gehe schließlich nicht jedes Mal in die Küche und kontrolliere, von wem mein Tee aufgegossen wird.«
Violet zeigte zu den hofseitigen Zimmern. »Neben der Küche liegt der Lastenaufzug. Dorothy könnte den Tee auch unten bestellt haben. Was macht dich so sicher, dass sie es war? Was macht dich so sicher, dass überhaupt irgendjemand so etwas tun könnte? Immerhin hattest du schon einmal …«
»Einen Herzinfarkt?« Er verengte die Augen. »Der liegt zehn Jahre zurück, und das hat sich anders angefühlt.« Larry deutete nach oben, wo sich der wolkenlose Himmel über der Kuppel spannte. »Heute Morgen war ich spazieren, der Tag war herrlich, es ging mir blendend. Ich kam zurück und sagte Dorothy, ich wolle Tee. Dann passierte das Merkwürdige. Der Tee war schon fertig. Woher konnte sie das wissen? Manchmal will ich statt Tee nämlich lieber …«
»Brandy.«
Laurence strich über Violets Haar, das an den Schläfen feucht war von der Eile. »Als ich Dorothy fragte, wie sie den Tee so schnell herbeigezaubert hätte, sagte sie, Mr Sykes hätte ihr mein Kommen angekündigt.«
»Das klingt plausibel.«
»Bloß hat mich Sykes in der Halle gar nicht bemerkt. Oppenheim hat sich bei ihm erkundigt.«
»Du hast den Hoteldetektiv darauf angesetzt?«
»Wer wäre besser dafür geeignet?«
»Die Polizei.«
Larry öffnete den obersten Knopf des Schlafanzugs. »Das fehlte noch, dass uniformierte Kriminalisten durch mein Hotel geistern. Oppenheim ist ideal dafür. Es fällt nicht auf, wenn der Hoteldetektiv zu mir hochkommt. Von nun an wird er nicht nur Jagd auf Taschendiebe und Heiratsschwindler machen, sondern auch auf einen Giftmörder.«
»Die Angelegenheit scheint dir Spaß zu machen«, entgegnete Violet besorgt. »Als ob das Ganze nur ein Spiel wäre.«
»Spiel im Savoy«, lächelte Larry. »Entweder ich bin am Ende tot, dann habe ich verloren, oder Oppenheim macht den Täter unschädlich; in dem Fall hätte ich gewonnen.«
»Und wenn du dich täuschst?« Sie stand auf. »Wenn dir einfach schlecht geworden ist, ohne dass irgendjemand seine Hand im Spiel hatte? Ich kann mir bei Miss Pyke nicht vorstellen …«
»Sir Laurence!«
Mr Sykes stand in der Tür. »Miss Pyke ist da. Darf ich sie hereinlassen?«
»Zuerst musst du Henry zu dir bitten.« Violet beugte sich zu ihrem Großvater. »Du darfst deinen Sohn vor den Angestellten nicht demütigen.«
»Du bist ein kluges Mädchen.« Laurence zwinkerte ihr zu. »Henry, Judy, entschuldigt, dass ich euch so lange habe warten lassen«, rief er nach drüben. »Bitte kommt doch herein.« Er winkte dem Butler. »Miss Pyke soll warten. Schicken Sie sie ins Büro.«
»Wie Sie wünschen, Sir Laurence.«
»Setzt euch, setzt euch doch.« Larry streckte den beiden die Arme entgegen. »Wie ihr seht, geht es mir gut. Wollt ihr Tee? Ach, wie dumm, jetzt habe ich Sykes weggeschickt.«
»Ich mache das.« Violet überließ den beiden das Feld und betätigte den Klingelknopf im Salon. In wenigen Augenblicken würde ein Page erscheinen.
3Oppenheim
Otto war angehalten, Herrschaften von Rang mit ihrem ordnungsgemäßen Titel anzusprechen – Mylady, Commander, Your Excellency. Andererseits sollte er bekannten Persönlichkeiten im Fahrstuhl weitgehende Anonymität gönnen. Am liebsten hätte Otto den Gentleman, der sich hinter ihm im Spiegel betrachtete, ohne Worte in den dritten Stock gebracht, aber der Mann hatte ihm eine Frage gestellt, schon der Zweite an diesem Tag, der sich nach seiner Heimat erkundigte.
»Was hören Sie aus München?« Der Mann trug sein Haar in ergrauten Locken, besaß einen edlen Kopf, nüchterne Augen und einen Walrossbart, er schien mit seinem Anblick zufrieden zu sein.
»Ich war lange nicht mehr zu Hause, ähm … Sir.« Wenn man Mitgliedern des Hochadels begegnete, war die korrekte Anrede beim ersten Mal Your Grace, beim zweiten Mal genügte Sir oder Mylady. Aber galt das auch für einen Premierminister? Otto sah sich in der Zwickmühle.
»Bei euch in München brodelt es ganz ordentlich. Man darf gespannt sein.«
Was hatten sie denn heute alle mit München, dachte Otto. Er stammte aus Maxglan, sein Vater war im Krieg gefallen. Otto wusste von ihm hauptsächlich, dass er Queen Victoria verehrt hatte, und dass es für den belesenen Buchhändler eine Zumutung gewesen war, gegen die kultivierten Briten in die Schlacht zu ziehen. Vielleicht hatte er seine Meinung geändert, nachdem die Engländer die deutschen Schützengräben an der Somme nach siebentägigem Trommelfeuer mit anderthalb Millionen Granaten in eine Mondlandschaft verwandelt hatten. Ottos Vater starb durch keine Granate, er wurde von einer gigantischen Mine zerfetzt, die britische Pioniere in langen Rohren unter der deutschen Frontlinie durchgeschoben und zur Detonation gebracht hatten. Der Knall war angeblich bis nach London zu hören gewesen. In der Schule hatte man Otto beigebracht, dass der Franzose der Erbfeind der Deutschen sei, doch wegen seiner Hinterlist müsse man dem Briten noch mehr misstrauen.
Otto hatte seiner Mutter nicht auf der Tasche liegen wollen und war mit dreizehn als Tellerwäscher im Vier Jahreszeiten an der Maximilianstraße in den Hoteldienst getreten. Ein wohlhabender Gentleman aus Sussex hatte einen Leibdiener gesucht und Otto das Angebot gemacht, ihn nach Großbritannien zu begleiten. Nach einjähriger Dienstzeit hatte Otto sein Heil in London gesucht und war im Savoy zunächst als Schuhputzer untergekommen. Sir Laurence war rasch auf ihn aufmerksam geworden und fand, so ein frisches Gesicht dürfe nicht in der Schuhputzkammer verkümmern. Er hatte Otto eine Livrée und weiße Handschuhe verpasst und ihm den Aufzug Nummer drei zugewiesen.
Durch einen konkaven Spiegel über der Armatur konnte Otto seine Fahrgäste unbemerkt beobachten. Seit er seine Tage in dieser auf und ab schwebenden Gondel verbrachte, hatte er gelernt, die Blicke der Menschen einzuordnen, die lächelnden Blicke der Damen, neugierige Blicke von greisen Würdenträgern, Otto konnte inzwischen bei jedem Einzelnen Gefallen, Begehren und Neid unterscheiden. Im Blick des Mannes hinter sich fand er nichts davon. Dieser Mann sah nur sich selbst. Otto lächelte.
»Was ist daran so komisch?« Der andere hatte Ottos Entgleisung bemerkt. Ein Fehler, ein Riesenfehler, denn ein Liftpage war sozusagen Luft und hatte sich keinerlei Emotionen anzumaßen.
»Bitte verzeihen Sie, Sir, aber Sie sind heute schon der Zweite, der mich nach München befragt. Ich weiß leider wenig, da meine Mutter kaum Zeit findet, mir zu schreiben.«
»Aber die Zeitungen werden Sie doch lesen.« Der Premier fuhr sich mit beiden Zeigefingern über den Schnäuzer.
»Wir Angestellten haben keinen Zugang zu den Journalen.«
»Wir leben in Zeiten, in denen jeder informiert sein sollte.«
»Danke, dass Sie mich darauf hingewiesen haben, Sir.« Der Fahrstuhl hielt. »Dritter Stock, Sir.«
Im Hinaustreten warf der Premierminister Otto einen prüfenden Blick zu. »Typisch für Sir Laurence, dass er einen deutschen Liftpagen beschäftigt.«
Otto machte eine sinnlose Verbeugung. Es stimmte schon, seine Mutter schrieb ihm so gut wie nie, dafür schickte Ottos Cousine Gabriele ihm häufig Briefe. Gabriele war zwei Jahre älter als er. In der Nacht, bevor er aus Deutschland abgereist war, hatten er und Gabriele einander geküsst. Nur ein einziger Kuss in Schwabing, aber Otto hatte seither oft an sie denken müssen. Gabriele berichtete über die verrückten Veränderungen, die in München vor sich gingen und von den Auftritten jenes Mannes, der selbst in London im Gespräch war. »Es ist alles wahr, was er sagt«, hatte Gabriele geschrieben. »Ich frage mich, wieso vor ihm niemand diese einfachen, klaren Wahrheiten über Volk und Rasse und unser Vaterland gesagt hat. Nächsten Freitag gehe ich wieder zu seiner Veranstaltung. Mir ist, als ob dieser Mann nichts als die reine Wahrheit sprechen kann.« Otto verwahrte Gabrieles Briefe liebevoll, weniger wegen ihres Inhalts, sondern weil die schöne Cousine es ihm angetan hatte.
Während Otto das Scherengitter des Fahrstuhls schloss, nickte der Premierminister den Polizeioffizieren zu, die das Treppenhaus inspiziert und gesichert hatten und ihn auf dem Korridor erwarteten. »Melden Sie mich bei der Herzogin.«
Der ranghöhere Polizist ging voraus und klopfte an die Tür der Erkersuite. Zugleich kam Mrs Drake den Korridor entlang. Die Hausdame erkannte den besonderen Gast und versank ordnungsgemäß in einem Hofknicks, während der Premier die Suite von Lady Edith betrat.
So mancher im Hotel hätte darauf gewettet, dass Mrs Drake ein Mann war. Als dienstälteste Hausdame kleidete sie sich in der Uniform ihres Ranges, war aber größer als die meisten männlichen Angestellten. Ihre Haut hatte die Grobporigkeit eines Elefanten, das Blond ihrer Dauerwelle konnte man nur als aggressiv bezeichnen. Niemand hatte jemals einen Mister Drake im Hotel gesehen.
»Warte!«, rief Mrs Drake, bevor Otto den Fahrstuhl in Bewegung setzte. Sie bestieg ihn, nahm den Flakon mit dem Eau de Cologne und blinzelte durch das geschliffene Glas. »Der ist ja noch gar nicht leer.«
»Sir Laurence wünscht trotzdem, dass er ausgetauscht wird.« Sie nahm die Flasche an sich. »Fahr mich runter, Junge.«
»Wie Mylady befehlen.« Er zwinkerte und schloss das Scherengitter.
***
Alt fühlte sich Sir Laurence, alt und leer, obwohl es ihm spürbar besser ging. Schwerfällig sank er in den Schreibtischsessel, ein Stück aus dem frühen 19.Jahrhundert, der sich nicht nur drehen, sondern mittels einer Federkonstruktion auch kippen ließ. Zum Schlafanzug trug er den schwarzen Morgenmantel mit Monogramm. Sir Laurence gab Oppenheim ein Zeichen, zu beginnen.
Dorothy Pyke war aufgefordert worden, gegenüber Platz zu nehmen. Der Hoteldetektiv hatte ihren Stuhl dort platziert, wo das harte Licht der Nachmittagssonne ihr Gesicht traf. Die Sonne war Oppenheims Verhörlampe.
»Das ist eine interne Untersuchung«, begann er. »Es ist entscheidend, dass ich meine Nachforschungen anstellen kann, ohne dass jemand davon erfährt. Sollten Sie etwas von der Untersuchung verlauten lassen, muss ich Anzeige gegen Sie erstatten. Verstehen Sie das, Miss Pyke?« Oppenheim stützte sich auf die Schreibtischplatte.
Larry fiel auf, dass die Oberarme seines Detektivs die Nähte der Anzugjacke zu sprengen drohten. »Gut, Clarence, das haben wir verstanden.« Er faltete die Hände. »Dorothy, hören Sie zu. Ich lasse Sie deshalb als Erste befragen, damit sich Ihre Unschuld rasch erweist. Vorher können wir nämlich nicht zu unserer Arbeit zurückkehren.«
»Das ist mir klar, Sir Laurence.«
Er schätzte an Miss Pyke, dass sie trotz ihrer Jugend eine natürliche Autorität besaß. Im Augenblick war allerdings wenig davon zu spüren. Schweißperlen glänzten auf ihrer Stirn, der Lippenstift wirkte in dem ungeschminkten Gesicht grell und übertrieben.
»Bitte Clarence, fahren Sie fort.«
»Wieso haben Sie die Tasse und das Kännchen von Sir Laurences Teegeschirr sofort ausgewaschen?«
»Weil es normal ist, benütztes Teegeschirr sauber zu machen«, antwortete sie.
»Waschen Sie das Teegeschirr jedes Mal selbst ab?«
»Wenn es meine Zeit erlaubt.« Miss Pyke musterte Oppenheim, als ob sie eine derart dumme Frage von ihm nicht erwartet hätte.
»Der Zimmerservice erzählt mir etwas anderes«, erwiderte er. »Normalerweise stellen Sie das gebrauchte Geschirr in den Lastenaufzug und schicken es in die Küche.«
»Heute war im Büro nicht viel zu tun. Da habe ich es selbst gemacht.« Dorothy strich die Taille ihres Kostüms glatt.
»Ich habe die Tasse, das Kännchen und die Teebüchse ins Labor geschickt.« Oppenheim umrundete den Schreibtisch. »Wenn darin auch nur die kleinste Spur von Gift zurückgeblieben ist, wird man sie finden.«