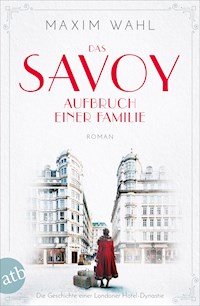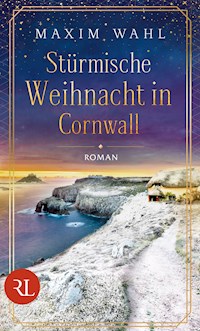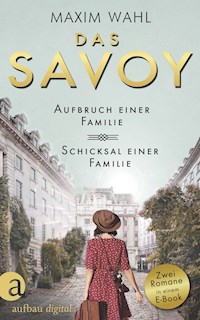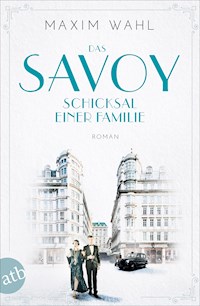
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die SAVOY-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Dunkle Geheimnisse.
London 1936. Violet tritt das Vermächtnis ihres Großvaters an und leitet das Hotel Savoy. Neben ihren nicht enden wollenden Pflichten belastet sie eine große persönliche Schuld. Violet wirft sich vor, ihren Partner John in den Selbstmord getrieben zu haben. Erst die Begegnung mit dem französischen Adeligen Omar de la Durbollière scheint ihr neues Glück zu bringen. Obwohl sie die politischen Veränderungen in Deutschland mit Abscheu beobachtet, folgt sie seiner Einladung zu den Olympischen Sommerspielen. Doch nicht nur auf der Bühne der Weltpolitik, sondern auch im Savoy überschlagen sich Ereignisse, denen Violet sich nicht entziehen kann.
Der zweite Band der großen 30er-Jahre-Saga über das berühmteste Hotel der Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Ähnliche
Über Maxim Wahl
Hinter Maxim Wahl verbirgt sich ein deutscher Bestsellerautor, der mit seinen zahlreichen Romanen auch international Aufmerksamkeit erregte. Für seine Stoffe sucht sich Maxim Wahl am liebsten große Schauplätze der europäischen Geschichte. Er lebt in Berlin und London, und am allerliebsten im Hotel Savoy.
Im Aufbau Taschenbuch ist bisher »Das Savoy. Aufbruch einer Familie«, der erste Band seiner erfolgreichen Saga erschienen.
Informationen zum Buch
Dunkle Geheimnisse.
London 1936. Violet tritt das Vermächtnis ihres Großvaters an und leitet das Hotel Savoy. Neben ihren nicht enden wollenden Pflichten belastet sie eine große persönliche Schuld. Violet wirft sich vor, ihren Partner John in den Selbstmord getrieben zu haben. Erst die Begegnung mit dem französischen Adeligen Omar de la Durbollière scheint ihr neues Glück zu bringen. Obwohl sie die politischen Veränderungen in Deutschland mit Abscheu beobachtet, folgt sie seiner Einladung zu den Olympischen Sommerspielen. Doch nicht nur auf der Bühne der Weltpolitik, sondern auch im Savoy überschlagen sich Ereignisse, denen Violet sich nicht entziehen kann.
Der zweite Band der großen 30er-Jahre-Saga über das berühmteste Hotel der Welt.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Maxim Wahl
Das Savoy
Schicksal einer Familie
Roman
Inhaltsübersicht
Über Maxim Wahl
Informationen zum Buch
Newsletter
London 1936
1 Die Geliebte
2 Ein treuer Diener seines Herren
3 Die Vorbereitung
4 Das Auge
5 Eine Blume aus Blut
6 Omar
7 Bully
8 Alles, was er liebte
9 Von oben herab
10 Das Jahrhundert
Die Spiele
11 Am Steuer
12 Helden
13 Ein Vorgeschmack
14 Earl Grey
15 Bewölkt von Tauben
16 Die Macht der Masse
17 Gemma Galloway
18 Siebzig Fuß
19 Die Augen eines Hundes
20 Die Flamme
21 Der schönste Ort auf Erden
22 Sechzig Meilen die Stunde
Das andere Savoy
23 Winston und Charlie
24 Unsichtbar
25 Zu schmal für zwei
26 Der Faschist
27 Liebe am Nachmittag
28 Larry
29 Vabanque
30 Jungfer im Grünen
31 Ein Feind, so kühn erobert
32 Judy
33 Number 10
34 Für England
35 Das Ende des Marquet
36 Noch nicht jetzt
Impressum
Dank an Uschi
London 1936
1Die Geliebte
Halblanges kastanienbraunes Haar, das souveräne Lächeln, ein flaschengrünes Kleid, so sah sich Violet auf der Titelseite der Gesellschaftszeitung, die viele Gäste in der Lobby in den Händen hielten. Sie fand ihr Gesicht häufig in Magazinen. Violet war eine Frau, über die man sprach. Anders als auf der Fotografie trug sie heute ein schlichtes Kostüm in Dunkelbraun und erwartete ihren Gast.
Umgeben von vielen Menschen in der großen Eingangshalle des Savoy, fühlte sich Violet doch vollkommen allein. Rund um sie schimmerte poliertes Messing, brach sich das Tageslicht im geschliffenen Glas der Schwingtüren, marmorverkleidete Säulen erhoben sich zu beiden Seiten. Sie war Besitzerin dieses Hotels, sie war Arbeitgeberin und anerkannt in ihrer Zunft, ein Vorbild für Frauen, bewundert von Männern, und war schrecklich allein. Wäre es nach ihren Wünschen gegangen, hätte sie im Kreis von Gleichgesinnten gewirkt und sich in diesem Wir mit anderen, in diesem Miteinander bestens aufgehoben gefühlt. Doch die First Lady des Savoy zu sein bedeutete ein anderes Schicksal. In dem traditionsreichen Hotel, unweit der Themse gelegen, war es ihr bestimmt, einen Alltag zu leben, wie sie ihn sonst von Männern kannte. Violet war eine junge Frau, gerade erst dreißig geworden, und so genoss sie es, sich mit einer gleichaltrigen Frau zu treffen, die nichts mit dem Hotel und seinen Zwängen zu tun hatte.
Sie begrüßte ihren japanischen Gast und führte Miss Ayumi in den Golden Pavillon, den größten Speisesaal des Hauses. Es wurde noch kein Lunch serviert, die Flügeltüren schlossen sich hinter ihnen wieder. In der Weite des Saales nahmen sie an einem Tisch nahe des Fensters Platz.
Miss Ayumi war eine außergewöhnlich schöne Frau, sie trug ihr schweres Haar zu einem schlichten Knoten gewunden. Tagsüber zeigte sie sich mit dezentem Make-up, abends hatte Violet sie schon grellweiß geschminkt gesehen. Heute strahlte Ayumi nicht so sehr die reizvolle Unnahbarkeit aus, für die Violet sie bewunderte, sie befand sich in einem beängstigenden Zustand der Starre.
»Soll ich die Polizei verständigen, Miss Ayumi?«, fragte Violet, nachdem die Japanerin ihr geschildert hatte, was vorgefallen war.
»Die Polizei ändert nichts«, antwortete die Japanerin in jenem leichten Ton, der kaum etwas über ihre Gefühle verriet.
»Dieser Mann tut Ihnen Dinge an, die in unserem Land streng bestraft werden.«
»Fujiwara-san ist mein Danna«, entgegnete Ayumi. »Mein Sponsor. An seiner Seite reise ich durch die Welt und biete meine Dienste an.«
»Selbst wenn Mr Fujiwara Ihr angetrauter Ehemann wäre, dürfte er nicht solche … Praktiken von Ihnen verlangen. Ich bin … Verzeihen Sie, ich weiß so wenig darüber. Im Grunde weiß ich nichts über Ihre Welt.«
Violet und die Japanerin waren keine Freundinnen. Die Position der Hoteldirektorin verlangte die höfliche Abgrenzung von ihren Gästen. Doch die beiden Frauen waren einander nähergekommen, da Miss Ayumis Begleiter, der japanische Geschäftsmann Mr Fujiwara, seit einem Monat im Savoy residierte.
Das Entscheidende hatte Violet bereits begriffen: Eine Geisha war keine Prostituierte. Diese Annahme wäre eine schlimme Beleidigung gewesen. Eine Geisha sah sich als Bewahrerin der traditionellen japanischen Künste, sie trat bei Festen und größeren Dinners auf und unterhielt die Anwesenden durch Gesang, Tanz und niveauvolle Konversation. Die Kosten für die Dienste einer Geisha richteten sich nach ihrer Arbeitszeit und wurden durch die Zahl der abgebrannten Räucherstäbchen bestimmt. Manche Geishas hielten sich einen Danna, der für einen Teil ihrer Lebenshaltungskosten aufkam. Eine Geisha zu sponsern, galt für den wohlhabenden Japaner als Statussymbol.
Ayumi nahm einen Schluck Tee, ihr Kimono rutschte hoch, rasch zog sie den Ärmel wieder über ihr Handgelenk. Violet hatte die Blutergüsse und Schwellungen jedoch vorhin schon bemerkt. Allein die Andeutung der Prozedur, von der Ayumi gesprochen hatte, ließ in Violet eine Wut aufsteigen, die sie in letzter Zeit häufiger an sich feststellte. Dabei war ihre Wut ein Paradoxon. Schon die kleinste Ungerechtigkeit an Frauen nahm Violet als Bestätigung für die unwürdige Position, in der sich die Frau im 20.Jahrhundert immer noch befand. Andererseits verkörperte sie selbst den Beweis dafür, dass die Vormachtstellung des Mannes nicht mehr absolut war. Ihre ersten dreißig Jahre hatte sie in der Zuversicht durchlebt, dass Männer zwar vom Mars und Frauen von der Venus stammten, dass ihr Konflikt jedoch ein kreatives Aufeinanderprallen war, von dem beide Seiten profitierten. Erst seit Violet dazu gezwungen gewesen war, in der Nachfolge ihres berühmten Großvaters die Leitung des vielleicht schönsten Hotels in London zu übernehmen, hatte sich ihre Sichtweise auf das Leben verändert. Violet war das Sinnbild des Savoy geworden. Diese Erkenntnis schwebte als Schatten über ihr, der sie auf Schritt und Tritt verfolgte.
Bevor sie Ayumi eine entsprechende Antwort gab, entstand eine Unruhe im Golden Pavillon, die für Violet normal, für die Japanerin jedoch überraschend war. Arturo Benedetti, der musikalische Leiter des Savoy, betrat das Podium und bat sein vierzigköpfiges Orchester zu einer Probe. Der Maestro nützte die Vormittagsstunden, um das abendliche Programm einzustudieren, mit dem die Gäste während des Dinners unterhalten werden sollten.
»La mia directrice!«, rief Benedetti, als er Violet in der Mitte des leeren Saales entdeckte. »Wir stören Sie doch nicht?«
»Im Gegenteil, Arturo, halten Sie nur Ihre Probe ab, sofern wir Sie nicht stören«, gab Violet lächelnd zurück.
Mit der Grandezza eines Florentiners verbeugte sich Benedetti und gab den Musikern den Einsatz. Eine schwungvolle Melodie aus Cavalleria rusticana ertönte, die im Kontrast zu dem ernsten Thema stand, das Violet mit der Japanerin besprach.
»Sie müssen diesen Mann verlassen, Ayumi. Es gibt keine Rechtfertigung, die ausreichen würde, Mr Fujiwaras Verhalten zu entschuldigen.«
»Fujiwara-san ist ein kluger, rechtschaffener Mann, durch den ich die halbe Welt bereist und viel Schönes erfahren habe.« Beide Frauen sprachen mit erhobener Stimme, um das fröhlich orgelnde Orchester zu übertönen.
»Wenn er solche Dinge von Ihnen verlangt, ist er ein kranker Mensch«, widersprach Violet. »Er fesselt Ihren Oberkörper auf die Beine, bis Sie sich nicht mehr bewegen können, und dann trampelt er auf Ihnen herum?«
»Es ist eine Liebestechnik, die im alten Japan angewandt wurde, eine Form von Unterwerfung, die …«
»Hören Sie um Gottes willen auf, Ayumi. Wir haben über diese Art von Männern schon einmal gesprochen. Sie sind nur dann in der Lage, ihre Angst vor Frauen zu überwinden, wenn sie die Frauen dafür bestrafen, dass sie kostbar, schön und reizvoll sind. Was diese Männer tun, hat mit Liebe nichts gemein.«
Laut und grell standen Violets letzte Worte in der Stille des Raumes. Benedetti hatte das Musikstück unterbrochen.
»Nein, meine Herren, hier steht ein Des«, korrigierte er die Holzbläser. »Was ich aber von Ihnen höre, ist ein D.« Er hob den Taktstock. »Ziffer sieben, nur das Holz.«
Ein trauriges Lächeln überflog das Gesicht Ayumis. »Es gibt bei uns Unterschiede zwischen Mann und Frau, die in der Welt des Westens gänzlich unbekannt sind. Onnarashii, das Weibliche, umfasst unser gesamtes Verhalten, sogar unsere Art zu sprechen. Japanische Frauen sprechen absichtlich mit hoher Stimmlage. Sie verwenden häufig Höflichkeitsformen, onna kotoba, das sind Frauenworte. Otokorashii, die männliche Welt, basiert auf einer anderen Tradition. Und weil mir diese Tradition vertraut ist, weiß ich, Fujiwara-san liebt und ehrt mich auf eine ganz besondere Weise.«
»Es gibt keine Rechtfertigung für das, was Mr Fujiwara tut«, entgegnete Violet über die Töne der Holzbläser hinweg. »Er erregt sich an Ihrer Unterwerfung. Egal, aus welchem Kulturkreis Sie stammen, egal, ob Männer solche Dinge seit Jahrhunderten bei Ihnen tun, Sie dürfen es sich nicht länger gefallen lassen. Sie sind in London, Ayumi, wir schreiben das Jahr 1936. Was Mr Fujiwara von Ihnen verlangt, gehört ins Mittelalter. Sie müssen es stoppen, bevor es zu spät ist, bevor Mr Fujiwara Ihnen noch wirklich etwas antut.«
»Des, Des, Des, maledetto!« Benedetti unterbrach abermals. »Bitte nur die Klarinette allein.«
»Sie haben mir erklärt, was der Name Ayumi bedeutet«, fuhr Violet fort.
Die Japanerin musterte ihr Gegenüber. »Ayumi bedeutet den eigenen Weg gehen.«
Als ob damit alles gesagt wäre, hob Violet die Arme. »Ihren Weg gehen, Ayumi, wählen Sie Ihren eigenen Weg. Sie müssen diese krankhaften Zustände beenden.«
Die Japanerin senkte den Blick und dachte eine Weile nach. »Gut«, sagte sie schließlich. »Sie haben recht, Violet. Ich will es tun. Aber auf traditionelle Weise.«
Als hätte Ayumis Antwort auch die Unstimmigkeit im Orchester beseitigt, stimmten die Musiker jene strahlende Melodie an, in der Hoffnung, Aufbruch und das Glück der Liebe zum Ausdruck kamen. Durch diese Klänge fühlte sich Violet an Ereignisse erinnert, die trotz ihrer Jugend Ewigkeiten zurückzuliegen schienen.
Wenig später schwangen die Flügeltüren in den Golden Pavillon auf und dreihundert hungrige Menschen drängten an die Tische mit den Blumenarrangements, dem kostbaren Porzellan und dem Silberbesteck.
Während Violet an der Seite Ayumis den Speisesaal verließ, bemerkte sie einen Stammgast, den sie seit Jahren ins Herz geschlossen hatte. Emil Lilienthal, Besitzer eines Wiener Modesalons, stieg zweimal im Jahr im Savoy ab. Gerade befand er sich im Gespräch mit Judy Wilder, die verwandtschaftlich so etwas Ähnliches wie Violets Tante war und im Hotelbetrieb ihre rechte Hand. Judy trug ein blaues Kostüm mit raffiniertem Pelzbesatz, der sich vom Kragen bis zur Taille zog. Der Rock war figurbetont und die Absätze ihrer Schuhe von beeindruckender Höhe. Lilienthal ließ es sich nicht nehmen, auf Violet zuzueilen und ihr die Hand zu küssen. Sie wechselte ein paar Worte mit dem Wiener und winkte Judy zu. »Sehen wir uns nachher bei dir?«
»Einverstanden.« Judy gestattete Mr Lilienthal, sie zu der Nische zu eskortieren, die für die Geschäftsleitung reserviert war.
Nachdem Violet sich von Miss Ayumi verabschiedet hatte und zu ihren Pflichten zurückkehrte, dachte sie, wie froh sie war, dass Judy ihr bei der schwierigen Aufgabe beistand, das Hotel durch die ungewisse Gegenwart zu steuern. Obwohl sie Judy täglich sah, fiel es Violet immer wieder auf, wie sehr sich die schmale Person in den letzten Jahren verändert hatte. Früher hatte man über Judy Wilder gesagt, sie sehe frisch und natürlich aus und damit gemeint, sie tue wenig für ihr Äußeres. Früher hatte sie ihr Haar zum Dutt geschlungen, heute erschien Monsieur Patrice zweimal die Woche, um Judys Frisur zu machen. Früher war sie meist unauffällig als bewundernde Gattin ihres Mannes im Hintergrund geblieben. Dieses Bild hatte sich gründlich gewandelt. Heute war es Henry, der Sohn von Sir Laurence, den man kaum noch an der Öffentlichkeit sah. Judy dagegen half Violet, wo sie konnte. Sie kümmerte sich um die Bestellung, Lieferung und die Abrechnung, während Violet sämtliche Repräsentationspflichten übernommen hatte, Konflikte schlichtete und die Linie des Hauses vorgab.
Früher hatte Violet gefürchtet, es müsse über kurz oder lang zum Erbfolgestreit im Savoy kommen, zu einem Krieg, in dem Henry, einziger Sohn des Patriarchen, auf seine angestammten Rechte pochen würde. Henry hätte ins Feld führen können, dass Violet zwar der Liebling ihres Großvaters sei, zugleich aber nur dessen uneheliche Enkelin war. Überraschenderweise hatten Henry und Judy keine Front gegen sie gemacht, sondern sich den neuen Verhältnissen angepasst. Es war eine Situation, in der jeder gewann.
Ein letzter Blick zurück: Judy und Mr Lilienthal setzten sich und schlugen die Menükarten auf.
»Garmisch war wunderbar.« Lilienthal holte seine Brille aus dem Etui. »Man kann gegen die derzeitigen Zustände sagen, was man will, eines muss man den Deutschen lassen, organisieren können sie. Die Winterspiele sind abgelaufen wie am Schnürchen. Meine Frau und ich waren zum Skilaufen in Kufstein und haben den Austragungsort mehrmals besucht. – Für mich bitte das Lamm«, sagte er zum herangeeilten Kellner. »Und eine Flasche Burgunder, Grand Cru, wenn Sie haben. Sie schließen sich doch an, Mrs Wilder?«
»Ein kleines Glas gerne«, antwortete Judy, und zum Kellner gewandt: »Für mich wie immer.«
»Sie können sich den Jubel nicht vorstellen«, fuhr Lilienthal fort, »als die Athleten ins Olympiastadion einmarschierten und geschlossen wie ein Mann den rechten Arm zum Gruß erhoben. Ein wunderbares Bild, wirklich, ich muss sagen, sehr erhebend.«
»Mr Lilienthal, ich verstehe Sie nicht.« Zurückgelehnt saß Judy da, die Hand an die Stirn gehoben, als ob sie sich vor der Sonne schützen müsste. »Als Henry und ich kürzlich in Berlin waren, schlug uns der Antisemitismus an jeder Straßenecke entgegen. Für Juden kein Zutritt war das Schild, das wir am häufigsten gelesen haben.«
»In Garmisch habe ich nicht ein einziges davon gesehen.«
»Natürlich nicht, weil die Deutschen sie abmontiert haben. Sie fürchten, dass der Rest der Welt ihre Sommerspiele boykottieren könnte.«
Der Kellner öffnete den Grand Cru und ließ Lilienthal probieren. »Ich bin weder blind noch naiv, liebe Mrs Wilder. Natürlich sind die Verhältnisse in Deutschland schwierig. Aber ich bin in erster Linie Geschäftsmann und erst in zweiter Linie Jude. Ein Geschäftsmann sollte die Zeichen der Zeit erkennen, zugleich aber zwischen den Zeilen lesen. Die Olympischen Spiele wurden bereits 1931 an das Deutsche Reich vergeben, als Herr Hitler noch Wahlkampfreden in Bierzelten gehalten hat. Reichskanzler Hindenburg war damals der Schirmherr von Olympia. Außerdem haben die Athleten im Stadion nicht den Arm zum Hitlergruß erhoben, sondern zum olympischen Gruß, dem saluto romano, der ganz ähnlich aussieht. Sie sehen, wenn man die Dinge in die richtige Perspektive rückt, erhält man ein Bild, das nicht ganz so grell und überzeichnet ist, wie es die antideutsche Propaganda gerne malt.« Nachdenklich, als ob er seinen Worten nicht ganz trauen würde, blickte Lilienthal in sein Glas.
Schließlich stieß er mit Judy an. »Bedauerlicherweise kam das Vereinigte Königreich nicht mit allzu vielen Medaillen nach Hause. Einmal Gold und einmal Silber, wenn ich richtig gezählt habe.«
»Britischer Sport findet auf dem Rasen statt«, erwiderte Judy lächelnd. »Das Herumtoben in Eis und Schnee überlassen wir den Teutonen.« Sie nippte und stellte ihr Glas ab. Du armer Teufel, dachte sie, versuchst das Gute im deutschen Aufbruch zu sehen. Du glaubst, wenn du dich assimilierst, wirst du in deinem kleinen Österreich die Weltenwende unbeschadet überstehen. Sie musterte das freundliche, ein wenig verhärmte Gesicht des Wieners. Du bedauernswerter, dich selbst betrügender Israelit. Wann wirst du begreifen, dass kein Gras mehr für euch wächst, kein Vogel für euch singt, dass eure Zukunft längst verspielt ist?
»Was hat Sie nach Berlin geführt?« Lilienthal bemühte sich, den heiteren Konversationston von vorhin wieder aufzunehmen.
»Vorwiegend Geschäfte.«
»In Berlin sollte man sich aber noch für andere Dinge Zeit nehmen. Eine großartige Stadt«, setzte er hinzu, während ihm das Lamm serviert wurde.
»Wir haben Freunde getroffen.« Judys Hand glitt am Pelzbesatz ihres Kostüms entlang. »Sehr liebe alte Freunde.«
»Ah, das sieht wirklich wunderbar aus.« Lilienthal drapierte die Serviette im Westenausschnitt und nahm den ersten Bissen.
2Ein treuer Diener seines Herren
Neunzehnhundertsechsunddreißig, dachte Violet angesichts der modernen Linien in Judys Büro, ein Drittel des Jahrhunderts hatten sie schon durchlebt. Judy hatte die dunklen Möbel, die Henry bevorzugte, hinausgeworfen und eine helle Täfelung gewählt, Birke oder Lindenholz, auch ihr Schreibtisch bestand daraus. Der Spiegel über dem Konsolentisch war riesig, wirkte aber nicht so, da sein Rahmen aus durchsichtigem Glas bestand. Fließend ging das helle Holz in die elfenbeinfarbenen Lederbezüge der Sitzgarnitur über.
Violet setzte sich. Einen Krieg hatten sie durchgestanden, eine Revolution gesehen, sie hatten miterlebt, wie die Werte der alten Welt verschwunden und durch neue, härtere Gesetze ersetzt worden waren. Als eines von wenigen Ländern behauptete sich England immer noch als Monarchie. King George V. war vor wenigen Monaten gestorben, alle Segenswünsche galten seinem Nachfolger, Edward VIII. An vielen anderen Schauplätzen Europas hatten Zaren, Imperatoren und Könige abdanken müssen. Was das Jahrhundert sonst noch bringen würde, war unabsehbar.
»Wenn es nur keinen Krieg gibt.«
An Judys überraschtem Blick erkannte Violet, dass sie ihren Gedanken stimmhaft ausgesprochen hatte.
»Wie meinst du?«
»Ach, nichts.« Violet strich über das weiche Leder und überlegte, wie sie Judy umstimmen könnte. »Ich mag mir das Savoy ohne Mr Sykes gar nicht vorstellen.«
Judy schenkte Wermut ein und brachte Violet ein Glas. »Der gute Sykes hat wirklich seine Schuldigkeit getan. Die paar Jahre, die er noch hat, sollte er seinen wohlverdienten Ruhestand genießen.«
Aber wenn du Mr Sykes das Savoy wegnimmst, raubst du ihm seinen Lebensinhalt.«
»Du übertreibst ein bisschen«, lächelte Judy. »Er ist einfach zu alt für die Aufgabe des Chefbutlers. Der Job erfordert enorme Umsicht und robuste Kräfte. Beides lässt Mr Sykes seit einiger Zeit vermissen.«
Judy hatte recht, Violet wollte es nur nicht zugeben. »Dabei bemüht er sich so, sein wahres Alter zu verbergen.«
»Es sind Fehler gemacht worden, gravierende Fehler, Vi. Ständig hat Sykes etwas am Herzen, immer häufiger ruht er sich aus.«
»Er muss …« Violet überlegte. »Er muss fast achtzig sein.«
Mit einem Lächeln gab Judy zu erkennen, dass dies der springende Punkt war. »Deshalb kann und darf man Mr Sykes nicht länger zumuten, ein dreistündiges Galadinner im Stehen zu absolvieren, bis sich die Herren an der Tafel zu Zigarren und Brandy zurückziehen.«
»Für die Beaufsichtigung der großen Dinners gibt es natürlich Jüngere«, stimmte Violet zu.
»Was hältst du davon, wenn du jemanden kennenlernst, der mir wärmstens empfohlen wurde? Dieser Mann wäre ideal, um Mr Sykes zu ersetzen … oder sagen wir, um ihn zu entlasten.«
»Du hast bereits Bewerber für seine Nachfolge kommen lassen, obwohl wir uns nicht einig sind, dass Sykes gehen muss?« Der Wermut schmeckte Violet nicht, sie stellte ihn beiseite.
»Selbstverständlich geschieht nichts ohne deine Einwilligung«, räumte Judy ein. »Andererseits hast du mir den Auftrag gegeben, stets vorauszudenken.«
Judy meinte es gut, dachte Violet. Nur weil sie ein inniges Verhältnis zu dem alten Chefbutler hatte, bedeutete das nicht, dass er diesen Posten für immer ausfüllen konnte. Der liebe, gute, strenge Mr Sykes hatte Violet buchstäblich auf seinen Armen gewiegt. Damals, als sein Haar noch schwarz und sein Gang noch jugendlich gewesen war, hatte sie sich jederzeit an ihn wenden können, auch während der schlimmen Zeit, als sie mit vier Jahren ihre Mutter verlor, die Tochter von Sir Laurence. Violets Vater, der ewig erfolglose Komiker, war kurz darauf ebenfalls aus ihrem Leben verschwunden. Damals war Mr Sykes Violets Nanny gewesen, zugleich ihr freundlicher Onkel und ihr Freund. Wahrscheinlich hatte auch er den Ausschlag gegeben, dass Violet im Savoy bleiben durfte. Ihr Großvater hatte Zweifel gehabt, ob es richtig für ein Kind sei, im Labyrinth dieses Hotels aufzuwachsen. Mr Sykes hatte dafür gebürgt, dass es dem kleinen Mädchen an nichts fehlen sollte. Wenn er selbst keine Zeit hatte, um auf sie zu schauen, war sie in die Obhut mütterlicher Zimmermädchen gekommen. Er hatte ebenfalls dafür gesorgt, dass Violet schon mit fünf Jahren Französisch- und Deutschunterricht bekam. Es fiel ihr schwer, diesen guten, treuen Mann ins Ausgedinge zu schicken.
»Wer ist dieser Bewerber, den wir uns ansehen sollten?«, fragte Violet.
Judy trat einen Schritt näher. »Er heißt Timothy Cordle und dient bei Lord Trentham. Du weißt, das Anwesen der Trenthams ist riesig, und die Festivitäten des Lords sind exotisch und aufwendig. Bei einem solchen Herrn als Chefbutler zu bestehen, will schon etwas besagen.«
»Na gut. Ich werde ihn mir irgendwann ansehen.«
»Das trifft sich blendend.« Judy kehrte zum Schreibtisch zurück. »Lord Trentham ist gerade unser Gast. Cordle dürfte also hier im Haus sein.«
Violets Augen wurden schmal, sie ließ sich gegen die Lehne sinken. »Willst du damit sagen, ich soll mich für deinen Kandidaten entscheiden, bevor wir überhaupt mit Mr Sykes gesprochen haben?«
»Es ist reiner Zufall, dass Trentham zurzeit hier wohnt«, beschwichtigte Judy.
»Wirklich?« Violets Ton war scherzhaft, aber sie ließ Judy spüren, dass eine Portion Wahrheit in ihren Worten steckte. »Ist es nicht eher ein Schachzug der raffinierten Judy Wilder, die mich in dem Glauben lässt, dass ich in diesem Haus die wichtigen Entscheidungen treffe?«
»Ich fürchte, wir müssen noch über eine andere Entscheidung sprechen, Vi. Und sie wird dir noch mehr wehtun, als Mr Sykes in den Ruhestand zu schicken.«
»Was ist es?«
»Wir müssen die Stelle endlich nachbesetzen.«
»Die … Stelle?« Etwas im Innern zwang Violet, nicht gleich zu verstehen, was Judy meinte.
»Es geht jetzt nicht mehr anders. Dein Haus bricht allmählich auseinander. Ständig sind wir nur daran, das Schlimmste zu verhindern. So kann es nicht weitergehen. Es tropft durch die Zimmerdecken, die alten Heizungsrohre klopfen nachts so laut, dass die Gäste sich beschweren. So etwas darf es im Savoy nicht geben. Am schlimmsten steht es um die Elektrik. Unsere Anlage stammt aus dem Jahr 1912! Moderne Stromanlagen leisten ein Vielfaches unserer antiquierten Kiste. Wir müssen das jetzt in Angriff nehmen, Vi, wir müssen Stockwerk für Stockwerk sperren und endlich mit den Renovierungsarbeiten beginnen. Wir brauchen gute Klempner, fähige Elektriker und Heizungsmonteure. Aber vor allem brauchen wir jemanden, der die Umgestaltung beaufsichtigt und von der Behörde abnehmen lässt. Wir müssen John endlich ersetzen, Vi. Bitte verzeih, dass ich dir das so offen ins Gesicht sage. Aber die Zeit ist reif.«
»John ersetzen?«, wiederholte Violet leise. Man konnte niemanden ersetzen, der tot war, dachte sie. Natürlich war es möglich, einen Hausmechaniker zu engagieren. Seit der Wirtschaftskrise suchten Hunderttausende qualifizierte Männer Arbeit, aber einen Freund, einen Geliebten, einen Lebensmenschen konnte man nicht ersetzen. Johns Tod lag nun bereits zwei Jahre zurück, trotzdem wurde es für Violet nicht leichter, daran zu denken.
»Du hast recht«, antwortete sie dennoch. »Willst du mir diesbezüglich auch Vorschläge machen?«
»Einverstanden.« Judys Blick war offenherzig. »Ich werde mich heute noch umtun.«
Violet stand auf. Bevor sie in die Öffentlichkeit des Hotelbetriebs zurückkehrte, wollte sie gewohnheitsmäßig einen Blick in den Spiegel werfen. Sie zuckte zurück. Violet konnte ihrem Gegenüber nicht in die Augen sehen. Diese Frau war schuld an Johns Tod. Kein Gericht der Welt würde Violet jemals dafür anklagen. Sie selbst war ihr eigener Richter. Sie allein wusste, was sie getan hatte.
»Bevor du gehst …« Judy tauchte in ihrem Spiegelbild auf. »Da der Butler schon einmal im Haus ist, wollen wir Mr Cordle nicht rasch heraufbitten?« Gelassen und freundlich schaute Judy ihr über die Schulter. »Er wird dir gefallen. Ich glaube, er könnte sogar Mr Sykes gefallen.«
Alles vergeht, dachte Violet und wandte sich vom Spiegel ab. Ich muss John hinter mir lassen, aber ich habe keine Ahnung, wie.
Judy griff zum Telefon und ließ sich mit der Suite von Lord Trentham verbinden.
* * *
Timothy Cordle justierte die Hosenträger seines Herrn. In der Rechten hielt Lord Trentham den Reisebericht über die koreanische Halbinsel, den er mit Spannung las, in der Linken eine Tasse Jasmintee. Die Körpermitte überließ der Lord seinem Butler.
»Zu stramm, Timmy«, murmelte Trentham, ohne den Blick von dem Buch zu nehmen.
»Verzeihung, Mylord.« Cordle lockerte die Spangen der Hosenträger ein wenig, trat zur Seite und brachte Lord Trentham die leichte graue Weste, die an einem kühlen Apriltag wie heute zwar nicht angebracht war, doch Trentham bestand darauf. Mit geschickten Bewegungen gelang es dem Butler, den Lord einerseits in die Weste schlüpfen zu lassen, ohne dass Trentham andererseits seine Lektüre unterbrechen oder die Tasse absetzen musste. Während Cordle die Westenknöpfe schloss, ging er ein wenig in die Knie. Es wäre ihm ungehörig erschienen, auf gleicher Augenhöhe wie sein Dienstherr zu stehen.
»Wann werden Sie im Savoy antreten, Timmy?« Nach einem Schluck Tee leckte sich Trentham die Lippen, Zeichen für Cordle, die Tasse zu übernehmen und dem Herrn die Serviette zu reichen. Der Lord tupfte sich über den Mund.
»Ist die Stelle offiziell schon ausgeschrieben, Sir?« Der Butler nahm die benützte Serviette entgegen.
»Offiziell? Das kümmert mich nicht.« Der Lord entfernte sich vom Butler, obwohl Cordle gerade auf die Knie ging, um ihm die Gamaschen über die Schuhe zu streifen. Lord Trentham trat an den Rauchertisch und öffnete die Zigarrenschatulle. »Ich habe Judy Wilder erklärt, dass Sie zu haben wären. Sie zeigte sich hocherfreut darüber. Das versteht sich auch von selbst, einen Besseren als Sie wird das Savoy nicht finden.«
»Vielen Dank, Sir.« Cordle befand sich im Zwiespalt. Er hätte aufspringen und dem Lord die Zigarre präparieren müssen, andererseits verharrte er, die rechte Gamasche in der Hand, immer noch auf den Knien. »Verzeihen Sie, dass ich nochmals davon anfange, Sir, aber meinen Sie nicht, dass ich Ihnen auf der Reise durch Asien von größerem Nutzen sein könnte?«
»Natürlich, Timmy, und ich werde Sie auch schmerzlich vermissen.« Der Lord schloss die Schatulle wieder, öffnete stattdessen ein flaches Silberetui und entnahm ihm eine Zigarette. »Aber ich halte Sie für zu kostbar, um Ihr Leben in der Position eines Kammerdieners zu fristen.«
»Eine Position, die ich in Ihrer Nähe als höchst erstrebenswert erachte«, getraute sich Cordle einzuwerfen.
»Ich weiß, nichts geht über Ihre Treue und Loyalität.« Der Lord ließ den Blick über den Rauchertisch schweifen. Ein Streichholz war nirgends zu entdecken. »Aber ich möchte, dass im Leben etwas aus Ihnen wird, Timmy. Deshalb ist die Stelle des Chefbutlers im Savoy genau das Richtige für Sie.«
Geschmeidig, dabei schnell wie der Blitz, kam Cordle auf die Beine, zauberte eine Schachtel Schwedenhölzchen hervor und gab seinem Herrn Feuer. »Wann erwarten Sie die Antwort von Mrs Wilder?«
»Ich erwarte keine Antwort«, entgegnete Lord Trentham mit leichtem Stirnrunzeln. »Ich gehe von einem prompten Vollzug aus.«
»Verzeihen Sie, Sir.« Um dem Stirnrunzeln, einer der schärferen Unwillensäußerungen des Lords, zu entgehen, sank Cordle auf die Knie und brachte die Gamasche dort an, wo sie hingehörte. Dafür musste der Lord für einen Augenblick den Fuß heben, Cordle griff ihm stützend unter die Schuhsohle.
Das Telefon klingelte. In der labilen Position, in der sich Herr und Diener befanden, war es keinem möglich, zum Hörer zu greifen. Es klingelte ein zweites und drittes Mal. Die Gamasche saß, Cordle ließ den Fuß des Lords los und eilte zum Apparat.
»Suite von Lord Trentham? – Ich will nachsehen, ob Seine Lordschaft zugegen ist.« Cordle hielt die Sprechmuschel zu. »Mrs Wilder, Sir«, rief er leise und prononciert.
Ohne Eile kam Trentham näher. »Also ist es so weit. Jetzt müssen Sie sich entscheiden, mein Lieber.« Mit zur Seite geneigtem Kopf blieb der Lord vor dem Butler stehen. »Sie haben mir auf die bestmögliche Weise gedient, Timmy. Wir hatten gute Jahre miteinander, nicht wahr?«
»Die schönsten meines Lebens, Mylord. Darf ich Ihnen nochmals vorschlagen, mich als Reisebegleiter in Erwägung zu ziehen?«
Mit erhobenem Zeigefinger gab der Lord zu erkennen, dass die Entscheidung gefallen war. »Ich werde Japan bereisen, China und sogar die mongolische Steppe. Möglicherweise bin ich jahrelang unterwegs. Nein, wie heißt es so schön: Bring das Heu in die Scheuer, solange die Sonne scheint.«
»So heißt es wohl, Mylord.«
»Nun denn, Timmy: Bring das Heu in die Scheuer.«
»Wie Sie wünschen, Mylord.« Cordle erlaubte sich, zu lächeln, und machte dabei eine leichte Verbeugung. Trentham nahm den Telefonhörer entgegen.
»Liebe Mrs Wilder«, rief er etwas zu laut. Der Lord konnte sich noch nicht an den Gedanken gewöhnen, dass die Schallwellen seiner Stimme auf elektrischem Wege in andere Räume geleitet wurden. Er hatte nach wie vor die Angewohnheit, die Distanz zu einem Gesprächspartner am Telefon durch Schreien verringern zu wollen. Er lauschte einen Moment, dann zwinkerte er Cordle ungewohnt leutselig zu. »Mein Butler? Ja, richtig, wir hatten darüber gesprochen.«
3Die Vorbereitung
Violet betrachtete die Sintflut. Der Haupthahn war längst abgedreht worden, trotzdem floss das Wasser ungehindert durch den Korridor. Der stahlblaue Teppich, über den manche Gäste beim Darüberlaufen staunend bemerkten, dass er jedes Geräusch schluckte, hatte sich in einen unterseeischen Algengarten verwandelt. Mr Sykes trug Gummistiefel zum Frack. Er hatte Violet ebenfalls ein Paar davon mitgebracht, doch er kam zu spät. Sie hatte ihre Pumps ausgezogen und band das knöchellange Kleid hoch. Barfuß arbeitete sie sich durch das Wasser auf die Quelle des Unglücks zu.
»Wollen Sie nicht die Stiefel nehmen?« Sykes stakste hinter ihr her. »Sie könnten sich etwas eintreten, Miss Violet.«
»Ist die Feuerwehr schon unterwegs?«, rief sie über die Schulter. »Wo ist der Mann, der es entdeckt hat?«
»Sie laufen direkt auf ihn zu.« Sykes folgte, so schnell er konnte. »Die Feuerwehr müsste in ein paar Minuten …«
Violet hörte ihn nicht mehr. Ein beängstigendes Geräusch nahm sie gefangen. Überall gluckerte und tropfte, floss und rann es, als befände man sich in einer Tropfsteinhöhle. Violet betrat die Tydlehoff-Suite. Bis zu den Waden im Wasser watend betrachtete sie das Bild der Zerstörung. Die Stehlampen waren umgestürzt und erloschen, durch den Schirm der einen floss ein schmutzig brauner Sud. Aufgequollen lagen die Sitzkissen der Chaiselongue im Wasser, zwei Gemälde mit Jagdmotiven waren von der Wand gefallen und trieben obenauf. Servietten mit dem Monogramm des Savoy schwammen vorbei, eine Teebüchse war aufgegangen, Earl Grey und Darjeeling vermischten sich zu einer trüben Brühe. Violet watete ins Bad. Erstaunlicherweise war hier fast alles trocken geblieben. Die Wanne war leer.
»Woher …« Sie holte tief Luft. »Woher ist all das Wasser gekommen?«
Ein junger Mann saß auf dem Deckel der Toilette. »Miss Mason.« Er stand auf, machte sich aber nicht die Mühe, vor seiner Chefin die Uniformjacke zu schließen.
»Otto? Was machst du denn hier?«
»Ich sollte der Lady von zweihundertfünfzehn Besorgungen aufs Zimmer bringen. Da habe ich bemerkt, dass Wasser bei der Tür austrat.« Auch er hatte die Schuhe ausgezogen und die Hosenbeine hochgekrempelt.
»Bei dieser Tür?« Violet wandte sich zum Badezimmereingang.
»Nein, vorne, bei der Zimmertür.«
»Wie konnte das passieren?« Sie kehrte in den Living Room zurück.
Otto und Violet waren alte Bekannte. Der junge Mann aus Bayern hatte unter Sir Laurence zur gleichen Zeit als Liftpage angefangen, als Violet in die Geschicke des Hotels verstrickt worden war. Jahrelang hatte Otto Gäste im Fahrstuhl auf und abgefahren, doch inzwischen war er zum Supervisor aufgestiegen und beaufsichtigte die Liftpagen sämtlicher Aufzüge. Schon als Halbwüchsiger hatte Otto flott ausgesehen, mittlerweile war er zu einer männlichen Augenweide herangewachsen. Unter den Hotelgästen gab es Damen, die sich von Otto nicht nur ihre Pakete aufs Zimmer bringen ließen. Violet hatte davon gehört, wollte derlei aber gar nicht zu genau wissen. Ein Heer von Zimmermädchen, Köchinnen und Gesellschaftsdamen hatten während der Jahre für Otto geschwärmt, Violet billigte auch das. Solange Ottos Arbeit und die der Mädchen nicht darunter litt, belebte es die Atmosphäre des Hotels.
»Erzählen Sie schon, Otto. Wo kam das Wasser her?«
Mit platschenden Schritten folgte er ihr. »Es ist bei den seitlichen Ritzen zur Tür herausgekommen. Ich bin auf dem Korridor gestanden, habe geklopft und gerufen. Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand vergessen hat, das Badewasser abzudrehen. Als sich niemand meldete, habe ich meinen Hauptschlüssel benutzt.«
»Du bist im Besitz eines Generalschlüssels?«, fragte Violet überrascht.
»Ich habe einen, weil ich doch manchmal in die Zimmer muss, um …« Otto haspelte.
»Schon gut. In diesem Fall war das gewissermaßen unsere Rettung, dass du hineinkonntest. Du hast also aufgeschlossen – und dann?«
»So einfach war das nicht. Sehen Sie, die Tür geht nach innen auf. Sie ließ sich auch mit dem Schlüssel nicht öffnen, also habe ich mich mit aller Kraft dagegengestemmt. Die Flut schoss mir förmlich entgegen. Das Wasser stand knietief in der Suite. Leider war es zu spät, die Tür wieder zu schließen. Alles ergoss sich auf den Flur und immer weiter und …«
»Wo könnte das Wasser hergekommen sein?«, rief Violet mit geballten Fäusten.
Otto zeigte zur Decke. Über dem offenen Kamin befand sich ein großes Loch. »Ich nehme an, dort oben steht ein Wasserspeicher. Er muss geplatzt sein.«
Verdammter alter Kasten, verdammtes runtergekommenes Luxuskarussell, dachte sie, das sich Tag für Tag und Nacht für Nacht weiterdrehen musste, obwohl man es längst hätte abschalten und reparieren müssen. Es hatte Zeiten gegeben, als das Savoy das erste Hotel Londons gewesen war, in dem elektrische Aufzüge zwischen den Etagen surrten, eines der ersten, wo sich die Gäste über ein Badezimmer en-suite freuen durften. Hier hatte Claude Monet von seinem Zimmer aus die Themse gemalt, hier hatten gekrönte Häupter, Premierminister und Regierungen gespeist, hier war das Pfirsich-Melba-Dessert erfunden worden. Mittlerweile wirkte das Haus erschöpft, verbraucht und ausgelaugt, es war im höchsten Grad renovierungsbedürftig. John hatte Violet bereits vor Jahren davor gewarnt, dass das Innenleben des Hotels veraltet sei.
Was musste geschehen? Mit wem konnte Violet offen darüber sprechen? Nicht nur, was die Sanierung betraf, wer gab ihr einen Rat, der das Ganze erfasste, das große Ganze, das sie mehr und mehr aus den Augen verlor? Für einen Moment wünschte sie sich, ihr Leben von außen betrachten zu können. Was war inzwischen aus Violet Mason geworden, wohin führte ihr Weg? Die Richtung, aus der sie einmal gekommen war, hatte ihr eine andere Zukunft vorgezeichnet. Wenn sie damals nicht in die Fußstapfen ihres Großvaters getreten, sondern am Theater geblieben wäre, wenn sie beim Radio weiter ihr Glück versucht hätte, wo stünde sie dann heute? Wenn sie sich für Max, den Chefredakteur der BBC, und gegen das Hotel entschieden hätte, was wäre dann gewesen? Sie ließ den Kopf sinken, die nächste Frage fiel ihr schwer. Was wäre wohl geschehen, wenn sie John, ihren Geliebten, seine eigene Entscheidung hätte treffen lassen, statt ihm die ihre aufzudrängen?
Violet wusste, zu wem sie gehen musste. Weniger um Fragen beantwortet zu bekommen, sondern um die Kraft und Ruhe zu finden, die sie brauchte, um sich dem Schlamassel zu stellen, in den das Savoy durch die Katastrophe geraten war. Zumindest der Osttrakt musste sofort geschlossen werden. Alle Zimmer unterhalb der Tydlehoff-Suite waren fürs Erste unbrauchbar. Es würde Wochen dauern, die Wasserschäden in den angrenzenden Trakten zu beseitigen. Gäste mussten umquartiert, Veranstaltungen verlegt werden, wahrscheinlich war es sogar nötig, zeitweilig eine Dependance zu finden. Zuallererst musste Violet aber jenen Mann engagieren, der das Problem an der Wurzel packen würde, einen Nachfolger für John.
Sie hatte vorgehabt, heute noch mit Mr Sykes zu sprechen und ihn vorsichtig auf die kommenden Schritte vorzubereiten. Doch als der Chefbutler nun die Suite betrat, gefolgt von den Männern des Feuerwehrkommandos, verwarf sie ihre Absicht. Der alte Mann in Frack und Gummistiefeln hatte an diesem Tag bereits genug zu verkraften. Es war undenkbar, ihn auch noch mit seiner eigenen Pensionierung zu konfrontieren.
Männer in dicken Jacken und Helmen, mit langen Schläuchen und unförmigen Pumpen betraten die überflutete Suite. Barfuß, wie sie war, hieß Violet die Feuerwehr willkommen.
* * *
Ayumi schlang den Maru-Obi zum vierten Mal um Bauch und Rücken, bevor sie den breiten Gürtel einmal umschlug und über die Schulter legte. Wegen seines Gewichts und der komplizierten Art, ihn anzulegen, wurde der Maru-Obi üblicherweise nur bei Hochzeiten verwendet. Er bestand aus Brokat und war mit Goldfäden durchwirkt. Seine hellrote Farbe entsprach dem Frühlingsmonat April, doch durch die intensive Musterung spielte der Obi von den Farben des Sandes bis zum Ochsenblut. Jede seiner Schattierungen kontrastierte auf das Wunderbarste mit dem schwerelosen Seidenkimono, den Ayumi darunter angelegt hatte.
Sie vollendete das Binden des Obi mit der traditionellen Rückenschlaufe. Ihr Make-up war abgeschlossen. Unter Verwendung zweier Spiegel hatte sie ein Muster im Nacken aufgetragen, das dem heutigen Anlass entsprach. Normalerweise bestand es aus zwei Linien, die an bestimmten Stellen die Hautfarbe der Geisha durchschimmern ließen. An diesem Abend hatte Ayumi drei Linien gewählt, um die erotische Spannung zu erhöhen. Nur im Nacken lüftete die Geisha das Geheimnis ihrer Haut, ihr Gesicht dagegen war durch die weiße Paste fast unkenntlich. Sie hatte die Augen wie stets betont und die Brauen durch dünne Linien nachgezeichnet.
Fujiwara-san liebte es, wenn Ayumi während ihrer nächtlichen Begegnungen das eigene Haar zur Schau trug. Heute hatte sie sich für die Perücke entschieden, die seit Längerem unbenutzt im Schrank lag. Ayumi hatte das lange schwere Haar geöffnet, sorgfältig gebürstet, das aufgebauschte Oberhaar getrimmt und schließlich die wareshinobu frisiert. Zu dieser Form der Perücke passte der Haarschmuck, den Ayumi für die Zeremonie bereitlegte. Der Kanzashi