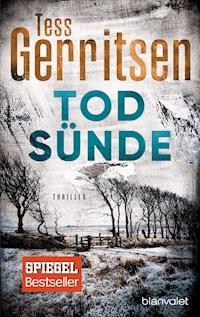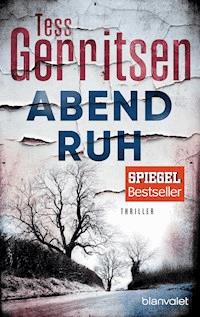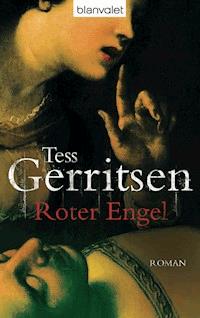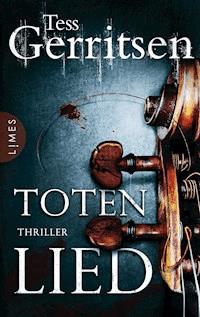9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein unheimliches altes Haus, eine verschwundene Frau und ein dunkles Geheimnis, das tief in die Vergangenheit reicht ...
Nach einem tragischen Ereignis flüchtet Ava von Boston auf eine abgelegene Halbinsel an der Küste Maines. Dort mietet sie ein altes herrschaftliches Haus und hofft, endlich zur Ruhe zu kommen und Inspiration für ihr neues Buch zu finden. Obwohl das Haus zunächst düster und unheimlich wirkt, übt es doch eine unerklärliche Anziehungskraft auf sie aus. Dann beginnt sie plötzlich seltsame Geräusche zu hören, und eines nachts glaubt sie eine schattenhafte Gestalt hinter den Vorhängen in ihrem Schlafzimmer zu sehen. Von den Dorfbewohnern erfährt sie von dem mysteriösen Verschwinden ihrer Vormieterin. Als Ava beginnt nachzuforschen, kommt sie hinter ein verstörendes Geheimnis, das verzweifelt gewahrt werden soll …
Tess Gerritsen ist neben den Stand-alones »Gute Nacht, Peggy Sue«, »Kalte Herzen«, »Roter Engel«, »Trügerische Ruhe«, »In der Schwebe«, »Leichenraub« und »Totenlied« auch die Autorin der erfolgreichen Thriller-Reihe um das Ermittlerduo Rizzoli & Isles.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Nach einem tragischen Ereignis flüchtet Ava von Boston auf eine abgelegene Halbinsel an der Küste Maines. Dort mietet sie ein altes herrschaftliches Haus und hofft, endlich zur Ruhe zu kommen und Inspiration für ihr neues Buch zu finden. Obwohl das Haus zunächst düster und unheimlich wirkt, übt es doch eine unerklärliche Anziehungskraft auf sie aus. Dann beginnt sie plötzlich seltsame Geräusche zu hören, und eines Nachts glaubt sie eine schattenhafte Gestalt hinter den Vorhängen in ihrem Schlafzimmer zu sehen. Von den Dorfbewohnern erfährt sie von dem mysteriösen Verschwinden ihrer Vormieterin. Als Ava beginnt nachzuforschen, kommt sie hinter ein verstörendes Geheimnis, das verzweifelt gewahrt werden soll …
Autorin
So gekonnt wie Tess Gerritsen vereint niemand erzählerische Raffinesse mit medizinischer Detailgenauigkeit und psychologischer Glaubwürdigkeit der Figuren. Bevor sie mit dem Schreiben begann, war die Autorin selbst erfolgreiche Ärztin. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit dem Thriller »Die Chirurgin«, in dem Detective Jane Rizzoli erstmals ermittelt. Seither sind Tess Gerritsens Thriller um das Bostoner Ermittlerduo Rizzoli & Isles von den internationalen Bestsellerlisten nicht mehr wegzudenken. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Maine.
Weitere Informationen unter: www.tess-gerritsen.de
Von Tess Gerritsen bereits erschienen
Gute Nacht, Peggy Sue · Kalte Herzen · Roter Engel· Trügerische Ruhe · In der Schwebe · Leichenraub · Totenlied · Das Schattenhaus · Die Studentin
Die Rizzoli & Isles-Romane
Die Chirurgin · Der Meister · Todsünde · Schwesternmord · Scheintot · Blutmale · Grabkammer · Totengrund · Grabesstille · Abendruh · Der Schneeleopard · Blutzeuge · Mutterherz
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Tess Gerritsen
Das Schattenhaus
Roman
Deutsch von Andreas Jäger
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Shape of Night« bei Ballantine Book, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeiftung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen
Copyright der Originalausgabe © 2019 by Tess Gerritsen
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published by Arrangement with Tess Gerritsen Inc.
Dieses Werk wurde im Auftrag von Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Redaktion: Gerhard Seidl
Covergestaltung und -motiv: © www.buerosued.de
JaB · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25131-4V005
www.limes-verlag.de
Für Clara
Prolog
Ich träume immer noch von Brodie’s Watch, und es ist jedes Mal der gleiche Albtraum. Ich stehe in der gekiesten Auffahrt, und das Haus ragt vor mir auf wie ein Geisterschiff, das im Nebel dahintreibt. Die Schwaden wabern und schlingern um meine Füße, überziehen meine Haut mit eisigem Reif. Ich höre die Wellen vom Meer heranrollen und krachend gegen die Klippen schlagen, und über mir warnen mich die Möwen mit lautem Gekreisch, diesem Ort auf keinen Fall zu nahe zu kommen. Ich weiß, dass der Tod hinter dieser Haustür lauert, und doch kehre ich nicht um, denn das Haus ruft mich. Vielleicht wird es mich immer rufen. Sein Sirenengesang zwingt mich, noch einmal die Stufen zur Veranda hinaufzusteigen, wo die Schaukel knarrend hin- und herschwingt.
Ich öffne die Tür.
Drinnen ist nichts mehr, wie es sein sollte. Das ist nicht mehr das prächtige Haus, in dem ich gewohnt und das ich geliebt habe. Das massive, geschnitzte Treppengeländer ist von Kletterpflanzen umrankt, die sich wie grüne Schlangen um den Handlauf winden. Der Fußboden ist mit welkem Laub übersät, hereingeweht durch die zerbrochenen Fenster. Ich höre das stete Tropfen des Regenwassers, das von der Decke fällt, und als ich aufblicke, sehe ich einen einzelnen Kristallanhänger von den kahlen Armen des Kronleuchters baumeln. Über die Wände, einst cremeweiß gestrichen und mit hübschen Stuckleisten verziert, ziehen sich jetzt schwarze Schimmelbahnen. Lange bevor Brodie’s Watch hier stand, bevor die Männer, die das Haus erbauten, Holz und Steine hinaufschleppten und Balken an Pfosten nagelten, gab es auf diesem Hügel nur Moos und Bäume. Jetzt erobert der Wald sein Reich zurück. Brodie’s Watch ist auf dem Rückzug, und der Geruch des Verfalls hängt in der Luft.
Irgendwo über mir höre ich das Summen von Fliegen, und als ich die Treppe hinaufgehe, wird das ominöse Geräusch immer lauter. Die einst so stabilen Stufen, die ich jeden Abend erklommen habe, ächzen und geben unter meinem Gewicht nach. Der Handlauf, vormals zu seidigem Glanz poliert, starrt vor Dornen und Ranken. Ich erreiche den oberen Treppenabsatz, und eine Fliege taucht auf, umkreist surrend meinen Kopf und attackiert mich im Sturzflug. Eine zweite gesellt sich dazu, dann eine dritte, während ich den Flur entlang zum Schlafzimmer gehe. Durch die geschlossene Tür kann ich das gierige Brummen der Fliegen im Zimmer hören. Irgendetwas da drin hat sie angelockt.
Ich öffne die Tür, und schlagartig wird aus dem Brummen ein Dröhnen. Sie fallen über mich her, eine dichte Wolke, die mir den Atem raubt. Ich wedle mit den Händen, schlage wild um mich, doch schon wimmeln meine Haare, meine Augen, mein Mund von ihren Leibern. In diesem Moment erst wird mir klar, was die Fliegen in diesen Raum gelockt hat. In dieses Haus.
Ich bin es selbst. Sie laben sich an mir.
1
Solche Vorahnungen plagten mich nicht an jenem Tag Anfang August, als ich in den North Point Way einbog und zum ersten Mal nach Brodie’s Watch fuhr. Ich wusste nur, dass die Straße reparaturbedürftig war und der Belag von den Wurzeln der vordringenden Bäume unterminiert wurde. Die Frau von der Hausverwaltung hatte mir am Telefon erklärt, dass das Haus über hundertfünfzig Jahre alt und noch nicht ganz fertig renoviert sei. In den ersten paar Wochen würde ich noch damit leben müssen, dass zwei Zimmerleute oben im Turmzimmer ihre Hämmer schwangen, aber das war auch der Grund, warum ein Haus mit einem so imposanten Seeblick für einen Apfel und ein Ei vermietet wurde.
»Die letzte Mieterin musste vor ein paar Wochen die Stadt verlassen, Monate vor dem Auslaufen ihres Mietvertrags. Sie haben mich also genau im richtigen Moment angerufen«, sagte sie. »Der Eigentümer möchte das Haus nicht den ganzen Sommer leer stehen lassen, und er ist sehr daran interessiert, jemanden zu finden, der es pfleglich behandelt. Er hofft, wieder an eine Frau vermieten zu können. Frauen sind verantwortungsbewusster, meint er.«
Und jetzt hat er seine neue Mieterin gefunden: mich.
Auf dem Rücksitz miaut Hannibal, mein Kater, zum Gotterbarmen und verlangt, aus der Transportbox befreit zu werden, in der er gefangen ist, seit wir vor sechs Stunden in Boston losgefahren sind. Ich drehe mich zu ihm um und sehe, wie er mich durch die Gitterstäbe anfunkelt, ein massiger Maine-Coon-Kater mit wutblitzenden grünen Augen. »Wir sind fast da«, versichere ich ihm, obwohl ich allmählich schon befürchte, falsch abgebogen zu sein. Wurzeln und Frost haben den Asphalt rissig gemacht, und die Bäume scheinen immer näher zu rücken. Mein alter Subaru, schwer beladen mit Gepäck und Küchengeräten, schrappt über die Straße, als wir durch einen immer enger werdenden Tunnel aus Tannen und Kiefern rumpeln. Es gibt hier keinen Platz zum Wenden, mir bleibt nichts anderes übrig, als weiter diese Straße hinaufzufahren, wohin sie auch führen mag. Hannibal miaut wieder, diesmal noch dringlicher, wie um mich zu warnen: Halt jetzt an, bevor es zu spät ist.
Durch die überhängenden Äste erblicke ich hier und da ein Stückchen grauen Himmel, dann weicht der Wald plötzlich einem breiten, mit Flechten bewachsenen Granithang. Das verwitterte Schild bestätigt, dass ich die Zufahrt zu Brodie’s Watch erreicht habe, doch der ansteigende Weg verliert sich in derart dichtem Nebel, dass ich vom Haus noch nichts sehen kann. Die Räder drehen durch, und Schotter spritzt auf, als ich meinen Weg über die nicht geteerte Auffahrt fortsetze. Dunstschwaden verschleiern den Blick auf windgepeitschtes Gestrüpp und kahle Granitflächen, doch ich kann die Möwen hören, die über uns kreisen, kreischend wie eine Legion von Geistern.
Und dann taucht plötzlich das Haus vor mir auf.
Ich stelle den Motor ab. Eine Weile sitze ich einfach nur da und starre zu Brodie’s Watch hinauf. Kein Wunder, dass es vom Fuß des Hügels aus nicht zu sehen war. Mit seinen grauen Schindeln ist es im Nebel perfekt getarnt, und nur ganz vage kann ich einen Erkerturm ausmachen, der in die tief hängenden Wolken ragt. Das muss doch wohl ein Irrtum sein – man hat mir gesagt, dass es ein großes Haus sei, aber mit einem solchen Herrenhaus habe ich nun wirklich nicht gerechnet.
Ich steige aus und betrachte die Schindeln, von Wind und Wetter zu silbrigem Grau verblasst. Auf der Veranda schwingt eine Schaukel quietschend vor und zurück, wie von einer unsichtbaren Hand angestoßen. Sicherlich ist das Haus zugig, die Heizung uralt, und ich stelle mir feuchte Zimmer vor, erfüllt von Schimmelgeruch. Nein, das ist nicht das, was mir als Refugium für den Sommer vorgeschwebt hat. Ich hatte auf ein ruhiges Plätzchen zum Schreiben gehofft, einen stillen Rückzugsort.
Einen Ort der Heilung.
Doch dieses Haus wirkt abweisend auf mich, seine Fenster starren mich an wie feindselige Augen. Die Möwen schreien lauter, mahnen mich, die Flucht zu ergreifen, solange ich noch kann. Ich weiche zurück und will gerade wieder in meinen Wagen steigen, als ich das Knirschen von Reifen auf dem Schotterweg vernehme. Ein silberfarbener Lexus hält hinter meinem Subaru, eine blonde Frau steigt aus und winkt, während sie auf mich zugeht. Sie ist ungefähr in meinem Alter, schlank und attraktiv, und alles an ihr strahlt Optimismus und Selbstvertrauen aus, von ihrem Brooks-Brothers-Blazer bis hin zu ihrem Lächeln, das zu sagen scheint: Ich bin Ihre beste Freundin.
»Sie sind Ava, stimmt’s?«, sagt sie und streckt die Hand aus. »Entschuldigen Sie bitte die kleine Verspätung. Ich hoffe, Sie haben nicht allzu lange warten müssen. Ich bin Donna Branca, die Hausverwalterin.«
Während wir Hände schütteln, suche ich schon fieberhaft nach Ausreden, um aus dem Mietvertrag auszusteigen. Dieses Haus ist zu groß für mich. Zu abgelegen. Zu unheimlich.
»Wunderschön hier, nicht wahr?«, schwärmt Donna und deutet auf die kahlen Granitfelsen. »Zu schade, dass man wegen des Wetters gerade nichts sehen kann, aber wenn der Nebel sich erst mal verzogen hat, wird der Seeblick Sie von den Socken hauen.«
»Es tut mir leid, aber dieses Haus ist nicht ganz das, was …«
Aber sie geht schon die Verandastufen hinauf, die Hausschlüssel in der Hand. »Sie hatten Glück, dass Sie genau im richtigen Moment angerufen haben. Gleich nachdem wir miteinander gesprochen haben, kamen zwei weitere Anfragen zu diesem Haus rein. Diesen Sommer ist in Tucker Cove die Hölle los, die Touristen reißen sich regelrecht um die Ferienwohnungen. Offenbar will dieses Jahr niemand den Sommer in Europa verbringen. Die Leute machen lieber Urlaub vor der Haustür.«
»Es freut mich zu hören, dass es noch andere Interessenten für das Haus gibt. Ich glaube nämlich, dass es für mich eine Nummer zu …«
»Voilà. Immer rein ins traute Heim.«
Die Tür schwingt auf und gibt den Blick auf glänzendes Eichenparkett und eine Treppe mit kunstvoll geschnitztem Holzgeländer frei. Sämtliche Ausreden, die mir auf der Zunge lagen, lösen sich mit einem Mal in Luft auf, und eine unwiderstehliche Macht scheint mich über die Schwelle zu ziehen. Im Eingang blicke ich zu einem Kristalllüster und einer Decke mit aufwendigen Stuckornamenten auf. Ich hatte damit gerechnet, dass das Haus kalt und feucht sein würde, dass es nach Staub und Schimmel müffeln würde, doch was ich jetzt rieche, ist frische Farbe und Politur. Und das Meer.
»Die Renovierungsarbeiten sind fast abgeschlossen«, erklärt Donna. »Die Zimmermänner haben noch ein wenig oben im Turmzimmer und auf dem Witwenbalkon zu tun, aber sie werden versuchen, Sie nicht zu stören. Und sie arbeiten nur an Werktagen, sodass Sie am Wochenende das Haus für sich haben. Der Eigentümer war bereit, die Miete für den Sommer zu senken, weil ihm klar ist, dass die Handwerker eine Unannehmlichkeit sind, aber sie werden nur noch ein paar Wochen hier sein. Danach haben Sie dieses fantastische Haus den ganzen Rest des Sommers für sich allein.« Sie sieht, wie ich die Deckenleisten bewundere. »Sie haben gute Arbeit geleistet bei der Renovierung, nicht wahr? Ned, unser Zimmermann, ist ein Meister in seinem Fach. Es gibt niemanden, der dieses Haus so in- und auswendig kennt wie er. Kommen Sie, ich zeige Ihnen auch noch den Rest. Da Sie vermutlich Rezepte ausprobieren werden, möchten Sie sicher zuerst einen Blick in die fantastische Küche werfen.«
»Habe ich Ihnen erzählt, was ich mache? Ich kann mich nicht erinnern, es erwähnt zu haben.«
Sie lacht ein wenig verlegen. »Sie haben am Telefon gesagt, dass Sie Food-Autorin sind, und ich konnte es mir nicht verkneifen, Sie zu googeln. Ich habe schon Ihr Buch über Olivenöle bestellt. Ich hoffe, Sie werden es mir signieren.«
»Mit Vergnügen.«
»Ich glaube, Sie werden feststellen, dass dieses Haus der perfekte Ort zum Schreiben ist.« Sie geht voran in die Küche, einen hellen, luftigen Raum mit schwarzen und weißen Bodenfliesen, angeordnet in einem geometrischen Muster. »Die Küche verfügt über einen Gasherd mit sechs Brennern und einen extragroßen Backofen. Ich fürchte, an Kochgeschirr ist nur das Nötigste vorhanden, nur ein paar Töpfe und Pfannen, aber Sie sagten ja, dass Sie Ihre eigenen Sachen mitbringen.«
»Ja. Ich habe eine lange Liste von Rezepten, die ich ausprobieren muss, und ich gehe nirgendwohin ohne meine Messer und Pfannen.«
»Und worum geht es in Ihrem neuen Buch?«
»Um die traditionelle Küche Neuenglands. Ich interessiere mich dafür, wie in den Seemannsfamilien gekocht wurde.«
Sie lacht. »Ich schätze mal, gesalzener Kabeljau mit noch mehr gesalzenem Kabeljau.«
»Es geht auch um ihre Lebensweise. Die langen Winter und die kalten Nächte, und all die Gefahren, denen sich die Fischer aussetzten, nur um ihren Fang nach Hause zu bringen. Es war nicht leicht, vom Meer zu leben.«
»Nein, das war es sicher nicht. Und der Beweis dafür ist im nächsten Raum.«
»Was meinen Sie?«
»Ich zeig’s Ihnen.«
Wir gehen weiter in einen kleinen Salon, wo im Kamin schon Holzscheite und Kienspäne zum Anzünden bereitliegen. Über dem Sims hängt ein Ölgemälde eines Schiffs, das auf aufgewühlter See krängt und dessen Bug die windgepeitschte Gischt durchschneidet.
»Dieses Gemälde ist nur eine Kopie«, sagt Donna. »Das Original ist im Historischen Verein ausgestellt, unten im Ort. Dort haben sie auch ein Porträt von Jeremiah Brodie. Er war eine ziemlich beeindruckende Erscheinung. Groß, mit pechschwarzen Haaren.«
»Brodie? Heißt dieses Haus deswegen Brodie’s Watch?«
»Ja. Captain Brodie hat sein Vermögen als Schiffskapitän auf Fahrten zwischen hier und Schanghai gemacht. Er hat das Haus 1861 gebaut.« Sie betrachtet das Gemälde des Schiffs, das durch die Wellen pflügt, und erschaudert. »Ich werde seekrank, wenn ich das Bild nur anschaue. Für kein Geld der Welt würde ich einen Fuß auf so einen Kahn setzen. Segeln Sie?«
»Als Kind schon, aber ich bin seit Jahren auf keinem Boot mehr gewesen.«
»Diese Küste gehört angeblich zu den besten Segelgewässern der Welt, wenn das Ihr Ding ist. Meins ist es jedenfalls nicht.« Sie geht auf eine Doppeltür zu und stößt sie auf. »Und hier ist mein Lieblingsraum im ganzen Haus.«
Ich trete ein, und mein Blick wird sofort von der Aussicht in Bann gezogen. Durch die Fenster erblicke ich wabernde Nebelbänke, und der dunstige Schleier gibt nur flüchtige Blicke frei auf das, was dahinter liegt: das Meer.
»Wenn die Sonne rauskommt, wird dieser Ausblick Ihnen den Atem rauben«, sagt Donna. »Im Moment können Sie den Ozean nicht sehen, aber warten Sie nur bis morgen, bis dahin sollte der Nebel sich verzogen haben.«
Ich würde gerne noch an diesem Fenster verweilen, aber sie hat es offenbar eilig und ist schon weitergegangen in ein Esszimmer mit einem schweren Eichentisch und acht Stühlen. An der Wand hängt ein weiteres Seestück, allerdings von einem längst nicht so begabten Künstler. Der Name des Schiffs steht auf einem Messingschild am Rahmen.
The Minotaur.
»Das war sein Schiff«, sagt Donna.
»Das Schiff von Captain Brodie?«
»Es ist das, mit dem er untergegangen ist. Sein Erster Offizier hat dieses Bild gemalt und es Brodie geschenkt, in dem Jahr, bevor sie beide auf See den Tod fanden.«
Ich starre das Gemälde der Minotaur an, und die Härchen in meinem Nacken stellen sich plötzlich auf, als ob ein kühler Windstoß ins Zimmer gefahren wäre. Ich drehe mich sogar um, um zu sehen, ob ein Fenster offen steht, aber sie sind alle fest geschlossen. Donna scheint es ebenfalls zu spüren, und sie schlingt die Arme um den Oberkörper.
»Es ist kein sehr gutes Gemälde, aber Mr. Sherbrooke meint, es gehört zum Haus. Da der Erste Offizier es selbst gemalt hat, nehme ich an, dass die Details des Schiffs korrekt dargestellt sind.«
»Aber es ist ein bisschen verstörend, dass es hier hängt«, murmele ich, »wenn man weiß, dass dies das Schiff war, mit dem er untergegangen ist.«
»Genau das hat Charlotte auch gesagt.«
»Charlotte?«
»Ihre Vormieterin. Sie hat sich so sehr für seine Geschichte interessiert, dass sie unbedingt mit dem Eigentümer darüber sprechen wollte.« Donna wendet sich ab. »Kommen Sie, ich zeige Ihnen noch die Schlafzimmer.«
Ich folge ihr die gewundene Treppe hinauf und lasse meine Hand über den polierten Handlauf gleiten. Er ist aus kunstvoll verarbeitetem Eichenholz und fühlt sich robust und solide an. Dieses Haus ist gebaut, um Jahrhunderte zu überdauern, ein Zuhause für künftige Generationen, und doch steht es nun leer und wartet darauf, von einer alleinstehenden Frau und ihrer Katze bewohnt zu werden.
»Hatte Captain Brodie Kinder?«, frage ich.
»Nein, er hat nie geheiratet. Nach seinem Tod auf See ist das Haus an einen seiner Neffen gefallen, und danach hat es noch einige Male den Besitzer gewechselt. Heute gehört es Arthur Sherbrooke.«
»Warum wohnt Mr. Sherbrooke nicht selbst hier?«
»Er hat ein Haus unten in Cape Elizabeth bei Portland. Er hat dieses Haus vor Jahren von seiner Tante geerbt. Es war in einem ziemlich schlechten Zustand, als er es übernahm, und er hat schon ein Vermögen in die Renovierung gesteckt. Er hofft, dass ein Käufer es ihm abnimmt.« Sie hält inne und sieht mich an. »Für den Fall, dass Sie interessiert sind.«
»Ich könnte es mir niemals leisten, ein Haus wie dieses in Schuss zu halten.«
»Na ja, ich dachte mir, ich erwähne es einfach mal. Aber Sie haben recht, die Instandhaltungskosten für solche historischen Gebäude sind ein Albtraum.«
Während wir den oberen Flur entlanggehen, deutet sie durch die offenen Türen auf zwei spärlich eingerichtete Schlafzimmer und geht weiter zu einer Tür am Ende des Gangs. »Das hier«, sagt sie, »war Captain Brodies Schlafzimmer.«
Als ich eintrete, steigt mir erneut ein kräftiger Hauch Seeluft in die Nase. Unten war mir der Geruch nicht aufgefallen, aber diesmal ist er überwältigend – als ob ich direkt vor der tosenden Brandung stünde und die Gischt mir ins Gesicht spritzte. Und dann, von einem Moment auf den anderen, ist der Geruch verschwunden, als ob jemand ein Fenster geschlossen hätte.
»Sie werden diesen Blick lieben«, sagt Donna und zeigt auf das Fenster, obwohl man durch die Scheibe im Moment nur Nebel sehen kann. »Im Sommer geht genau dort die Sonne über dem Meer auf, da können Sie jeden Morgen das Naturschauspiel genießen.«
Ich betrachte stirnrunzelnd die unverhüllten Fenster. »Keine Vorhänge?«
»Nun ja, der Schutz vor neugierigen Blicken ist hier kein Thema, weil da draußen einfach niemand ist, der Sie sehen könnte. Das Grundstück reicht bis hinunter zur Flutlinie.« Sie dreht sich um und nickt zum Kamin. »Sie wissen, wie man Feuer macht, ja? Dass Sie immer zuerst den Rauchabzug öffnen müssen?«
»Ich war früher oft zu Besuch auf der Farm meiner Großmutter in New Hampshire, ich habe also reichlich Erfahrung mit offenen Kaminen.«
»Mr. Sherbrooke will nur sichergehen, dass Sie vorsichtig sind. So ein altes Haus kann im Handumdrehen in Flammen aufgehen.« Sie nimmt den Schlüsselbund aus der Tasche. »So, ich denke, jetzt haben Sie alles gesehen.«
»Sie sagten doch, dass es oben noch ein Turmzimmer gibt?«
»Oh, da wollen Sie jetzt nicht raufgehen. Im Moment herrscht dort das totale Chaos, alles voller Werkzeug und Holzlatten. Und betreten Sie auf keinen Fall den Witwenbalkon, bevor die Zimmerleute den Bodenbelag erneuert haben. Es ist nicht sicher.«
Ich habe die Schlüssel noch nicht genommen, die sie mir hinhält. Ich denke an den Moment, als ich das Haus zum ersten Mal erblickte – die Fenster, die mich anstarrten wie tote, glasige Augen. Brodie’s Watch schien mir keine Geborgenheit, keine Zuflucht zu bieten, und mein erster Impuls war es gewesen, gleich wieder umzukehren. Aber jetzt, da ich es betreten habe, die Luft geatmet und das Holz berührt habe, scheint alles anders zu sein.
Dieses Haus hat mich akzeptiert.
Ich nehme die Schlüssel.
»Falls Sie noch Fragen haben, ich bin von Mittwoch bis einschließlich Sonntag im Büro, und im Notfall bin ich immer mobil erreichbar«, sagt Donna, als wir hinausgehen. »In der Küche finden Sie eine nützliche Liste von örtlichen Telefonnummern, die Charlotte dort aufgehängt hat. Klempner, Arzt, Elektriker und so weiter.«
»Und wo hole ich meine Post ab?«
»Am unteren Ende der Zufahrt ist ein Briefkasten. Sie können aber auch ein Postfach in der Stadt mieten. So hat Charlotte es gemacht.« Sie bleibt neben meinem Auto stehen und starrt die Transportbox auf dem Rücksitz an. »Wow, das ist aber ein Prachtexemplar von Katze, das Sie da haben.«
»Er ist absolut stubenrein«, versichere ich ihr.
»Er ist ja riesig.«
»Ich weiß. Ich muss ihn auf Diät setzen.« Ich öffne die Tür und wuchte die Transportbox heraus. Hannibal faucht mich durch die Gitterstäbe an. »Er ist sauer, weil er die ganze Zeit im Auto eingesperrt war.«
Donna geht in die Hocke, um Hannibal genauer anzusehen. »Sehe ich da überzählige Zehen? Er ist ein Maine Coon, nicht wahr?«
»Ja, mit seinen ganzen zwölf Kilo Lebendgewicht.«
»Ist er ein guter Jäger?«
»Wann immer er die Gelegenheit bekommt.«
Sie lächelt Hannibal an. »Dann wird es ihm hier gefallen.«
2
Ich schleppe die Transportbox ins Haus und lasse das Monster frei. Hannibal kommt aus dem Käfig hervor, wirft mir einen vernichtenden Blick zu und trottet davon in Richtung Küche. Natürlich ist das der erste Raum, den er ansteuert – selbst in diesem fremden Haus weiß Hannibal haargenau, wo er sein Fressen bekommen wird.
Ich muss ein dutzend Mal zwischen Auto und Haus hin- und hergehen, bis ich alles ausgeladen habe: meinen Koffer, die Pappkartons mit Büchern, Bettzeug und Kochgeschirr und die zwei Tüten mit Lebensmitteln, die ich unten in Tucker Cove gekauft habe, genug für die ersten paar Tage. Aus meiner Wohnung in Boston habe ich alles mitgenommen, was ich brauche, um die nächsten drei Monate zu überstehen. Da sind die Romane, die in meinem Bücherregal Staub angesetzt haben – Bücher, die ich immer schon mal lesen wollte und die ich mir jetzt endlich vornehmen werde. Da sind meine Gläser mit kostbaren Kräutern und Gewürzen, die ich mitgenommen habe, weil ich fürchtete, dass ich sie in einem kleinen Lebensmittelladen in Maine vergeblich suchen würde. Ich habe sowohl Badeanzüge und leichte Sommerkleider als auch Pullover und eine dicke Daunenjacke eingepackt, weil das Wetter in Down East Maine selbst im Sommer unberechenbar ist. Sagt man jedenfalls.
Bis ich alles ins Haus getragen habe, ist es weit nach sieben, und ich bin von der feuchten Kälte völlig durchgefroren. Jetzt will ich nur noch mit einem Drink am prasselnden Kaminfeuer sitzen, also packe ich die drei Flaschen Wein aus, die ich aus Boston mitgebracht habe. Als ich den Küchenschrank öffne, um nach einem Glas zu suchen, entdecke ich, dass meine Vormieterin ähnliche Gelüste gehabt haben muss. Auf dem Bord, neben einer Ausgabe des Kochbuch-Klassikers Joy of Cooking, stehen zwei Flaschen schottischer Single Malt Whisky, eine davon fast leer.
Ich räume den Wein weg und greife stattdessen nach der fast leeren Whiskyflasche.
Es ist meine erste Nacht in diesem großartigen alten Haus, also warum nicht? Ich habe nicht mehr vor auszugehen, ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir, und an diesem feuchten, kühlen Abend ist ein Whisky genau das Richtige. Ich füttere Hannibal und gieße zwei Fingerbreit Scotch in ein Bleikristallglas, das ich im Schrank gefunden habe. Noch im Stehen genehmige ich mir den ersten Schluck und seufze befriedigt auf. Während ich den Rest trinke, blättere ich nebenbei in Joy of Cooking. Das Buch ist fleckig und voller Fettspritzer, offensichtlich wurde es viel und gerne benutzt. Auf dem Titelblatt finde ich eine handgeschriebene Widmung.
Alles Gute zum Geburtstag, Charlotte! Jetzt, wo Du allein wohnst, wirst Du das hier brauchen!
Alles Liebe, Deine Oma
Ich frage mich, ob Charlotte schon gemerkt hat, dass sie ihr Buch vergessen hat. Beim Blättern stoße ich auf viele Randnotizen, die sie sich zu den Rezepten gemacht hat. Braucht mehr Curry … Zu viel Arbeit … Harry war begeistert davon! Ich weiß, wie sehr ich mich ärgern würde, wenn ich eines meiner geliebten Kochbücher verlegt hätte, besonders, wenn es sich um ein Geschenk von meiner Großmutter handelte. Charlotte will das Buch bestimmt wiederhaben. Ich muss es Donna bei Gelegenheit sagen.
Der Whisky entfaltet seine magische Wirkung. Während die Wärme mein Gesicht flutet, lockern sich meine Schultern, und die ganze Anspannung fällt von mir ab. Endlich bin ich in Maine, allein mit meinem Kater in einem Haus am Meer. Ich weigere mich, darüber nachzudenken, was mich hierhergebracht hat, und ich werde auch nicht darüber nachdenken, wen und was ich zurückgelassen habe. Stattdessen stürze ich mich in die Beschäftigung, die mir immer wieder zuverlässig Trost spendet: Kochen. Heute Abend werde ich ein Risotto machen, weil es einfach und sättigend ist und man für die Zubereitung nur zwei Kochtöpfe und etwas Geduld braucht. Ich nippe ab und zu an meinem Whisky, während ich Champignons und Schalotten mit trockenem Reis dünste und umrühre, bis die Körner zu knistern beginnen. Als ich Weißwein dazugebe, gieße ich auch einen Schuss in mein inzwischen leeres Whiskyglas. Es ist nicht ganz die korrekte Getränkefolge, aber wer ist da, der darüber die Nase rümpfen könnte? Ich schöpfe heiße Brühe in den Topf und rühre um. Trinke einen Schluck Wein. Und rühre wieder eine Weile. Noch eine Kelle heiße Brühe, noch ein Schluck Wein. Immer weiter umrühren. Andere Köchinnen mögen darüber klagen, wie langweilig es ist, ein Risotto zu bewachen, aber das ist genau das, was mir an diesem Gericht so gefällt. Es geht einfach nicht schneller, man darf nicht ungeduldig sein.
Und so halte ich am Herd Wache, rühre mit einem Holzlöffel um und konzentriere mich ganz auf das, was da auf dem Brenner vor sich hin köchelt. Ich gebe frische Erbsen, Petersilie und geriebenen Parmesan dazu, und der Duft lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Als ich endlich meinen Teller auf den Tisch im Esszimmer stelle, ist es Nacht geworden. In Boston wird es nachts nie richtig dunkel, aber hier sehe ich absolut nichts hinter den Fenstern, keine vorbeifahrenden Schiffe, keinen pulsierenden Lichtstrahl von einem Leuchtturm, nur das tiefschwarze Meer. Ich zünde Kerzen an, öffne eine Flasche Chianti und schenke mir ein. Diesmal in ein richtiges Weinglas. Mein Tisch ist mustergültig gedeckt: Kerzenlicht, eine Stoffserviette, eine Schüssel Risotto, mit Petersilie bestreut, flankiert von Löffel und Gabel.
Mein Handy klingelt.
Noch bevor ich den Namen auf dem Display lese, weiß ich, wer mich anruft. Natürlich ruft sie mich an. Ich sehe Lucy vor mir, wie sie in ihrer Wohnung in der Commonwealth Avenue sitzt, den Hörer ans Ohr gepresst, und darauf wartet, dass ich mich melde. Ich kann den Schreibtisch sehen, an dem sie sitzt: das gerahmte Hochzeitsfoto, die Porzellanschüssel mit den Büroklammern, die Palisander-Uhr, die ich ihr zum Abschluss ihres Medizinstudiums geschenkt habe. Während mein Handy wieder und wieder läutet, sitze ich mit geballten Fäusten da, und vor Widerwillen krampft sich mein Magen zusammen. Als das Telefon endlich verstummt, empfinde ich die plötzliche Stille als Segen.
Ich nehme einen Löffel voll Risotto. Obwohl ich dieses Gericht schon ein dutzend Mal gekocht habe, schmeckt dieser Happen fade wie Tapetenkleister, und mein erster Schluck Chianti ist bitter. Ich hätte besser den Prosecco aufgemacht, aber er war noch nicht gekühlt, und Schaumwein muss immer gut gekühlt sein, am besten in einem mit Eis gefüllten Sektkübel.
So, wie ich letztes Jahr an Silvester den Champagner serviert habe.
Wieder höre ich das Klirren der Eiswürfel, die Jazzmusik aus der Stereoanlage und das Stimmengewirr von Freunden, Verwandten und Kollegen, die sich in meiner Bostoner Wohnung drängen. Für diese Party hatte ich alle Register gezogen, hatte tief in die Tasche gegriffen, um Damariscotta-Austern und eine ganze Keule Jamón Ibérico de Bellota zu besorgen. Ich weiß noch, wie ich den Blick über meine lachenden Gäste schweifen ließ, die Männer zählte, mit denen ich schon geschlafen hatte, und mich fragte, mit wem ich diese Nacht schlafen würde. Es war schließlich Silvester, und allein kann man schlecht feiern.
Hör auf, Ava. Denk nicht an diese Nacht.
Aber ich muss immer wieder an dieser Wunde kratzen, so lange bis der Schorf abplatzt und sie wieder zu bluten beginnt. Ich schenke mir Wein nach und lasse den Erinnerungen ihren Lauf. Das Gelächter, das Klappern der Austernmuscheln, das köstliche Prickeln des Champagners auf meiner Zunge. Ich sehe Simon, meinen Lektor, wie er sich eine glitzernde Auster in den Mund gleiten lässt. Ich sehe Lucy, die in dieser Nacht im Krankenhaus Bereitschaft hatte, brav an ihrem Mineralwasser nippen.
Und ich sehe Nick, wie er geschickt den Korken einer neuen Flasche knallen ließ. Ich weiß noch, dass ich dachte, wie flott er an diesem Abend aussah, die Krawatte schief, die Hemdsärmel bis zu den Ellbogen hochgekrempelt. Wann immer ich an diese Nacht zurückdenke, landen meine Gedanken unweigerlich bei Nick.
Die Kerze auf meinem Esstisch flackert und erlischt. Ich blicke hinunter und stelle zu meiner Überraschung fest, dass die Chiantiflasche leer ist.
Als ich aufstehe, scheint das Haus zu schwanken, als ob ich auf dem schlingernden Deck eines Schiffs stehe. Ich habe keine Fenster geöffnet, aber dennoch weht wieder der Geruch der See durch den Raum, und ich kann sogar das Salz auf den Lippen schmecken. Entweder halluziniere ich, oder ich bin doch betrunkener, als ich geglaubt habe.
Ich bin zu müde, um den Tisch abzuräumen, also lasse ich mein kaum angerührtes Risotto stehen, gehe zur Treppe und schalte unterwegs das Licht aus. Hannibal schießt vorbei, und ich stolpere über ihn, stoße mir das Schienbein am oberen Treppenabsatz. Der verdammte Kater kennt das Haus schon besser als ich. Als ich im Schlafzimmer ankomme, hat er sich bereits auf der Bettdecke breitgemacht. Ich habe nicht die Energie, ihn zu verjagen, ich schalte nur das Licht aus und lasse mich neben ihm aufs Bett fallen.
Dann schlafe ich ein, mit dem Geruch der See in der Nase.
In der Nacht spüre ich, wie sich die Matratze bewegt, und ich strecke die Hand aus, suche nach der Wärme von Hannibals Körper, doch er ist nicht da. Ich schlage die Augen auf, und im ersten Moment weiß ich nicht, wo ich bin. Dann kommt die Erinnerung zurück: Tucker Cove. Das Haus des Kapitäns. Die leere Chiantiflasche. Wieso habe ich geglaubt, dass es irgendetwas ändern würde, wenn ich weglaufe? Wo immer wir hingehen, wir schleppen unseren Kummer mit uns wie einen verrottenden Kadaver, und ich habe meinen die Küste entlang zu diesem einsamen Haus in Maine mitgenommen.
Ein Haus, in dem ich ganz offensichtlich nicht allein bin.
Ich liege wach und lausche auf das Kratzen und Scharren von winzigen Pfoten in den Wänden. Es hört sich an, als ob Dutzende, wenn nicht Hunderte von Mäusen die Wand hinter meinem Bett als Autobahn benutzen. Hannibal ist auch wach, er miaut und tigert nervös im Zimmer umher, getrieben von seinem Jagdinstinkt.
Ich steige aus dem Bett und öffne die Tür, um ihn rauszulassen, doch er macht keine Anstalten, das Zimmer zu verlassen, und läuft weiter miauend hin und her. Die Mäuse veranstalten schon genug Lärm – wie soll ich bei Hannibals Maunzen schlafen? Ich bin jetzt hellwach, also setze ich mich in den Schaukelstuhl und schaue aus dem Fenster. Der Nebel hat sich gelichtet, und der Himmel ist atemberaubend klar. Das Meer erstreckt sich bis zum Horizont, jede einzelne Welle ist vom Mondschein versilbert. Ich denke an die volle Whiskyflasche im Küchenschrank und frage mich, ob ein kleiner Schlummertrunk mir helfen könnte, den Rest der Nacht durchzuschlafen, aber der Schaukelstuhl ist so bequem, und ich habe keine Lust aufzustehen. Und der Anblick ist so wunderschön, die weite See wie getriebenes Silber. Ein Windhauch weht an meine Wange, streift meine Haut wie ein kühler Kuss, und wieder nehme ich ihn wahr: den Geruch der See.
Augenblicklich wird es totenstill im Haus. Sogar die Mäuse in den Wänden verharren reglos, als ob etwas – jemand – sie erschreckt hätte. Hannibal gibt ein lautes Fauchen von sich, und sämtliche Härchen an meinen Armen stellen sich auf.
Da ist noch jemand im Zimmer.
Ich rappele mich hastig hoch, mein Herz pocht wie wild. Der Stuhl schaukelt weiter, während ich zum Bett zurückweiche und im Halbdunkel das Zimmer absuche. Ich sehe nur die Umrisse der Möbel und Hannibals glühende Augen, in denen sich das Mondlicht spiegelt. Er fixiert etwas in der Zimmerecke. Etwas, das ich nicht sehen kann. Dann gibt er ein kehliges Knurren von sich und verzieht sich in einen dunklen Winkel.
Eine halbe Ewigkeit stehe ich da, beobachte und lausche. Mondlicht strömt zum Fenster herein, fällt schräg auf den Boden, und in seinem silbrigen Glanz bewegt sich nichts. Der Meergeruch ist verschwunden.
Es ist niemand sonst im Zimmer. Nur ich und mein feiger Kater.
Ich klettere rasch wieder ins Bett und ziehe mir die Decke bis unters Kinn, aber selbst unter den Daunen fröstele ich und zittere am ganzen Leib. Erst als Hannibal unter dem Bett hervorkommt und sich neben mich kuschelt, hört das Zittern auf. Irgendetwas an so einem warmen, schnurrenden Katzenleib, der sich an einen schmiegt, kann sämtliche Sorgen vergessen machen, und mit einem Seufzer vergrabe ich meine Finger in seinem Fell.
Das Getrippel der Mäuse in der Wand setzt wieder ein.
»Morgen«, murmele ich, »müssen wir uns eine andere Unterkunft suchen.«
3
Drei tote Mäuse liegen neben meinen Hausschuhen.
Immer noch schlaftrunken und verkatert starre ich auf die grausigen Geschenke, die Hannibal mir in der Nacht gebracht hat. Er sitzt neben seinen Opfergaben, die Brust stolzgeschwellt, und ich erinnere mich an die Bemerkung der Hausverwalterin, als ich ihr gestern erzählte, dass mein Kater gerne jagt.
Dann wird es ihm hier gefallen.
Wenigstens einer von uns beiden fühlt sich hier wohl.
Ich ziehe eine Jeans und ein T-Shirt an und gehe nach unten, um Küchenpapier für die Tatortreinigung zu holen. Selbst durch mehrere Lagen Papier hindurch fühlen sich die Mäusekadaver widerlich matschig an. Hannibal funkelt mich an, als wollte er sagen: Was zum Teufel machst du da mit meinen Geschenken? Er trottet hinter mir her, als ich die Mäuse nach unten trage und zur Haustür hinaustrete.
Es ist ein herrlicher Morgen. Die Sonne scheint, die Luft ist frisch, und die Strauchrosen nahe dem Haus stehen in voller Blüte. Ich spiele mit dem Gedanken, die Mäuse einfach im Gebüsch verschwinden zu lassen, aber Hannibal lauert in der Nähe und wartet zweifellos nur darauf, sich seine Beute wiederzuholen, also gehe ich ums Haus herum, um sie stattdessen ins Meer zu werfen.
Im ersten Moment bin ich geblendet vom Anblick des Ozeans. Ich blinzle in die Sonne, als ich an den Rand der Klippe trete, und schaue hinunter auf die wogende Brandung, die glitzernden Ranken des Seetangs, die an den Felsen tief unter mir kleben. Möwen kreisen über mir, und in der Ferne gleitet ein Hummerboot übers Wasser. Ich bin so gebannt von der Aussicht, dass ich fast vergesse, warum ich das Haus verlassen habe. Ich wickle die toten Mäuse aus und werfe sie über die Klippe. Sie fallen auf die Felsen und werden von der nächsten Welle ins Meer gespült.
Hannibal schleicht davon, wahrscheinlich, um nach neuer Beute Ausschau zu halten.
Neugierig, wohin sein Weg ihn führen mag, beschwere ich die zusammengeknüllten Papiertücher mit einem Stein und folge ihm. Er wirkt zielstrebig und entschlossen, als er an der Felskante entlangstreicht und einem schmalen Fußpfad folgt, kaum mehr als ein Strich, der sich durch Moos und buschiges Gras windet. Der Boden ist hier mager, der Untergrund besteht größtenteils aus mit Flechten überzogenem Granit. Der Pfad führt sanft bergab und endet an einem kleinen halbmondförmigen Strand, eingefasst von Felsen. Hannibal geht weiter voran, den Schwanz in die Höhe gereckt wie eine pelzige Standarte; nur einmal bleibt er kurz stehen und blickt sich um, als wollte er sich vergewissern, dass ich ihm folge. Rosenduft steigt mir in die Nase, und ich entdecke ein paar robuste Rugosa-Sträucher, die es irgendwie fertigbringen, dem Wind und der Salzluft zum Trotz hier zu gedeihen. Das leuchtende Rosa ihrer Blüten hebt sich lebhaft vom Granitgestein ab. Ich stakse an ihnen vorbei, zerkratze mir den nackten Knöchel an ihren Stacheln und springe von den Felsen auf den Strand. Es gibt hier keinen Sand, nur kleine Kieselsteine, die leise klickernd von den Wellen hin und her geschoben werden. Zu beiden Seiten der kleinen Bucht ragen mächtige Felsen ins Wasser hinaus und machen den Strand von der Landseite aus uneinsehbar.
Das könnte mein eigener kleiner Zufluchtsort sein.
Schon beginne ich, ein Picknick zu planen. Ich werde eine Decke und ein Lunchpaket mitnehmen – und natürlich eine Flasche Wein. Wenn es ein warmer Tag wird, werde ich mich vielleicht sogar kurz in das eiskalte Wasser wagen. Die Sonne scheint mir warm ins Gesicht, die Luft ist vom Duft der Rosen erfüllt, und ich bin so entspannt und glücklich wie seit Monaten nicht mehr. Vielleicht ist dies wirklich der richtige Ort für mich. Vielleicht bin ich hier wirklich genau richtig. Hier werde ich arbeiten können, werde ich endlich wieder Frieden mit mir selbst schließen können.
Mit einem Mal bin ich wie ausgehungert. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt solchen Heißhunger verspürt habe; in den letzten paar Monaten habe ich so viel Gewicht verloren, dass die Hose, die ich mal meine Skinny-Jeans genannt habe, jetzt lose um meine Hüften schlackert. Ich steige den Pfad wieder hinauf, in Gedanken schon bei Rührei und Toast und literweise heißem Kaffee mit Sahne und Zucker. Mein Magen knurrt, und ich kann schon die selbst gemachte Brombeermarmelade schmecken, die ich aus Boston mitgebracht habe. Hannibal läuft wieder voraus – entweder hat er mir verziehen, dass ich seine Mäuse weggeworfen habe, oder er denkt auch an sein Frühstück.
Oben angekommen, folge ich dem Weg zur Landspitze. Dort, wo das Land ins Meer ragt wie ein Schiffsbug, steht das Haus in stolzer Einsamkeit. Ich male mir aus, wie der unglückliche Captain Brodie dort oben auf den Witwenbalkon tritt und aufs Meer hinausblickt, wie er dort Wache hält, bei Sonnenschein wie bei Sturm und Regen. Ja, dies ist genau der Ort, den ein Schiffskapitän wählen würde, um darauf sein Haus zu bauen, auf dieser windgepeitschten Felszunge, die …
Ich bleibe wie angewurzelt stehen und starre zum Witwenbalkon empor. Habe ich mir das eingebildet, oder habe ich da ganz kurz jemanden stehen sehen? Jetzt ist da niemand mehr. Vielleicht war es einer der Zimmermänner, aber Donna hat mir doch gesagt, dass sie nur werktags arbeiten, und heute ist Sonntag.
Ich eile den Pfad entlang und um das Haus herum zur vorderen Veranda, doch ich sehe keine anderen Fahrzeuge in der Einfahrt stehen, nur meinen Subaru. Wenn es wirklich einer der Handwerker war, wie ist er dann hergekommen?
Ich poltere die Stufen hinauf, stürze ins Haus und rufe: »Hallo? Ich bin die neue Mieterin!« Keine Antwort. Während ich die Treppe hinauf- und den Flur entlanglaufe, lausche ich auf die Geräusche von Handwerksarbeiten im Turmzimmer, aber ich höre kein Hämmern oder Sägen, nicht einmal das Knarren von Schritten. Die Tür zum Erkerturm knarrt laut, als ich sie öffne. Dahinter kommt eine dunkle, enge Treppe zum Vorschein.
»Hallo?«, rufe ich nach oben. Wieder antwortet niemand.
Ich bin noch nicht oben im Turmzimmer gewesen. Als ich hinauf in das Halbdunkel spähe, erblicke ich schwache Lichtstreifen durch die geschlossene Tür am oberen Ende der Treppe. Falls jemand dort oben arbeitet, ist er eigenartig leise, und für einen kurzen Moment ziehe ich die beunruhigende Möglichkeit in Erwägung, dass der Eindringling nicht einer der Zimmerleute ist. Dass jemand anderes sich durch die unverschlossene Haustür ins Haus geschlichen hat und mir jetzt dort oben auflauert. Aber wir sind hier nicht in Boston – das hier ist eine Kleinstadt in Maine, wo die Leute ihre Haustüren nicht abschließen und im Auto den Schlüssel stecken lassen. So hat man es mir jedenfalls erzählt.
Die erste Stufe gibt ein ominöses Knarren von sich, als ich mein Gewicht darauf verlagere. Ich halte inne und lausche. Immer noch kein Geräusch von oben.
Hannibals lautes Miauen lässt mich zusammenfahren. Ich blicke mich um und sehe ihn direkt hinter mir stehen. Er wirkt nicht im Mindesten beunruhigt. Jetzt schlüpft er an mir vorbei, tapst im Dunkeln die Stufen hinauf und wartet an der verschlossenen Tür auf mich. Mein Kater ist mutiger als ich.
Auf leisen Sohlen steige ich hinauf, mit jeder Stufe schlägt mein Herz schneller. Als ich oben ankomme, schwitzen meine Hände, und der Türknauf fühlt sich glitschig an. Langsam drehe ich ihn und drücke die Tür auf.
Grelles Sonnenlicht blendet mich.
Ich kneife die Augen zusammen, und nach ein paar Sekunden nimmt das Turmzimmer Konturen an. Ich sehe Fenster, fleckig von Salz. Seidige Spinnweben hängen von der Decke und schwanken im Luftzug. Hannibal sitzt neben einem Stapel Holzdielen und putzt sich seelenruhig die Pfoten. Überall stehen Gerätschaften zur Holzbearbeitung herum – eine Bandsäge, Schleifmaschinen, Sägeböcke. Aber es ist niemand hier.
Eine Tür führt auf den Witwenbalkon hinaus, die Dachterrasse mit Blick aufs Meer. Ich öffne die Tür und trete hinaus in die frische Brise. Ganz unten sehe ich den Klippenpfad, den ich vor wenigen Minuten noch entlanggegangen bin. Das Geräusch der Wellen wirkt so nahe, als würde ich am Bug eines Schiffs stehen – eines sehr alten Schiffs. Das Balkongeländer sieht wacklig aus, die Farbe längst von Wind und Wetter abgewaschen. Ich mache noch einen Schritt, und plötzlich sackt das Holz unter mir ab. Sofort weiche ich zurück und blicke auf die verrotteten Dielen hinunter. Donna hatte mich davor gewarnt, den Witwenbalkon zu betreten, und wenn ich noch weitergegangen wäre, hätte leicht der ganze Balkonboden unter meinem Gewicht nachgeben können. Und doch glaubte ich gerade vorhin noch, jemanden hier oben stehen zu sehen – wo das Holz nicht mehr Halt zu bieten scheint als ein Pappkarton.
Ich ziehe mich ins Turmzimmer zurück und schließe die Tür, um den Wind auszusperren. Mit seinen Ostfenstern ist der Raum schon von der Morgensonne aufgewärmt. Ich stehe da, in dieses goldene Licht getaucht, und versuche zu verstehen, was ich von der Klippe aus gesehen habe, aber ich finde keine Antworten. Eine Luftspiegelung vielleicht. Irgendeine seltsame Verzerrung, verursacht durch das uralte Fensterglas. Ja, das muss es sein, was ich gesehen habe. Wenn ich durch das Fenster blicke, ist das Bild durch Wellenlinien verzerrt, als ob ich durch Wasser schaue.
Am Rand meines Gesichtsfelds schimmert etwas.
Blitzschnell drehe ich den Kopf in die Richtung, doch ich sehe nur wirbelnde Staubkörnchen, die im Sonnenlicht glitzern wie Millionen von Galaxien.
4
Donna telefoniert gerade, als ich das Büro von Branca Immobilien und Hausverwaltung betrete. Sie winkt mir zur Begrüßung zu und deutet auf den Wartebereich. Ich suche mir einen Platz an einem sonnigen Fenster, und während sie ihr Gespräch fortsetzt, blättere ich in einem Prospekt mit Mietobjekten. Brodie’s Watch ist nicht darunter, aber es gibt andere verlockende Angebote, von schindelgedeckten Cottages am Strand über Apartments in zentraler Lage bis hin zu einer imposanten Villa in der Elm Street, die zu einem nicht minder imposanten Preis vermietet wird. Während ich die wunderschön fotografierten Immobilien betrachte, denke ich an den Blick aus meinem Schlafzimmerfenster in Brodie’s Watch und an meinen Spaziergang entlang der Klippen mit den duftenden Rosen. Wie viele Objekte in diesem Prospekt können mit einem eigenen Strand aufwarten?
»Hallo, Ava. Haben Sie sich schon ein bisschen eingelebt?«
Ich blicke zu Donna auf, die endlich ihr Telefonat beendet hat. »Ähm … Es gibt da ein paar kleine Probleme, über die ich mit Ihnen reden muss.«
»Oje. Was für Probleme?«
»Nun ja, da wären zunächst einmal die Mäuse.«
»Ah.« Sie seufzt. »Ja, das ist ein Thema bei manchen unserer älteren Häuser hier in der Gegend. Da Sie eine Katze haben, rate ich Ihnen davon ab, Gift auszulegen, aber ich kann Ihnen ein paar Mausefallen zur Verfügung stellen.«
»Ich glaube nicht, dass ein paar Fallen das Problem aus der Welt schaffen können. Es hört sich an, als ob eine ganze Armee von den Biestern in den Wänden wohnt.«
»Ich kann Ned und Billy – das sind die Zimmerleute – bitten, alle erkennbaren Schlupflöcher abzudichten, damit nicht noch mehr Mäuse hereinkommen. Aber es ist ein altes Haus, und hier bei uns lernt man einfach irgendwann, damit zu leben.«
Ich halte den Prospekt mit den Mietobjekten hoch. »Wenn ich in ein anderes Haus umziehen würde, hätte ich also wieder das gleiche Problem?«
»Im Moment könnte ich Ihnen sowieso nichts anderes anbieten. Es ist Hochsommer, und alles ist vermietet; allenfalls bekommen Sie hier und da etwas für eine Woche. Und Sie wollen ja länger bleiben, nicht wahr?«
»Ja, bis Ende Oktober. Ich brauche die Zeit, um mein Buch fertigzuschreiben.«
Sie schüttelt den Kopf. »Ich fürchte, Sie werden nichts finden, was Brodie’s Watch in puncto Aussicht und Alleinlage das Wasser reichen kann. Ihre Miete ist ja nur deshalb so günstig, weil das Haus noch renoviert wird.«
»Das wäre meine zweite Frage. Wegen der Renovierungsarbeiten.«
»Ja?«
»Sie sagten, die Zimmerleute würden nur an Werktagen arbeiten.«
»Das ist richtig.«
»Heute Morgen, als ich auf dem Klippenpfad war, glaubte ich, jemanden oben auf dem Witwenbalkon zu sehen.«
»An einem Sonntag? Aber die Handwerker haben keinen Hausschlüssel. Wie sind sie reingekommen?«
»Ich hatte die Haustür nicht abgeschlossen, als ich zu meinem Spaziergang aufbrach.«
»War es Billy oder Ned? Ned ist Ende fünfzig, Billy erst Anfang zwanzig.«
»Ich habe die Person ja nicht aus der Nähe gesehen. Und als ich zurückkam, war niemand im Haus.« Ich halte inne. »Ich denke, es könnte auch eine optische Täuschung gewesen sein. Vielleicht war da wirklich niemand.«
Einen Moment lang ist sie still, und ich frage mich, was ihr gerade durch den Kopf geht. Meine Mieterin hat eine Meise? Sie ringt sich ein Lächeln ab. »Ich werde Ned anrufen und ihn daran erinnern, dass er Sie am Wochenende nicht stören soll. Oder Sie können es ihm auch selbst sagen, wenn Sie ihn sehen. Die beiden müssten morgen früh bei Ihnen im Haus arbeiten. Also, was das Mäuseproblem betrifft – ich kann Ihnen morgen ein paar Fallen vorbeibringen, wenn Sie möchten.«
»Nein, danke, ich werde mir jetzt gleich welche besorgen. Wo bekomme ich sie hier im Ort?«
»Sullivan’s Eisenwarenhandlung ist nur ein paar Häuser weiter. Einfach links die Straße runter, Sie können es nicht verfehlen.«
Ich bin schon fast an der Tür, als mir plötzlich einfällt, was ich sie noch fragen muss. Ich drehe mich noch einmal um. »Charlotte hat ein Kochbuch im Haus vergessen. Ich schicke es ihr gerne zu, wenn Sie mir sagen können, an welche Adresse es gehen soll.«
»Ein Kochbuch?« Donna zuckt mit den Schultern. »Vielleicht wollte sie es nicht mehr.«
»Es war ein Geschenk von ihrer Großmutter, und es ist voll mit ihren handschriftlichen Notizen. Ich bin mir sicher, dass sie es wiederhaben möchte.«
Donna ist mit ihrer Aufmerksamkeit schon wieder halb bei ihrem Schreibtisch. »Ich schicke ihr eine kurze Mail und sage ihr Bescheid.«
Das sonnige Wetter hat die ganzen Touristen aus ihren Ferienwohnungen gelockt, und als ich die Elm Street entlanggehe, weiche ich Kinderwagen aus und mache einen großen Bogen um Familien mit tropfenden Eistüten in den Händen. Wie Donna schon sagte, es ist Hochsommer, und überall im Ort klingeln fröhlich die Ladenkassen, die Restaurants sind brechend voll, und die armen Hummer landen zu Dutzenden in dampfenden Kochtöpfen. Ich gehe vorbei am Historischen Verein von Tucker Cove, an einem halben Dutzend Geschäften, die alle die gleichen T-Shirts und Süßigkeiten wie Salt Water Taffy verkaufen, bis ich endlich das Ladenschild von Sullivan’s Eisenwarenhandel erblicke.
Als ich eintrete, läutet ein Glöckchen an der Tür, und das Geräusch versetzt mich zurück in meine Kindheit, als mein Großvater mich und meine ältere Schwester Lucy oft in eine Eisenwarenhandlung wie diese hier mitnahm. Ich halte inne und atme die vertrauten Gerüche nach Staub und frisch gesägtem Holz ein, und ich entsinne mich, wie Grandpa mit Begeisterung die verschiedenen Hämmer und Schrauben, Schläuche und Dichtungsringe inspizierte. Es war ein Ort, wo die Männer seiner Generation sich in ihrem Element fühlen konnten.
Ich kann niemanden sehen, doch ich höre, wie zwei Männer irgendwo im hinteren Teil des Ladens darüber diskutieren, ob Wasserhähne aus Messing denen aus Edelstahl vorzuziehen wären.
Ich nehme mir das erstbeste Regal vor und suche nach Mausefallen, finde aber nur Gartengeräte. Pflanzkellen und Spaten, Handschuhe und Schaufeln. Ich versuche es im nächsten Gang, wo die Regale mit Nägeln und Schrauben und Rollen von Ketten in diversen Gliederlängen bestückt sind. Alles, was man für eine Folterkammer Marke Eigenbau braucht. Ich will soeben in den dritten Gang einbiegen, als plötzlich ein Kopf hinter einer Lochplatte mit Schraubenziehern auftaucht. Die weißen Haare des Mannes stehen ab wie der Flaum einer Pusteblume, und er beäugt mich durch seine schief sitzende Brille.
»Kann ich Ihnen behilflich sein, Miss?«
»Ja, ich suche Mausefallen.«
»Haben wohl ein kleines Nagerproblem, wie?« Er kichert in sich hinein, während er um das Regal herumgeht und auf mich zukommt. Obwohl er Arbeitsstiefel trägt und einen Werkzeuggürtel umgelegt hat, scheint er mir viel zu alt, um noch selbst einen Hammer schwingen zu können. »Die Mausefallen hab ich dort drüben bei den Küchengeräten.«
Mausefallen als Küchengeräte. Keine sehr appetitliche Vorstellung. Ich folge ihm in einen entlegenen Winkel des Ladens, wo ich eine Auswahl an Pfannenwendern und billigen Töpfen und Pfannen aus Aluminium sehe, alle mit einer Staubschicht bedeckt. Er zieht eine Packung aus dem Regal und drückt sie mir in die Hand. Bestürzt starre ich die Sechserpackung Victor-Schlagfallen mit Sprungfeder an. Die gleichen Mausefallen, die meine Großeltern in ihrem Bauernhaus in New Hampshire aufzustellen pflegten.
»Haben Sie nicht irgendetwas … na ja, Humaneres?«, frage ich.
»Human?«
»Ich meine Fallen, die die Tiere nicht töten.«
»Und was wollen Sie mit den Viechern machen, nachdem Sie sie gefangen haben?«
»Aussetzen. Irgendwo in der freien Natur.«
»Dann kommen sie gleich wieder zurück. Es sei denn, Sie wollen sie zu einer längeren Spritztour einladen.« Er lacht schallend über seinen Witz.
Ich betrachte die Schlagfallen. »Die kommen mir so grausam vor.«
»Tun Sie einen Klacks Erdnussbutter drauf. Der Geruch lockt sie an, sie steigen auf die Feder, und zack!« Er grinst, als ich bei dem lauten Geräusch zusammenfahre. »Die spüren gar nix, das garantier ich Ihnen.«
»Nein, ich glaube, das ist wirklich nichts für …«
»Ich hab gerade einen Experten hier, der kann Sie sicher beruhigen.« Er ruft quer durch den Laden: »He, Doc! Kommen Sie mal her und erklären Sie dieser jungen Dame, dass sie nicht so zimperlich zu sein braucht!«
Ich höre Schritte, die auf uns zukommen, und als ich mich umdrehe, erblicke ich einen Mann ungefähr in meinem Alter. Er trägt Bluejeans und ein kariertes Hemd, und mit seiner attraktiven, adretten Erscheinung könnte er glatt einem Katalog für Herren-Freizeitmoden entstiegen sein. Fehlt nur noch der Golden Retriever an seiner Seite. Er hat einen Messing-Wasserhahn in der Hand, offenbar der Sieger der Messing-versus-Edelstahl-Debatte, die ich vorhin mitbekommen habe.
»Wie kann ich helfen, Emmett?«, fragt er.
»Sagen Sie dieser netten Dame hier, dass die Mäuse nicht leiden werden.«
»Welche Mäuse?«
»Die Mäuse in meinem Haus«, erläutere ich. »Ich bin gekommen, um Fallen zu kaufen, aber die hier …« Ich sehe auf die Packung Schlagfallen hinunter und erschaudere.
»Ich sag ihr die ganze Zeit, dass es mit denen am besten klappt, aber sie findet sie grausam«, sagt Emmett.