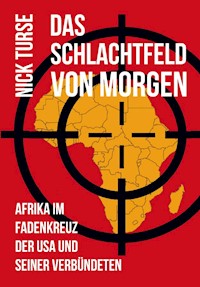
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Neuer Weg
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Als am 12. Juli 2013 das schrille Signal einer Bootsmannpfeife erklang, versammelte sich in einem kargen Gebäude auf der US-Militärbasis im deutschen Böblingen Offiziere militärischer Eliteeinheiten. Auf einer Bühne vor einer enormen amerikanischen Flagge nahmen Captain Robert Smith, Kommandeur der Naval Special Warfare Group Two, Captain J. Dane Thorleifson, der aus dem Amt scheidende Kommandeur der Naval Special Warfare Unit Ten, und sein Nachfolger Captain Jay Richards am feierlichen Wechsel des Befehlshabers teil, einer altehrwürdigen Marinetradition. Vor einer kleinen Ansammlung uniformierter Militärangehöriger und ein paar Zivilpersonen sprachen diese Männer, alle Angehörige des Special Operations Command Africa (SOCAFRICA), über etwas, das nur selten in der Öffentlichkeit thematisiert wird – über verdeckte US-Militäroperationen in Afrika.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nick Turse
Das Schlachtfeld von morgen
Originaltitel: America's Shadow Wars in Africa
Haymarket Books, Chicago 2015
© 2015 Nick Turse
Übersetzung: Marion Ahl, Seeheim-Jugenheim
Gesamtherausgabe 2019 © Verlag Neuer Weg
in der Mediengruppe Neuer Weg GmbH
Alte Bottroper Straße 42, 45356 Essen
Telefon +49-(0)-201-25915
Fax +49-(0)-201-6144462
www.neuerweg.de
Gesamtherstellung:
Mediengruppe Neuer Weg GmbH
ISBN: 978-3-88021-533-7
E-Book ISBN: 978-3-88021-534-4
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung: Das Schlachtfeld von morgen
1.Schattenkriege der USA in Afrika: ObamasKampf um Afrika - 12. Juli 2012
2.Zentrum der Rückschläge: Die Diaspora des Terrors - 18. Juni 2013
3.AFRICOMs gigantischer »kleiner Fußabdruck«: Der Schwenk nach Afrika - 5. September 2013
4.Stellvertreterkriege in Afrika: Ein neues Erscheinungsbild der Expeditionskriegsführung 13. März 2014
5.Nonstop-Operationen in Afrika: Das US-Militär kommt in Afrika im Durchschnitt auf mehr als eine Mission am Tag - 27. März 2014
6.AFRICOM wird zu einem »Krieg führenden Kampfkommando«: Ein heimliches In-den-Krieg-Ziehen - 13. April 2014
7.Das Pentagon, Libyen und der morgige Rückschlag, der sich heute schon abzeichnet: Wie man es schafft, die Gewalt in einem vom Krieg erschütterten Land nicht enden zu lassen 15. April 2014
8.Wie »Bengasi« die Neue Normalität in Afrika zur Folge hatte: Eine geheime afrikanische Mission und eine afrikanische Mission, die kein Geheimnis ist - 15. Mai 2014
9.Ein Kräftemessen zwischen Ost und West: China, die USA und ein neuer Kalter Krieg in Afrika? - 31. Juli 2014
10.Weihnachten im Juli und das Scheitern des großen afrikanischen Experiments: Während sich eine menschengemachte Hungersnot abzeichnet, wird es früh Weihnachten im Südsudan - 7. August 2014
11.Zeugnisse amerikanischen Scheiterns in Afrika? Wie man Herz und Verstand der Menschen nicht gewinnt - 7. September 2014
12.»Erfolg« der USA und der Aufstieg der westafrikanischen Piraterie: Die Piraten des Golfs von Guinea - 25. September 2014
13.Ein nicht existenter Stützpunkt in einem nicht ausfindig zu machenden Land: Ein Basislager, ein autoritäres Regime und die Zukunft der Rückschläge in Afrika - 20. November 2014
14.Zielscheibe Afrika - 15. Oktober 2015
15.Das US-Militär sieht in Afrika überall Feinde 11. Juni 2016
16.Das US-Militär baut eine 100 Millionen Dollar teure Drohnenbasis in Afrika 29. September 2016
17.Der Krieg, von dem Sie noch nie gehört haben: Wie exklusive Dokumente enthüllen, führen die USA einen massiven Schattenkrieg in Afrika 18. Mai 2017
NachwortBarack Obama im Südsudan entdecken
AnhangDas US Africa Command debattiert mit TomDispatch: Ein Gedankenaustausch über den Charakter der Präsenz des US-Militärs in Afrika - 26. Juli 2012
Danksagung
Über Nick Turse
Über TomDispatch
Über Dispatch Books
EINLEITUNG
DAS SCHLACHTFELD VON MORGEN
Als am 12. Juli 2013 das schrille Signal einer Bootsmannpfeife erklang, versammelten sich in einem kargen Gebäude auf der US-Militärbasis im deutschen Böblingen Offiziere militärischer Eliteeinheiten. Auf einer Bühne vor einer enormen amerikanischen Flagge nahmen Captain Robert Smith, Kommandeur der Naval Special Warfare Group Two, Captain J. Dane Thorleifson, der aus dem Amt scheidende Kommandeur der Naval Special Warfare Unit Ten, und sein Nachfolger Captain Jay Richards am feierlichen Wechsel des Befehlshabers teil, einer altehrwürdigen Marinetradition. Vor einer kleinen Ansammlung uniformierter Militärangehöriger und ein paar Zivilpersonen sprachen diese Männer, alle Angehörige des Special Operations Command Africa (SOCAFRICA), über etwas, das nur selten in der Öffentlichkeit thematisiert wird – über verdeckte US-Militäroperationen in Afrika.
Bis zum Sommer 2013 hatten Repräsentanten des US Africa Command (AFRICOM), dem neuesten der sechs geografisch eingeteilten Kampfkommandos des US-Verteidigungsministeriums sowie der Dachverband für Einsätze auf dem Kontinent immer wieder versichert, dass die Präsenz von US-Militär dort nur gering ist, eingeschränkt und vorübergehend, und vor allem harmlos. In Afrika ginge nichts von großer Bedeutung vor sich, wie sie beteuerten. Bei dieser hinter verschlossenen Türen abgehaltenen Zeremonie vor einer ausgewählten Zuschauermenge zeichneten die Offiziere – die zu Einheiten wie den elitären Navy Seals und anderen gehörten, die in Terrorismusbekämpfung bewandert und in der Lage sind, Kommandounternehmen von Schiffen, U-Booten und Flugzeugen aus durchzuführen – ein ganz anderes Bild der Militäroperationen.
»Der Auftrag der Naval Special Warfare Unit Ten läuft weiter«, erklärte Smith dem Publikum. »Während wir hier sprechen, werden Truppen auf den afrikanischen Kontinent verlegt. Truppen, die bereits auf dem afrikanischen Kontinent sind, führen die Mission der Naval Special Warfare Unit Ten, die SOCAFRICA-Mission, und die AFRICOM-Mission aus. Dieser Einsatz ist nicht beendet.« Er fügte hinzu: »Manche glauben, Afrika sei unsere künftige Verteidigungslinie«, um dann klarzustellen, »Afrika ist unsere aktuelle Verteidigungslinie.«
Smith beschrieb auch Partnerschaften mit afrikanischem Militär auf dem ganzen Kontinent von Uganda über Somalia bis nach Nigeria, und lobte gleichzeitig die Anstrengungen des scheidenden Kommandeurs Thorleifson: »Er stand selbst auf afrikanischem Boden und hat diesen Kampf angeführt.« Diese Bemerkung erregte meine Aufmerksamkeit. Das klang ganz und gar nicht mehr nach der Standardfloskel des AFRICOM vom »kleinen Fußabdruck«, der auf dem Kontinent hinterlassen würde und vorwiegend humanitäre Einsätze umfasste. Es klang eher danach, als befänden sich die USA in Afrika bereits in einem Krieg.
Smith verlieh Thorleifson den Legion-of-Merit-Orden, u. a. für das Entwickeln einer Strategie für »anhaltendes militärisches Engagement in fünf Schwerpunktländern des Special Operations Command Africa.« Dann trat Thorleifson selbst ans Rednerpult und lieferte eine noch aufschlussreichere Sicht auf die US-Operationen.
Er blickte auf die zwei Jahre zurück, in denen er das Kommando über die Naval Special Warfare Unit Ten gehabt hatte, und thematisierte das »hohe Tempo« der Operationen, bei denen die Soldaten »365 Tage im Jahr in mehr als einem halben Dutzend ganz verschiedenen, herausfordernden Schauplätzen im Einsatz waren«; Thorleifson lobte seine Truppen dafür, in einem »komplexen Kampfgebiet« erfolgreich zu agieren. Er zitierte seinen Chef, damals Brigadegeneral (heute Generalmajor) James Linder, den Befehlshaber der US Special Operations-Truppen in Afrika, der sich unter den Zuhörern befand. »General Linder hat gesagt, ›Afrika ist heute das Schlachtfeld von morgen‹, und Sir, ich stimme Ihnen völlig zu. Dieses neue Schlachtfeld ist wie maßgeschneidert für das SOC [Special Operations Command] und wir werden dort aufblühen. Das ist genau der Ort, an dem wir heute sein müssen, und ich gehe davon aus, dass wir auch in der Zukunft noch einige Zeit dort sein werden.«
Ich spitzte die Ohren. Der Kommandeur einer undurchsichtigen schnellen Eingreiftruppe stimmte seinem Befehlshaber, dem Oberhaupt der elitärsten amerikanischen Truppen in Afrika, darin zu, dass der Kontinent kein verschlafener Nebenschauplatz war, wie es von Sprechern und Öffentlichkeitsreferenten des AFRICOM behauptet wurde, und nicht einmal ein Kriegsschauplatz von morgen, sondern bereits heute ein Schlachtfeld. Diese geheime Zeremonie untermauerte genau das, was ich im vergangenen Jahr in meiner eigenen Berichterstattung enthüllt hatte, und überzeugte mich von der Notwendigkeit weiterer Recherchen, um herauszufinden, was das US-Militär fernab von neugierigen Blicken auf dem afrikanischen Kontinent so trieb.
DAS GROSSE AFRICOM-HINHALTEMANÖVER
Der Pfad, der mich an diese Stelle geführt hat, war wie so viele andere im Leben kurvenreich und voller Überraschungen. Während meiner Recherchen zu anderen Kriegen andernorts auf der Erde habe ich jahrelang am Rande Geschichten über Aktivitäten des US-Militärs in Afrika wahrgenommen, doch ich schenkte ihnen keine größere Beachtung. Ein- oder zweimal ging ich der Sache etwas nach, aber es kam nichts dabei heraus. 2005 schrieb ich für mein erstes Buch ein kurzes Kapitel über US-Militäroperationen in Afrika, das jedoch am Ende herausgekürzt worden ist. Einmal bot mir das Militär sogar an, seine einzige offizielle Basis auf dem afrikanischen Kontinent zu besuchen, Camp Lemonnier, in dem winzigen Staat Dschibuti am Horn von Afrika; doch für einen Bericht hatte ich keinen Abnehmer, der mir die Reise finanziert hätte. Also fuhr ich nie hin.
Als sich der Irakkrieg 2010 allmählich dem Ende zuneigte und der Präsident versprach, dass dasselbe irgendwann auch in Afghanistan der Fall sein würde, registrierte ich, wie sich die Hinweise auf verstärkte militärische Aktivitäten der USA in Afrika verdichteten. Bis zum nächsten Jahr war ich mir sicher, dass da eine große Sache lief, und ich erzählte meinem Chef bei einer Nachrichten-Webseite, deren leitender Redakteur ich kürzlich geworden war, davon. Wir saßen gerade in der Filiale einer Restaurantkette in New York City, als ich ihm von meiner Idee zu einer großen Enthüllungsgeschichte über undurchsichtige US-Militär-Operationen in Afrika erzählte. Sein Gesicht sprach Bände, und seine Worte bestätigten es. An Afrika bestehe kein Interesse, den Lesern sei es gleichgültig, und er wolle nicht, dass ich meine Zeit auf tiefschürfende Recherchen verschwende, bei denen am Ende keine Story herauskam. Ich verstand die Botschaft klar und deutlich. Glücklicherweise reagierte Tom Engelhardt, mein Kollege und Herausgeber von TomDispatch. com genau in entgegengesetzter Weise auf meinen Vorschlag, und ermutigte mich loszulegen.
Es wurde 2012, bis ich andere Projekte abgeschlossen hatte und mich an die Arbeit machen konnte, und am 12. Juli – auf den Tag genau ein Jahr vor dem feierlichen Wechsel des Befehlshabers in Böblingen und im Anschluss an umfangreiche Nachforschungen in öffentlich zugänglichem Material und wenig beachteten militärischen Dokumenten – veröffentlichte ich schließlich den Bericht »Obama’s Scramble for Africa: Secret Wars, Secret Bases, and the Pentagon’s ›New Spice Route‹«, der nun das erste Kapitel dieses Buches bildet. Mehr als zwei Jahre später bin ich noch immer dabei, den militärischen Aktivitäten des US-Militärs in Afrika auf den Grund zu gehen, zuvor als geheim eingestufte Dokumente und unter Verschluss gehaltene Berichte zu sichten und bei Gelegenheit über den afrikanischen Kontinent zu berichten.
Ich hatte nie vorgehabt, Afrika zu meinem zentralen Thema zu machen. Dieser erste Bericht hätte auch gut eine einmalige Angelegenheit sein können, und ich wäre zur Berichterstattung über den US-Krieg in Afghanistan oder die weltweiten Drohneneinsätze zurückgekehrt, oder ich hätte mit den Recherchen zu Einsätzen des US-Militärs in Südamerika oder etwas ganz anderem begonnen. Was mich dazu bewogen hat, an der Sache mit Afrika dranzubleiben, waren die Reaktionen des US-Africa-Kommandos.
Als ich einem Sprecher des AFRICOM Fragen für jenen ersten Bericht stellte, hatte ich das Gefühl, an der Nase herumgeführt zu werden. Was er mir erzählte, stimmte einfach nicht mit dem überein, was ich in meinen Nachforschungen herausgefunden hatte. Anstelle von aufrichtigen Antworten bekam ich abgedroschene Argumente zu hören – das erregte meinen Argwohn. Als ich später darum bat, die US-Einrichtungen besuchen zu dürfen, um mich mit eigenen Augen von der Sachlage zu überzeugen, wurde meine Bitte abgeschlagen. Genauso erging es mir, als ich Interviews mit Kommandeuren anfragte. Es wirkte ganz so, als habe das AFRICOM etwas zu verbergen.
Ungefähr eine Woche nach Veröffentlichung meines ersten Berichts erhielt TomDispatch einen »Leserbrief« von Colonel Tom Davis, dem Leiter der Öffentlichkeitsabteilung des US Africa Command. Er ficht darin recht detailliert etliche meiner Argumente an und weist auf zahlreiche vermeintliche Ungenauigkeiten hin. Darüber hinaus schickte er eine Kopie seines Briefes an den Leiter des Nation Institutes, der gemeinnützigen Mediathek, von der TomDispatch unterstützt wird.
In Anbetracht von 2500 sorgfältig analysierten Wörtern hatte AFRICOM ganz klar beträchtliche Zeit und Mühe in den Versuch investiert, die Glaubwürdigkeit meiner Arbeit zu untergraben. Dass sie überdies eine Kopie des Briefes an das Nation Institute geschickt hatten, wertete ich als Einschüchterungsversuch mit dem Ziel, meine Berichterstattung in den Augen der Mutterorganisation und des Kostenträgers von TomDispatch zu diskreditieren. Ich war augenblicklich wie elektrisiert und brannte darauf, den Brief zu beantworten, und zwar mit der vollen Unterstützung und Rückendeckung Engelhardts und des Nation Institute. Wenige Tage später tat ich dies in Form einer »Debatte« auf TomDispatch, in der wir Davis’ Schreiben und meine detaillierte Antwort veröffentlichten, die beide im Anhang dieses Buches zu finden sind. Im Wesentlichen ging es in unserer Debatte um meine These, dass sich die Präsenz der Vereinigten Staaten in Afrika verstärkt, was sich in einer Zunahme an Einsätzen und Vorposten äußert, und in Davis’ Beteuerungen, diese Präsenz sei unerheblich und daher kaum der Rede wert.
Nachdem sich der Staub gelegt hatte, schrieb ich Davis persönlich und bat ihn neben anderen Informationen um eine vollständige Auflistung dessen, was er als »temporäre Einrichtungen« bezeichnete, sowie aller Stützpunkte, Feldlager, Versorgungslager und anderer Anlagen, die vom US-Militär in Afrika genutzt werden konnten, um den vollen Umfang der amerikanischen Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent abschätzen zu können. Vier Tage darauf erhielt ich von einem Sprecher des AFRICOM, Eric Elliott, eine E-Mail, in der er mir mitteilte, dass Davis im Urlaub war, doch er fügte hinzu: »Ich werde sehen, was ich bezüglich Ihrer Anfrage nach einer vollständigen Liste der Einrichtungen tun kann. Im Hinblick auf die Einzelheiten, die wir Ihnen liefern können, gibt es aufgrund des Umfangs Ihrer Anfrage allerdings gewisse Grenzen.«
So wie immer!
Das war im August 2012. Monatelang hörte ich nichts. Ich erhielt keine Entschuldigung dafür, mich so lange warten zu lassen, keine Bitte um mehr Zeit. Meine Nachfrage von Ende Oktober wurde ignoriert. Auf eine Mitteilung Anfang November erhielt ich endlich die Antwort eines weiteren Sprechers des AFRICOM, Lieutenant Commander Dave Hecht, der mich darüber informierte, dass er nun mit der Angelegenheit betraut war und bis Ende der Woche mit einer Statusmeldung auf mich zukommen würde. Es wird Sie sicher nicht überraschen, dass das Wochenende kam und verstrich, ohne dass ich ein Wort von ihm gehört hätte. Ich schickte eine erneute Nachfrage. Am 16. November antwortete Hecht endlich: »Ich habe jetzt Antworten auf all Ihre Fragen. Bevor ich sie herausgeben kann, müssen sie lediglich noch von meinem Vorgesetzten durchgesehen werden. Ich hoffe, sie Ihnen bis Mitte nächster Woche schicken zu können.«
Nun dürfen Sie raten, was als Nächstes geschah – natürlich nichts. Weitere E-Mails blieben unbeantwortet. Es wurde Dezember, bis Hecht mir schrieb: »All Ihre Fragen wurden beantwortet, befinden sich jedoch noch immer in der Durchsicht, bevor sie freigegeben werden. Ich hoffe, Ihnen diese Woche alles zukommen lassen zu können.«
Was er nicht tat.
Im Januar 2013 bekam ich endlich Antworten auf ein paar andere Fragen, jedoch keine Reaktion auf meine Anfrage nach Informationen zu den US-Stützpunkten. Mittlerweile war auch Hecht verschwunden, und mein Anliegen war an Benjamin Benson, den Leiter der Presseabteilung des AFRICOM weitergeleitet worden. Als ich bezüglich meiner unbeachtet gebliebenen Fragen nachhakte, erwiderte er, dass meine Anfrage »über den Aufgabenbereich dieses Kommandos hinausgeht und über das, was uns für Recherchen und die Bereitstellung von Informationen im Rahmen des Programms für öffentliche Angelegenheiten zur Verfügung gestellt wird.« Er schlug vor, stattdessen ein Gesuch gemäß dem Gesetz zur Informationsfreiheit zu stellen. Anders ausgedrückt, ich sollte etwas unternehmen, das unter Garantie ein weiterer, sich endlos in die Länge ziehender Vorgang werden würde. (Trotzdem tat ich genau das. Und fast zwei Jahre später warte ich noch immer auf die Dokumente.)
Ich war, gelinde ausgedrückt, etwas verärgert. Schließlich hatte es sechs Monate gedauert, mir nichts vorzulegen und mich am Ende weiter zu verweisen. Das in etwa teilte ich Benson mit. Er antwortete: »Sie erklären zuletzt: ›Ich bin fast ein Jahr irregeleitet worden und beabsichtige, darüber zu schreiben.‹ In unserer freien Gesellschaft ist das natürlich Ihr gutes Recht. Wir erwarten, dass Sie als Profi die Tatsachen korrekt darstellen und möchten Sie bitten zu vermerken, dass wir recherchiert haben und Antworten auf die von Ihnen aufgeworfenen Fragen geliefert haben.«
Zur Kenntnis genommen, Ben. Lassen Sie mich zumindest anmerken, dass Sie mir so gut wie nichts geschickt haben, und ich mich darangemacht habe, die Antworten selbst herauszufinden.
Als wir dann Wochen nach seiner E-Mail telefonierten, bekundete ich wiederholt mein Verständnis dafür, dass er aufgrund der »Sicherheit der Operationen« keine Auflistung der Standorte von US-Stützpunkten in Afrika anbieten konnte, und ich daher jetzt nur noch gern die schlichte Zahl der Anlagen in Afrika hätte. »Das ist kompliziert. Es kommen ständig wechselnde Teams an unterschiedliche Standorte nach Afrika und gehen wieder«, erwiderte er. »Die Bandbreite der Orte, an denen sich US-Truppen möglicherweise befinden, kann ziemlich groß sein. Das könnte ein ziemlich verzerrtes Bild davon liefern, wo wir uns befinden … im Vergleich zu anderen Orten, an denen wir laufende Einsätze haben. Im Hinblick auf eine Zahl wüsste ich also gar nicht, wie ich diese bestimmen sollte.«
Das schien mir eine leichte Übung zu sein: Man musste sie einfach zählen und die notwendigen Haftungsausschlüsse hinzufügen. Also fragte ich, ob man bei AFRICOM Buch darüber führte, wo seine Truppen sich befanden. Das tat man. Wo also lag das Problem? Er setzte zu einem Monolog an, in dem er sich über die Schwierigkeit ausließ zu bestimmen, was genau »ein Standort« sei, und sagte mir dann: »Wir haben keine Methode, um die Standorte wirklich zu zählen.«
Spätestens an diesem Punkt war alles klar. Sie hatten die Zahl aller Standorte, doch sie konnten sie nicht zählen. Sie besaßen Listen davon, wo alle US-Truppen in Afrika stationiert waren, aber keine Liste der Stützpunkte. Es war der klassische Fall eines Hinhaltemanövers, und zwar von der exakt gleichen Art und Weise, in der sich das Kommando in den letzten Jahren mir gegenüber verhalten hatte.
Jedes Mal hatten AFRICOM und seine nachgeordneten Einheiten aufrichtige Anstrengungen unternommen, meine Arbeit zu behindern – angefangen beim Ignorieren meiner Anfragen nach grundlegenden Informationen bis hin zum Vereinbaren von Interviews, die dann kurzfristig wieder abgesagt wurden. Während Journalisten von Zeitungen und Magazinen, die AFRICOM-freundliche Berichte veröffentlichen, Zugang zu hochrangigen Offizieren und geheimen Vorposten ermöglicht wird, und sie mit eigenen Augen militärische Ausbildungsübungen verfolgen dürfen, sind meine Ersuchen um ähnlichen Zugang regelmäßig abgelehnt oder ignoriert worden.
Infolgedessen musste ich einfallsreicher vorgehen, das heißt, ich musste weitgehend unbeachtet gebliebenes öffentliches Aktenmaterial einsehen, Gesuche gemäß dem Gesetz zur Informationsfreiheit einreichen, und aus nächster Nähe einen Blick auf die »Erfolgs«-geschichten des US-Militärs in Afrika werfen, um nachzuprüfen, ob sie der Wahrheit entsprechen. Und ich musste auf das achten, was Offiziere des AFRICOM so sagen, wenn sie mal nicht der offiziellen Linie folgen müssen – zum Beispiel, wenn sie bei einem feierlichen Kommandowechsel auf einer Militärbasis in Deutschland miteinander sprechen.
DER SCHWENK DER USA UND MEINE ENTSPRECHENDE INTERESSENSVERLAGERUNG
Der »Schwenk« der USA gen Afrika begann während der Amtszeit von Präsident George W. Bush und hat sich unter Präsident Barack Obama noch immens verstärkt. Während dessen Amtszeit gab es einen Anstieg an Operationen auf dem gesamten Kontinent um mehr als 200 Prozent. Luftangriffe und Kommandounternehmen in Libyen, Geheimoperationen und Attentate durch Drohnenangriffe in Somalia, ein Stellvertreterkrieg in Mali, undurchsichtige Operationen im Tschad, Anstrengungen gegen die Piraterie im Golf von Guinea – die Liste ließe sich lange fortführen.
Dem Schwenk des Pentagons hin zu Afrika entsprechend verlagerte sich auch mein eigener Schwerpunkt. Im Folgenden stelle ich die Ergebnisse dieser Verlagerung dar. Ich werfe einen Blick auf ein Kriegsgebiet, das sich über fast 50 Länder erstreckt, und von dem man eigentlich überhaupt nicht wissen sollte, ein Kriegsschauplatz von der Größe der Vereinigten Staaten, China, Indien und dem größten Teil Europas zusammengenommen. Ein Kriegsgebiet, das offiziell gar nicht existiert, weil das amerikanische Militär – wenn man von geheimen Beratungen von Kommandeuren oder Briefings für private Auftragnehmer des Militärs absieht – behauptet, in Afrika nicht im Krieg zu sein. Doch die Beweise für diesen Krieg und erste Anzeichen seines Misserfolgs sind dort draußen bereits ersichtlich – von einer abgelegenen Drohnenbasis in Niger bis zu einem bröckelnden Projekt, mit dem man die Bevölkerung in Dschibuti für sich gewinnen wollte; von verhängnisvollen Ausbildungsprogrammen für libysche Milizionäre bis zu einer Christmas-in-July-Feier in der US-Botschaft im Südsudan.
Über so vieles wird nicht berichtet, es bleibt geheim und im Pentagon in den Akten vergraben, ist nur Navy Seals und Army Green Berets, undurchsichtigen privaten Auftragnehmern und verschwiegenen AFRICOM-Kommandeuren bekannt. Ich gab mein Bestes, um das Einrücken des US-Militärs nach Afrika in groben Zügen zu skizzieren und ein paar der Informationslücken zu schließen, um Licht in Operationen zu bringen, die lange im Verborgenen vor sich gegangen sind, und um aufzuzeigen, wo wir möglicherweise in den kommenden Monaten und Jahren hinsteuern könnten. Sie sind im Begriff, einen Ausflug in ein Kriegsgebiet zu unternehmen, von dem nur wenige Leute wissen, mit geheimen Operationen und Stützpunkten. Sie unternehmen heute einen Ausflug auf das Schlachtfeld von morgen.
Nick Turse
März 2015
ANMERKUNG ZUM TEXT
Die Mehrzahl der Artikel, aus denen sich Tomorrow’s Battlefield zusammensetzt, sind zwischen Juli 2012 und November 2014 geschrieben worden und größtenteils auf TomDispatch.com verfügbar. Beim Zusammenstellen dieses Buches sind sie überarbeitet und teilweise aktualisiert worden. Zeitangaben wie »kürzlich« und »letzten Monat« sowie Wiederholungen, wie sie naturgemäß in aufeinanderfolgend geschriebenen Berichten vorkommen, die alle dasselbe Kernthema behandeln, sind größtenteils herausgekürzt worden. Die Artikel sind ansonsten so abgedruckt worden, wie sie zuerst erschienen sind; es gibt lediglich zwei relevante Unterschiede: Online habe ich sie mit reichlich Links zu Quellen versehen; wer sich also eingehender mit der Materie beschäftigen will, sollte für weitere Informationen auch die Quellen heranziehen. Außerdem finden Sie online auch die farbigen Originale der Schwarz-Weiß-Abbildungen der Karten, Präsentationsfolien und Fotografien aus dem Buch. Wie angegeben sind die Kapitel 14–17 später entstanden und in anderen Medien erstmals veröffentlicht worden.
1
SCHATTENKRIEGE DER USA IN AFRIKA: OBAMAS KAMPF UM AFRIKA
12. JULI 2012
Sie nennen sie die Neue Gewürzroute, als Hommage an das mittelalterliche Handelsnetz, das Europa, Afrika und Asien miteinander verband. Bloß hat die heutige »Gewürzroute« nichts mehr mit Zimt, Nelken oder Seide zu tun. Sie ist vielmehr der Superhighway einer Supermacht, auf der Lkws und Schiffe über eine sich vergrößernde Verkehrsinfrastruktur zu Lande und zu Wasser Treibstoff, Nahrungsmittel und Kriegsgerät zu einem Netz von Versorgungsdepots, kleinen Camps und Flugplätzen transportieren, die einer schnell wachsenden Präsenz des US-Militärs in Afrika dienen sollen.
In den Vereinigten Staaten wissen nur wenige von diesem Superhighway oder von den Dutzenden von Übungsmissionen und gemeinsamen militärischen Manövern, die in Staaten durchgeführt werden, die die meisten Amerikaner nicht einmal auf der Landkarte finden würden. Noch weniger haben eine Ahnung davon, dass sich die Militärs beim Erschaffen eines größeren militärischen Fußabdrucks in Afrika auf Marco Polo und die Königin von Saba berufen. All dies spielt sich auf dem »schwarzen Kontinent«, wie man ihn in früheren imperialistischen Zeiten nannte, im Verborgenen ab.
In ostafrikanischen Häfen treffen riesige Frachtcontainer mit täglichen Bedarfsgütern für ein gieriges Militär ein. Sie werden auf Lkws verladen, mit denen sie dann über zerfurchte Straßen zu staubigen Stützpunkten und abgelegenen Vorposten weitertransportiert werden.
Die Dimensionen dieses Schattenkriegs sind an den Lkw-Rastplätzen zu erkennen, an denen einheimische Fahrer auf ihren Langstrecken eine Pause einlegen, zum Beispiel auf der Straße von Dschibuti nach Äthiopien. Dasselbe gilt für andere afrikanische Länder. Die Knotenpunkte dieses Netzwerks erzählen einen Teil der Geschichte, darunter Manda Bay, Garissa und Mombasa in Kenia, Kampala und Entebbe in Uganda, Bangui und Djema in der Zentralafrikanischen Republik, Nzara im Südsudan, Dire Dawa in Äthiopien und der afrikanische Vorzeigestützpunkt des Pentagons in Dschibuti, Camp Lemonnier.
Laut Pat Barnes, einem Sprecher des US Africa Command (AFRICOM), fungiert Camp Lemonnier als einzige offizielle US-Basis auf dem afrikanischen Kontinent. »Hier sind über 2000 Angehörige des US-Militärs stationiert«, teilte er TomDispatch per E-Mail mit. »Die wichtigste Organisation des AFRICOM in Camp Lemonnier ist die Combined Joint Task Force-Horn of Africa (CJTF-HOA). Die Bemühungen der CJTF-HOA konzentrieren sich auf Ostafrika. Sie arbeitet mit Partnerstaaten zusammen, um diese dabei zu unterstützen, ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken.«
Barnes merkte auch an, dass Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums US-Botschaften in ganz Afrika zugeteilt sind, wozu die 21 einzelnen Büros für Sicherheitszusammenarbeit gehören, die dafür zuständig sind, militärische Zusammenarbeit mit »Partnerstaaten« zu erleichtern. Er beschrieb die beteiligten Truppen als kleine Teams, die gezielte Operationen ausführen. Barnes gab zu, dass »AFRICOM an etlichen Standorten in Afrika eine kleine und vorübergehende Präsenz von Personal hat. In allen Fällen sind diese Militärangehörigen Gäste in den Einrichtungen des Gastgeberlandes und arbeiten entweder mit den Armeeangehörigen des Gastgeberlandes zusammen oder in Abstimmung mit ihnen.«
SCHATTENKRIEGE
Camp Lemmonier war 2003, als die Combined Joint Task Force-Horn of Africa (CJTF-HOA) dort aufgestellt wurde, in der Tat der einzige größere US-Außenposten in Afrika. In den darauffolgenden Jahren haben Pentagon und CIA dezent und weitestgehend unbemerkt ihre Truppen über dem ganzen Kontinent verteilt. Heute unterhalten die Vereinigten Staaten entgegen offiziellen Angaben eine überraschend hohe Anzahl von Militärbasen in Afrika. Und die afrikanischen Streitkräfte zu »stärken« erweist sich als wirklich dehnbarer Begriff für das, was dort vor sich geht.
Unter Präsident Obama haben die Einsätze in Afrika weit über die eher begrenzten militärischen Interventionen der Bush-Jahre hinaus sogar noch zugenommen: Da war der Krieg in Libyen 2011, eine regionale Drohnenoffensive, bei der die Einsätze von Flughäfen und Stützpunkten in Dschibuti, Äthiopien und den Seychellen aus geflogen wurden. Dann gab es eine Flotte von 30 Schiffen im Indischen Ozean, die regionale Einsätze unterstützte, und eine mehrgleisige Offensive durch Militär und CIA gegen Milizen in Somalia, zu der Operationen des Geheimdienstes, Schulungen somalischer Agenten, ein geheimes Gefängnis, Hubschrauberangriffe und US-Kommandounternehmen gehörten, sowie eine massive Bereitstellung von Bargeld für Operationen zur Terrorismusbekämpfung überall in Ostafrika. Möglicherweise gab es einen heimlich durchgeführten altmodischen Luftkrieg in der Region, bei dem bemannte Flugzeuge eingesetzt wurden. Es wurden zig Millionen US-Dollar in die Bewaffnung alliierter Söldner und afrikanischer Truppen gesteckt, und es wurde ein Spezialkommando (unterstützt von Experten des US-Außenministeriums) als Expeditionskorps entsendet, um dabei zu helfen, den Anführer der Lord’s Resistance Army, Joseph Kony, und seine höherrangigen Kommandeure zu ergreifen oder zu töten. All das kratzt nur an der Oberfläche dessen, was Washingtons schnell wachsende Pläne und Aktivitäten in der Region ausmacht.
Um diese wie Pilze aus dem Boden schießenden Missionen zu unterstützen, werden fast ständig Ausbildungs-operationen und gemeinsame, Allianzen schmiedende Übungen unternommen, und auf dem ganzen Kontinent sprießen Außenposten jeglicher Art hervor, die durch ein sich ausdehnendes geheimes Versorgungsnetz verbunden sind. Die meisten amerikanischen Stützpunkte in Afrika sind noch immer klein und bescheiden, doch sie erwecken immer mehr den Anschein größerer und dauerhafter Einrichtungen. Fotos des Camp Gilbert in Äthiopien aus dem Jahr 2011 zum Beispiel, die von TomDispatch untersucht wurden, zeigen eine Militärbasis voller klimatisierter Zelte, mit Frachtcontainern, 55 Gallonen fassenden Fässern und anderer, auf Paletten geschnürter Ausrüstung, doch ebenso Freizeitanlagen mit Fernsehgeräten und Videospielen sowie ein gut ausgestattetes Fitnessstudio mit Trimmrädern, Hanteln und anderen Sportgeräten.
KONTINENTALVERSCHIEBUNG
Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 rückte das US-Militär in größerem Umfang in drei wichtigen Regionen ein: Südasien (hauptsächlich Afghanistan), Nahost (in erster Linie Irak) und das Horn von Afrika. Die Vereinigten Staaten ziehen sich aus Afghanistan zurück und haben den Irak bereits verlassen. Doch Afrika bleibt für das Pentagon eine Wachstumschance.
Gegenwärtig sind die Vereinigten Staaten unmittelbar und durch Stellvertreter an Militär- und Überwachungsoperationen gegen eine immer länger werdende Liste regionaler Feinde beteiligt. Dazu zählen El Kaida im Maghreb in Nordafrika, die islamistische Bewegung Boko Haram in Nigeria, die El Kaida nahestehenden Kämpfer im Libyen der Nach-Gaddafi-Zeit, Konys blutrünstige Lord’s Resistance Army (LRA) in der Zentralafrikanischen Republik, der Demokratischen Republik Kongo und im Südsudan, Malis islamistische Rebellengruppe Ansar Dine, die al-Shabaab-Miliz in Somalia und die Guerillakämpfer von El Kaida auf der Arabischen Halbinsel jenseits des Golfs von Aden im Jemen.
Nachforschungen der Washington Post enthüllten, dass von Auftragnehmern betriebene Aufklärungsflugzeuge, die in Entebbe, Uganda, stationiert sind, auf Geheiß des Pentagons das von Konys LRA genutzte Gebiet absuchen, und dass ein- oder zweihundert US-Kommandosoldaten sich auf Manda Bay einen Stützpunkt mit dem kenianischen Militär teilen. Außerdem werden US-Drohnen vom Arba Minch Airport in Äthiopien aus und von den Seychellen im Indischen Ozean eingesetzt, während von Camp Lemonnier Drohnen und F-15 Jagdbomber als Teil der Schattenkriege fliegen, die vom US-Militär und dem CIA im Jemen und Somalia geführt werden. Aufklärungsflugzeuge, die für Spionageeinsätze über Mali, Mauretanien und der Sahara genutzt werden, fliegen auch Missionen von Ouagadougou in Burkina Faso aus, und Pläne für eine vergleichbare Basis im 2011 unabhängig gewordenen Staat Südsudan sind Berichten zufolge in Arbeit.
US-Sondereinsatzkräfte sind auf einer Reihe noch undurchsichtigerer vorgeschobener Operationsbasen auf dem afrikanischen Kontinent stationiert, darunter eine in Djema in der Zentralafrikanischen Republik und andere in Nzara im Südsudan und Dungu in der Demokratischen Republik Kongo. Die USA hatten auch in Mali Truppen stationiert, obwohl sie im Anschluss an einen Staatsstreich die militärischen Beziehungen zu diesem Land offiziell ausgesetzt haben.
Recherchen von TomDispatch zufolge hat die US-Marine zusätzlich einen vorgeschobenen Operationsstandort in Dire Dawa, Äthiopien, bekannt als Camp Gilbert, der vorwiegend mit Seabees [von Abkürzung CB für Construction Battalion, den Bautruppen der US-Navy], Personal für zivile Angelegenheiten und Truppen zum Schutz der eigenen Sicherheit bemannt ist. Neben Camp Lemonnier unterhält das US-Militär noch einen weiteren zwielichtigen Außenposten in Dschibuti, eine Marinehafenanlage, die nicht einmal einen Namen hat. AFRICOM beantwortete keinerlei Anfrage nach weiteren Informationen zu diesen Militärstützpunkten.
Außerdem sind US-Sondereinsatzkräfte in der Zentral-afrikanischen Republik von einem Militärlager in Obo aus mit Operationen gegen die LRA befasst, doch auch über diese Basis hört man nicht viel. »Angehörige des US-Militärs, die bei der Jagd auf Joseph Kony mit regionalem Militär zusammenarbeiten, sind Gäste der afrikanischen Sicherheitskräfte, aus denen die regionalen Bemühungen im Kampf gegen die LRA bestehen«, erzählte mir Barnes. »Speziell in Obo leben die Truppen in einem kleinen Camp und arbeiten mit Truppen des Partnerlandes auf einer ugandischen Militäreinrichtung zusammen, die auf Einladung der Regierung der Zentralafrikanischen Republik betrieben wird.«
Doch dies ist nur ein Teil der Geschichte. US-Truppen arbeiten auch auf Anlagen innerhalb Ugandas. Anfang 2012 bildeten Soldaten des Marine-Sondereinsatzkommandos Special Purpose Marine Air Ground Task Force 12 (SPMAGTF-12) Soldaten der Uganda People’s Defense Force aus, die nicht nur Operationen in der Zentralafrikanischen Republik durchführt, sondern auch als Stellvertretertruppe der Vereinigten Staaten in Somalia im Kampf gegen die militanten Islamisten, bekannt als al-Shabaab, fungiert. Jetzt stellen sie die Mehrzahl der Truppen der Mission der Afrikanischen Union, die die von den USA unterstützte Regierung in der somalischen Hauptstadt Mogadischu schützen.
Im Frühjahr 2012 bildeten Marinesoldaten des SPMAGTF-12 auch Soldaten der Burundi National Defense Force (BNDF) aus, dem zweitgrößten Truppenkontingent in Somalia. In der ersten Hälfte des Jahres nahmen Angehörige der Task Force Raptor, 3rd Squadron, 124th Cavalry Regiment der texanischen Nationalgarde an einer Ausbildungsmission mit dem BNDF in Mudubugu in Burundi teil, und das SPMAGTF-12 entsandte Ausbilder nach Dschibuti, um dort mit einer Eliteeinheit der lokalen Armee zu arbeiten, während andere Marinesoldaten nach Liberia reisten, um Liberias Militär im Zuge einer vom Außenministerium gesteuerten Maßnahme wiederaufzubauen und in Techniken zum Kontrollieren von Unruhen zu unterweisen.
Ferner führten die Vereinigten Staaten Antiterror-Übungen durch und rüsteten Streitkräfte in Algerien, Burkina Faso, dem Tschad, Mauretanien, Niger und Tunesien aus. 2012 führte AFRICOM 14 größere gemeinsame Ausbildungsmanöver durch, darunter Einsätze in Marokko, Kamerun, Gabun, Botswana, Südafrika, Lesotho, dem Senegal und Nigeria.
Die Truppenstärke der US-Streitkräfte, die diese gemeinsamen Ausbildungsübungen durchführen, schwankt, doch Barnes sagte mir, dass »im Durchschnitt ungefähr 5000 Angehörige des US-Militärs und Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums auf dem Kontinent tätig sind.«
AIR AFRICA
2012 enthüllte die Washington Post, dass spätestens seit 2009 die »Praxis der Beauftragung von Privatunternehmen zum Ausspionieren riesiger Flächen afrikanischen Gebiets … ein Grundpfeiler der geheimen Aktivitäten des US-Militärs auf dem Kontinent ist.« Die Tusker Sand genannte Operation besteht aus Einsätzen, die vom Flughafen Entebbe in Uganda und einer Handvoll anderer Flugplätze geflogen werden. Ihre harmlos aussehenden Turboprop-Flugzeuge sind vollgepackt mit technisch ausgefeilten Überwachungsgeräten.
Die Söldner-Spione der USA in Afrika sind jedoch nur ein Teil der Geschichte.
Obwohl das Pentagon ein vergleichbares Drohnen-Überwachungsprogramm, genannt Tusker Wing, gestrichen hat, hat es Millionen von US-Dollar für die Erweiterung des Zivilflughafens in Arba Minch, Äthiopien, investiert, um von dort Drohneneinsätze fliegen zu können. Die Infrastruktur für derartige Einsätze war vergleichsweise günstig und einfach aufzubauen, doch es zeichnet sich ein Problem ab, das weitaus beängstigender ist, eines, das in engem Zusammenhang mit der »Neuen Gewürzroute« steht.
»Marco Polo war nicht nur ein Erforscher«, erklärte Armeeplaner Chris Zahner 2013 bei einer Konferenz in Dschibuti. »Er war auch ein Logistiker, der logistische Knotenpunkte entlang der Seidenstraße erschlossen hat. Lasst uns jetzt dort, wo die Königin von Saba unterwegs war, etwas Gleichartiges tun.« Wenn man die Lobeshymnen auf vergangene Berühmtheiten mal beiseitelässt, haben die Gründe dafür, Mittel in die Versorgungsnetze zu Wasser und zu Lande fließen zu lassen, weniger mit Geschichte als mit Afrikas Flughafeninfrastruktur zu tun.
Von den 3300 Flugplätzen in Afrika, die in einem Bericht der National Geospatial-Intelligence Agency, des Geheimdienstes für Geodaten, aufgeführt sind, hat die Luftwaffe lediglich 303 begutachtet, doch nur 158 dieser Gutachten sind noch aktuell. Die Hälfte dieser untersuchten Flugplätze würde dem Gewicht der Transportflugzeuge Lockheed C-130 Hercules, auf die sich das US-Militär in hohem Maße zum Transport von Truppen und Material stützt, nicht standhalten. Diese Beschränkungen sind 2010 während des von der AFRICOM in jenem Jahr veranstalteten gemeinsamen Ausbildungsmanövers Natural Fire zutage getreten. Als die C-130er einen Flugplatz in Gulu, Uganda, nicht nutzen konnten, wurden zusätzliche 3 Millionen Dollar für das Einfliegen von Chinook-Transporthubschraubern ausgegeben.
Des Weiteren kosten das Beschaffen von Überflugs- und Landerechten und die Auflagen zur Nutzung der Flughäfen durch Militärflugzeuge das Pentagon nicht nur Zeit und Geld, sie wecken auch häufig den Argwohn der lokalen Bevölkerung. In einem Artikel im militärischen Handelsmagazin Army Sustainment warb Major Joseph Gaddis von der Air Force für eine sich abzeichnende Lösung: Outsourcing. Das Konzept wurde 2011 bei Atlas Drop, einem anderen AFRICOM-Schulungseinsatz, getestet.
»Statt der Verwendung von Militärmaschinen zum Lufttransport von Ausrüstung zu und von dem Manöver setzten die Planer gewerbliche Transportunternehmen ein«, schreibt Gaddis. »Teilnehmer der Übung wurden durch Transportdienste versorgt, die die Ware direkt an den Zielort lieferten, wodurch die Notwendigkeit zusätzlichen Personals, das die Ausrüstung durch die Fracht- und Zollbereiche schleust, umgangen wurde.« Das Nutzen von Söldner-Frachtunternehmen, um das Einholen von Überflugs- und Landerechten zu umgehen und Frachtgut zu den Flughäfen zu transportieren, die C-130ern nicht standhalten, ist jedoch nur einer der möglichen Wege, die das Pentagon eingeschlagen hat, um seine expandierenden Operationen in Afrika zu unterstützen.
Ein weiterer sind Bauprojekte.
DAS GROSSE AUFSTOCKEN
Militärische Ausschreibungsdokumente geben Aufschluss über Pläne für Investitionen von bis zu 180 Millionen Dollar allein in Baumaßnahmen am Camp Lemonnier. Zu ihnen gehört als bedeutendstes Projekt das Asphaltieren von 54 500 m2 Rollbahn, »die für Flugzeuge mit mittlerer Frachtmenge ausgelegt ist«, und der Bau eines 185 000 m2 großen Ladebereichs für Kampfflugzeuge. Zusätzlich sind Pläne in Arbeit, modulare Instandhaltungsbauten, Flugzeughangars und Lagerhallen für Munition zu errichten, die für zunehmende Einsätze des US-Militärs in Afrika benötigt werden.
Andere Ausschreibungsunterlagen legen nahe, dass das Pentagon in den kommenden Jahren bis zu 50 Millionen US-Dollar in neue Bauvorhaben auf diesem Stützpunkt sowie in Camp Simba in Kenia und weiteren, nicht näher bezeichneten Standorten investieren wird. Weitere Ausschreibungsunterlagen weisen auf zukünftige militärische Bauvorhaben in Ägypten hin, wo das Pentagon bereits eine medizinische Forschungsanlage unterhält, sowie auf weitere Arbeiten in Dschibuti.
Ferner geht aus Ausschreibungsdokumenten hervor, dass man mit einem Zustrom von »Notunterkünften für Truppen« in Camp Lemonnier rechnet, darunter fast 300 zusätzliche Containerwohneinheiten (containerized living units, CLU), stapelbare, klimatisierte Wohnquartiere sowie Latrinen und Waschküchen.
Militärische Dokumente weisen außerdem darauf hin, dass 2011 auf der US-Basis in Entebbe eine fast 450 000 Dollar teure Übungsanlage eingerichtet wurde. All dies legt nahe, dass das Pentagon mit seiner Truppenaufstockung in Afrika gerade erst begonnen hat.
DER KAMPF UM AFRIKA
AFRICOM-Kommandeur General Carter Ham erläuterte in einem Vortrag in Arlington, Virginia, die Beweggründe hinter den US-Operationen auf dem afrikanischen Kontinent: »Das absolute Gebot für das US-Militär ist es, Amerika, Amerikaner und amerikanische Interessen zu schützen; das heißt in unserem Fall, in meinem Fall, uns vor Bedrohungen zu schützen, die vom afrikanischen Kontinent ausgehen können.« Als Beispiel nannte Ham die in Somalia ansässige Terrormiliz al-Shabaab. »Warum kümmert uns das?«, fragte er rhetorisch. »Nun, El Kaida ist eine weltweit agierende Unternehmung … wir halten sie als eine El Kaida-Tochter ganz klar für … eine Bedrohung für Amerika und Amerikaner.«
Sie dort zu bekämpfen, damit wir sie nicht hier bekämpfen müssen, ist seit Jahrzehnten ein Kern-Dogma der amerikanischen Außenpolitik, ganz besonders seit den Terroranschlägen des 11. September 2001. Komplexe politische und gesellschaftliche Probleme militärisch lösen zu wollen, hat regelmäßig unvorhersehbare Konsequenzen nach sich gezogen. So führte der von den USA unterstützte Krieg in Libyen dazu, dass Söldnerheere der Tuareg, die für den libyschen Alleinherrscher Muammar al-Gaddafi gekämpft hatten, nach Mali zurückkehrten, wo sie die Destabilisierung des Landes förderten. In der Folge gab es einen Militärputsch durch einen von Amerikanern ausgebildeten Offizier und eine Machtübernahme in einigen Gebieten durch Tuareg-Kämpfer der Nationalen Bewegung zur Befreiung des Azawad, die zuvor libysche Waffenlager überfallen hatten. Andere Teile des Landes wiederum wurden von den Freischärlern von Ansar Dine in Besitz genommen, dem zuletzt von den Amerikanern ins Visier genommenen El-Kaida-»Tochterunternehmen.« Innerhalb nur eines Jahres hat eine militärische Intervention zu drei größeren Rückschlägen in einem Nachbarland geführt.
Da sich die Obama-Regierung ganz offensichtlich am Kampf um Afrika beteiligt, nimmt die Wahrscheinlichkeit von aufeinanderfolgenden Wellen sich überschneidender Rückschläge exponentiell zu. Mali dürfte erst der Anfang gewesen sein, und es lässt sich nicht vorhersagen, wie es in anderen Fällen ausgehen wird. Halten Sie Afrika einstweilen im Blick – das US-Militär wird dort noch auf Jahre hinaus für Schlagzeilen sorgen.
2
ZENTRUM DER RÜCKSCHLÄGE: DIE DIASPORA DES TERRORS
18. JUNI 2013
Der Golf von Guinea. Er sagte es ohne einen Anflug von Ironie oder Verlegenheit. Dies war eine der großen Erfolgsstorys des US Africa Commands.
Halb so wild, dass die meisten Amerikaner ihn auf einer Landkarte nicht finden würden und von den Nationen an seinen Ufern wie Gabun, Benin und Togo noch nie gehört haben. Es macht nichts, dass nur fünf Tage bevor ich mit dem leitenden Sprecher vom AFRICOM gesprochen habe, die Wochenzeitschrift The Economist die Frage aufgeworfen hatte, ob der Golf von Guinea nahe daran war, »ein zweites Somalia« zu werden, weil die Piraterie dort von 2011 bis 2012 um 41 Prozent zugenommen hatte und sich die Situation weiter verschlimmern werde.
Der Golf von Guinea sei eines der Hauptgebiete in Afrika, in denen sich die »Stabilität signifikant verbessert hat«, wie mir der Sprecher des Kommandos versicherte, und das US-Militär habe eine maßgebliche Rolle dabei gespielt, dies zu erreichen. Doch wie mag es dann in den vielen anderen Gebieten des afrikanischen Kontinents aussehen, die seit der Aufstellung des AFRICOM von Staatsstreichen, Aufständen, Gewalt und Instabilität geplagt worden sind?





























