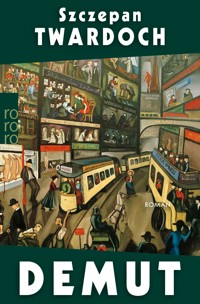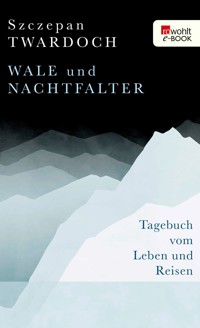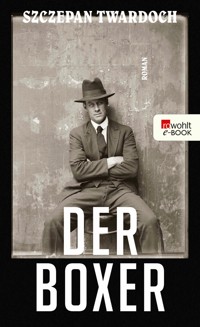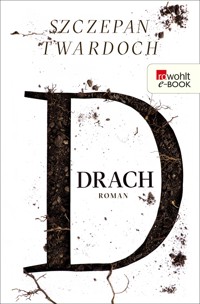9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warschau nach dem deutschen Angriff 1939. Jakub Shapiro, früher Unterweltkönig der Stadt, kämpft als Soldat einen aussichtslosen Kampf. Sein Gangsterreich zerfällt, das luxuriöse Leben ist zu Ende. Während Shapiro seine Familie zu schützen versucht, macht er einen unverzeihlichen Fehler. Frau und Söhne verlassen ihn. Jakubs Geliebte Ryfka rettet ihn aus dem Ghetto in eine konspirative Wohnung. So ist es bald der halbwüchsige Sohn David, der das Überleben von Mutter und Bruder sichert, durch Schmuggel und Schwarzhandel; unter schon alltäglicher Todesgefahr erlebt er in bizarren Abenteuern einen Rausch von Jugend und Freiheit. Doch die Gräuel, Hunger, Gewalt und Mord, konzentrieren sich hier wie unter einem Brennglas, umso mehr nach dem Ghettoaufstand. Und der Preis für ein Überleben ist so hoch und schrecklich, dass niemand die Schuld je tragen können wird. Als das Ghetto zerstört liegt, kämpft Ryfka in der apokalyptischen Trümmerwelt bis aufs Blut für ihrer beider Zukunft. Und David will Rache nehmen, an den Deutschen, an allen. Szczepan Twardoch schildert kompromisslos einen gewaltigen Stoff: die deutsche Besatzung, die Warschauer Aufstände, das Ghetto. Er erzählt von Juden, Polen, Deutschen, von Opfern und Henkern, erzählt mit glänzender, eisiger Spannung von einer dunklen Zeit – und der schwersten aller Prüfungen, Mensch zu bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Szczepan Twardoch
Das schwarze Königreich
Roman
Über dieses Buch
«Ein wuchtiger, unter die Haut gehender Geschichtsroman.» (Deutschlandfunk)
«Eine enorme Sprachkraft.» (Hamburger Abendblatt)
«Ein Meisterwerk.» (NDR Kultur)
Warschau nach dem deutschen Angriff 1939. Jakub Shapiro, früherer Boxer und Unterweltkönig der Stadt, führt als Soldat einen aussichtslosen Kampf. Doch das luxuriöse Leben geht zu Ende, sein Reich zerfällt, auch seine Familie. Bald sorgt der halbwüchsige Sohn David unter Todesgefahr durch Schmuggel und Schwarzhandel für das Überleben von Mutter und Bruder. Gräuel, Hunger und Verrat beherrschen die Stadt, der Preis um zu überleben ist unermesslich hoch. Als das Ghetto zerstört liegt, kämpft Jakubs Geliebte Ryfka bis aufs Blut für ihre und Jakubs Zukunft. Und David will Rache nehmen, an den Deutschen, an allen.
Der meisterhafte Roman des polnischen Literaturstars Szczepan Twardoch über das Überleben im Warschauer Ghetto. Kompromisslos erzählt, mit glänzender, eisiger Spannung.
Vita
Szczepan Twardoch, geb. 1979, ist einer der herausragenden Autoren der Gegenwartsliteratur. Mit «Morphin» (2012) gelang ihm der Durchbruch, das Buch wurde mit dem Polityka-Passport-Preis ausgezeichnet und begeisterte Kritik und Leser. Für «Drach» wurden Twardoch und sein Übersetzer Olaf Kühl 2016 mit dem Brücke Berlin Preis geehrt. Zuletzt erschienen der hochgelobte Roman «Der Boxer» sowie das Tagebuch «Wale und Nachtfalter». Szczepan Twardoch lebt mit seiner Familie in Pilchowice/Schlesien.
Olaf Kühl, 1955 geboren, studierte Slawistik, Osteuropäische Geschichte und Zeitgeschichte und arbeitet seit 1996 als Osteuropareferent für den Regierenden Bürgermeister von Berlin. Er ist Autor und einer der wichtigsten Übersetzer aus dem Polnischen und Russischen. Sein zweiter Roman, «Der wahre Sohn», war 2013 für den Deutschen Buchpreis nominiert.
Impressum
Die polnische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel «Królestwo» bei Wydawnictwo Literackie, Krakau.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Copyright © 2018 by Szczepan Twardoch
Copyright © 2018 by Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2018. All rights reserved.
Motto: Jan Kochanowski, «Die Abfertigung der griechischen Gesandten», aus dem Polnischen von Spiridon Wukadinović, Posen, 1929.
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt, nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Ferdinando Scianna/Magnum Photos/Agentur Focus
ISBN 978-3-644-00357-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Verlottert Königreich, dem Untergange nahe,
Wo weder Rechte gelten, noch Gerechtigkeit auch
Daheim ist, sondern alles nur mit Golde käuflich!»
Jan Kochanowski,
Die Abfertigung der griechischen Gesandten
Ryfka
In Kälte, in Dunkelheit, in unablässiger Furcht.
In Kälte, in Dunkelheit, in unablässiger Furcht ich, das Nachttier.
An dunklen Tagen ducke ich mich in mein Loch, grau wie die Wände der mich bergenden Höhlen, gehe in der dunklen Nacht auf Beutezug, die Fleischreste abkratzen vom Skelett der toten Stadt, ihr hartgefrorenes Aas benagen. Husche zwischen Betonfelsen hindurch, durch die Canyons der Straßen, laufe leichtfüßig über Trümmerhalden, ohne Spuren zu hinterlassen, beinahe unsichtbar, geräuschlos und grau, den Stachel in der Tasche, ich weide, kehre dann zurück und füttere wie eine Mutter denjenigen, den ich geliebt habe, schmiege mich in mein Lager, werde eins mit den Wänden, den Lumpen, rolle mich ein neben ihm, wärme ihn mit dem Rest Wärme, den ich in mir habe, wärme ihn wie eine Mutter.
Einen bösen Menschen habe ich geliebt, mein ganzes Leben.
Ich wärme und füttere ihn, dann gehe ich wieder hinaus, und er bleibt, in der Finsternis. Ich erinnere mich hiermals und erinnerte mich damals, in der Kälte, in der Dunkelheit, in der Furcht, wie er bei mir saß, sitzt, ein paar Jahre zuvor, in einer anderen Welt, noch in meinem Bordell, dort wo die Pius-XI. und die Koszykowa aufeinanderstoßen, bei mir saß, nachdem sie 1937 dann doch nicht nach Palästina ausgereist waren, er und diese seine Frau. Nachdem sie zurückgekehrt waren. Nachdem das Flugzeug kehrtgemacht hatte.
Also er saß bei mir, ich erinnere mich, er sitzt, saß nackt auf dem Bett, stützte die Ellbogen auf die Knie und den Kopf auf die Ellbogen. Schwieg zunächst. Dann trank er. Trinkt. Weinte. Donnert mit der Faust gegen die Wand, bis er sich die Knochen der rechten Hand bricht, die Wand blutig gemacht hat, aber er schlägt weiter, zu betrunken, um den Schmerz der Knochen zu spüren, die nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal brachen, da ihm alles weh tat, nur der Körper nicht, ich weiß nicht, ob ich es Herz oder Seele nennen soll, schließlich hat so ein Mensch keine Seele und nur einen Muskel als Herz, trotzdem ist etwas im Inneren, etwas, das nicht Körper ist und doch Mensch, weil es zum Menschen gehört, oder der Mensch zu ihm, dem, was da im Inneren ist, und dieses Etwas tat ihm weh, und um diesen Schmerz zu betäuben, brach er sich die Mittelhandknochen, indem er gegen die Wand schlug, und ich rief den Doktor, der Doktor kam, sah sich die Hand an, er musste ins Spital, dort röntgte der Doktor, richtete ein, gipste, tat alles, was zu tun war, und Jakub kehrt bald darauf zurück und trank weiter, mit vergipster Hand, dann verlor er das Bewusstsein und lag auf dem Bett, nackt und nichts wissend.
Ich liebe, liebte einen bösen Menschen, dachte ich damals, als ich seinen Körper betrachtete, die blaugrauen Tätowierungen und die von dickem Speck überwachsenen Muskeln.
Denkt etwa Frau Goebbels so von ihrem Mann, dass sie einen bösen Menschen liebe? Und liebt sie ihn? Was ist die Liebe, wenn man einen so Bösen liebt? Auch ich bin ein böser Mensch, aber er liebt mich nicht. Das ist die Konstellation zwischen uns, zwei böse Menschen, ich böse, er böse, ich liebe ihn, er aber liebt niemanden, nicht einmal sich selbst, vielleicht macht mich das ein bisschen besser, dass ich in all meiner Verderbtheit, in der ganzen Niedertracht meiner Nicht-Seele, meines Nicht-Herzens, doch immerhin ihn liebe, vielleicht bin ich doch nicht ganz so böse, vielleicht ist etwas Menschenähnliches in mir geblieben, in ihm dagegen nicht, denn er liebt niemanden. Früher einmal hat er sich selbst geliebt, all diese Nippsachen, Pistolen, Taschenmesser und hübschen Anzüge, seine teuren Lederschuhe und Automobile hat er geliebt, mit denen er sich ausstaffierte, weil er mehr sein wollte als nur einer von vielen Warschauer Judenbengeln, kein Juden-Niemand, Stück Scheiße, menschlicher Auswurf, und er hatte kein Nicht-Herz in sich und keine Nicht-Seele, die er irgendeiner Idee opfern hätte können, so wie sein Bruder sich für Palästina opferte und dafür sterben wollte, jedoch starb er nicht für Palästina, sondern für nichts, allerdings durch Jakub, also vielleicht für Jakub; hat er ihm sein Leben hingegeben, vielleicht?
Und Jakub wollte mehr sein als Auswurf, deshalb boxte er, schoss, staffierte sich aus, spazierte, stolzierte, promenierte von der Tłomackie zum Kercelak, lüftete den Hut, lächelte, verbeugte sich, vor wem es geboten war, turtelte, flirtete, Männchen das, Stier der, Vieh, und dann geschah, was geschehen ist, und Jakub liebte sich selbst nicht mehr, also liebte er auch niemand anderen und liegt jetzt hier, in einem Lager aus Fetzen, Decken und Mänteln, einem Lumpenlager, mager, unrasiert, bedeckt von Lumpen, hat seit einer Woche kein Wort in keiner menschlichen Sprache gesprochen, wollte stattdessen schreien, und ich hielt ihm den Mund zu, er ist schwach wie ein Kind, und ich bin bei ihm.
Wenn es mir gelingt, gelang, etwas zu essen aufzutreiben, fütterte ich ihn, manchmal beinahe mit Gewalt. Ich öffne ihm den Mund, legte einen Zuckerwürfel hinein, wartete, bis er sich aufgelöst hat im Speichel, warte, bis er ihn schluckt.
Ich zwinge ihn, sich zu entleeren, zum Glück reichen ein oder zwei Mal die Woche, denn da ist nichts, was auszuscheiden wäre.
Ich sorge dafür, dass er sich nicht einnässt, Kleidung und Bettwäsche nicht vollmacht, denn dann würde er erfrieren.
Und ich denke daran, wie er nackt bei mir saß, sitzt, am Tag, nachdem er sich die Hand gebrochen hatte, immer noch das Jahr 1937, ich denke zurück an all die Nächte, da er in meinem Bett schlief und ich danebensaß und seinen breiten, tätowierten Rücken betrachtete, die Schultern und die Gesäßbacken, und seine Kraft liebte, die Angst liebte, die er auslöste, seine Unbändigkeit, die Trauer liebte, die ihn erfüllte, ihn sogar dafür liebte, dass er mich so sehr in der Hand hatte, ihn dafür liebte, dass er mich für diese Pissnelke verlassen hat, dieses Drecksluder aus gutem Hause, dieses Advokatentöchterchen, verzärtelt, verwöhnt, und es amüsierte mich sogar, dass sie so zugrunde ging, nicht jetzt, aber damals, dieses Püppchen, das sich hätte assimilieren und wie eine normale Polin hätte leben können, so ein hübsches Mädchen, sie ging mit ihm, ja, es amüsierte mich, sogar dafür habe ich ihn geliebt, denn ich hielt sehr wenig von mir, ein Mädchen aus dreckigster jüdischer Gosse, deshalb betrachtete ich das als einen weiteren seiner Erfolge, er nimmt sich so eine, Dämchen aus einer anderen Welt, ihm gelingt alles und auch das.
Das ist nicht wahr. Sogar hier belüge ich mich, wenn auch nur ein bisschen, sogar hiermals versuche ich, mit Lügen ein bisschen von meiner damals verlorenen Würde zu wahren. Ich hasste ihn dafür. Dafür wollte ich ihn töten. Auch sie wollte ich töten, eine Flasche zerschlagen und ihm das Glas ins Gesicht stoßen, in den Bauch, aufschlitzen, Augen auskratzen, das kann ich ja, ich erinnere mich noch immer gut, wie es ist, wenn man diese innere Explosion zulässt. Das weiß ich noch aus dem Gefängnis.
Ich liebte ihn auch damals, hager, mit grauer und rauer Haut, schwach, zitternd, ich liebe ihn, selbst wenn ich ihm den Hintern wische und die dreckigen Papierfetzen für später aufbewahre, als Heizmaterial, ich liebe seine vom Hunger schon geschwollenen riesenhaften Hände, zum ersten Mal seit Kriegsanfang ist er vom Hunger gedunsen, jetzt, erst jetzt, da die Sowjets schon in Praga stehen. Und er hat gedacht, alle anderen würden aufschwemmen, nur er nicht. Höchstens vom Speck, der ihm über den Hosengürtel quoll.
Das Schlimmste ist, dass er nicht aufgedunsen sein müsste. Wir hungern, schon, aber erst seit ein paar Monaten, seit dem Aufstand. Im Ghetto haben wir uns satt gegessen, nach der Großaktion, in den Fabriken, den Szopy, waren wir auch nicht hungrig, aber schon damals verlor Jakub langsam das Interesse am Essen, er wurde immer apathischer, aß immer weniger. So wie später, bei ihr. Er magerte ab. Substanz genug hatte er. Am Ende aß er nur noch, was ich ihm in den Mund schob und zu schlucken beinahe zwang.
Es wird schon dunkel, wurde, man wird den Rauch nicht sehen, also kann ich ein Feuer machen. Ich kann auch so Feuer machen, dass überhaupt kein Rauch entsteht, ich bin ein Nachttier, ein Nachtungeheuer, wenn ich das nicht könnte, wäre ich nicht mehr am Leben, deshalb habe, hatte ich für das nächtliche Feuer nicht qualmendes Brennzeug zurückgelegt, für das Tagesfeuer dagegen besondere, ganz trockene Scheite, deren Rauch sich in unserem Versteck ausbreitet und schon gar nicht mehr zu sehen ist, wenn er nach draußen entweicht. Zu diesem Zweck habe ich mir aus einer alten, rostigen Tonne, die ich aus dem Keller hierhergeschleppt habe, einen Ofen gebastelt, habe darin Ziegelsteine gestapelt, Roste darübergelegt, habe mit einer Feile Öffnungen für Feuerluke und Aschefach gebohrt, habe aus aufgelesenen Rohren einen Schornstein gebastelt, der Zug macht und den Rauch nicht nach draußen leitet, das wäre Selbstmord, sondern in den Flur nebenan, wo er sich ruhig ausbreiten kann, von draußen immer noch unsichtbar.
Ich zerknülle zum Anzünden ein paar Fetzen der «Jüdischen Zeitung» Jahrgang 1942, werfe ein paar vom Schrank abgespaltene Spreißel dazu, zünde an und warte, bis es brennt. Ein wenig wird es ihn wärmen.
«Ich muss gehen, Jakub», sage ich sehr leise. «Ich muss. Rühr dich nicht fort von hier.»
Es ist Zeit. Heute habe ich ihm den letzten Zuckerwürfel aus dem Säckchen gegeben, das ich noch aus der Wohnung dieser polnischen Nutte mitgenommen hatte, die uns versteckte, doch an sie will ich jetzt nicht denken. Wasser habe ich genug, noch mehrere Liter in der Milchkanne, wichtiger aber ist, dass ich weiß, wo ich Wasser bekomme, denn ich habe einen fertigen Brunnen. Es gefriert, das tut nichts, ich schmelze das Eis nachts auf meinem Öfchen.
Ich schaue auf meinen in die Wand geritzten Kalender, schaute. Ich tippte auf den ersten Dezember, jetzt sehe ich, es stimmt, ich habe mich nicht geirrt. Ich habe zwei Paar dicker Strumpfhosen an, eine wollene Männerhose, zwei Pullover und eine für mich viel zu große, dicke Männerjacke. Ich nehme den Sack, nahm ihn, aus dem Sack habe ich mit Hilfe einer dicken Schnur so etwas wie einen Rucksack gemacht, den werfe ich mir über und knöpfe den Mantel zu, zurre ihn mit einem Soldatengürtel fest, umwickle die Schuhe mit Lappen, den Kopf mit einem Schal und einem dicken Wolltuch. Ich habe auch zwei Paar wollener Handschuhe, über den linken ziehe ich Jakubs alte Armbanduhr, eine deutsche Glashütte, die er vor dem Krieg getragen hat, mit abgewetztem Armband, aber Zeigern, die im Dunkel leuchten. Unter den Gürtel, hinten, schiebe ich ein kleines, gebogenes Brecheisen, sehr nützliches Werkzeug, in eine Manteltasche stecke ich das Messer, ein gewöhnliches Küchenmesser, in die andere die Pistole.
Gekauft habe ich sie noch im Februar dreiundvierzig in der Twarda, damals ging ich außerhalb des Restghettos zur Arbeit, natürlich ging man ausschließlich in Gruppen; wenn jemand es wagte, allein zu gehen, schossen die Deutschen ohne Vorwarnung; unser Kommando wurde von einer dicken Deutschen angeführt, die den verbreiteten Namen Miller trug.
Jakub ging nirgendwo mehr hin, Jakub war schon damals von Nacht umgeben, er hatte eine Nummer zum Überleben, doch nach der Januaraktion zeigte sich, dass die Nummer die Sicherheit nicht mehr garantierte, damals holte man allein aus unserem Szop mehrere hundert Menschen ab, nur wie durch ein Wunder, ein fett geschmiertes, blieben wir verschont, Jakub beachtete das fast gar nicht, er vegetierte und ging immer mehr ein, ich zog allein los zum Schmuggel. Ich achtete auf uns beide, auf alles, auf das man achten musste, um zu leben.
Leben, leben, leben, das einzige Gebet, das ich sprach.
In der Twarda war ein Laden, im Grunde auf dem Hof eines der Häuser Ecke Pańska und Twarda, übrigens auf dem Gelände des ehemaligen kleinen Ghettos, nach der Liquidierung fand dort viel Schmugglerhandel statt, ich hatte ein paar Bekannte und lernte einen Menschen aus Lublin kennen, den ich schließlich frage, fragte, ob er mir nicht ein Schießeisen besorgen könnte. Ich fragte ihn, weil ich längst wusste, dass er ein Auge auf mich geworfen hatte, dann läuft das Geschäft immer leichter. Der Lubliner Schmuggler antwortete mir, er sagt, Schießeisen sind heutzutage sehr teuer, jeder Judenbengel würde gern so ein Eisen kaufen, so schießwütig sind die Juden plötzlich alle.
So war das damals tatsächlich, schon nach der Großaktion war eine Pistole die beste Währung in dem, was vom Ghetto geblieben war, und nachdem sie diese Aktion im Januar durchgeführt hatten, beschloss ich für mich, dass sie mich nicht lebend kriegen würden; besser, wenigstens einen Deutschen umzubringen, wenn sie mich holen kommen, als einfach zu sterben. Damals dachten viele von uns schon so, besonders die aus der Partei, aber dorthin zog es mich nicht, nicht dazu hatte ich mit jedem, der mir über den Weg lief, um mich selbst gekämpft, um jemand und nicht niemand zu sein, nicht dazu hatte ich so viel geopfert, wie ich geopfert hatte, um jetzt auf die Befehle eines eingebildeten Scheißkerls zu hören, egal ob er Bundist, Zionist oder ein Ha-Schomer war.
Auf Geld legte niemand mehr Wert, obwohl es welches gab. Wenn jemand schmuggelte und sich nicht erschießen ließ, war der Gewinn sicher. Am meisten kaufte die Partei, aber die Privaten auch, wenn sie nur bezahlen konnten, und die Kämpfer der Partei drückten dabei ein Auge zu, pressten den Reichen ordentlich Geld ab, bis sich irgendwann diese Reichen mit den Bejtar-Leuten zerstritten. Es hieß, die Partei sei einverstanden damit, dass die Privaten Waffen haben, denn wenn wir endlich den Aufstand wagen würden, könne sich jeder mit einer Waffe dem Kampf um einen würdigen, makkabäischen Tod anschließen.
Ich jedoch hatte andere Ziele als den makkabäischen Tod.
Ich rechnete zwar damit und wollte lieber sterben und dabei wenigstens eins dieser Ungeheuer mit in den Tod reißen, aber lieber wollte ich nicht sterben, und deshalb lebe ich, habe überlebt, während alle gestorben sind.
Damals also sagte ich ihm, diesem Typen aus Lublin, ich hätte Geld, so viel wie nötig. Zwei Tage später, auf dem Weg zur Arbeit, traf ich ihn am vorherigen Ort. Er fragte, ob ich das Geld dabeihätte, hatte ich, ich zahlte siebentausend, was sollte ich damit, sieben-, zehn-, einhunderttausend, was sollte ich anfangen mit dem Geld, seinem Geld und meinem, dem alten Geld noch aus der Vorkriegszeit und dem neuen, vom Schmuggel. Geld ist Papier, Geld ist nichts. Ein Schießeisen ist ein guter, würdiger, mutiger Tod, ich machte mir keine Illusionen, dass ein Schießeisen vielleicht sogar das Leben bedeuten könnte, wenn Leben, dann nicht dank einem Pistölchen, mit einer Pistole erkämpfst du dir das Leben nicht, dafür braucht es eine Armee und eine Flotte, Flugzeuge und Panzer, die Pistole taugt nur für den guten Tod, für das Leben braucht es etwas ganz anderes. Aber ein guter Tod ist besser als solch ein Tod.
So dachte ich damals, hiermals weiß ich nicht mehr, was besser ist. Ich bildete mir ein, damals, ein Sterben, bei dem ich mit der Pistole schieße, wäre besser, weil ich im Kampf die Menschenwürde wahre, die man mir im Zug nach Treblinka genommen hätte und die mir jeder Gestapomann nehmen könnte, der mich ausliefert, jeder Pole, der mich auf der Stelle umbringt, doch das stimmt ja nicht, Tod ist Tod. Im Tod verliert man genau diese Menschenwürde, unabhängig von der Art des Sterbens, denn im Sterben wird der Mensch vom Menschen zu einem toten Körper, einem Nichts.
Also zahlte ich und frage, wo das Eisen sei, darauf jener Mensch: Im Zimmer oben, und dort würde er von mir noch etwas verlangen, sonst würde nichts aus der Transaktion.
Darauf wollte ich ihm im ersten Reflex antworten, ich sei keine Nutte, aber dann sagte ich mir, wozu streiten, was macht es für einen Unterschied, schließlich sterben wir sowieso bald, kein Streit, keine Zeit, unsere Gruppe macht sich in einer Stunde auf den Rückweg, und der Körper, was ist das schon, der Körper nutzt sich davon nicht ab, und wenn er dreckig wird, kann man ihn waschen. Deshalb ging ich mit ihm auf dieses Zimmer, dort sagte ich zu ihm, wenn er sein Vergnügen haben wolle, bräuchte ich eine Schüssel mit heißem Wasser, ein Stück echter Seife und ein Handtuch. Er lief die Treppe runter und kam gleich darauf mit allem zurück. Fragte, ob ich mich vorher wasche, nein, nachher. Er war schon zu erregt, um zu protestieren. Ich zog mich aus, ohne auf die Aufforderung zu warten, er tatschte mich ab, es war widerwärtig, aber ich habe schon ganz andere Dinge ertragen, und dann tat er, was er tun musste, ich spürte, spüre seinen Schwanz in mir, und das wurde mir so egal, als wäre es eine vorübergehende, körperliche Unbequemlichkeit, als würde mich einen Moment lang der Schuh drücken und ich wüsste, dass ich ihn gleich ausziehen, er gleich nicht mehr drücken würde.
Ich wandte den Kopf ab, sah aus dem Fenster, es wurde gerade hell, der Tag war frostig, und der Himmel von diesem blassen, winterlichen, tristen Blau. Auf dem Balkongeländer saß, sitzt eine Dohle, ganz aufgeplustert, schwarzgrau, und sah mich an mit schief gelegtem Vogelköpfchen, mich und den Mann, der auf mir lag, und ich wollte glauben, die Dohle verstünde mich, obwohl ich ja weiß, das kann nicht sein, Dohlen sind klug, aber verstehen tun sie nur sich selbst, so wie wir alle.
Vielleicht wollen sie sich sogar, wie wir, weismachen, sie wären sich selbst ein Geheimnis, wir alle tun das, dabei ist es nicht wahr.
Wir haben selbst keine Geheimnisse vor uns, wenn wir uns nur in die Augen zu schauen wagen.
So wandte, wende ich den Blick von der Dohle und vom Winterhimmel ab. Ich wollte nicht den Mann ansehen, der auf mir lag, sich auf die Ellbogen stützte und tat, was er tun musste, aber in Gedanken kehrte ich zurück zu seiner aufdringlichen Gegenwart und zur aufdringlichen Gegenwart der Männer überhaupt.
Wie durch einen Nebel erinnerte ich mich, wie das früher gewesen war, auch wenn diese Welt und dieses Ich von damals schon so vollständig untergegangen sind, als hätten weder die Welt noch ich je existiert, untergegangen ist dieses Ich und diese Welt mit mir darin, schon lange vor dem Krieg. Ich erinnere mich nicht an all diese Männer, sie verschwimmen zu einem einzigen Körper mit einem aufdringlichen, frechen Schwanz, ich habe ja rasch die professionelle Gleichgültigkeit erlernt, meine Kolleginnen von der Straße in Łódź oder später von unserem Freiluft-Bordell, im Gebüsch an der Weichsel, sie alle haben längst ins Gras gebissen oder sind nach Argentinien, beißen dort auch bald ins Gras, das ist der Lauf der Dinge, mein Leben ist nach oben geschossen, dann ist es abgestürzt wie das aller Warschauer Juden, und dennoch habe ich besser gelebt als sie alle. Habe mehr vom Leben gehabt.
Gewiss gibt es welche, die besser leben als ich und viel mehr vom Leben haben, zum Beispiel seine polnische Nutte da, aber das ist egal.
Gerechtigkeit ist die lachhafteste aller Fiktionen, an die Menschen glauben.
Langsam könnte er fertig werden, dachte ich und griff zu dem professionellen Trick, bäumte mich auf unter ihm, fasste zwischen seine Backen, sagte etwas mit professioneller, gespielter Erregung, für mich ganz mechanisch, ungewohnt für ihn. Es wirkte. Er heulte auf, heult, spannte sich an, kam, fiel neben mir auf das Bett und schmiegte sich an, schob mir den Kopf unter die Achsel wie ein Hund, drückte sein Gesicht auf meine Brüste und erstarrte so, reglos, wortlos, ohne ein Zucken, nur auf der Haut spürte ich seinen Atem. Ich ließ das zu, befand das als Teil der Dienstleistung, die er von mir für die Pistole verlangt hatte, also gestattete ich es ihm eine Weile, und er lag so da, mit verdecktem Gesicht, regungslos weiterhin, bis ich die Geduld verlor.
«Genug jetzt mit Kuscheln», brummte ich und löste mich von ihm.
Ich stand auf, griff nach Wasserschüssel, Seife, Handtuch, wusch und trocknete mich ab. Er lag da und sah mir zu. Sein Blick störte mich nicht, ich habe längst gelernt, Blicke zu übersehen.
«Jetzt die Ware», sagte ich.
Er entschuldigte sich sofort, plötzlich verlegen, setzte sich auf, griff unter das Bett und reichte mir ein in Papier gewickeltes, verschnürtes Päckchen. Ich löste Schnur und Papier, ohne mich anzuziehen, auch er saß nackt da und wartete, bis ich es ausgepackt hatte, und diese zweisame Nacktheit gefiel mir nicht, sie suggerierte etwas wie Nähe, die doch zwischen uns nicht bestand und die ich nicht wollte, doch die Ware war mir wichtiger. Drin waren Lappen, fett von Öl und stark nach Waffe riechend. Ich kenne diesen Geruch gut, noch von vor dem Krieg. Ich wickelte, wickele sie aus, und es ist eine Pistole, eine Parabellum.
«Vorsicht …», hob er an und streckte die Pfoten aus, um mir zu erklären, wo das Geschoss herauskommt, und ich schenkte ihm einen Blick, der ihn zurückschrecken ließ.
Ich hob die Pistole aus dem Päckchen. Mit einem Hebeldruck warf ich das Magazin aus, zog den Kniegelenkverschluss zurück und prüfte, ob die Kammer leer war, drückte den Abzug, die Nadel schlug zu. Noch einmal zog ich den Verschluss, blockierte ihn in der hinteren Position und warf im Licht einen Blick in den Lauf. Das Gewinde klar erkennbar, sauber, kein Rost.
Die Waffe war gut. Ein volles Magazin, acht Patronen.
«Nicht mehr Munition?», fragte, frage ich. Der Typ war überrascht und besorgt.
«Nein, nicht. Woher kennen Sie sich so gut mit Waffen aus? Können das heutzutage alle Jüdinnen?»
«Geht Sie einen Scheiß an, woher ich mich auskenne», erwiderte ich trocken.
«Die Juden kaufen angeblich Waffen, damit sie hier den Kommunismus einführen können, wenn die Deutschen abhauen.»
«So …?», ich wunderte, wundere mich, denn die Einführung des Kommunismus mit Waffengewalt hat mich nie interessiert.
«So sagen sie jedenfalls in der Stadt. Dass das Ghetto Waffen will, wissen alle. Beim Schmuggel fragen alle nach Schießeisen.»
«Dass die gegen die Deutschen gebraucht werden, auf die Idee kommt keiner?»
«Dass Juden auf Deutsche schießen? Wer’s glaubt. Deshalb sagen die Leute, es muss um den Kommunismus gehen.»
«Und Sie meinen, die Sowjets würden das nicht selbst erledigen? Stalin mit seinen Divisionen, Panzern und Flugzeugen? Meinen Sie, er braucht die Juden dazu und die fünf jüdischen Revolver?»
Er verdrehte nur die Augen. Ich tat’s ab. Was soll ich ihm erklären. Ein Pole versteht einen Juden nicht. Auch keine Jüdin. Nicht mal so eine Pseudo-Jüdin wie mich.
Die Patronen sah, sehe ich mir genauer an, Stück für Stück. Zwar eine deutsche Waffe, aber die Patronen sind polnisch, aus der Vorkriegszeit, und das betrübte mich, denn je älter ein Geschoss, desto schlechter, und polnische Sachen sind schwer einzuschätzen. Aber wählerisch durfte ich nicht sein. Also zog ich mich an, wickelte die Pistole in Lappen und Papier, dann versteckte ich sie in einem Block weicher Butter, die ich am Vortag gekauft hatte, weil ich diese Waffe irgendwie an der Wache vorbeikriegen musste.
Ich warf einen letzten Blick auf den Schmuggler, der mir die Pistole gebracht hatte und dem ich dafür sehr dankbar war. Er hatte hagere Gliedmaßen, einen flachen, hängenden Arsch, schlaffe, wenngleich männliche Brüste und einen großen, dabei harten Bauch, prall nicht von Unterhautfett, sondern von innerem Speck, wie ein Fußball, mit vorstehendem Nabel.
«Sie sind ein guter Mensch», sagte, sage ich unvermittelt. Er war verwundert, dabei war er ja gut. Besser als die Mehrzahl der Polen, die ich im Leben getroffen habe. Er hätte das Geld nehmen und mir die Pistole wegschnippen können. Hätte mit einem Gestapomann oder sonst einem Gendarmen, wie wir sie damals fälschlich nannten, zurückkommen, hätte mich verraten können, alles hätte er mir antun können. Wie sie alle. Er wollte nichts als meinen Körper, den ich ihm aus freien Stücken nicht gegeben hätte, niemandem hätte ich ihn gegeben, ihm am allerwenigsten, wenn mir nicht an der Pistole gelegen gewesen wäre, wenn er mich nicht erpresst hätte, da kam er mit seinem Wunsch, das war nicht gut, aber die Menschen tun Schlimmeres. Viel Schlimmeres. Und ob jemand gut oder schlecht ist, kann ganz unterschiedlich ausfallen. Im Salon ist man anders gut als in Treblinka. In einer anderen Welt hätte ihn das, was er hier tat, als den letzten Schweinehund gelten lassen. Dort, damals, in Warschau, in der Twarda, hat dieser Mensch mit seinem prallen Bauch sich ganz normal benommen. Und wenn ich sein Benehmen insgesamt betrachtete, kam ich zu dem Schluss, dass er trotz dieser kleinen Gemeinheit ein guter Mensch war.
Er wunderte sich also, und dann war es ihm sehr, sehr peinlich. Er bückte sich, griff nach seiner Hose, zog sie an, griff nach dem Hemd, als schämte er sich nun auch seiner Nacktheit.
«Ich weiß, es war nicht anständig, was ich getan habe», sagte er plötzlich. «Man darf nicht so mit einer Frau, erpresserisch … Ich habe einfach schon sehr lange nicht, ich hatte einfach dieses große Bedürfnis nach einem Körper … Aber ich weiß, anständig ist es nicht.»
Ich zuckte mit den Schultern.
«Klar. Aber so sind die Zeiten, anständig oder unanständig, das zählt nicht mehr. Alles ist anständig und alles unanständig.»
Er nickte, kratzte sich die grauen Bartstoppeln.
«Kubicki meine Name, Stanisław Kubicki», sagte er.
«In Ordnung», erwiderte ich.
«Sie sagen, ich sei gut, ja? Wenn Sie überleben, oder besser, falls wir beide die Zeiten erleben, dass der Krieg zu Ende ist, dann denken Sie daran, dass Sie so über mich gedacht haben. Dass Stanisław Kubicki aus Lublin ein guter Mensch ist. Dass Stanisław Kubicki gut zu Ihnen war. Ihnen geholfen hat. Vielleicht begegnen wir uns noch einmal. Vielleicht ist dann alles anders herum, nicht? Das Schicksal ist launisch.»
Wir sind uns nie mehr begegnet. Ich erwiderte auch nichts darauf. Ich zog mich an und ging, gehe grußlos.
Stanisław Kubicki erlebte die Zeit nicht, in der der Krieg zu Ende war, er starb im Frühjahr 1944 am Typhus, und das ist mir völlig egal. Ich weiß es nur eben.
Die Butter gab ich Frau Miller, die eine Schwäche für mich hatte, seit sie wusste, dass ich auch aus Łódź stamme, so wie sie, ich gab ihr noch hundert Złoty für diese Gefälligkeit, denn eine Schwäche für hundert Złoty hat jeder, und es war klar, dass der Wachmann eine Deutsche, selbst so eine Volksdeutsche, nicht kontrollieren würde. Selbstverständlich wusste Frau Miller nicht, dass in der Butter eine Waffe versteckt war, Butter schmuggeln ist das eine, eine Waffe schmuggeln das andere.
Seit Jakub und ich, statt zu sterben, auf die arische Seite gewechselt waren, hatte ich mich nicht von der Parabellum getrennt, deshalb nehme, nahm ich sie auch jetzt mit, auch wenn ich nicht die Absicht hatte zu schießen. Solange wir das Restghetto nicht verlassen hatten, habe ich überhaupt kein einziges Mal geschossen. Die Munition ist zu wertvoll, um die Waffen auszuprobieren, und wo denn auch. Mir ist klar, dass wir das Versteck bald wechseln müssen, hätten wir schon längst tun sollen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn zur Bewegung, zur Tat zwingen kann.
Wir verbergen uns jetzt im höchsten Stockwerk der Elektrotechnischen Fakultät, nicht weit, wenige hundert Meter von dem Ort, an dem das Mietshaus stand, das schöne Mietshaus an der Ecke Pius- und Koszykowa, in dem ich diese gar nicht so üblen Jahre verbracht habe, die Jahre vor dem Krieg, aber dieses Mietshaus gibt es nicht mehr. Die Mauern stehen, doch die Mauern waren nie wichtig, sondern das, was darin war. Der größte Vorzug unseres Verstecks ist, dass die Treppen zum letzten Stock wie eingebrochen wirken. Auf ihnen liegt ein wirrer Trümmerhaufen, alte Möbel, die ich selbst dazu gepackt habe, und Stahlstäbe aus der Decke, die zerrissenen Innereien des ermordeten Gebäudes, in das beim polnischen Aufstand eine Mörsergranate eingeschlagen ist.
Niemand kommt darauf, dass der große stählerne Archivschrank, von der Explosion verbeult, verschoben werden, dass er sich überhaupt vom Fleck rühren kann. Er würde das auch nicht tun, wenn man ihn einfach nur schieben wollte. Um ihn zu bewegen, habe ich einen Flaschenzug gezimmert, mit Jakubs Hilfe, den ich zu dieser Hilfe irgendwie bewegt habe, ich weiß, wusste selbst nicht, wie. In den Kellern der Elektrotechnischen Fakultät fand ich Rollen, die sich vorzüglich dafür eigneten, ich fand zudem viele Meter Stahlseil und machte etwas, von dem ich heute weiß, dass es Sechserflaschenzug heißt, und auch wenn ich damals diesen Namen nicht kannte. Ich brauche nur dieses im Schutt verborgene Seil auszugraben und daran zu ziehen, ein paar Meter weit, und der Schrank wird um einige zig Zentimeter verrückt, gerade genug, um sich daran vorbeizudrücken.
Hätte mir vor dem Krieg jemand gesagt, dass ich einmal Flaschenzüge fertigen würde, mit Hilfe eines Handbohrers, mit Schraubenschlüsseln, Schraubenziehern, einem Hammer und Meißel, ich hätte nur gelacht. Als Kind habe ich gelernt, das Messer zu benutzen und wegzulaufen, später benutzte ich meinen Körper, Titten und Arsch, weil ich es musste, und später das Geld, um meinen Körper nicht mehr benutzen zu müssen.
Andere Werkzeuge habe ich nicht angerührt. Scheckbuch und Füllfeder, mehr nicht. Aber im Ghetto hat man alles gelernt. Wenn eine Jüdin leben wollte, musste sie sehr aufnahmefähig sein, die Leute bauten Bunker, ich half dabei, ich sah zu und lernte. Ich kann vieles. Einen Flaschenzug bauen ist nicht einmal das, was ich am besten kann.
Neben dem Flaschenzug befindet sich eine Falle, die ich immer dann scharfstelle, wenn wir drinnen sind. Zieht jemand an dem Stahlseil, ohne zuvor die sowjetische Handgranate zu entschärfen, die ich sorgsam zwischen Schrank und Türschwelle geklemmt und aus der ich vorher behutsam den Splint herausgezogen habe, dann rollt ihm diese Granate vor die Füße und explodiert.
Natürlich ist das nicht der einzige Ausgang aus unserem Versteck, ich bin ja nicht dumm. Ich bin ein Nachtungeheuer. Ich weiß, was zu tun ist, habe alles gelernt. Falls die Deutschen auf der Treppe herumschnüffeln, höre ich das sofort, es wird laut, ich habe absichtlich alles so eingerichtet, dass es laut wird. Für den Fall also, dass sie dort herumschnüffeln, habe ich auf der anderen Seite des Gebäudes eine Schnurleiter vorbereitet. Selbstgefertigt, aus Kabeln, die ich in den Kellern des Instituts fand, und als Sprossen nahm ich alles, was sich eignete, Besenstiele, Stuhlbeine und so weiter.
Mehr noch, ich habe im Keller einen provisorischen Brunnen entdeckt, den ich gereinigt habe; jemand muss dort gleich nach dem Aufstand den Boden aufgestemmt und ihn gegraben haben, deshalb habe ich auch Wasser, so viel ich will, und Wasser ist in einer ausgebrannten Stadt am schwierigsten zu bekommen. Essen findet man immer irgendwo, Wasser nicht.
Meine Situation ist so schlecht also nicht. Komfortabel. Ich bin ganz zufrieden damit. Ich habe Wasser. Die Deutschen werden mich nicht finden. Ich habe Jakub. Ich lebe. Im Gegensatz zu den vierhunderttausend Jüdinnen und Juden aus dem Ghetto bin ich am Leben. War am Leben. Außer unserer Elektrotechnischen Fakultät haben die Chemie und der Zeichensaal nebenan ganz gut überdauert, die übrigen Gebäude des Polytechnikums sind ausgebrannt, hier aber ist es gut, hier ist es ziemlich sicher. Nicht weit entfernt das Piłsudski-Spital, auch nicht ausgebrannt, dorthin kann man immer umziehen, falls notwendig, das ganze Viertel zwischen der Niepodleglości und den Wasserwerken steht auch noch, doch dort wohnen Deutsche, an der Noakowski haben ein paar Mietshäuser noch ihre Dächer, auch dort kann man nachts hin, falls hier was los ist, ich hab sogar mir schon zwei Wohnungen ausgeguckt, aber dahinter, bis zum Erlöserplatz und weiter ist alles ausgebrannt, nackte Mauern mit leeren Fensterhöhlen, nicht einmal die Stockwerke sind erhalten, genauso weiter oben, die Marszałkowska und Mokotowska entlang, bis zur Jerozolimskie-Allee, hier und dort steht noch ein Haus mit Dach, sonst nur Skelette.
Dass die Deutschen nicht weit von hier sind, stört nicht, im Gegenteil. Wir sind diskret, wir sind mucksmäuschenstill und klein, die Deutschen finden uns nicht, sie haben schon jetzt keine Chance, uns zu finden.
Ich habe keine Lust rauszugehen, will nicht raus in diese schreckliche Nacht.
Das ist nicht Angst, ich will einfach nicht, wollte nicht.
Ich bin, ich war gut darin, mich durch die nächtliche Stadt zu bewegen, ich gleite nachts so glatt dahin wie die Angst in menschliche Nicht-Seelen, also kann ich mit der Nacht umgehen, weiß, wie man sich geräuschlos auf Trümmern bewegt, weiß, wo man Essen und Wasser sucht, weiß, wo man sich nachts aufwärmen kann, wen man meiden sollte und wessen Nähe möglicherweise suchen, nach Neuigkeiten fragen, weiß, wie man deutschen Wachposten und Patrouillen ausweicht, könnte mich vielleicht sogar retten, wenn ich einer Patrouille über den Weg laufe, und doch will ich nicht hinaus in diese schreckliche Dezembernacht.
Ich schäme mich, dass ich mich durch die nächtliche Stadt bewegen und in die Nacht gleiten kann, denn hinter mir, hinter uns sind all jene geblieben, die das nicht konnten und nie gelernt haben.
Tagsüber hörte ich furchtbare Explosionen.
Das ist nichts Besonderes, Explosionen, das Getöse und Donnern der Geschosse und dieses spezifische Geräusch des Flammenwerfers, ein Geräusch, das in Donnern übergeht und dann wieder in ein Rauschen, all das ist zu hören seit Mitte Oktober, aber die Explosionen heute waren die lautesten, die ich gehört habe.
Hätte die Elektrotechnische Fakultät noch Fensterscheiben, dann wären sie heute bestimmt herausgeflogen, denn wir spürten, wie alles bebte, besser gesagt, ich spürte es, denn er spürt ja nichts mehr, spürt nicht einmal, das ist mein Eindruck, meine Gegenwart oder seinen eigenen Körper.
Ich habe keine Lust rauszugehen, aber es gibt nichts mehr zu essen, also muss ich auf die Suche gehen, bis ich etwas finde. Er muss irgendetwas essen.
Ich gehe, ging raus, gehe zuerst langsam, lange, die Treppen von unserem vierten Stock hinunter, am Ende auf den Hof, zwischen die Bäume, denn hier zum Beispiel sind die Bäume noch da, unbelaubt jetzt und trist, aber sie sind da, und das ist immerhin etwas, wenn es Bäume gibt.
Ich dachte daran, in Richtung Wasserwerke zu gehen, wo jetzt die Deutschen sind. Die Deutschen, die auch essen und ihr Essen irgendwo herbekommen müssen. Darum versuche ich, in der Nähe der Deutschen zu bleiben, und hoffe auf das, was sie übrig lassen, auf die Reste vom Tisch der Herrschaft, von denen zwei stille, leise Ratten wie wir uns gern ernähren.
Die Deutschen sitzen, saßen dort in den früheren Offiziershäusern des Militärwohnungsfonds, wo ich in guten Zeiten so viele gute, ständige Kunden hatte. Später, vor fünf Jahren, als die Deutschen kamen, haben die selbst sich dort einquartiert, neue Soldaten in alten Soldatenwohnungen, und sie wohnten dort sogar mit den Familien dieser polnischen Offiziere, und noch später, nach dem polnischen Aufstand, kamen dort die polnischen Aufständischen zusammen, denn dort hatten die Deutschen einen Sammelpunkt verkündet und schickten sie dann weiter.
Jakub und ich blieben. Wir konnten weder mit den Zivilisten noch mit den Aufständischen gehen, dazu fehlt ihm und fehlt mir das Aussehen, wir beide sehen aus, als hätte jemand uns mit roter Farbe das Wort JUDE auf die Stirn gemalt. Und so blieben wir in dieser leeren Stadt, der hungrigen und kalten, ausgebrannten Stadt, in der außer uns nur wenige solche wie wir geblieben waren, dazu Deutsche mit Flammenwerfern und Sprengsätzen, und Ungeheuer, die nachts herauskamen.
Solche wie ich.
Oder wie Ares.
Uns unterscheidet, dass er angeblich versucht, sie zu bekämpfen, während mich der Kampf gegen die Deutschen nicht interessiert, obwohl ich sie aufrichtig hasse, wie jeder. Mich interessiert das Überleben, nicht der Kampf. Ich will leben, um weiter hassen zu können. Damals wusste ich übrigens nicht einmal, ob Ares tatsächlich existiert oder ob das eine von den vielen Geschichten ist, die die Menschen sich aus purem Entsetzen über die Welt, in der sie leben müssen, erzählen.
Hiermals weiß ich es.
Zum ersten Mal erzählte mir eine Frau von ihm, deren Vor- und Zunamen ich damals nicht erfuhr, später hörte ich noch mehrmals von anderen etwas über ihn. Die Frau, die mir zuerst von ihm erzählt hatte, war Jüdin, auch wenn sie perfekt Polnisch sprach, ohne einen Hauch von Akzent, und ihr Aussehen lag gerade so dazwischen. Soweit man das unter den Röcken und Kopftüchern erkennen konnte, in die sie gehüllt war.
Ich begegnete ihr in den Ruinen der Kirche an der Łazienkowska, unweit des Batory-Gymnasiums, sah sie lange, bevor sie merkte, dass ich sie beobachtete. Sie hatte ein zu großes Feuer angezündet. Schließlich ging ich auf sie zu, warnte, dass ich näher komme und eine Waffe habe, dass sie sich aber nicht fürchten müsse, ich wollte sie nicht ausrauben. Sie beruhigte sich rasch. Sie hatte nichts, womit sie handeln konnte, also tauschten wir Informationen. Sie wolle rüber nach Praga, sagt sie. Ich bezweifelte, dass das möglich wäre, zuckte mit den Schultern, sie erklärte, es sei egal, und wenn sie auch umkomme bei dem Versuch, das Leben habe keine Bedeutung für sie. Sie besitze keine Waffe und könne nicht kämpfen – wenn sie eine Pistole hätte wie ich, dann würde sie gegen die Deutschen kämpfen, so wie Ares.
Ich fragte, wer das sei, dieser Ares. Wisse man nicht, sagte sie, bestimmt ein polnischer Aufständischer. Ein Desperado, dem nichts am Leben liegt, nur so viele Deutsche wie möglich wolle er töten, er kenne sich in den Ruinen aus wie in seiner Westentasche, verstecke sich tagsüber und schleiche sich nachts an, töte Deutsche und schreibe mit ihrem Blut auf die Wand, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun hätten. Er zeichne mit ARES, in großen roten Buchstaben.
Ich lachte darüber, lachte. Das war ja Quatsch.
Ich fragte, frage, ob sie diese Buchstaben gesehen habe, wenn sie behaupte, sie seien groß und rot. Nein, antwortete sie, aber vor einigen Tagen habe ihr das ein Mann aus der Gruppe gesagt, die sich angeblich in einem Bunker unter den Ruinen des kleinen Ghettos verstecke, irgendwo in der Sienna. Ich sagte ihr, ohne zu wissen, dass ich mich irrte, dass unter dem Ghetto keine Bunker erhalten geblieben seien, man könne dort ja nicht mal sagen, wo früher die Straßen verliefen und wo Häuser standen, das hätte ich mit eigenen Augen gesehen, sagte ich, das sei nicht so wie hier in Mokotów, wo die ausgebrannten Häuserskelette noch stehen, dort gebe es gar nichts mehr außer Unkraut, das auf den Trümmerfeldern wächst. So sprach ich damals, hiermals weiß ich, dass ich unrecht hatte. Es gab noch Bunker unter dem Ghetto, einige wenige.
Sie erwiderte, sie selbst habe sich anfangs auf der arischen Seite versteckt, doch dieser Mann aus dem Bunker habe ihr gesagt, die Partei habe tief unter der Erde, im Ghetto, ein ganzes System von Bunkern, in denen es alles gebe, Strom, Wasser und Ventilation, sie hätten dort Waffen und Vorräte, dort versteckten sich über zehntausend Juden, und wenn die Sowjets nahe genug seien, würden sie rauskommen, die Deutschen angreifen und sich für ihre ermordeten Brüder rächen, und Ares würde mit ihnen kämpfen, Seite an Seite.
Da stand ich auf und ging, gehe ohne ein Wort des Abschieds. Wahnsinn ist ansteckend, nicht immer, aber in Zeiten wie diesen durchaus. Sehr ansteckend. Man muss auf der Hut sein, sich vor Wahnsinnigen hüten, ihren Worten und ihrer Gegenwart. Darf sich nicht anstecken.
Damals war ich sicher, dass diese Frau nicht lange überleben würde. Sie würde in der Weichsel ertrinken oder von einem Deutschen erschossen werden oder von einem Wlassow-Soldaten, dem ihr zu großes Feuer auffällt. Oder erstochen von jemandem wie mir, nur böser, der hofft, etwas Essbares bei ihr zu finden.
Hiermals weiß ich, dass ich mich geirrt habe, sie hat fast bis zum Ende überlebt, hat sich im Wald versteckt. Umgebracht haben sie polnische Partisanen, die wie sie selbst jeden lebenden Juden und jede Jüdin nur allzu gern für bolschewistische Spione hielten, umgebracht, als sie anfing, ihnen von den Bunkern unter Warschaus Ruinen zu erzählen, wo eine große jüdische Armee nur auf das Zeichen wartet, das hat sie ihnen erzählt, also stellten sie sie an einen Baum, und der Anführer mit Ringkragen am Hals schoss ihr mit leichtem Bedauern in die Stirn, denn er schoss nicht gern auf Frauen, aber bei bolschewistischen Spionen hat man keine Wahl, so sind die Zeiten.
Ich bin nicht wie sie. Mich hat kein SS-Mann und kein Ukrainer erschossen, kein polnischer Partisan, ich lasse mich von keinem überrumpeln und ausrauben. Ich bin ein Nachtungeheuer, wie Ares, der angeblich mit deutschem Blut an die Wände schreibt. Aber ich werde kein unschuldiges Opfer ermorden, um es auszurauben.
Also ziehe ich nachts los. Es ist, war still und sehr kalt. Neumond, die ideale Nacht. Eine dünne Schicht Schnee knirscht hier und da unter den Füßen. Gut, dass es nur wenig ist und der Wind weht, so kann man den Schnee umgehen, um keine Spuren zu hinterlassen, und selbst wenn man darauftritt, verweht der Wind es sogleich; es ist noch nicht der schwere, mit der Erde verklebte, in sie hineingefrorene Winterschnee, der jede Spur wie Lehm bewahrt. Bald wird auch diese Art Schnee fallen, ich werde dann meine Ausflüge einschränken oder mir etwas ausdenken müssen, um die Spuren zu verwischen.
Ich betrete, betrat das ausgebrannte, zerbombte Gebäude des Chemieinstituts und überlege noch einen Augenblick, ob ich zu den Deutschen gehen oder mich an sie anschleichen soll, unsichtbar, leise und wachsam, merke aber, besser nicht heute, heute woanders, heute möglichst weit weg von ihren graugrünen Uniformen und Gewehren. Das sagt mir mein Instinkt. Dem Instinkt traue ich immer. Dank meinem Instinkt bin ich am Leben.
Es sind schon weniger als vor einem Monat. Vor einem Monat traf hier eine Patrouille nach der anderen ein, es gab Detonationen ohne Unterbrechung, ständig brannte etwas, immer Schießereien in der Nähe oder Ferne, über die Weichsel donnerten Geschütze, und ich weiß inzwischen sehr gut, wie ein über den Kopf sausendes Artilleriegeschoss sich anhört, ein schrecklicher und furchtbar schöner Klang.
Wir versteckten uns damals woanders, nicht hier, tagsüber ineinandergeschmiegt, reglos, manchmal hörten wir die Deutschen hinter der Wand, kein Atemzug, Mund und Nase in den Ärmel, in die Achsel geschmiegt, und hörten sie so mehrere Stunden lang durch die Wand und machten keinen Mucks, ich am ganzen Leib erstarrt und keinen Mucks.
Jetzt sind es weniger. Viel seltener sind Schüsse zu hören, wenn auch immer noch. Die Patrouillen fahren nicht mehr so oft.
Deshalb ziehe ich los, eingewickelt in Kleidung und Lumpen, ziehe dreckig, stinkend, geräuschlos und dunkel los, ganz anders als früher, komme vorbei an den Ruinen des Chemieinstituts, husche zwischen den Bäumen hindurch, kleine graue Rättin, vorbei am Hauptgebäude des Polytechnikums und bin schon auf der Noakowskiego, dort hinein in die Ruinen, ich gehe langsam, vorsichtig, immer dicht an der Wand entlang, nie im offenen Gelände, wo meine Silhouette sich deutlich vom Hintergrund abheben könnte. Hinter den Ruinen der Noakowskiego erreiche ich das ausgebrannte Skelett der Markthalle, husche dort an verbogenen Stahlstäben vorbei, die wie Walrippen ragen, und erreiche schließlich die von Trümmern übersäte Koszykowa, bleibe vor der Ruine meines alten Mietshauses stehen, die wie ein Schiffsbug zwischen die Koszykowa und Pius zielt.
Mein Mietshaus. Mein Geschäft, das ich bekam und damit zugleich Jakub verlor, als Ablöse, damit er sich von mir befreien konnte.
Mein Mietshaus, in dem ich eine schöne, große Wohnung hatte, das schönste Zimmer darin mit eigenem Bad und Garderobe gehörte mir und nur mir, und niemand, absolut niemand hatte dort Zutritt, in den anderen Zimmern waren meine Mädchen, dort machten sie ihre Jugend und Schönheit zu Geld, machten sie zuschanden, und darauf, auf all dem gründete meine Freiheit, das heißt das Geld, denn weibliche Freiheit bemisst sich einzig und allein am Geld, über das sie frei verfügen kann. Die männliche übrigens auch. Ich weiß nicht, warum ich weiblich gesagt habe. Vielleicht, weil Frauen nicht so leicht Geld verdienen und darüber verfügen können?
Jetzt sind von meinem Mietshaus nur die verbrannten Außenmauern geblieben. Das Dach, die Wände und alles darin hat sich in einen großen Trümmerhaufen verwandelt. Das Türmchen mit der glänzenden Kuppel, die Balkone, das Dach, alles zerstört. Nichts mehr da. Tagsüber sieht man durch das Fenster die Reste der Tapete, die ich selbst kleben geholfen habe, nachts sieht man nichts.
Nichts zu bedauern. Alles, was irgendeinen Wert für mich besaß, habe ich vor vier Jahren aus diesem Haus geholt, nachdem bekannt gegeben wurde, dass das Ghetto geschlossen wird.
Damals war Völkerwanderung in Warschau, wer eine Fuhre mit vorgespanntem Gaul besaß, konnte ein Vermögen damit machen, dass er jüdische Möbel in das Ghetto brachte, das gerade zugemacht wurde, und polnische Möbel aus dem Ghetto in den arischen Teil der Stadt; die Leute waren verrückt auf Wohnungen, ein verschimmeltes Zimmer im Ghetto kostete so viel wie vor dem Krieg eine ganze Wohnung, und ich packte alles in einen Koffer, der nicht einmal besonders schwer war, sodass ich ihn selbst tragen konnte, brauchte keine Fuhrleute, brauchte überhaupt keine Hilfe. Ein Zimmer, und zwar ein ordentliches, nicht irgendwo, sondern in der Sienna, hatte ich mir schon vor längerer Zeit besorgt, viel deutete ja darauf hin, dass die Dinge sich so entwickeln würden, und ich bin gern auf alles vorbereitet.
Jakub war mit seiner Familie auch schon früher umgezogen, doch damals waren wir eine Zeitlang nicht sehr eng in Kontakt.
Auf der arischen Seite ließ ich die Möbel und die meisten Kleider zurück, nahm vor allem mit, was mich später am Leben erhielt: Złoty, Dollar, Goldrubel, ein wenig Schmuck, auch meinen ganzen Hass und meinen Zorn. Aus Zorn und Hass ist mein Lebenswille gewebt, Zorn und Hass sind schwer und nicht leicht zu tragen, doch mitnehmen muss man sie, denn ohne sie endet man vorzeitig dort, wo ohnehin alle enden.
Deshalb werfe ich keinen Blick in jene Richtung, wozu auch, in der Stadt ist es dunkel und schwarz, geräuschlos und rasch durchmesse ich das, was von der Koszykowa geblieben ist, kreuze die Pius und gehe, ging weiter, durch verbrannte Viertel, die Poznańska entlang, aber durch die Ruinen, nicht auf der Straße, auf der Straße ist es gefährlich, tastend fast gehe ich durch Trümmerhalden, zwischen den erhaltenen Mauern der Mietshäuser an der Wilcza, durch ihre verschütteten Hinterhöfe, Hohlwege.
Geblieben ist hier nur ein Skelett der Stadt, ein verlassenes, gefrorenes Skelett. Von den Stadtknochen hängen bisweilen Fetzen herab wie Fleischreste an dem von Vögeln abgefressenen Pferdeskelett. Oder einem anderen, aber wie ein Pferdeskelett aussieht, weiß ich zufällig sehr gut, deshalb denke ich bei der Stadt daran.
Bisweilen stoße ich auf Reste der alten Welt. Auf einem der Höfe tief im Viertel, exakt auf der Höhe der Sowjetischen Botschaft in der Poznańska 15, die wie durch ein Wunder unversehrt geblieben ist, stoße ich, stieß ich auf Bücher, die verstreut auf den Trümmern liegen, der Wind blättert die Seiten um. Ich überlege kurz, ob ich eins mitnehmen soll, aber im Dunkeln kann ich nicht einmal die Titel entziffern, und ich will nicht zu viel mit der Lampe leuchten. Schließlich nehme ich ein kleineres mit, stecke es in den Sack, gehe weiter. Hier in den Ruinen ist nichts mehr zu finden, das weiß ich, ich habe sie vor guten zwei Wochen gründlich durchsucht. Andererseits, fällt mir auf und ich bleibe plötzlich stehen, waren da diese Bücher bestimmt noch nicht hier. Wie kommen Bücher, eine ganze zerstreute Bibliothek, plötzlich in diesen Hof?
Mir fällt, fiel ein, dass in der Poznańska, beinahe auf Höhe der Botschaft, zwei Mietshäuser sind, ich merkte mir das im Kopf, in ganz gutem Zustand, und dort war ich noch nicht, habe nicht probiert, ob man da reinkommt, weiß nicht, wie es drinnen aussieht. Das ist etwas, was ich wissen muss, wenn ich überleben will. Ich überlege kurz, ob ich es nicht dort versuchen soll.
Aber nein, ich gehe weiter, ging. Vor ein paar Tagen hatte ich dort ein merkwürdiges Abenteuer, ich ging vorüber und hörte plötzlich menschliche Stimmen, Gelächter, Besteck, rhythmische Musik, all das entfernt und gedämpft, aber ich hörte es. Vielleicht zwei, drei Sekunden lang. Es klang unwirklich und unmöglich, und hiermals weiß ich, dass das einfach eine Halluzination war, etwas aus der anderen Welt war in meine Welt geraten, schließlich existiert alles gleichzeitig, das was war, hört nicht auf, und das was sein wird, ist bereits, alles existiert zur gleichen Zeit, und bisweilen kommt es zu so einem Kurzschluss der Wirklichkeiten, voneinander getrennte Dinge berühren sich.
Doch das ist unwichtig, unwichtig. In diese Häuser wollte ich nicht, weil ich damals abergläubisch war, hiermals bin ich es nicht, aber hiermals ist es zu spät.
Erst einmal wollte ich die noch stehenden Gebäude in der Nowogrodzka durchsuchen, gegenüber dem ausgebrannten Fernmeldeamt, die Deutschen hatten sie bislang nicht angerührt, denn sie wohnten darin, auch nach dem Aufstand. Ich hoffe, dass sie schon ausgezogen sind, und hoffe ebenso, dass sie etwas zurückgelassen haben, und das ist wohl die letzte der mageren, kleinen Hoffnungen, auf die ich meine allgemeine Hoffnung stützte, das Ende des Kriegs erleben zu können.
Auf Rattenpfaden husche ich über den Hof der Orgelbrand-Werke, laufe schnell durch die Hoża und bin wieder in Ruinen, hier kenne ich den Weg nicht so gut, muss also meine Lampe einschalten, leuchte ein Stück Weges aus, schalte wieder aus, gehe weiter, komme in die Wspólna, halte vorsichtig Ausschau, ob dort was leuchtet, ob etwas zu hören ist, aber nein, dunkel, schwarz. Ich laufe also über die Wspólna, erneut Ruinen, Skelette, Häuser, vom Dach bis ins Parterre verkohlt, leere Schalen, ich gehe durch das, was früher Zimmer waren, gehe über Höfe, bis in die Świętej Barbary und lauere erneut, warte. Gegenüber, das weiß ich, ist das Lyzeum, noch einigermaßen erhalten, aber ich nehme einen anderen Weg, wieder durch Ruinen, und komme auf den Hof des ausgebrannten Fernmeldeamtes, nicht so ausgebrannt wie die anderen, drinnen sind Decken, Treppen und Stockwerke noch erhalten. Die Deutschen haben hier den ganzen Aufstand über gesessen, haben geschossen, den Aufständischen gelang es nicht, das Amt zu erobern.
Und hier finde ich einen bequemen Beobachtungspunkt. Ich komme vom Hof hinein, gehe sehr langsam, sehr vorsichtig, taste mich an den Wänden entlang, zum Fuß der Treppe, und auf der Treppe stoße ich auf etwas, das ich sofort als Leichnam erkenne.
Mit Leichen kenne ich mich sehr gut aus. Ich warte einen Augenblick, horche, befinde schließlich, dass ich die Lampe anknipsen kann. In Treppennähe gibt es kein Fenster, das Licht dürfte nicht nach außen dringen. Also mache ich die Lampe an.
Die Leiche ist alt, noch vom Herbst, vom polnischen Aufstand. Sie verweste ein bisschen, bevor sie steinhart gefroren ist. Sie liegt auf dem Bauch. Sie trägt eine vom Gürtel gestraffte Bluse mit Tarnfleckmuster, deutsch, eine zivile Hose, hohe deutsche Knobelbecher, gut beschlagen, am rechten Oberarm ein weißrotes Arm- band mit dem Buchstaben WP, dem Adler und den Ziffern 124.
Ich untersuche, untersuchte zuerst die Gesäßtasche, leer. Ich drehe die Leiche auf den Rücken, was mir nicht leichtfällt, denn sie ist steif wie eine Schaufensterpuppe, aber am Ende gelingt es, ich habe sie umgedreht. In der bläulich schwarzen Masse, die einmal Gesicht war, klaffen zwei Einschusslöcher. Sie müssen ihn hier erschossen haben, während des Aufstands oder danach.
Ich suche weiter. Taste zuerst den Brustkorb ab, finde eine Brieftasche, in der Brieftasche zweihundert Złoty in den Geldscheinen, die Młynarskis genannt werden, nach dem Präsidenten der Zentralbank, dann Fotos, darauf eine Frau, Kinder, interessiert mich nicht weiter, dann ein AK-Ausweis, Schütze, Pseudonym Waza, Vorname Andrzej, Nachname Jankowski. Das Geld nehme ich, Fotos und Brieftasche werfe ich weg. Überlege kurz, ob mir der AK-Ausweis des Schützen Waza irgendwie nützlich sein kann, kaum, aber ein Stück Papier liegt nicht schwer in der Tasche, also nehme ich es.
Am Gürtel hat er zwei Patronentaschen. Ich öffne, öffnete sie. Die eine ist leer, in der anderen zwei Streifen mit Gewehrpatronen. Ich zögere kurz, zögerte, dann nehme ich sie an mich, auch wenn ich kein Gewehr habe und keins brauche. Aber vielleicht bekomme ich was dafür. Irgendwann.
Taste noch die Taschen ab. In einer ein zerdrücktes Päckchen deutscher Zigaretten, Juno. Nehme ich. Streichhölzer, auch. Ein Löffel. Den Löffel nehme ich nicht.
Das war’s. Jetzt muss ich ihm die Stiefel ausziehen, das Einzige, was ich wirklich gebrauchen kann. Doch die Stiefel wollen nicht abgehen. Das Gemsleder ist steif vom Frost, und das faulende Fleisch ist in die Stiefel hineingefroren. Ich ziehe ein Messer und beginne, in den Schäften herumzuschneiden, und plötzlich denke ich, dass diese Stiefel, wenn Jakub sie anzieht und seine Beine sie erwärmen, fürchterlich nach Leiche stinken werden.
Bestimmt werden sie das. Aber besser, man hat ordentliche, hohe Stiefel, die nach Leiche stinken, als löchrige Halbschuhe, die fast auseinanderfallen, denn solche Schuhe blieben Jakub, als wir vor fast zwei Jahren das Ghetto verließen, komisch genug, wenn ich daran denke, was für Stiefel er in diesem Ghetto trug – im ganzen Ghetto durfte niemand schönere hohe Stiefel tragen als Jakub Shapiro, dazu reichte seine Willenskraft noch, oder sich schöne Stiefel bestellen, und kaum hatte er einen Polizisten oder Schmuggler in besseren gesehen als die seinen, bestellte er sich gleich neue.
Die hohen Stiefel machten einen Menschen aus ihm. Wer Halbschuhe trug, war schwach und weich, kein Mensch. Ein Stück Dreck in schmuddeligen Socken, die Hosenbeine mit Schlamm beschmutzt.
Die Herren in Halbschuhen bitte zum Umschlagplatz. Und einer in hohen ist entweder Polizist oder war, zu ihrer Zeit, einer von der Dreizehn, oder ein reicher Schmuggler, ein Geschäftsmann oder ein bedeutender Beamter des Judenrats, echte, starke Leute. Solche, mit denen die Deutschen Geschäfte machen, die manchmal auch eins von den Deutschen auf die Fresse kriegen, aber Gesprächs- und Geschäftspartner, die Vor- und Nachnamen haben, nicht nur eine Nummer oder einen grauen, verwaschenen Fleck, vor dem sich Kimme und Korn aufeinander scharfstellen, auch kein zu entsorgendes Totgut, noch nicht.
Jakub also hatte zu seiner Zeit sechs Paar solcher hohen Stiefel, am deutlichsten sehe ich ihn aber in dem Paar vor mir, das ihm der Schuster aus der Pawia nach dem Vorbild von Reiterstiefeln genäht hatte, auch wenn Jakub sein Leben auf keinem Pferd gesessen hat: aus hellem, fast gelbem Leder, kniehoch, vorn auf ganzer Länge geschnürt, am Knie bogenförmig gewölbt und zusätzlich mit einem Schnallengürtel verklammert. Dreitausend Złoty hat er dafür bezahlt, doppelt so viel wie für normale Knobelbecher. Dazu trug er selbstredend Breeches, denn kein echter Mensch trug einfache, lange Hosen, und sobald es etwas kühler wurde, zog er noch einen Burberry-Trench über die Jacke und straffte ihn mit dem Militärgürtel, dazu die Polizistenmütze und neben der Judenarmbinde die Polizeiarmbinde, und so lief er das ganze erste Viertel ab, stand auf dem Grzybowskiplatz herum und gab sich wohl manchmal dem Eindruck hin, alle würden ihn grüßen so wie damals, wenn er über den Kercelak ging.
Aber es war überhaupt nicht wie damals. Ganz anders grüßten sie ihn, und niemand hatte mehr Respekt vor Jakub. Viele fürchteten ihn nach wie vor, und manche können Furcht schlecht von Respekt unterscheiden; ich kann es, ich kann es klar unterscheiden.
Die Stiefel gehen, gingen schließlich ab. Zum Glück trug er Fußlappen, so konnte ich die Stiefel ohne verfaulte und dann gefrorene Leichenhaut abziehen. Ich stecke sie in den Sack. Jetzt wird Jakub wieder hohe Stiefel haben.
Ich gehe, ging in den zweiten Stock, finde ein Fenster zur Nowogrodzka hinaus. Hier wird mein Posten sein, war er. Ich lege mich ans Fenster, gewöhne die Augen an die Dunkelheit und beobachte lange die vier Mietshäuser in der ganz gut erhaltenen Straßenfront zwischen Poznańska und Pankiewicza. Ihre hellen Mauern heben sich deutlich von der Dunkelheit ab.