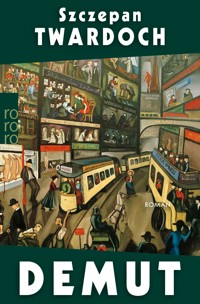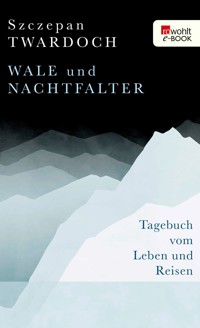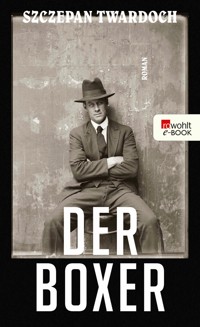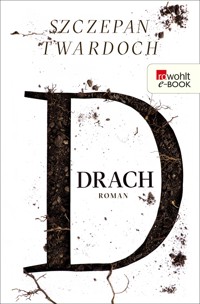
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Gedächtnis der Erde. Szczepan Twardochs monumentaler, kühner Roman über eine schlesische Familie. Die Erde weiß alles. Mit kühlem Blick, der die Zeiten durchdringt, sieht sie alles, was auf ihr geschieht. Sie kennt das Kind Josef Magnor, das im Oktober 1906 den Geschmack der Wurstsuppe schmeckt und nie mehr vergisst. Josef, der im Dreck der Schützengräben von Frankreich landet und später im Bett der jungen Caroline. Dem diese Erde jahrelang ein Versteck im schlesischen Stollen bietet, nachdem er aus Eifersucht eine Tragödie angerichtet hat. Die Erde kennt Nikodem, Josefs Urenkel. Nikodem, der zu seiner Geliebten zieht, aber von seiner Frau und Tochter nicht loskommt, auch nicht von dem schönen Haus, das er sich, gefragter Architekt des neuen Polen, gebaut hat – alles entgleitet ihm, auch die Geliebte. Was wird er retten können? Die Erde kennt das Ende, sie bleibt grausam kalt ... Szczepan Twardoch lässt die Erde selbst erzählen – den Drachen, der den Menschen ausspeit und ihn wieder verschlingt: In kühner Montage, ein ganzes Jahrhundert wie in einem einzigen Blick, schildert er die Dramen zweier Männer und die Chronik ihrer schlesischen Familie, vier Menschenalter. Ein grandioser Reigen von Werden und Vergehen, von der Suche nach Liebe und der Sehnsucht, sie festzuhalten – und ein gewaltiges Panorama des 20. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Szczepan Twardoch
Drach
Roman
Über dieses Buch
Das Gedächtnis der Erde. Szczepan Twardochs monumentaler, kühner Roman über eine schlesische Familie.
Die Erde weiß alles. Mit kühlem Blick, der die Zeiten durchdringt, sieht sie alles, was auf ihr geschieht. Sie kennt das Kind Josef Magnor, das im Oktober 1906 den Geschmack der Wurstsuppe schmeckt und nie mehr vergisst. Josef, der im Dreck der Schützengräben von Frankreich landet und später im Bett der jungen Caroline. Dem diese Erde jahrelang ein Versteck im schlesischen Stollen bietet, nachdem er aus Eifersucht eine Tragödie angerichtet hat.
Die Erde kennt Nikodem, Josefs Urenkel. Nikodem, der zu seiner Geliebten zieht, aber von seiner Frau und Tochter nicht loskommt, auch nicht von dem schönen Haus, das er sich, gefragter Architekt des neuen Polen, gebaut hat – alles entgleitet ihm, auch die Geliebte. Was wird er retten können? Die Erde kennt das Ende, sie bleibt grausam kalt …
Szczepan Twardoch lässt die Erde selbst erzählen – den Drachen, der den Menschen ausspeit und ihn wieder verschlingt: In kühner Montage, ein ganzes Jahrhundert wie in einem einzigen Blick, schildert er die Dramen zweier Männer und die Chronik ihrer schlesischen Familie, vier Menschenalter. Ein grandioser Reigen von Werden und Vergehen, von der Suche nach Liebe und der Sehnsucht, sie festzuhalten – und ein gewaltiges Panorama des 20. Jahrhunderts.
Vita
Szczepan Twardoch, geboren 1979, ist die herausragende Stimme der jungen polnischen Literatur. Mit seinem Roman «Morphin» (2012) gelang ihm der Durchbruch, das Buch war in Polen ein Ereignis, wurde für die wichtigsten Literaturpreise nominiert und unter anderem mit dem renommierten Polityka-Passport-Preis ausgezeichnet. «Drach», 2014 erschienen, übertraf diesen Erfolg beim Publikum noch. «Tygodnik Powszechny» schrieb: «Die Klarheit dieser Erzählweise fasziniert und begeistert», und «Gazeta Wyborcza» meinte: «Ein großartiger Roman.» Szczepan Twardoch lebt mit seiner Familie in Pilchowice/Schlesien.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Die polnische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel «Drach» bei Wydawnictwo Literackie, Krakau
Copyright © 2014 by Szczepan Twardoch
Umschlaggestaltung und Motiv Anzinger Wüschner Rasp, Miriam Bloching
ISBN 978-3-644-12141-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Teil Eins
1. Kapitel
1906, 1918, 1921, 1934, 1939, 1942, 1945
2. Kapitel
1241, 1906, 1918
3. Kapitel
1241, 1813, 1866, 1870, 1906, 1914, 1915, 1918
4. Kapitel
1870, 1903, 1904, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1941
5. Kapitel
1870, 1914, 1915–1918, 1921, 1939, 1945, 1979, 2013, 2014
6. Kapitel
1904–1914, 1918, 1919, 1930, 1945, 1951, 1987, 1997, 1998, 2013
7. Kapitel
1906, 1918, 1919
8. Kapitel
1902, 1912, 1919, 1920, 1924, 1970, 1980, 1989, 2014
9. Kapitel
1886, 1870, 1914, 1918, 1919
Teil Zwei
1. Kapitel
1906, 1919, 1921, 1943, 1945, 1946, 1948, 1950, 1954, 2014
2. Kapitel
1903, 1904, 1919, 1954, 2014
3. Kapitel
1902, 1920, 1921, 1944, 1945, 1946, 1947, 1963, 2013
4. Kapitel
1921, 1945–1947, 1976, 1996, 2013
5. Kapitel
1914, 1921, 1922, 1923, 1944–1947, 1960, 2001, 2013, 2014
6. Kapitel
1921, 1927, 1945, 1987, 1989/1990, 2014
7. Kapitel
1921, 1920, 1922, 1925, 1945, 1939, 1941, 1943, 1980, 1979, 1987, 1989, 1993, 1997, 2014
8. Kapitel
1911, 1915–1918, 1919, 1921, 1941, 1944, 1945, 1946, 1950, 1951, 1971, 1989, 1993, 1999, 2001, 2003, 2008, 2011, 2014
Loretto. Höhe 165
Hiob 40,15–24
1915–1918
Teil Drei
1. Kapitel
1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925, 1934, 1945, 1951, 1964, 1998, 1999, 2011–2014
2. Kapitel
1903, 1921, 1932, 1941, 1944, 1945, 1997, 2014
3. Kapitel
1906, 1921, 1924, 1935–1937, 1991, 1994, 2013, 2014
4. Kapitel
1921, 2014, 2016, 2013, 1951, 1947
Teil Vier
1. Kapitel
1433, 1883, 1906, 1919, 1921, 1934, 1935, 1939, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1951, 1961, 1973, 1989, 1993, 1994, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2012, 2013, 2014
2. Schlaftherapie
1921, 1922, 1935, 1937, 1939, 1940, 1944, 1945, 2014
3. Kapitel
1915–1918, 1921, 1925, 1938, 1939, 1945, 1986, 2014
Editorische Notiz
Teil Eins
1.
1906, 1918, 1921, 1934, 1939, 1942, 1945
Er hat geschlafen, wird aber sehr früh wach, und es ist noch dunkel, es ist Oktober und immer noch warm, noch vor den ersten Nachtfrösten. Josef schläft in einem Bett mit seinem kleinen Bruder und weiß, die Mamulka wird böse, wenn er ihn weckt, deshalb schlüpft er so still wie möglich aus dem Bettzeug. Schaut aus dem Fenster, auf den Platz.
Der Platz ist verschlammt, Wirtschaftsgebäude aus kirschrotem, hartem Ziegel umgeben ihn. Auch das Haus, der Schuppen, die Schweineställe und Hinterhäuser sind aus diesem Ziegel gebaut. Auf einem Hügel in der Nähe, der früher eine Burg gewesen ist, steht die Holzkirche.
«So ne Marotschke …», schimpft einen Stock tiefer die Mamulka beim Blick aus der Waschkiche, denn der Regen verwandelt den Platz in eine einzige Schlammpfütze.
«Mamulka is schoa in der Waschkiche», sagt hinter Josefs Rücken sein kleiner Bruder, der doch aufgewacht ist.
Die Mama war da schon gestern, hat mit der Tante Pfeffer und Piment gemahlen, und Wacholderbeeren und Koriander, und Ingwer, hat alles gerieben und ordentlich gehäufelt, neben zierlichen Rosinen, Säckchen mit Majoran, neben trockenen Semmeln, in Würfel zerschnitten – und wie schön sich das trockene Brötchen schneidet, wie es kracht und wie viel Krümel danach bleiben –, und all das duftete stark, erregend und aufreizend zugleich.
Josef Magnor ist acht Jahre und schaut auf den Platz, dann endlich hat sich sein Warten gelohnt, sie sind da: der Metzger und sein Geselle, beide in Schürzen, sie tragen Messer und Beile.
Im Stall steht das Schwein.
Das Schwein wird geboren. Das Schwein lebt. Das Schwein kauft Josefs Vater Wilhelm, er kauft es für Mark, es sind Zeiten, als die Mark gegen Gold getauscht wird. Später wird sie nicht mehr getauscht, der Krieg ist teuer. Früher hat Wilhelms Vater Otto das Schwein für Vereinstaler gekauft, noch früher Ottos Vater Friedmar für Preußentaler, und sie alle steckten ihre Schweinchen in den Stall, fütterten sie mit Tischabfällen, und die Schweinchen fressen und wachsen und verwandeln sich in Schweine, und so lebt das Schwein. Das Schwein wächst. Das Schwein nimmt zu.
Dann kommt der Herbst, und im Herbst kommt der Metzger mit seinem Gesellen, und das Schwein weiß nichts, bis es auf den Platz gezerrt wird, dann weiß und versteht es mit seiner Schweinsklugheit, was los ist, und es findet sich damit ab, auch wenn sein ganzer Instinkt sich nicht damit abfinden will, dass es eins vor den Kopf bekommen wird, dass ihm die Kehle durchschnitten, die Borsten abgeflämmt, dass es an der Fessel an einen Haken gehängt und in vier Teile gehauen wird, dagegen sträubt der Instinkt sich, das Schwein will um sein Leben kämpfen. Aber da ist andererseits die Schweinsklugheit, die verborgene Schweinsklugheit, die sich damit abfindet. In seiner tiefsten, unter dem Instinkt verborgenen Klugheit weiß das Schwein, dass es in die Erde zurückmuss, aus der es geboren ist.
Josef schaut auf den Platz. Auf dem Platz der Metzger mit dem Gesellen, mit Messern und Beilen, begrüßen Mutter und Tante Truda, breiten die Utensilien ihres blutigen Handwerks aus.
«Weg mit dir, du Drach!», schreit die Mutter zu Josef. «Raus hier, ins Haus, aber sofort!»
Der Metzger Erwin Golla steht ein wenig schwankend auf seinen Beinen, die Mutter bringt Schnaps und gießt dem Metzger ein, mit seiner gnädigen Erlaubnis auch dem Gesellen, der Hanys Grychtoll heißt und seinen saufenden Meister hasst für all die Schläge ins Gesicht, die er demütig einsteckte, weil er musste, und mehr noch für die Schläge ins Gesicht, die er künftig würde einstecken müssen. Aber eines Tages, im Mai 1921, wird Hanys Grychtoll mit ein paar Kameraden zum Haus von Erwin Golla kommen und sich für all die Schläge ins Gesicht rächen. Und danach wird er den blutigen, noch lebenden Körper des Metzgers Golla betrachten – wird ihn mit großer Enttäuschung betrachten, wird verstehen, dass die Hiebe mit Stöcken und dem Kolben des alten Karabiners keinen einzigen der Schläge in sein Gesicht ausradiert haben werden, dass all die Schläge, die Hanys Grychtoll von Erwin Golla bekommen hat, in sein Gesicht wie in Stein gemeißelt sind zur ewigen Erinnerung, in Hanys Gesicht geschrieben, unaustilgbar.
Die Kameraden wollen Golla umbringen, aber Hanys Grychtoll hält sie davon ab, das nimmt ihnen sofort den Mut. Sie bringen Erwin Golla nicht um und werden dafür zahlen, denn Golla erinnert sich an sie und zeigt achtzehn Jahre später zwei von ihnen bei der entsprechenden Stelle an, entschlossene Männer mit einem schwarzen Citroën kommen sie holen, mit dem Zug werden sie nach Mauthausen gebracht und sterben dort beide, am Typhus und am Tod. Bei dem Citroën wird es sich um einen Traction Avant handeln, mit Vorderantrieb und selbsttragender Karosserie, was wichtig ist, aber keinerlei Bedeutung hat.
Während sie den Metzger Golla mit Stöcken schlagen und auf ihn spucken, wissen sie das noch nicht: weder welches Modell der Citroën sein wird noch welche Marke Tod, Typhus und Steinbruch. Vielleicht hätte es sie beruhigt zu wissen, dass Mauthausen in dieser Branche als verlässliche Marke gilt.
Hanys Grychtoł bringt 1939 niemand nach Mauthausen, denn Hanys Grychtoł – der das doppelte «l» im Namen gegen ein polnisches «ł» getauscht hat – wird sich ein paar Jahre vorher zu Tode trinken. Sich zu Tode trinken ist nicht leicht, es ist sogar sehr schwer, und man stirbt öfter an den Komplikationen als am Trinken selbst, genauso ist es mit Hanys, der sich bis zur Bewusstlosigkeit betrinkt und auf der Schwelle seines bescheidenen Häuschens in Knurów erfriert; seinen erfrorenen Körper findet nach ein paar Stunden Klara Grychtoł, geborene Lanuszny, seine Frau, und ist weder überrascht noch verzweifelt von diesem Fund, denn sie hat im Leben nichts Gutes von Hanys Grychtoł erfahren, ein knappes bisschen Lust und viel Elend; dank Grychtołs Bemühungen hat sie fünf Kinder, häufig aufgeschlagene Lippen und große Blutergüsse auf dem Rücken, denn Hanys schlägt Klara gern, wenn er betrunken ist, was die alten Schläge von Erwin Golla auch nicht abwischt – trotzdem versucht Hanys es immer wieder, in der Hoffnung, die blauen Schultern und Gesäßbacken seiner Frau könnten gegen das vor langer Zeit geprügelte Gesicht helfen.
«Na, neo is aus, du elender Woarm, neo bis verreckt un liegst inne Marotschke, oller Taumellolch», sagt Klara Grychtoł ruhig und mit philosophischer Sinnigkeit an einem Januarmorgen im Jahre 1934 an der Tür des Elternhauses in Knurów, über der Leiche ihres Mannes.
Doch das weiß Hanys Grychtoll nicht, als er seinen milchgrauen Schnaps trinkt an einem Oktobermorgen im Jahr 1906, und auch Golla weiß nichts – weder von der Schlägerei noch davon, wie er 1921 mit dem Leben davonkommt, um es 1942 zu verlieren infolge einer fettverstopften Ader in Herznähe, schmerzhaft, aber rasch, ein Abgang in Angst und Erleichterung zugleich, mit einem Fünkchen Glauben, dass Besseres ihn erwartet und nicht nur Dunkelheit.
Das einzige Geschöpf, das schon etwas weiß, ist das Schwein, denn als es aus dem Stall geführt wird, sagen ihm Instinkt und Klugheit, was geschehen wird. Zefliczek sieht mit wachsender Erregung zu, wie sie das Schwein an die Klappe des Abfallbehälters binden, wie Hanys es an den Ohren festhält, Golla die Axt aussucht, sich vor dem Tier aufstellt und mehrmals ausholt, um ihm eins über den Schädel zu ziehen, während Zefliczeks Mutter und Tante Truda schon mit Eimern dastehen, um das warme Blut aufzufangen und dann umzurühren, die ganze Zeit zu rühren, damit es nicht gerinnt.
Golla holt aus, Grychtoll hält die Ohren fest, wir schreiben das Jahr 1906, was eine gewisse Bedeutung hat, aber keine große, und die Welt scheint ewig zu sein und unveränderlich: Ihnen allen, Golla, Grychtoll, Josef, Josefs Mutter und Vater und dem Schwein, wobei die Art, wie das Schwein sich die Welt vorstellt (forschteluje, sagen Golla, Grychtoll, Zeflik, seine Mutter und sein Vater), noch am wenigsten kompliziert ist und daher der Wahrheit am nächsten kommt, denn Golla, Grychtoll, Zeflik – der kleine Josef – sein Vater und seine Mutter sehen die Welt in menschlichen Dimensionen. Da ist also, menschlich gesehen, das Dorf Deutsch Zernitz, darin stehen eine alte Holzkirche und dazu der weniger alte Pforrer Stawinoga (der ein begeisterter Deutscher ist, aber anständig, wie es im Dorf heißt), es gibt Gleiwitz mit dem Gericht, dem Landrat, der Ulanenkaserne und der Infanteriekaserne, es gibt das Bergwerk, wo man arbeitet, und es gibt Berlin, dort wohnt der Kaiser.
Sie wissen zu viel, um zu verstehen. Das Schwein weiß weniger, deshalb versteht es besser, es versteht die Wahrheit des schlagenden Herzens und die Wahrheit des Beils.
Die Wahrheit des Schweins nun wird sich bald erfüllen, denn Golla holt schon zum siebten Mal aus, bis er schließlich mit aller Kraft zuschlägt und danebenhaut. Der Rücken des Beils rutscht am Schweineschädel ab und verletzt diesen sowie die rechte Hand des Gesellen Grychtoll schwer. Grychtoll fällt hin, brüllend vor Schmerz und Angst, überzeugt, dass Golla ihm die Hand abgehackt hat, und auch das Schwein kreischt vor Schmerz und Angst, es reißt sich los, und weil es fest an den Klappengriff gebunden ist, reißt es die Klappe mit ab und zieht sie mit sich, rennt über den Hof, Rettung suchend, doch Rettung gibt es nicht.
Golla, leicht benebelt vom Alkohol, steht da mit dem Beil.
«Was habt ihr angerichtet, Meister», schreit Josefs Mutter, und Josef am Fenster im ersten Stock bebt vor unsagbarer Erregung, und alles, was er sieht, prägt sich dem Jungen für immer ein. Deshalb denkt er später daran, als er mit dem Wehrmachtszug von der Leie zurückkommt, aus dem Morast der Schützengräben unter die Erde, aus der Erde in die Erde.
«Ich bring dich um!», brüllt Schlachter Golla zwölf Jahre vor dem Augenblick, in dem Josef Magnor mit dem Wehrmachtszug nach Niederschlesien zurückkommt, die kurzen Beine des Schlachters Golla setzen den mächtigen Körper in Bewegung, und Schlachter Golla setzt dem Schwein nach, chancenlos wegen seiner Fettleibigkeit, wäre da nicht der fürchterliche Ballast der Abfallbehälterklappe, die das verletzte Schwein hinter sich her schleppt. Geselle Grychtoll weint in der großen Einsamkeit des Schmerzes und betrachtet sorgfältig die blau anlaufende Hand, er weiß schon, dass Golla ihm die Hand nicht abgehackt, sondern nur gequetscht und verletzt hat, es tut Grychtoll sehr weh, und auch das Schwein ist sehr einsam und entsetzt in seinem Schmerz, denn es hat ebenfalls große Schmerzen.
«Komm schoa, Miststick, ferfletstes …!», brüllt Golla, hebt das Beil über den Kopf, erwischt es endlich in seiner quiekenden Flucht und schlägt zu und trifft nicht und fällt hin, und das Schwein läuft weiter, bis die Mutter nach dem Seil greift, mit dem es an die Klappe gebunden ist, da kommt Golla zum dritten Mal heran, und diesmal trifft er, Zefliks Mutter springt im letzten Augenblick beiseite, der Beilrücken saust auf den Schweineschädel nieder, und das betäubte Tier erstarrt im Modder, ähnlich wie ein Vierteljahrhundert später im Modder der Leichnam des Gesellen Grychtoll erstarren wird, der es nie zum Meister gebracht, dafür aber das doppelte «l» im Namen gegen ein «ł» getauscht hat.
«Flenn ock nich wie ne Amme, geh lieber resch, du Riepel!», schreit Golla Grychtoll an, und Grychtoll geht, das Schweineschlachten kommt jetzt in geregelte Bahnen. Den Platz betritt Josefs Tante Truda. Josef sieht, wie Golla, scheinbar etwas ernüchtert, mit einem großen Messer den Schweinehals aufschneidet, aus dem in schaumigem Strahl dunkelrotes Blut pladdert, in die Schüssel pladdert, die die Mutter hält. Und als sie voll ist, reicht sie sie der Tante, die mit einem Holzlöffel darin rührt, damit das Blut nicht gerinnt, während die Mutter eine zweite Schüssel unter den Strahl hält.
Der betrunkene Golla und der wunde Grychtoll wuchten den Schweinekörper in einen großen Holztrog, in dem Josefs Mutter sonst Unterwäsche wäscht, jetzt bringt sie gemeinsam mit Tante Truda einen großen Topf kochend heißes Wasser, mit dem Golla und Grychtoll das Schwein brühen und ihm die Stoppeln abziehen, danach hängen sie es an einem Haken an die Tür der Waschküche. Zeflik läuft schon auf den Hof, er weiß, jetzt darf er, die Mutter ruft ihn sogar, und Zeflik sieht nun zu, wie der betrunkene, wenn auch leicht ernüchterte Schlachter Golla am Damm beginnend mit nunmehr sicheren Bewegungen das Schwein auftrennt und aus dem aufgeschnittenen Bauch gräulich blaue Eingeweide sich ergießen, die Zefliks Mutter sorgfältig sortiert.
«Mensch, haste dies Geschlenker geseha?», flüstert Josef fasziniert seinem Bruder zu.
Golla und Grychtoll gehen daran, den Schweinekörper zu zerlegen. Zefliks Mutter und Tante Truda stellen einen gusseisernen Kochtopf in die Waschküche, in dem die Schweinelungen und -nieren, der Kopf, die Wamme und weitere ansonsten unbrauchbare Teile landen: So wird Wellfleisch gekocht, und gegen zehn kommen schon die ersten Gäste, gerade als das Wellfleisch fertig ist. Schlachter Golla trinkt nicht mehr, er ist mit Grychtoll emsig bei der Arbeit: Nachdem das Schwein zerlegt ist, säubern sie seine Innereien, aus denen für den Anfang Graupawoscht und Semmelwurst gemacht werden, indem man Heidengraupen, also Buchweizengrütze, mit Fettstückchen und Brocken trockener Brötchen mit Blut übergießt. Aus dem Magen wird eine große Presswurst.
Zefliks Mutter und Tante Truda arbeiten ebenso eifrig, sie kochen, bewirten die Gäste mit Schnaps und Bier aus der Brauerei Scobel, kochen Kartoffeln und Panschkraut zur frischen Wurst, zu der wieder Gäste kommen, andere und dieselben, die am Morgen da waren, sie kommen so gegen viertel zwei zur Wurst, essen sie mit Kartoffeln, trinken etwas dazu, bekommen dann eine Wegzehrung mit, Stücke von frischem Fleisch, Wurst, Presswurst und Leberwurst auf geliehenen Tellern, die in Tuchservietten gewickelt sind.
Zeflik aber, während er Woscht und Semmelwürste isst und Woschtsuppe schlürft, denkt an das Schwein, das gestorben ist und dessen Schweinsgestalt restlos verschwand und sich in Essen verwandelt hat. Er denkt an die silbrig blauen Innereien.
Diese Geschmäcker werden ihn heimsuchen: die von Woscht und Semmelwurst und von Woschtsuppe, von frischem Brot mit frischer Presswurst, und der bittere Geschmack des Bieres, von dem der Vater ihn probieren lässt und das ihm nicht schmeckt, diese Geschmäcker werden ihn heimsuchen, wenn er tief in mir ruht, unter der Erde und in der Dunkelheit, lebendig, die Beine mit einer Decke bedeckt, wenn er in das letzte Stück altgewordener Wurst mit trockenem Brot beißt und Wodka dazu trinkt, betäubt, geschwächt und krank, und wenn er im ewigen Schlaf versinkt und wenn er im Schnee auf dem Platz vor dem Haus in Przyszowice liegt.
2.
1241, 1906, 1918
«Baum, Mensch, Rieh, Stein. Dasselbigte. Baum un Mensch sind eins. Der Stamm ist der Leib, der Kern die Seele, das Fruchtfleisch das Blut. Die Blätter sin de Finger un de Augen», sagt der alte Pindur.
Er sitzt mit Josef auf einem umgestürzten Stamm, in den Sümpfen. Josef ist acht, einige nennen ihn Zeflik. Der alte Pindur spricht mehr in die Luft als zu Josef, Josef aber hört zu und lässt die Füße in zierlichen Schühchen baumeln.
«Iss die Stulle, Söhnchen. Mit Butter», sagt Pindur und reicht Josef die dünn mit Butter bestrichenen zwei Scheiben sauren, schweren Brotes, denn er weiß, er muss den Jungen beschäftigen, wenn er einen Zuhörer haben will.
«Acht nur, dass du nich zu resch isst, jo? Resch essen ist nich gut. Langsam mechteste essen, grindlich.»
Josef nickt und isst das Butterbrot langsam.
Er hat keinen Hunger.
«Das Rieh ist auch dasselbigte. Leib ist Leib, un Seel ist Seel. Das Rieh hoot auch een Seel», sagt der alte Pindur. Josef hört zu.
Der alte Pindur hat Rückenschmerzen, er nimmt also einen Schluck Bitterlikör aus der flachen Flasche. Gegen den Schmerz. Der Rückenschmerz geht davon nicht weg. Aber der Likör schmeckt.
Der Baumstamm und das Sumpfgebiet liegen in dem kleinen Wald zwischen Birawka-Mühle und Nieborowitzer Hammer. Gespeist wird der Sumpf vom Wasser der Bierawka, die ihren Namen einst von den an ihren Ufern lebenden Vandalen bekam, heute aber gibt es keine Vandalen mehr. Auf dem Grund des Sumpfes gibt es dafür ein Lehmgefäß voller Silberschmuck und Münzen: arabische Dirhems, Brakteaten aus Hedeba, rheinische und lotharingische Dinare. Niemand auf der Erdoberfläche weiß von ihm, niemand erinnert sich, wer ihn dort vergraben hat. Der den Topf in die Erde getan hat, hieß Radzim und war ein reicher Mann, nur ich erinnere mich, wie hitzig er gegraben hat, und weiß um sein berechtigtes Entsetzen und die bald enttäuschte Hoffnung und den Wald, damals alt und dicht.
An alles erinnere ich mich.
Ein Wald voll von Pferdewiehern und unheilvollen Rufen. Am anderen Ende der Sümpfe erscheint ein scheues Reh, eine Ricke.
«Das Rieh ist doas selbigte wie een Baum un een Mensch. Guck mal, Kleener: Doas ist een Rieh. Das semmer. Un doas ist een Baum. Genau daselbigte, gelt ock? So is unser Daseen uf dieser Erde, Kleener. Rieh, Baum, du, ich, doas selbigte.»
Baum und Mensch und Reh sind das gleiche, denkt Josef Magnor zwölf Jahre später, im Wehrmachtszug von der Leie nach Niederschlesien. Er ist nicht mehr Zeflik und ist es doch noch. Weiterhin hört er die Stimme des alten Pindur. Baum und Mensch und Reh sind das Gleiche. So ist unser Dasein auf dieser Erde.
Das Gleiche.
3.
1241, 1813, 1866, 1870, 1906, 1914, 1915, 1918
Josef sitzt im Waggon und denkt zurück. Der Hunger sorgt für diese Erinnerungen.
Er ist nicht sicher, welches Jahr das war, aber ich bin es: Es war 1906, dasselbe Jahr, in dem der alte Pindur in dem Hain zwischen Nieborowitzer Hammer und Birawka-Mühle saß und sich in Wald und Feld in der Nähe von Deutsch Zernitz herumtrieb, über Kaziormühle, bis hin nach Neudorf und Barglowka, und manchmal gingen sie noch weiter, durch die Staatsforste um Gross Rauden, die einem Menschen mit einem sehr langen Vor- und Zunamen gehörten: Viktor II. Amadeus, Zweiter Herzog von Ratibor und Zweiter Fürst von Corvey, Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Von diesem ganzen Namen kannte Josef nur den Teil «Herzog von Ratibor» und wusste, dass dem Herzog von Ratibor diese Wälder gehörten, aber er wusste nicht, was genau es bedeutet, Wald zu besitzen, und fragte Pindur danach, und Pindur antwortete ihm, es heiße, sich selbst zu belügen. Pindur kannte sich gut in Wäldern aus und in Fürsten, im Besitzen längst nicht so gut.
Doch daran erinnert sich Josef jetzt nicht. Er erinnert sich nicht an die Spaziergänge und die Weisheit des alten Pindur, das stille Evangelium der Bäume und Rehe. Josef erinnert sich an etwas anderes, denn er ist hungrig. Er erinnert sich an einen Tag, an dem er nicht zur Schule musste, obwohl Wochentag war.
«Der Lehrer wird nich schimpfa, gelt ock, wenn ein Schwein geschlachtet wird, hoot der Kleene nich in der Schule zu hocka», sagt Josefs Vater zu Josefs Mutter, und Josef geht nicht zur Schule. Am nächsten Tag bringt er dem Lehrer ein hübsches Geschenk, und damit hat es sich.
Josef Magnor hat den Geschmack der Wurstsuppe auf der Zunge, obwohl er jetzt keine Wurstsuppe isst. Es ist Mai 1918, es ist warm, und der Waggon hat Wände aus Brettern, die in einem Stahlskelett sitzen, auch die Tür besteht aus Brettern, die sich mit Mühe in den Stahlschienen bewegen lassen. Vier Jahre zuvor hatte man die optimistische Losung «Von Gleiwitz über Metz nach Paris» auf die Tür geschrieben, jetzt schreibt niemand mehr etwas, denn niemand hat mehr etwas zu sagen, was man auf die Waggontür schreiben könnte.
Der Geist von 1914 ist verschwunden.
In demselben Waggon, ebenfalls bereits ohne Losungen, fährt Josef auch drei Jahre vorher.
Ein Waggon, Bretter in einem Stahlskelett, Josef, das Jahr 1915. Frühling. 7. Kompanie, 2. Bataillon, 22. Infanterie-Regiment, auch 1. Oberschlesisches genannt, Infanterie-Regiment Keith (1. Oberschlesisches) Nr. 22, Worte und Ziffern wie geographische Koordinaten, Musketier Josef Magnor, 7. Kompanie, 2. Bataillon, 22. Infanterie-Regiment Keith, 11. Reserve-Infanterie-Division. Ersatztruppen.
Im Waggon neben dem Musketier Josef Magnor: Landsturmmann Leo Beer. Musketiers: Hermann Becker, Anton Alker, Wilhelm Blania. Gefreiter Augustin Broll. Gefreiter Vinzent Cholewa. Gefreiter Franz Danieltschik. Reservist Alois Dembczyk. Franz Golla. Musketiers Boleslaus und Leopold, und der Freiwillige Wilhelm, alle Holewa, leibliche Brüder, sich hassend, wie nur Brüder sich hassen können, und sich gegenseitig den Tod wünschend, und ihr Wunsch wird in Erfüllung gehen. Weiter: Unteroffizier Paul Howanietz. Paul Nießporel. Josef Patuszka. Und andere, Dutzende und Hunderte und Tausende anderer.
Jetzt alle in der Erde, von der Erde geboren und in sie zurückgekehrt, aus Morast geboren und zu Morast geworden, und sie werden wieder auferstehen aus dem Morast, denn das Leben ist sehr lang, nur eben nicht das einzelne, sondern sein Zyklus. Josef wird keinem von ihnen mehr begegnen und nur von Ferne ihre leichten, in mir aufgelösten Körper spüren, aber Schicksale interessieren mich nicht, denn sie alle kreisen schon in mir.
Nur Josef noch nicht im Morast, sondern im Waggon auf der Rückfahrt. Verdun, Béthincourt, Malancourt, Haucourt und Termitenhügel. Artois. Die Höhe von Loretto. Somma. Arras. Wieder Artois. Lens. Flandern. Armentiéres. Alles kommt aus der Erde und kehrt in die Erde zurück.
Josef fährt zurück, nach Schlesien. Unter die Erde, aber nicht in die Erde, in die Grube. Von Armentiéres ins Bergwerk. Das Regiment ist geblieben: Ypern – La Bassée, Yser und weiter, bis das Kriegsende sie an der Leie ereilt. Das Regiment wird bleiben, auch wenn niemand von denen, die mit Josef im Ersatztruppenwaggon Anfang 1915 unterwegs waren, bis zum Kriegsende überdauert hat, nur Josef hat überdauert, denn im März meldet die Grube Delbrück Bedarf nach ihm, was ist es also, das an der Leie dauert, wo sie die Kapitulation überraschte und wo Josef nicht mehr ist?
Das Regiment lebt weiter. Regimenter leben ewig. Das Infanterie-Regiment Keith ist hundertundfünf Jahre alt, als es vom Frieden überrascht wird, und als Regiment hat es sein eigenes kleines Bewusstsein, das mehr ist als die Summe des Bewusstseins der Menschen, aus denen es sich zusammensetzt. Das Regiment besitzt also die diskrete Intelligenz einer Institution, und in ihm hält sich eine Überzeugung, die ebenso hartnäckig wie falsch ist, nämlich: Wenn das Regiment hundert Jahre überdauert hat, werde es ewig leben, es werde immer irgendwo ein Infanterie-Regiment Keith, das erste Oberschlesische, geben. Es gab das Regiment 1918, es gab es 1866, 1870, und es gab es 1914, deshalb kann es nicht einfach aufhören zu sein. Regimenter sind wie kleine Kirchen. Sie müssen weiterbestehen.
Und dennoch, das Infanterie-Regiment Keith wird verschwinden, so wie die Muster der Flechten auf Waldsteinen verschwinden, sie verschwinden und verwandeln sich in andere, auch das Regiment wird sich verwandeln, wie die Zeichnungen der Birkenrinde und die Rehlosung auf den Feldern. Alles das gleiche, Menschen-Regimente und Rehlosungen, alles das gleiche.
Im Jahr 1918 sitzt Josef in der Ecke, an der Wand. Er trägt eine Uniformbluse mit Plisséeknöpfen, ausgewaschen und abgenutzt, doch sauber dank stundenlangen Bürstens. Die Hose hat Josef neu, Farbe steingrau, die alte ist kaputtgegangen. Als Josefs Entlassung bevorstand, baten seine Kollegen vom Zug ihn, die gute Hose dazulassen, da er sowieso nach Hause fahre, aber Josef gab sie nicht her. Die schweren Knobelbecher hat er ausgezogen, die in Lappen gewickelten Füße unter den Mantel geschoben. Er fährt. Seit vierundzwanzig Stunden hat er nichts gegessen, nicht einmal einen Bissen Kommissbrot. Hunger macht schlechte Laune. Auch Rehen. Es ist Mai 1918. Der Waggon hat Bretterwände und eine Brettertür. Die Bretter waren einmal ein Baum. Der Baum war einmal Erde. Die Erde war einmal Mensch. Baum und Mensch und Bretter – das Gleiche.
Es ist Mai 1918, und Josef steigt aus dem Waggon mit Bretterwänden und Brettertür aus, auf dem Bahnhof in Gleiwitz. Das Bahnhofsgebäude ist nicht sehr hoch. Vor dem Bahnhof stehen Droschken. In einer überdachten Bude verkauft ein älterer Bahner Bahnsteigkarten. Die gelangweilten Kutscher rauchen Zigaretten. Es ist Freitag, darin sind sich alle einig. Und der 17. Mai, auch das ist klar. Der Himmel wolkenlos.
Josef steht vor dem Bahnhof und streckt sich. Er ist unschlüssig. Er betrachtet die bekannten Gebäude: Drahtindustrie. Hier arbeiten Josefs Kameraden. Nichts ändert sich. Ein hagerer Brauner vor der Kutsche schlägt mit dem Schädel. Josef strafft die Hosenträger. Dann geht er los, geht bis zur Neudorferstraße, biegt in die Wilhelmstraße ein und geht, geht langsam, Richtung Markt, biegt dann aber gleich in die Kreidelstraße ein, kommt an der Kasinogesellschaft vorbei, wo die Kleinbürger über Zeitungen sitzen, dann kommt er an dem Haus mit den Türmchen auf der anderen Straßenseite vorüber, in dem sein Leben sich so radikal ändern sollte, doch in diesem Augenblick hat Josef keine Ahnung davon, dass in genau diesem Haus ein vierzehnjähriges Mädchen sitzt, das dabei sein wird, wenn Josefs Leben sich von Grund auf umwendet, jetzt aber ist Josef aus dem Krieg zurück und geht durch den Park, den er immer so mochte, schließlich hat er es nicht eilig, nach Hause. Er setzt sich auf eine Bank, legt den mit schwarz-weiß geflecktem Rinderfell bezogenen Rucksack neben sich, lockert den Kragen der Uniformbluse. Er wärmt sich in der Sonne. Denkt an fast gar nichts. Er will nicht einfach so nach Hause. Er will noch ein bisschen allein sitzen. Nur ein Schluck Wasser aus der Feldflasche. Das Wasser ist warm.
Ein Pfiff, ein zweiter, weitere Pfiffe auf der ganzen Länge des Schützengrabens, das Einrasten der Federn beim Aufsetzen der Bajonette, Leitern, Morast, ein dünner Film warmer Ausscheidungen läuft unter den Hosenbeinen runter bis zu den Stiefeln.
Und jetzt wärmt Josef sich in der Sonne. Auf der Parkbank. Er ist hungrig, er hat Geld, aber er will nicht essen. Er wird nichts essen. Aber vielleicht etwas trinken. Jetzt wärmt er sich in der Sonne. Über Gleiwitz O.S. kein Wölkchen, wie im Juli, obwohl Mai ist. Josef wärmt sich in dieser Sonne. Sich in der Sonne wärmen, statt zu verwesen, ist gut.
Zwischen Deutsch Zernitz, Nieborowitz, Birawka-Mühle und Leboschowitz ist ein Wald namens Jakobswalde. Von dem sumpfigen Hain, in dem ein Topf voller arabischer Dirhems, Brakteaten aus Hedeba, rheinischen und lotharingischen Dinaren ruht, ist Jakobswalde durch eine Schmalspurbahn getrennt, auf der von vier Uhr fünfunddreißig morgens an offene Waggons langsam von Gleiwitz nach Plania, bis Trynek, Schönwald, Nieborowitz, Pilchowitz, Stanitz, Rauden, Nendza, Babitz, Markowitz und Lukasine ziehen.
Durch Jakobswalde geht Josef früher mit dem alten Pindur. Sie sammeln Beeren und Pilze. Über Jakobswalde ebenfalls kein Wölkchen, es ist nicht weit von Gleiwitz, südwestlich. Von dem Hain, in dem Josef zwölf Jahre zuvor mit dem alten Pindur sitzt, ist Jakobswalde durch die Schmalspurbahn und den Fluss Bierawka getrennt. Früher einmal hat das aus dem Schoß einer Merkitin namens Höelün geborene Imperium seine Fühler nach den Ufern der Bierawka ausgestreckt, später zog sich das Imperium zurück, doch für Radzim hatte das keine Bedeutung, Radzim ist in der Erde versickert, nicht weit von dem Topf, den er zuvor vergraben hatte, und aus der Erde haben ihn die Bäume gesaugt, die dann gefällt wurden, dann vermoderten, und Radzim kehrte in die Erde zurück und wurde wieder herausgesaugt und kehrte wieder zurück.
Deshalb sind Baum und Mensch das Gleiche. Der alte Pindur sagt so, denn er hält das für eine schöne Metapher, auch wenn er das Wort «Metapher» nicht kennt.
Als sie so gemeinsam durch die Wälder gehen, der junge Josef und der alte Pindur, ist Pindur sechssiebzig, heißt ebenfalls Josef mit Vornamen und ist in einer anderen Welt geboren. Als seine Mutter den kleinen Pindur zur Welt brachte, leistete sein Vater noch Frondienst auf den Gütern des Grafen von Wengersky, wusste aber, dass er das nicht mehr lange würde tun müssen. Pindurs Vater, Kazimierz, sprach meist Schlesisch, er las und schrieb Deutsch, hielt sich für einen Preußen und war stolz auf sein Preußentum. Aus dem Frondienst entlassen, hielt er sich desto mehr für einen Preußen und Untertan des preußischen Königs. Das waren Zeiten, in denen der Preuße nicht Deutsch sprechen musste. Früher sprach nicht einmal der König gern Deutsch. Für Pindur war wichtig, dass der Preuße keine Fronarbeit leistet. Der Preuße bewirtschaftet sein eigenes Feld und muss sich von Zeit zu Zeit für seinen König umbringen lassen, aber es lohnt sich, sich für den König umbringen zu lassen, wenn man keine Fronarbeit leisten muss. Josef Pindur wollte Priester werden, wurde aber aus dem Seminar geworfen, diente danach dem preußischen König in den Kriegen gegen Österreich und Frankreich, kehrte zurück und wurde zum Dorfweisen und Original, arm bis auf diese seltsame Weisheit, die dumm und klug zugleich ist, eine Weisheit, flüchtig und aufs Geratewohl aus den Büchern von aufgeklärten Menschen angelesen, ohne von ihnen verdummt worden zu sein, sie nahm sich daraus, was sie brauchte. Die Weisheit eines Schamanen, die Weisheit der Mutter und des Jägers, die Weisheit eines Menschen, der mit einem anderen Menschen oder einem wilden Tier kämpft und dank dieser Weisheit den Kampf gewinnt, die Weisheit eines Säuglings, der die Fäustchen ballt und gierig mit den Lippen nach der Mutterbrust sucht.
Pindur spricht von Bäumen, Rehen und Menschen, weil er das vor langer Zeit von einem Älteren gehört hat, der es wiederum von einem noch Älteren gehört hat. Und noch früher war da jemand ganz anderes, der das tatsächlich gedacht und alles verstanden hat, und die von ihm gesprochenen Worte lebten ihr verborgenes Leben lange nach seinem Tod, ein stilles, geheimes Evangelium der Weisen, denen nichts gegeben ist als ihre seltsame Weisheit.
Der alte Pindur kann das Gewicht der Fragen, die sich dahinter verbergen, nur ahnen. Deshalb redet er so. Mehr für sich als für Zeflik, der nichts ahnt und nicht weiß, dass Baum und Mensch das Gleiche sind und es nie erfahren wird, allenfalls ganz am Ende. Der alte Pindur dagegen meditiert über diese seltsame Weisheit, die den Sinnen und der Erfahrung widerspricht.
Mit ihm wird auch dieses stille, geheime Evangelium sterben, das vor langer Zeit und woanders geboren wurde, bevor im Hain zwischen Birawka-Mühle und Nieborowitzer Hammer die ersten Christen auftauchten.
In Jakobswalde leben Rehe. Rehe haben keine Namen, zwei von ihnen aber wollen wir benennen, um sie von anderen Rehen zu unterscheiden. Ein kleiner Betrug, genauso wie wenn ihr euch einreden wollt, ihr würdet euch in irgendeiner Weise von euren Nächsten unterscheiden, ihr wäret etwas Besonderes.
Die Rehe nennen wir das Erste und das Zweite.
Das Erste hat gerade gesetzt, es hat zwei Kitze: auch ein Erstes und ein Zweites. Das Erste und das Zweite verstecken sich im Unterholz. Das Erste kommt nur zum Säugen zu ihnen, damit es mit seinem Geruch die herrenlosen Hunde nicht anlockt, von denen es in der Gegend wimmelt. Oder Füchse, von denen es nicht wimmelt.
Das Zweite ist noch trächtig, es wird morgen oder übermorgen setzen. Es sammelt Kräfte für die Geburt, auch wenn es gar nichts davon weiß.
Josef sitzt auf der Bank.
Auf der Bank in der Laube des Hauses in Wilcza (häufig Wilchwa geschrieben) sitzt die Witwe eines Soldaten, die Vor- und Zunamen hat, doch sie sind unwesentlich. Sie wärmt sich in der Sonne, wie Josef. Am Abend werden der Kutscher Mucha aus Krostoschowitz und der Kriegsinvalide Kloska aus Wilcza in ihr Haus kommen.
Den Kutscher Mucha hat der Kriegsinvalide Kloska zu diesem Besuch angestiftet. Die Soldatenwitwe hat es abgelehnt, den Kriegsinvaliden Kloska zu heiraten. Sie hat nicht weiter darüber nachgedacht, warum, doch sicher hat die Einschätzung der Besitzverhältnisse des Kriegsinvaliden Kloska Einfluss auf diese Entscheidung gehabt. Der Kriegsinvalide Kloska hat nämlich einen scheußlichen Charakter, einen unreinen Atem, ist alkohol- und ätherabhängig und besitzt die Hälfte eines Ziegelhauses, das seine Eltern ihm hinterlassen haben, noch bevor er Kriegsinvalide wurde. Dem Kriegsinvaliden Kloska fehlen also die Eltern, der größte Teil des linken Beines, Attraktivität und Vermögen. Die andere Hälfte des Hauses bewohnt seine zänkische Schwester, die ihm unaufhörlich vorhält, dass er alles Geld für Wodka ausgibt, was nicht zutrifft, denn ein erheblicher Teil seiner Mittel geht für Äther drauf, den er vermischt mit Himbeersaft trinkt, stibitzt aus der Speisekammer seiner Schwester.
Endlich erhebt Josef sich von der Bank und kehrt in die Wilhelmstraße zurück, geht in Richtung Marktplatz. Setzt sich in das Café Kaiserkrone, bestellt beim Kellner ein Bier der Brauerei Scobel und trinkt es langsam, sehr langsam. Er sieht sich die Gäste an in dem Restaurant, das am Krieg zu knabbern hat, konkret an Versorgungsengpässen. Er sieht sich die Gäste im angrenzenden Cafébereich an, die von anderer Art sind. Zwei Mädchen über ihren Kaffeetassen lächeln dem gut aussehenden Soldaten zu.
«Bald gibt es auch kein Bier mehr», sagt der Kellner. «Bald sind wir alle pleite.»
Josef trinkt aus, zahlt und geht weiter. Der Marktplatz. Durch die Gassen der Altstadt erreicht er die Teuchertstraße. Alles vertraut. Er geht langsam, kommt an schönen Damen und bäuerlich gekleideten Frauen vorbei, die schönen Damen sprechen deutsch, die in Tracht nicht. Ein Herr mit Hut lüftet diesen vor Josef und spricht mit trauriger und erhabener Stimme vom Dienst am Vaterland, Josef bleibt vor ihm stehen wie vor einem Offizier und hört sich die Danksagungen geduldig an, dann geht er weiter, obwohl er dem eleganten Herrn gern eine reingehauen hätte. Er kommt vorbei an den Ulanenkasernen, am Landratsamt, der Kaserne des Infanterie-Regiments, in dem er gedient hat, vorbei am Proviantamt, überquert die Brücke über die Ostropka und erreicht Gillnersdorf, lässt den aufragenden Ziegelschornstein hinter sich und geht weiter.
Er begegnet auf der Straße einem Bekannten aus Deutsch Zernitz, der Bekannte heißt Russin und geht mit einem Packen auf der Schulter in Richtung Gleiwitz, er erkennt Josef nicht, deshalb grüßt Josef ihn nicht. Sie gehen wie Unbekannte, zu denen sie gerade geworden sind, aneinander vorbei, denn Josef weiß nicht, wer jetzt Hanys Russin ist, und Hanys Russin weiß nicht, wer Josef Magnor ist.
Es ist schon später Nachmittag, als Josef in die Straße am Friedhof einbiegt und über die zu dieser Jahreszeit grünen Felder in Richtung Deutsch Zernitz geht.
Es ist schon später Nachmittag, als der herrenlose, kräftige Rüde Alpha mit Anteilen eines deutschen Schäferhunds und eines Terriers die Witterung des Ersten aufnimmt. Alpha führt ein Rudel, zu dem außer ihm zwölf ähnliche Mischlinge gehören, doch Alpha ist der Größte und Kräftigste und hat die beste Witterung.
Die Vierte Flandernschlacht ist schon in die Geschichte eingegangen, zusammen mit der gesamten Frühjahrsoffensive, optimistisch Kaiserschlacht genannt. An der Westfront dauert dennoch verstärkte Aktivität von Artillerie und Luftwaffe an. Britische Flieger bombardieren Metz. Dort kommt bei einem Luftangriff Herr Bernhardt Segalla, siebenundsechzig, ums Leben, der abends sehr gern Moselwein trank, doch das hat überhaupt keine Bedeutung. Die deutschen Truppen mühen sich damit ab, die bei der Offensive gewonnenen Gebiete zu halten, und werden dadurch weiter geschwächt. In drei Monaten werden die Alliierten ihre Offensive der hundert Tage beginnen, in deren Folge in einem halben Jahr sehr viel passieren wird.
Das Erste rennt so schnell, wie sein Rehkörper rennen kann, es rennt schneller als die Hunde, verliert aber auch schneller an Kraft.
Es ist schon später Nachmittag, als der Kriegsinvalide Kloska und der Kutscher Mucha bei der Soldatenwitwe an die Tür klopfen. Die öffnet ihnen, schließlich ist sie gut erzogen, wenn auch eine einfache Frau.
Josef sieht schon die ersten Häuser des Heimatdorfes.
Die verwilderten Hunde umzingeln das Erste, mit wölfischer Präzision, unbewusst, instinktiv, alles machen sie richtig.
Der Kutscher Mucha schlägt der Soldatenwitwe ins Gesicht, mit geballter Faust und voller Kraft, die Soldatenwitwe stürzt besinnungslos zu Boden. Der Kriegsinvalide Kloska sieht zu, wie Kutscher Mucha den schmächtigen Leib der Witwe aufs Bett zerrt, nachdem er Federbett, Kissen und Überdecken auf den Boden geworfen hat.
Der Kriegsinvalide Kloska knöpft die Hose auf, rafft die Röcke und Schürzen der Witwe hoch, reißt die Knöpfe ihres schwarzen Jäckchens auf, zerreißt das Leibchen, legt die vertrockneten Brüste der Frau frei, dann schlägt er ihr mit der flachen Hand ins Gesicht, damit sie wach wird. Die Kriegerwitwe kommt zu sich und begreift rasch, in welcher Lage sie sich befindet.
Der kräftige Mischling aus Deutschem Schäferhund und Terrier fällt das Erste an, schlägt ihm die Zähne in die Gurgel und schließt die Kiefer, bleibt so an ihm hängen, das Erste macht noch ein paar Schritte, die anderen Hunde verbeißen sich in seine Lenden, das Hinterteil und den Bauch.
Josef steht vor der Tür seines Elternhauses.
Der Penis des Kriegsinvaliden Kloska will nicht steif werden, und der Kriegsinvalide ist nicht in der Lage, ihn in die Scheide der Kriegerwitwe einzuführen, die nun bei Bewusstsein ist. Der Kriegsinvalide Kloska begnügt sich also damit, die Finger in die Scheide der Kriegerwitwe einzuführen und sie ein paarmal hin- und herzubewegen. Die Kriegerwitwe weint nicht. Schließlich befindet der Kriegsinvalide Kloska, es sei genug, steht mühsam vom Bett auf und lehnt sich gegen die Wand, schließt den Schlitz der Hose, deren linkes Bein oberhalb des Knies, das dem Invaliden samt Unterschenkel und Fuß abgenommen worden ist, mit einer Sicherheitsnadel zusammengehalten wird und die Versehrung unübersehbar macht.
Der Kutscher Mucha bohrt ärgerlich in der Nase, er will schon gehen. Der Kriegsinvalide Kloska nimmt seine Krücke und verlässt mit dem Kutscher Mucha das Haus der Witwe.
Die Kriegerwitwe weint und bringt sich in Ordnung. Morgen wird sie zur Polizei gehen, und einige Wochen danach werden der Kriegsinvalide Kloska und der Kutscher Mucha je zwölf Jahre bekommen, dazu einige Jahre Festungshaft für Verbrechen, die sie früher begangen haben und von denen hier nicht die Rede ist.
Von dem Ersten bleiben eine Blutlache, der Kopf mit Wirbelsäule und Rippen, Fetzen von Fell. Die Hunde tragen die Läufe und die Innereien weg, jeder in seine Richtung, um das Erste ungestört aufzufressen. Die Kitze des Ersten, geruchlos und unsichtbar für die Hunde, weil im Unterholz versteckt, werden hungrig.
Josef betritt das Haus. Er ist sehr hungrig.
«Bin rem!», ruft er.
Der Vater öffnet die Tür.
«Seid ihr nich in der Grube, Voater?», fragt Josef und legt den Rucksack ab.
Der alte Magnor verdreht die Augen und schüttelt den Kopf.
«So ein Krieger un so tumm …»
Er geht in der Tür an Josef vorbei, und Josef weiß, dass das schon die ganze Begrüßung war. Er legt den Rucksack im Flur ab und geht weiter, die Mutter ist in der Küche. Schmeißten Rucksack uffe Rischla und gieht weiter, weil Mamalka inne Kiche is – das würde Josef denken, gefragt, was er tut, als er den Rucksack hinwirft. Er wäre auch fähig zu denken, dass er den Rucksack hinwirft, und dabei die Wortendungen mit linkischer Sorgfalt auszusprechen. In dieser Sprache sind die Zeitungen, die er von Kind auf liest. Hat das irgendeine Bedeutung? Keine und eine riesengroße, so wie alles.
Überschwänglich begrüßt er die Mutter.
«Woas is denn Voater so beese, Mama?»
«Weilst so tumme Fragen stellst.»
«Warum dumm?»
«Jes’s, warum se nich in der Grube nich sind? Weeßt du doas ock nich? Hast du’s im Krieg vergessa? Gibt es vielleicht im Haus un uf dem Feld nichs zu tun?»
Josef ist bedrückt, eingeschüchtert vom Wortschwall der Mutter, genau wie er von den Flüchen des Feldwebels eingeschüchtert war.
«Deshalb hoot Voater dem Steiger finf Mark uff die Schipp gedrickt un neo machen se an der Hitte.»
«Dann esse ich nur un gehe zu ihnen.»
«Jo, genau, Sehnchen, geh zu ihnen, geh.»
Mama tut ihm Kartoffeln auf, ein hartgekochtes Ei, fischt ein Stück Speck mit Schwarte aus dem Topf. Darüber gießt sie Josef einen Teller Żurek. Ordentlich viel.
«Das ist eine Suppe, Mamulka», freut sich Josef.
«Na, da is mir der Sohn aus dem Krieg rem», erwidert die Mutter, stolz auf ihre Umsicht.
Der kräftige Mischling mit Zügen des Deutschen Schäferhunds und des Terriers ruht im Schatten aus, und das Erste löst sich langsam in seinem Hundeblut auf. Das Erste und das Zweite wimmern im Unterholz, rufen nach der Mutter. Bald werden sie damit aufhören.
Der alte Magnor repariert die Tür des Schweinestalls. Der Haken an der Tür ist abgegangen, weil das Brett morsch geworden war. Der alte Magnor überlegt, ob er das ganze Brett austauschen oder nur den Haken neu festnageln soll.
«Herrgott hilf», sagt Josef, wie man sagen soll, wenn man jemanden bei der Arbeit antrifft, sogar wenn man Gott im flandrischen Morast zurückgelassen hat, denn was man sagen soll, ist stärker als das, woran man glaubt oder nicht.
«Gebe der Herrgott», antwortet der Vater automatisch.
«Soll ich euch vielleicht helfa?», fragt Josef, und er weiß das nicht, doch hört er das furchtbare Rauschen des beginnenden Artillerieangriffs nicht mehr, eine Sekunde vor den ersten Einschlägen der Mörsergranaten, der Haubitzen- und Kanonengeschosse.
«Raus hier», knurrt der Vater, aber er verjagt Josef dann doch nicht.
Josef wundert sich, dass der Vater dem Steiger fünf Mark auf die Schippe gegeben hat, um den Haken an der Tür des Schweinestalls zu reparieren. Er wagt nicht zu fragen. Der Vater geht in den Stall, wühlt in einem Haufen Gerümpel, schließlich wählt er ein Stück Brett aus, das ihm passend erscheint. Josef hält das Brett, während der Vater es auf die richtige Länge absägt, dann hält er Brett und Tür fest, während der Vater es festnagelt.
4.
1870, 1903, 1904, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1941
Aus dem Nirgendwo kommt ihr auf die Welt. Es gibt euch überhaupt nicht, und dann quillt aus dem in den Schoß des Frauenleibes gespritzten Samen etwas auf, das später ihr werdet, und plötzlich seid ihr schon und werdet mit jedem Augenblick mehr. So kam Josef auf die Welt, so später seine Söhne Ernst und Alfred und die Tochter Elfrieda und dann Ernsts Tochter Natalia und ihr Sohn Nikodem. So taucht ihr alle auf und verschwindet plötzlich, so tauchte auch Caroline Ebersbach auf, tauchte auf im Schoß ihrer Mutter, eine Viertelstunde nachdem Carolines leiblicher Vater den Dienstboteneingang hinter sich geschlossen hatte und diskret aus der Villa an der Kreidelstraße 23 in Gleiwitz, O.S., verschwunden war.
Das Haus hat romantische Türmchen und Zierschornsteine, einen Balkon und eine Fassade aus rotem Klinker, weißes Bossenwerk und einen schönen Garten. In dem Haus wohnt der Richter am Bezirksgericht, Dr. Paul Huth. Hier wohnt auch ein gewisser Luschowski mit seinem Sohn, der eine Holzhandelsfirma hat. Und hier wohnt die Familie Ebersbach. Es ist das Jahr 1904 und März, der Kaiser hat soeben seine Ansprache an das Volk auf der von Edison erfundenen Wachswalze aufgenommen. In Baltimore sind vor kurzem eintausendfünfhundert Häuser bei einem Großbrand zerstört worden. In Deutsch-Südwestafrika brach der Herero-Aufstand los. Noch bevor Caroline auf die Welt kommt, wird der tapfere General Lothar von Trotha die Schwarzen in der Schlacht bei Waterberg schlagen, wird sie in die Wüste Omaheke treiben, wo sie verdursten, Männer, Frauen, geborene und ungeborene Kinder, sterben werden sie und vertrocknen wie Mumien in dieser Wüste Omaheke, dort, wo sich nicht einmal die Löwen oder Hyänen hin verirren, auch keine anderen Tiere, die ihre Leichen verschleppen könnten, und so bleiben sie dort liegen. Vertrocknete Kinder an vertrockneten Brüsten, die vertrockneten, geschrumpften Lippen der Frauen weggedorrt von den Zähnen. Der tapfere General Lothar von Trotha wird ebenfalls sterben, aber erst im Jahr 1920: an Bauchtyphus; winden wird er sich auf dem Bett, als zerrten die Geister der vertrockneten Schwarzen an ihm, doch keine Geister werden da sein, von allein wird sein Leib zucken, und was von Trotha übrig bleibt, wird den längst nicht mehr existierenden Einheiten Befehle erteilen, wird längst gestorbene Adjutanten verfluchen, Ordonnanzen beschimpfen und am Ende nur noch schreien vor Entsetzen bei jedem Gedanken an die vertrockneten schwarzen Männer, Frauen, Kinder, Hunde und Vieh.
Im Jahre 1903 verschwindet der Liebhaber von Carolines Mutter diskret durch den Dienstboteneingang. Frau Dolores Ebersbach liegt im Bett, das Bett kühlt aus und trocknet. Der Samen, den der Geliebte in Frau Ebersbachs Schoß abgelegt hat, keimt gerade und geht auf, bis er schließlich Menschengestalt annimmt, die sich mit dem Gesäß nach unten dreht, dem Doktor gelingt es nicht, die noch namenlose Caroline durch die Bauchdecke zu drehen, sodass sie in Steißlage geboren wurde, die Geburt wird sehr schwer sein und Frau Ebersbach beinahe umbringen. Rehe bringen ihre Kitze leichter zur Welt.
Die Mutter wird Caroline hassen für diese Geburt, aber auch die Rehmütter hassen manchmal ihre Neugeborenen und verlassen sie. Die Mutter wird die neugeborene Caroline nicht verlassen, weil sie nicht kann. Wenn sie könnte, hätte sie es getan.
Doch Caroline ist aus gutem Hause. In guten Häusern werden die Kinder nicht weggegeben, sondern nur gehasst, manchmal. Caroline Ebersbach ist aus dem Haus ganz am Ende der Kreidelstraße, gleich hinter dem Stadtpark, aus dem Haus mit den Türmchen.
Caroline ist nicht klug. Caroline ist nicht dumm. Caroline ist. Brav sitzt sie beim Unterricht am Gymnasium, die Hände auf der Schulbank. Brav überhört sie, was der Lehrer sagt, und brav bekommt sie schlechte Noten.
«Caroline ist nicht klug, aber dafür gut erzogen», sagt die Mutter zu ihrem Mann, der nicht Carolines Vater ist. Carolines Vater ist ein Mann, den Carolines Mutter einmal geliebt hat, der sie aber bald für eine andere Geliebte verlassen hat. Der Mann von Carolines Mutter weiß nicht, dass er nicht Carolines Vater ist. Carolines Vater weiß, dass er ihr Vater ist, aber das ist ihm egal, denn er hat Carolines Mutter nie geliebt, nur kopuliert mit ihr. Auch dafür hasst Frau Ebersbach ihre Tochter, dass ihr Geliebter sie verlassen hat, und dafür, dass Caroline dem Geliebten ganz egal ist, und dafür, dass sie im Leben nur ihn geliebt hat und er sie nicht, weder früher noch danach, und Frau Ebersbach weiß das sehr gut und hasst dafür ihre Caroline.
Caroline glaubt, ihr Vater sei der Mann ihrer Mutter, und wird nie erfahren, dass ihr Vater jemand anders ist. Caroline ist sich nicht bewusst, dass ihre Mutter sie hasst. Außer dem Hass hat Frau Ebersbach nämlich auch eine gewisse Art von Liebe zur Tochter in sich entwickelt, denn das erwartete die ganze Welt von ihr – und Caroline bemerkt diese Liebe.
Verschlungen sind die Wege der menschlichen Liebe. Verworrener als die Wege der Rehliebe und der Baumliebe. Alle aber führen an den gleichen Ort, zur Erde. Alles, was lebt, ist nur das Pulsieren der Erde.
Caroline sitzt brav beim Mittag, Kleid mit Matrosenkragen, die Schultern gerade, die Ellbogen eng. Es ist August. Im nahegelegenen städtischen Casino an der Kreidelstraße 16 herrscht Euphorie: Endlich ist Krieg! Burgfrieden! Die SPD hat für die Kriegskredite gestimmt! Die Bajonette der Infanteristen vom ersten Niederschlesischen sind mit Blumen geschmückt. Jüdische Bürger, katholische Bürger und protestantische Bürger freuen sich gemeinsam. Heute sind wir alle Deutsche. Nieder mit Frankreich!
Caroline bekommt Zeichenunterricht. Es ist das Jahr 1917. Der Geist von 1914 ist längst verflogen. Der Zeichenlehrer wollte einmal Künstler werden, er hat in Wien studiert, doch statt Künstler zu sein, bringt er nun Bürgerstöchtern das Zeichnen bei. Der Zeichenlehrer hasst Caroline dafür, dass er kein Künstler, sondern nur Herr Zeichenlehrer ist. Dem Herrn Lehrer gefallen Carolines Knie.
Caroline füttert den Kanarienvogel. Der Kanarienvogel ist ein Kanarengirlitz, doch das weiß er nicht. Caroline weiß, dass der Kanarienvogel ein Girlitz ist, aber sie weiß nicht, was das bedeutet, also weiß sie auch nicht viel mehr als der Kanarienvogel.
Caroline hat den Kanarienvogel Wilhelm getauft, zu Ehren des Kaisers, aber dem Papa sagt sie nichts davon, er würde das nicht billigen. Der Kanarienvogel steckt seinen Kopf zwischen die Gitterstäbe, er zappelt, kriegt den Kopf nicht mehr heraus und stirbt.
Caroline beerdigt den Kanarienvogel im Garten, vergießt keine einzige Träne und wird für den Tod des Kanarienvogels ihren Vater hassen, auch wenn der gar nichts dafür kann. Caroline wird einige Jahre später sterben, lange vor dem Kaiser, wird eines ähnlichen Todes sterben wie der Kanari. Beerdigen wird man sie auf dem Friedhof in der Kleinen Feldstraße, ein weißer, jungfräulicher Sarg, ein bescheidener Grabstein, wenige Menschen und die Luft schwer von männlichem Zorn, von Rachedurst und jenem spezifisch weiblichen Groll, der zugleich Vorwurf gegen die Männer ist.
«Warum tut ihr nichts, seid ihr keine Männer?», sagt dieser weibliche Groll.
In den Männern wächst der Zorn.
«Zeigt, zu was ihr fähig seid. Nehmt die Waffe und tut etwas, sonst habt ihr unsere Körper nicht verdient, sonst lassen wir euch nicht in uns eintauchen», sagt der weibliche Groll.
Die Frauen sprechen diese Worte niemals aus, was sie sagen, ist das genaue Gegenteil. Doch die Männer hören gerade diese, von weiblichem Zorn und weiblichen Körpern ausgesprochenen Worte, hören sie deutlich.
Der Kaiser wird vierundzwanzig Jahre nach dem Kanarienvogel sterben, an einer Lungenembolie, und wird in Doorn begraben, in Holland, es wird eine militärische Beisetzung sein, bescheiden, nebeneinander herschreiten werden: der greise Marschall Mackensen in alter Husarenuniform aus dem Ersten Weltkrieg, Admiral Canaris in neuer Admiralsuniform aus dem Zweiten Weltkrieg und Reichskommissar Seyß-Inquart in der Uniform des Reichskommissars für Holland. Niemand wird nach Rache dürsten. Mackensen wird sich fragen, was die Erde mit dem Kaiser noch verschlingen wird: Preußen, das Reich, ganz Deutschland? Canaris wird an die Koalition denken. Seyß-Inquart an seine Geliebte.
Caroline nimmt brav Klavierunterricht. Für Elise, klimprig, langsam. Das sind Arpeggios. Der Herr Lehrer berührt diskret ihre Unterarme, damit sie die Handgelenke hebt. Legato, Caroline. Legato. Caroline gefällt die Berührung des Herrn Lehrers. Es ist das Jahr 1918. Der Klavierlehrer ist neunzehn, Freibauernsohn aus Lubomia bei Raciborz, aber unter die Leute gekommen, so sagt Carolines Vater, unter die Leute gekommen, auch wenn seinem Deutsch noch ein Anflug von hartem, slawischem Akzent anzumerken ist, aber er hat es zu was gebracht, sagt Carolines Vater zu Carolines Mutter, wenn sie abends gemeinsam Bücher im Salon lesen.
Caroline bekommt Zeichenunterricht. Der Herr Zeichenlehrer hasst Caroline dafür, dass er kein Künstler ist. Der Herr Zeichenlehrer will, dass Caroline weiß, was er von ihr hält, und macht ihr das auf raffinierte Weise klar: in des Herrn Zeichenlehrers Augen ist Caroline ein wertloses Menschentier, die Fähigkeit zu zeichnen wird ihr nie etwas nützen, denn ihre einzige Pflicht und ihr Lebensziel ist es zu heiraten, die Beine breit zu machen, den Mann in sich aufzunehmen, Kinder zu gebären und aufzuziehen. Besonders den letzten Teil dieser Botschaft maskiert der Herr Zeichenlehrer mit Anspielungen, die für eine Vierzehnjährige unverständlich sind, und dennoch dringt etwas durch diese Anspielungen zu ihr.
Caroline zeichnet Stillleben, sie konstruiert Perspektiven, der Herr Zeichenlehrer steht hinter ihr, legt ihr die Hand auf den Nacken und drückt zu, nicht sehr fest, aber er drückt zu und hält sie. Wie einen Gegenstand. Caroline erstarrt, aber sie zeichnet weiter.
Caroline sitzt brav beim Mittag, die Ellbogen eng, das Dienstmädchen stellt die Terrine mit Hühnerbrühe auf den Tisch, Caroline schiebt geräuschvoll ihren Stuhl zurück, greift nach der Terrine und schüttet die Brühe über den Mann, den sie für ihren Vater hält, dann setzt sie sich wieder und presst die Ellbogen an die Seiten, die Schultern gerade. Herr Ebersbach, den Caroline für ihren Vater hält, schreit und reißt sich die kochend heißen Sachen vom Leib.
Caroline hat Probleme, sagt Carolines Mutter zu ihrem Mann, als sie allein sind. Herr Ebersbach hat sich den Bauch, die Genitalien und die Oberschenkel verbrüht, die Haut ist gerötet, doch ohne Brandblasen. Das wird rasch heilen. Carolines Mutter schmiert die Oberschenkel ihres Mannes mit Doktor-Trommler-Salbe ein. Herr Ebersbach ist erregt. Frau Ebersbach schmiert die Genitalien ihres Mannes mit Doktor-Trommler-Salbe ein. Bei Herrn Ebersbach gewinnt die Erregung Oberhand, und sein Penis wird steif, was nicht häufig vorkommt. Frau Ebersbach jedoch ist vom Blutandrang in den Schwellkörpern ihres Mannes nicht erfreut. Empört springt sie von Herrn Ebersbach weg. Sie ekelt sich vor seinem Penis.
Herr Ebersbach denkt hasserfüllt an seine Frau. Er hätte gern eine Geliebte, weiß aber nicht, wie er eine finden soll, er ist weder gut aussehend noch reich, auch kein Draufgänger, also geht er manchmal ins Bordell, aber selten, denn das kostet Geld und macht nicht so viel Spaß, wie Herr Ebersbach gern hätte. Aber manchmal geht er. Zweimal im Jahr, und zwar in Breslau, denn in Gleiwitz gibt es keins, dort gibt es nur Heimarbeiterinnen, und die sind teurer und riskant.
Frau Ebersbach sehnt sich nach ihrem früheren Geliebten, denn sie liebt ihn noch immer. Und weil sie stärker ist als ihr Mann, verweigert sie ihm seit Jahren die ehelichen Pflichten, er wiederum weiß nicht, wie er sie durchsetzen könnte, also schlafen Herr und Frau Ebersbach überhaupt nicht miteinander, na und, hat das eine Bedeutung?
Frau Ebersbach geht mit Caroline zum Doktor. Doktor von Kunowski, Psychiater, untersucht sie. Stellt ihr Fragen. Horcht den Brustkorb ab. Misst den Puls. Schaut ihr in den Rachen. In die Ohren. Die Nase. Heißt sie sich hinlegen und starr in eine andere Richtung blicken, fährt mit der Hand zwischen Carolins Schenkel und stellt fest, dass Caroline Jungfrau ist. Die Mutter sitzt daneben und verdreht empört die Augen, was denkt er von ihrer Tochter, schließlich sind sie nicht irgendwer. Doktor von Kunowski empfindet keine sexuelle Erregung, als er die Hand zwischen Carolines Schenkel und weiter schiebt. Caroline empfindet sexuelle Erregung, weiß aber nicht, was dieses Vergnügen ist, ein Vergnügen verbunden mit einem Begehren, das sie spürt, ohne zu wissen, was sie da begehrt. Doktor von Kunowski wird Caroline nicht mehr begegnen, dagegen wird Josef Magnor ihm begegnen, später, und keiner wird sich bewusst sein, was sie verbindet, und selbst wenn sie es wüssten, würden sie über diesen Zufall nur die Schultern zucken, denn allein ich weiß, es gibt keine Zufälle.
Caroline spricht mit einer Schulkameradin. Die Kameradin weiß besser, was das für ein Vergnügen ist, und was Caroline begehrt, weiß sie auch besser, weil sie älter und auf einem Dorf bei Kreuzberg aufgewachsen ist, wo die Sitten etwas lockerer als im Gleiwitzer Kleinbürgertum waren, auch wenn es ein protestantisches Dorf war. Die Kameradin heißt Anna, Nachname Piontek, doch das hat keine Bedeutung. Und hat doch Bedeutung, wie alles andere. Die Kameradin erklärt Caroline, welche Art von Vergnügen sie empfunden hat, als Dr. von Kunowski sie untersuchte.
Caroline bekommt Klavierunterricht. Der Flügel steht im Spielzimmer. Der Vater macht ein Nickerchen in seinem Kabinett, nach zwei Bieren auf das Mittagessen, die Mutter, im Salon, liest einen Liebesroman. Caroline ergreift die Hand ihres Lehrers, der schaut sie überrascht an, zieht die Hand aber nicht zurück, denn er liebt Caroline seit langem. Caroline schiebt mit der Linken ihren Rock hoch, legt die Hand des Klavierlehrers auf ihren von zartem Haar bedeckten Schoß. Caroline trägt altmodische Unterwäsche mit offenem Schritt, denn Frau Ebersbach ist altmodisch und meint, Höschen mit vernähtem Schoß trügen ausschließlich Prostituierte. Der Herr Klavierlehrer fährt entsetzt hoch. Caroline bedeckt die nackten Knie mit dem Rock und erlebt zum ersten Mal im Leben die brennend schmerzhafte Erniedrigung, abgewiesen zu werden.
Caroline hat gerade etwas sehr Wichtiges gelernt, weiß das aber nicht.
«Ich bin hässlich», sagt sie, denn so viel zumindest folgt aus dem, was Anna ihr beibringen konnte, die ältere Kameradin, die gesagt hat, jeder Mann habe jederzeit Lust, die Finger oder das Glied zwischen die Beine der Frau zu schieben, und keiner würde ablehnen, wenn man ihn nur auffordert, es sei denn, die Frau wäre hässlich oder alt. Dass sie nicht alt ist, weiß Caroline.
«Nein, Fräulein …», flüstert erschrocken der Herr Klavierlehrer, der nie mit einem Mädchen verkehrt hat, also auch nicht weiß, was er tun soll, außerdem ist er arm und braucht die Mark, die ihm Carolines Vater zweimal die Woche zahlt, er braucht keine Pistolenkugel und keine Schlägerei, auch kein Gefängnis, das ihm je nach Laune des Hausherrn drohen würde, wenn man ihn beim Berühren von Caroline erwischen würde. Der Herr Klavierlehrer liebt Caroline und versteht mehr oder weniger, was Lieben heißt, denn er hat diverse Liebesromane gelesen, aber er liebt sie nicht so sehr, um sein Leben für sie zu geben, geschweige auf das wöchentliche Einkommen zu verzichten. Erschrocken setzt er sich wieder auf seinen Stuhl, und sie gehen an die gerade geübte Sonatine zurück. Caroline spielt gut, trotz des brennenden Schmerzes der Zurückweisung. Legato. Und so spielen wir das Arpeggio. Na bitte.
Der Herr Klavierlehrer heißt Jan, zu Hause sagen sie Hanys oder Jōnek zu ihm, aber bei Caroline zu Hause hat er sich als Hans vorgestellt, Hans Kletschka.
«Legato, die Handgelenke höher halten, Fräulein!»