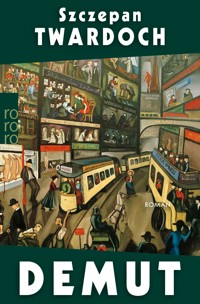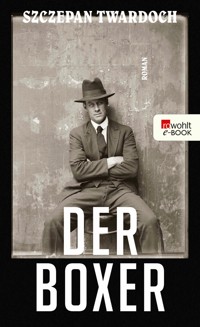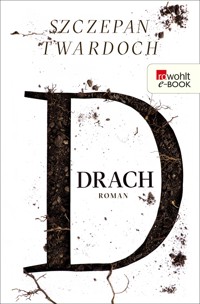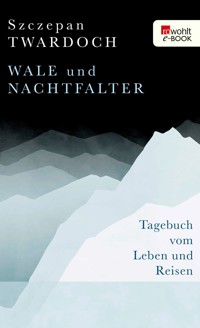
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wale und Nachtfalter" ist ein außergewöhnliches Denk- und Reisetagebuch. Große Erzählkunst – und zugleich ein lebenspralles Bild unserer Zeit. Szczepan Twardoch schreibt nicht nur aufregende Romane, sondern beobachtet die Welt intensiv, mit allen Sinnen und in unterschiedlichen Rollen: als Autor, als Vater und als Reisender in abenteuerlichen Weltgegenden. Sehr persönlich und stilistisch glänzend erzählt er von Krakau und Warschau, von Deutschland und seinen Autobahnen; vom Aufwachsen seiner Kinder; von Ernst Jüngers Haus in Wilflingen oder, ein Höhepunkt des Buchs, vom exotisch kargen Spitzbergen, dem seit langem großpolitisch begehrten Archipel im hohen Norden, wo sich die Dramen der menschlichen Existenz wie unter einem eisigen Brennglas zeigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Szczepan Twardoch
Wale und Nachtfalter
Tagebuch vom Leben und Reisen
Über dieses Buch
Szczepan Twardoch schreibt nicht nur aufregende Romane, sondern ist auch ein großartiger Beobachter der Welt um ihn herum – die er intensiv, mit allen Sinnen und in ganz unterschiedlichen Rollen erlebt: als Autor, als Vater und nicht zuletzt als begeisterter Reisender, der in abenteuerlichen Weltgegenden die Grenzen des Menschlichen erkundet. Über all das erzählt er in seinem sehr persönlichen, stilistisch glänzenden Tagebuch. Da gibt es treffende, schöne Beobachtungen aus dem Leben, zum Aufwachsen seiner Kinder. Geistesblitze, Pointen zu Krakau, Warschau, zu Deutschland und seinen Autobahnen. Twardoch schreibt über Literatur und Kunst; bei einem Besuch von Ernst Jüngers Haus in Wilflingen denkt er über Augenblick und Ewigkeit nach. Und da sind die Reisen selbst. Höhepunkt ist ein Aufenthalt im exotisch kargen Spitzbergen, dem seit Jahrzehnten großpolitisch heißbegehrten, dabei lebensfeindlichen Archipel im hohen Norden, auf dem sich die Dramen der menschlichen Existenz wie unter einem eisigen Brennglas zeigen.
«Wale und Nachtfalter» ist ein außergewöhnliches Denk- und Reisetagebuch. Große Erzählkunst – und zugleich ein augenöffnendes, lebenspralles Bild unserer Zeit und ihrer Verhältnisse.
Vita
Szczepan Twardoch, geboren 1979, ist einer der herausragenden Autoren der polnischen Gegenwartsliteratur. Mit «Morphin» (2012) gelang ihm der Durchbruch, das Buch wurde mit dem Polityka-Passport-Preis ausgezeichnet, Kritik und Leser waren begeistert. Für den ebenfalls hochgelobten Roman «Drach» wurden Twardoch und sein Übersetzer Olaf Kühl 2016 mit dem Brücke Berlin Preis geehrt. Bei polnischen Lesern wie Kritikern übertraf «Der Boxer» diese Erfolge sogar noch. Szczepan Twardoch lebt mit seiner Familie in Pilchowice/Schlesien.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg bei Reinbek, Mai 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Die polnische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel «Wieloryby i ćmy» bei Wydawnictwo Literackie, Krakau
Copyright © 2015 by Szczepan Twardoch
Copyright © 2015 by Wydawnictwo Literackie, Krakau
All rights reserved
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung Eve Sand
ISBN 978-3-644-10090-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
2007
Mein Sohn liegt da, mit weit geöffneten blauen Augen, aus denen er schaut, obwohl er angeblich nichts sieht. Mit kleinen Händchen schiebt er die Welt vor seiner Nase beiseite, schließt und öffnet die Finger, dünn wie die eines Frosches. Ich stehe über ihm, und er nimmt mich nicht wahr, und mir kommt es vor, als verberge sich in seinem ungereiften Gehirn ein Geheimnis.
Als gäbe es Platons Anamnesis aus dem Phaidon wirklich und als hätte Origenes recht – es kommt mir vor, als erlerne mein kleiner Sohn die neue Welt noch nicht, sondern vergesse gerade erst, was seine Seele, erschaffen am Uranfang der Zeiten, längst weiß.
Ich verstehe sogar, warum er noch nicht sprechen kann – er muss erst vergessen, was er weiß, denn diese Dinge sind zu groß für Worte. Deshalb blickt er nur blind, verschiebt die Welt mit kleinen Händen, öffnet und ballt die Fäuste, biegt die Handgelenke wie eine indische Tänzerin.
Er muss alles vergessen, bevor er das erste Wort ausspricht, bevor er die erste Initiation durchmacht, die schmerzhafteste von allen – die Schwelle zum Bewusstsein der eigenen Existenz. Danach wird er mühsam, wie wir alle, die Wahrheit neu entdecken, wird den Vorhang heben von dem, was seit jeher in seiner Seele steckt.
Aber noch weiß er dies alles. In seiner kleinen, zerbrechlichen Existenz ist er geweiht, mein kleiner Bodhi mit der Tigermütze.
Die Gnosis, selbst wenn sie nicht zur wahren Natur der Welt führt, kann uns anrühren; ob es falsch oder richtig ist, spielt keine Rolle.
2008
Man schläft, schlief unter freiem Himmel, und wird wach, erwacht sehr früh, weit entfernt von den Städten, im Spätsommer, im August oder Anfang September, wenn die Nächte kalt sind.
Die Sonne scheint bereits, der Tag steht schon beinah in voller Größe, doch die Luft ist noch kühl, das Licht von scharf weißer Färbung. Auf dem Schlafsack sammelt sich Tau. Aus der Asche kringelt sich ein immer dünner werdender Rauchfaden in die Luft. Es ist kalt, wir sind hoch in den Bergen.
Ich habe Kopfschmerzen, schaue auf die Uhr, es ist fünf. Vor mir geht die sibirische Taiga in die mongolische Steppe über.
Gestern war die Wasseroberfläche klar, heute furcht schwacher Wellengang den weißgrauen Teppich. Ich gehe näher hin, bin sehr neugierig, habe aber ein wenig Angst.
Auf dem Wasser schaukeln tote Nachtfalter, groß und fingerdick, sie bedecken die Wasserfläche wie ein weißer Pelz, ihre Flügel weit ausgebreitet.
Ich setze mich ans Ufer, stecke mir die erste Zigarette an, schaue auf die schaukelnden Falter und denke an den Geschmack der eiskalten, dunkelroten Äpfel, gepflückt im Garten meines Großvaters an einem Morgen nach der ersten wirklich kühlen Oktobernacht.
In den Nächten gehe ich spazieren. Ein paar Kilometer, sechs, manchmal sieben, eine Stunde oder länger. Rasch, aber kein Lauf, ein Marsch, um elf gehe ich los, die leere Straße hinunter, nur am Kreuzweg lehnen einige Halbwüchsige am Kühlergrill eines alten Vectra, sie rauchen und sagen «guten Abend», leicht verlegen. Vom Asphalt komme ich auf den Schotterweg und gehe über die Felder, die sich zwischen Pilchowice und Stanica hinziehen.
Vor Mitternacht erreiche ich den Unterstand, an dem tagsüber hitzemüde Radfahrer rasten. Vor mir blinken die drei Reihen roter Lichter der gut zehn Kilometer entfernten Schornsteine des Kraftwerks von Rybnik. Unter diesen rot-weiß gestreiften Türmen habe ich Anfang der neunziger Jahre segeln gelernt.
Ich schaue nach Nordosten, am Horizont blinken schlierig orange die dichten Lichter der Stadt, ebenso weit entfernt wie die Schornsteine von Rybnik, dahinter glüht grün wie ein großer Leuchtkäfer das Neonlicht der Tankstelle am Stadtrand, kaum erkennbar, und darüber, am nächtlich hellen Himmel, wächst eine große Wolke empor, ein Cumulonimbus mit einem Fuß wie eine Muschel. Matt orange ist sie, angestrahlt vom Lichterglanz der Zweimillionen-Metropolregion, so wie der Rest der Wolken an diesem blassen, hellen Himmel – denn es ist ein städtischer Himmel, auch wenn rings um mich her nur Feld und Wald sind, wo ich mit meinen Schritten die Rehe aufgescheucht habe; nach irrem, kurzem Galopp sind sie im Gestrüpp verschwunden. Von der Wolke her kommt ein stärker werdender Wind, ich spüre ihn an den Armen und im Nacken, angekündigt vom raschelnden Laub des Zisterzienserwaldes, der sich hinter mir zwanzig Kilometer weit nach Westen erstreckt, bis nach Racibórz. Das Rascheln wird lauter, der Wald rauscht wie ein Fluss. Ich drehe mich um. Über den Bäumen kriechen die Wolken am Himmel entlang und verschlucken die Sterne. Nur über den Schornsteinen von Rybnik leuchtet noch der Sirius. Das Wehen wird heftiger.
Das Rauschen des Windes dringt durch die Kopfhörer. Der Sprecher moduliert seine beunruhigende Stimme, er spielt den Wortwechsel zwischen dem Jungen und dem Mann mehr, als dass er ihn liest, sein Englisch ist überraschend deutlich, vorzüglich artikuliert. Ich hatte Cormac McCarthys Die Straße zuvor in der ausgezeichneten Übersetzung von Robert Sudoł gelesen. Jetzt höre ich das englische Original, und es kommt mir stärker vor, McCarthys kurze Sätze klingen besser im Englischen mit seiner einfacheren Grammatik. Das Buch setzt natürlich auf elementarste Emotionen, vielleicht gar auf Instinkte, doch warum sollte das seinen Wert schmälern? Die Literatur muss das Wichtigste berühren, und McCarthy, der erzählt, wie ein Vater und sein Kind nach der Apokalypse durch die Welt gehen, schreibt über dieses Wichtigste: schreibt vom bedingungslosen Menschsein, vom Zweifel, von der Feigheit, von Tod und Liebe, vom Willen zum Überleben. Und zugleich ist sein Buch, was Literatur sein soll: eine Geschichte, die – wenn man sie in der Nacht hört – Angst macht. Immer wieder muss ich mich umdrehen wie ein Idiot und über meine Schulter blicken, wenn Stiefelsohlen auf dem Kies knirschen und der Sprecher von einem Keller liest, den Kannibalen in eine Speisekammer voller Menschenfleisch verwandelt haben.
Wenige Stunden zuvor war mein Sohn auf meinem Schoß eingeschlafen. Der kleine, in einen bunt gestreiften Anzug gekleidete Körper, das Köpfchen in meiner Ellbogenbeuge, die winzige Hand presst meine Finger zusammen. Ruhig liegt er da und fährt nur manchmal abrupt auf, wenn der Schmerz von den durchs Zahnfleisch dringenden Zähnen in sein noch krabbelndes Bewusstsein dringt. Dann weint er einen Augenblick, strafft sich und wird still. Er hat große Füße mit hohem Spann und kurzen Zehen, so wie ich.
Wie soll man reisen? Bronisław Malinowski schreibt am Anfang seiner Argonauten des westlichen Pazifik, es gebe zwei Möglichkeiten, fremde Welten und Kulturen kennenzulernen. Einmal, wenn der Aufenthalt in dem Land nicht allzu lange dauert, denn dann verstellt das Übermaß der Details uns nicht den Blick auf das Ganze; und dann, wenn man die Kultur endgültig durchdrungen hat und eine glaubwürdige Zusammenschau der gesammelten Beobachtungen wagen kann.
Dadurch habe ich vor einiger Zeit begriffen, dass ich trotz der nicht erlöschenden Faszination, trotz meiner Lektüren und Besuche nicht viel zum Thema Russland zu sagen habe. Es fällt mir leicht, die dümmlich-trüben, bei polnischen Journalisten verbreiteten Ammenmärchen vom «finsteren Imperium» sowie von den «ewig betrunkenen Russen mit der Ziehharmonika» zu widerlegen, und ich kann auch über den Versuch lachen, die polnischen Minderwertigkeitskomplexe damit zu heilen, sich den «russischen Kalmücken» gegenüber zivilisatorisch überlegen zu fühlen, aber wenn ich versuchen sollte, Russland zu erklären, weiß ich nichts zu sagen. Ich könnte die Essenz meiner Reisen aufschreiben, dadurch würde der Leser viel über mich erfahren, so gut wie gar nichts aber über Russland, denn ich war, mit Malinowski gesprochen, dort zu lange und gleichzeitig nicht lange genug.
Denn was weiß man von Russland, wenn man es durch die Fenster der Transsibirischen Eisenbahn erfährt?
Ein Internetcafé am Lenin-Denkmal in Irkutsk. Der Genuss der holzgeheizten Dampfsauna nach gut drei Tagen im Zug, mit sibirischem Flusswasser, das nach Birkenrauch und billiger Seife duftet. Japanische Luxusautos mit dem Lenkrad auf der rechten Seite, von denen es am Baikal mehr gibt als die dem Rechtsverkehr angepassten Ladas, Wolgas und UAZs. Kreml, Café Arbat, Puschkin-Denkmal. In Kopftücher und Jacken gehüllte Mütterchen, die an den sibirischen Bahnhöfen, wo die Transsib gerade mal ein paar Minuten hält, heiße Kartoffeln in Alufolie verkaufen, siedendes Wasser aus dem Samowar in jedem Waggon, dazu die Zugbegleiterin, die die Seriosität von Herrschaft und Staat verkörpert.
Das sind nur Klischees, das ist nur ein gespiegeltes, nicht das wahre Russland, ein Russland, wie der polnische Leser es sehen möchte; so echt wie die winzige Moskau-Reklame auf Mobiltelefonen.
Ich habe etwas anderes Russisches gefunden, weit jenseits des Polarkreises, am achtundsiebzigsten Breitengrad. Auf norwegischem Territorium, unter der durch den Pariser Vertrag festgelegten norwegischen Hoheit – in Spitzbergen also, von den Norwegern Svalbard genannt, da sie den Namen «Spitsbergen» der größten Insel des Archipels vorbehalten, was die anderen europäischen Staaten aber wundersam ignorieren.
Der in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts unterzeichnete Vertrag sprach diesen polaren, wenngleich vom Golfstrom erwärmten und deshalb einigermaßen eisfreien Archipel Norwegen zu, unter dem Vorbehalt, dass alle anderen Unterzeichnerstaaten das Recht haben, auf Svalbard jede beliebige Wirtschaftstätigkeit zu betreiben. Das Recht dazu nutzen im Grunde nur die Russen, die die Bergbausiedlung Barentsburg unterhalten – und es war in Barentsburg, dass ich einen Krumen Wahrheit über Russland fand.
Barentsburg war von den Amerikanern und Holländern gegründet worden, in den zwanziger Jahren kaufte der sowjetische Trust Arktikugol die Grundmauern der Siedlung, in den dreißiger Jahren wurde die Kohleförderung begonnen, dann fielen die Geschosse des Panzerkreuzers Tirpitz auf die evakuierte Siedlung, und nach dem Krieg wurde sie in der Form wiederaufgebaut, in der man sie heute sieht. Auf dem Höhepunkt der sowjetischen Präsenz auf Spitzbergen wurde in Barentsburg ein großes Treibhaus betrieben, das einerseits frisches Gemüse lieferte, andererseits den sowjetischen Bergleuten – Russen und Ukrainern aus Donetzk und dem Donbass – als Erholungsort von der kargen Tundralandschaft diente. Es gab Viehställe, Koben und Hühnerställe, eine Bäckerei, ein großes Sportzentrum mit Fußballplatz und Schwimmbecken. Wohnblöcke aus merkwürdig gelbem Ziegelstein. Dieses alte Barentsburg betrachte ich durch das Objektiv des sowjetischen Fotografen, der 1979 in Moskau ein Album mit dem Titel Spicbergen: Das Land der spitzen Berge – strana ostrich gor – veröffentlicht hat. Noch vor dem Ende der Glanzzeit, auf aufsteigender Welle – man sieht Neubauprojekte, die spektakulärsten Gebäude wachsen erst empor, durch die vom Schnee freigefegten kleinen Straßen gehen magere, fröhliche Männer in grellen Jacken oder grauen Mänteln, auf dem Kopf haarige Mützen aus dem Fell sibirischer Hunde. Mein Vater hatte früher genau so eine Mütze, ich erinnere mich, Fotos aus dem Album, aufgenommen noch vor meiner Geburt, aber nicht lange, vielleicht ein Jahr davor. Heute trägt er sie nicht mehr. Und die Männer auf den Fotos tragen Polarbärte oder -schnauzer, ein bisschen zu langes Haar, und die Kinder sind alle, aber wirklich alle, pausbäckig, rotwangig und gesund. Der Grund dafür wird schwerlich in propagandistischer Retusche zu suchen sein, denn von diesen Kindern gibt es auf den Fotos viele, so viele, dass der Fotograf aus der mageren Barentsburger Kinderpopulation gar nicht diese allerschönsten hätte aussuchen können. Vielleicht war es das Polarklima, das den strohblonden Jungs und Mädels mit in große schwarze Schleifen gebundenen Zöpfchen so gut bekam.
Unsere diesjährige Trasse nach Barentsburg führte über die Hänge des Nordhallet entlang einer alten Straße, auf der vor fünfzig Jahren die Gaz-69-Autos bis zur Anlegestelle fuhren, von der man mit der Fähre über die Colesbucht zum Hafen gelangte, der das Bergwerk in Grumant bediente.
Die seit einem halben Jahrhundert unbefahrene Straße ist nur noch eine Spur in der Tundra, an die man sich besser hält, um die tiefsten, von Bächen gegrabenen Hohlwege sicher zu vermeiden – doch ist sie für Autos unbefahrbar, der ewige Frost hat sein Werk getan. Die Brücken über die zum Fjord rinnenden Flüsschen sind längst eingebrochen. Der am Uferbruch über den Strand führende Weg ist verschwunden, das Meer hat ihn weggerissen.
Wir hatten nur kleine Rucksäcke mit, darin Ersatzjacken, ein bisschen Proviant, ein kleiner Gaskocher, wasserdichte Hosen zum Durchqueren der Flüsse. Auf dem Rücken Gewehr und Fotoapparat, beides für die eventuelle Begegnung mit einem Bären, in den Taschen Patronen, Fernglas und Schokolade. Dazu Wanderstöcke, ohne die man in diesem großen Polarsumpf schwer zurechtkommt. Der Rest unseres Dreißigkilogepäcks, das wir zuvor auf dem Rücken geschleppt hatten, war im Lager geblieben, wir waren zu einem Tagesausflug aufgebrochen, gut dreißig Kilometer weit.
Es waren die letzten Augenblicke unserer von mehrtägigen Rastpausen unterbrochenen Wanderung. In zwei Tagen schon sollte uns ein halbfestes Boot der Marke Polarcirkel abholen, wir würden neben dem morschen Kai in Colesbukta an Bord gehen und über den ruhigen Fjord bis Longyear fahren, mit einer Geschwindigkeit von vierzig Knoten nach Longyearben zurückkehren, von wo wir vor zwei Wochen aufgebrochen waren.
An diesem Tag aber, als wir nach Barentsburg gingen, war schönes Wetter, unter den Sohlen gluckerte die Tundra, die bereits feucht und braun geworden war und auf den heraufziehenden Herbst hindeutete, der Himmel war blau, und am anderen Ufer des Isfjord flossen mühsam Gletscher in den Arktischen Ozean, ein ums andere Jahrhundert ihre Täler aushöhlend. Ihre Dutzende Meter hohen Stirnen waren von unserem Ufer aus nur als schmale, graublaue Striche zu erkennen. Wir gingen schnell, denn hier kommt man leicht voran, kein Vergleich mit dem mühevollen Gekraxel über die sumpfige Grundmoräne, dem Erklimmen eines bröckelnden Kliffs durch die Felsrinne oder dem Waten durchs Delta eines Flusses, der in Dutzenden von Bächen, aufgelösten Zöpfen gleich, in den Fjord mündet. Schließlich hielten wir uns an das Gedächtnis des Weges.
Und schließlich, nach sechs Stunden, kamen wir an – erst die Wirtschaftsgebäude, sowjetisches Rohr- und Kabelgewirr, dann der Hubschrauberlandeplatz mit Hangar; um diese Helikopter streiten die Russen mit den umweltbewussten Norwegern. Ein Hubschrauber war unterwegs schräg an uns vorbeigeflogen, ein großer und klobiger Mi-8. Im weiteren Verlauf war die Straße befestigt, an ihr lag ein Friedhof, aber nicht so malerisch wie das Feld weißer Kreuze im norwegischen Longyearbyen, der Hauptstadt Svalbards, auch nicht so dramatisch im Ausdruck wie der in Colesbukta, mit dem Grab eines einjährigen Mädchens, Jahrgang meiner Mutter. Sie war im Mai 1951 geboren und hatte einen tatarischen Vaters- und Nachnamen: Dora Minislawowna Farizowa. Der Vorname mag anders gelautet haben, die Buchstaben waren fast völlig verwittert, aber bestimmt fing er mit D an und war kurz. Das Mädchen hatte den arktischen Sommer überlebt, die Dunkelheit der Polarnacht, es hatte mit dem weichenden Schnee Laufen gelernt und war dann gestorben. Ihre Eltern, der tatarische Vater und die uns unbekannte Mutter, müssen untröstlich gewesen sein, als sie die Grabtafel mit dem Foto des kleinen, mit einer Haube bedeckten Kinderkopfes anfertigten, denn auf den Tod eines Kindes haben weder Allah noch der christliche Gott eine tröstende Antwort, von Marx und Lenin ganz zu schweigen. Davon bin ich überzeugt, denn mein Sohn ist jetzt genauso viele Monate alt wie diese kleine Polar-Tatarin, als sie starb, und ich weiß, dass ich keine Antwort fände, sollte passieren, was ich nicht zu schreiben wage.
Wir kamen an einem Friedhof mit serienmäßig aus Beton gegossenen Grabsteinen vorbei und erreichten am Ende eine Tafel mit dem kyrillisch geschriebenen Namen der Siedlung. Im ersten Augenblick hätte die Stadt menschenleer wirken können, wäre da nicht die feine Rauchfahne gewesen, die aus dem Schornstein des fernen Heizkraftwerks aufstieg.
Man könnte denken, auch hier sei so eine Geschichte passiert wie im hundert Kilometer entfernten Pyramiden, wo im Jahr 1998 russische und ukrainische Bergleute vergeblich nach dem Versorgungsschiff Ausschau hielten, das zu ihnen aus Murmansk kommen sollte.
Es kam keins, denn in Russland war inzwischen das Geld ausgegangen, die Beamten bekamen kein Gehalt, jemand hatte sich gesagt, wenn das neue, nicht mehr rote, sondern dreifarbige Russland ihm nichts mehr zahle, werde er auch nicht mehr am Schreibtisch sitzen. Irgendjemand hatte irgendein Papier nicht unterschrieben, jemand anders hatte mit den Schultern gezuckt, wieder jemand anders ratlos die Arme ausgebreitet. Und so gab es kein Schiff, das sich vom Hafen aus in die Polarnacht aufmachte – weder ein Versorgungsschiff noch eines, das die Bewohner der Siedlung am Pyramidenberg hätte evakuieren können. Es war der 10. Januar, drei Tage nach dem orthodoxen Weihnachtsfest, und auf Spitzbergen herrschte damals absolute Dunkelheit, vierundzwanzig Stunden am Tag. Nicht ein Hauch von Morgendämmerung erhellte den Horizont, das Essen ging zu Ende, nur Kohle war noch da, am Ende entrissen sie sie eigenhändig der gefrorenen Erde, aber Kohle kann man nicht essen. In der Bäckerei fehlte das Mehl, und in den Gewächshäusern wuchsen schon lange keine Tomaten und kein Kohl mehr. Schweine und Hühner waren aufgegessen, die Ställe standen leer. Nur Strom hatten sie noch, das Heizkraftwerk arbeitete einwandfrei, in den Baracken war es warm, Lenins schneebestäubte Büste war durch oranges Laternenlicht vor der Dunkelheit geschützt, die Fernseher empfingen über Satellitenantennen das Moskauer Programm. Die wenigen Kinder hatten großen Hunger, und alle Bewohner der Bergbausiedlung im Polarkreis verstanden sehr gut, was die alte russische Smuta, die Zeit der Wirren, bedeutet.
Und dann fuhr doch ein Schiff in den Hafen ein. Die Norweger im wenige Dutzend Kilometer entfernten Longyearbyen waren zu dem Schluss gekommen, dass sie es nicht zulassen konnten, dass am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts, beinahe vor ihren Augen und ganz gewiss in Reichweite ihrer Funkstation, tausend Russen in gut geheizten und beleuchteten Baracken hungers starben.
Das Schiff ließ eine Motorschaluppe hinab – alles im Licht von Scheinwerfern, die die polare Finsternis zerschnitten, im Krachen des Packeises, das gegen den gepanzerten Schiffsrumpf knirschte. Aus der Schaluppe stiegen Offizielle von Spitzbergen, vielleicht sogar die Frau Sysselmann Ann-Kristin Olsen persönlich, grauhaarig, vierzigjährig, schlank, sehr nordisch, gekleidet in eine blaue, marineartige Uniform oder doch eher in einen warmen Parka mit fellgefütterter Kapuze. Sysselmann ist ein alter nordischer Titel, so etwas wie Woiwode, Sheriff oder Bailiff, nur archaischer im Stil, ausgegraben aus einem verstaubten Wälzer während des Festivals der nationalen Wiedergeburt Norwegens.
Die Schaluppe, mit der Frau Sysselmann oder ohne sie, legte also an, die Norweger drückten den Direktoren des bankrottgehenden Arktikugol die Hände, die Sirene heulte, und die tausend Russen oder Ukrainer ließen alles stehen und liegen. Mütter hüllten ihre hungrigen Kinder in Jacken und Schals, und dann, zusammengedrängt in den Schiffskabinen, aßen sie einfaches und warmes Essen – erniedrigte, doch glückliche Diener eines einst mächtigen Imperiums.
Pyramiden wurde von den Norwegern evakuiert, tausend russische oder ukrainische Bergleute, Dienstfrauen, Ingenieure, Direktoren und Kinder wurden nach Murmansk gebracht. Dort stiegen sie am Ufer des großen Landes aus, das damals nur noch auf der Landkarte existierte, und bestimmt interessierte sich niemand für sie, denn zwei Jahre mussten noch vergehen, bis Wladimir Wladimirowitsch Putin Russland den starken Staat zurückgab – schreibt zumindest Michael Stürmer in seiner Biographie des KGB-Präsidenten. In Pyramiden blieben im Lesesaal Bücher mit eingelegten Lesezeichen auf den Tischen zurück, Gläser in der Bar, ungewaschene Socken neben dem Bett, ein unvollendeter Brief und ein Schachbrett mit einer Partie, die beim vierten Eröffnungszug zum Stillstand gekommen war.
Und das ist nun die Wahrheit – die verlassene Stadt, diese Gläser, Briefe und das Schachbrett. Der ganze Rest nicht unbedingt. Die Geschichte als solche ist interessant, so habe ich sie von einem alten Polar-Kämpen gehört, als ich das erste Mal auf Spitzbergen war, 2006 in Longyearbyen.
Alles an ihr deutet darauf hin, dass sie nicht stimmt.
Es gab vielleicht Versorgungsmängel, ja, aber keine hungrigen Kinder und wohl auch keine norwegischen Schiffe, denn die Russen haben sich – wenngleich in großer Eile – selbst evakuiert. Geblieben ist ein kleines Grüppchen, sie hatten Bulldozer, Sprengstoff und jagten in die Luft, was in die Luft zu jagen in diesem frischen Stadtleichnam ihnen gefiel.
So wie in Józef Mackiewiczs Man darf es nicht laut sagen, wo die Hauptfigur gerührt eine Geschichte erzählt, deren Zeuge sie war – sie hat gesehen, wie ein deutscher Panzerfahrer mit knirschenden Ketten sein Fahrzeug auf dem Pflaster zum Stehen brachte, um ein Eichhörnchen nicht zu überfahren, das auf die Straße gelaufen war. Und die Zuhörer, polnische Patrioten, wenden ein, das dürfe man so nicht erzählen, es solle lieber ein polnischer Panzer sein, ein amerikanischer oder, wenn es gar nicht anders geht, ein sowjetischer, aber es könne doch kein deutscher Panzer sein. Die Hauptfigur wundert sich über die Gesprächspartner wie der Perser von Montesquieu – er merkt schüchtern an, er sei halt Augenzeuge des Ereignisses gewesen und könne nichts dafür, dass der Panzer ein deutscher war. Und wird gerügt: Das sei vielleicht die individuelle, subjektive Wahrheit, ein Ausschnitt; die objektive Wahrheit sei eine andere.
Und genau das ist die Wahrheit der Geschichte mit den hungernden Kindern und der norwegischen Evakuierung – sie ist objektiv im Hegel’schen Sinne und steht im Einklang mit dem Zeitgeist. Genau so eine Geschichte hätte passieren müssen in den Zeiten der Jelzin’schen Wirren, um den Zeitgeist angemessen zum Ausdruck zu bringen; nur hat das offenbar jemand vergessen, und in Wirklichkeit ist eine ebenso dramatische Geschichte passiert – Beweis dafür die unübersehbare Hast, mit der Pyramiden verlassen wurde, nur eben weniger spektakulär.
Man kann, wenn man Barentsburg betritt, gar nicht anders, als an dieses verlassene Pyramiden zu denken, besonders wenn man in den vergangenen Tagen regelmäßig an den Ruinen russischer Gebäude vorbeikam, die noch früher aufgegeben worden waren – wenn auch ohne diese Hast der Wirrezeit. Dort, in der Bucht von Coles, in Grumantbyen, haben die Russen, oder besser die Sowjets, ihre Bauwerke aus wirtschaftlichen Erwägungen aufgegeben – die leicht zugänglichen Kohlevorkommen waren erschöpft, also demontierte man, was sich demontieren ließ, jagte einen Teil der Bauten in die Luft und zog weiter, dorthin, wo die Kohle leichter zu fördern war. Zurück blieben Bäche, rot gefärbt vom Schrott, der in ihren Oberläufen lag und rostete.
Wir kamen also an der Tafel mit der Aufschrift «Баренцбург» vorbei, ich entlud mein Gewehr und öffnete den Verschluss – so wie es Sitte ist, damit jeder Einwohner sieht, dass die Waffe ungefährlich ist. Doch begegneten wir niemandem. Lange gingen wir durch etwas, das an industrielle Vororte erinnerte – zwischen offenen, verrottenden Hangars, in denen eine Hubschrauberstaffel Platz gefunden hätte, zwischen verlassenen Baracken unbekannten Verwendungszwecks und zwischen Stapeln von Müll, von klein wie verbogene Nägel bis groß wie ein halbes Haus, verrostet oder aus Beton, mit den starrenden Stäben stählerner Rüstung. Wir kamen an einem verlassenen Treibhaus vorbei. An die Tür hatte vor Jahren jemand einen Zettel in englischer Sprache geheftet, der Touristen informierte, dass in the greenhouse niemand Englisch oder Norwegisch spricht, falls also jemand das greenhouse besichtigen wolle, solle er ins Hotel gehen und nach einem Führer fragen. Heute ist diese Tür mit Brettern vernagelt, Fenster und Glasdach sind zertrümmert; durch sie sieht man, dass drinnen völlig vertrocknete Reste von Tomatenstauden sich um unversehrte Stäbe ranken und an den unter dem Glasdach aufgespannten Schnüren die erfrorenen Leichen von Kletterpflanzen wie graubraune Leinen hängen.
Dann leere Hühner- und Schweineställe. Nicht einmal die Bäckerei arbeitet mehr, alle Lebensmittel werden, so wie im norwegischen Longyearbyen, vom Kontinent hergebracht – wozu sich abmühen, wenn in Longyearbyen zweimal täglich ein Flugzeug landet? Es folgen abblätternde Wandmalereien mit einer scheckigen Kuh, andere mit Getreidefeldern irgendwo in der großrussischen Ebene, wieder andere mit den Stämmen eines Birkenwaldes. Und alles leer, verlassen – nur an einer Stelle, auf einem von Mineralwolle und Brettern ummantelten Fernwärmerohr, bemerken wir eine Katze. Die Norweger haben die Katzenhaltung auf ganz Svalbard verboten, weil die Tiere angeblich den Vögeln ihre Jungen wegfressen. Dieser Kater, grau und dick, hatte bestimmt schon viele Küken verputzt und schien sich nicht im Geringsten um das vom Sysselmann selbst erlassene Verbot zu scheren. Ohne Menschen hätte er den Winter nicht überlebt, also werden auch die Russen oder Ukrainer, die ihn pflegen, verächtlich mit den Schultern zucken beim Gedanken an den Beamten, der sich einbildet, er könne durch die Veröffentlichung eines Verbots in irgendeinem Amtsblatt die zur Polarnacht verdammten Menschen ihrer Katzengesellschaft berauben – und das wegen einer so trivialen Sache wie Vogelküken. Und für die Möwen, Seeschwalben, Eissturmvögel, Tordalke und Krabbentaucher, von denen in der Saison Hunderttausende über den Kliffen kreisen und einen Heidenlärm machen, der mit nichts auf der Welt zu vergleichen ist, haben die Spitzbergener Bergleute gewiss nicht mehr übrig als für diesen grauen Kater, der sich in polarer Nacht gern an irgendwelchen Knien wärmt.
Und endlich begegnen wir zwei Russinnen. Seltsam sehen sie aus, gehen Hand in Hand in Pumps und eleganten pelzbesetzten Jacken – wir dagegen in schweren, verschlammten Stiefeln, in Goretex und Softshells, Stöcke in der Hand und Waffe auf der Schulter. Die Damen, eine älter, die andere jünger, lachen über diese Stöcke, die wir zum Marschieren einsetzen. Wer hat euch die Skier geklaut?, fragen sie. Wir lachen mit und gehen weiter.
Im Hotel dann norwegische Preise, russische Bedienung, wir trinken Cola und Bier, essen nicht besonders schmackhafte Pelmeni, sogar ohne Borschtsch, auf dem großen Fernsehbildschirm halbnackte Mädchen, jedenfalls tragen sie mehr Schmuck als Kleider, singen und strecken ihre Popos silbernen Porsches, Ferraris und Lamborghinis entgegen, die würdevoll durch Moskaus Straßen gleiten. Es ist warm.
Unweit des Hotels steht das ehemalige sowjetische Konsulat. Auf dem Foto in meinem alten Album ist es grün, herausgeputzt, sozrealistische Klassik, in den Fenstern Gardinen; hätte es ein Fünkchen mehr Charme und würde auf dem Dach nicht die rote Flagge mit Hammer und Sichel wehen, könnte es glatt die unscheinbare Botschaft eines kleinen Staates irgendwo in einem stillen Viertel von Wien oder Warschau sein. Jetzt hat sich alles verändert – das Gebäude ist verlassen, die Treppen zu dem repräsentativen Ort zerfallen. Die leeren Fensterskelette sind beängstigend, die Läden baumeln an herausgerissenen Scharnieren, die Türen sind mit Brettern vernagelt.
Doch hinter dem verlassenen sowjetischen Konsulat steht das neue, russische. Es scheint das einzige Gebäude zu sein, das hier nach dem Zerfall der Sowjetunion neu errichtet wurde. Mit Ausnahme der orthodoxen Kirche, zu der ich gleich komme, sie steht ein Stück weiter. Ein spitzer Lattenzaun, als sollten Droschken vor dem Konsulat halten, auf dem Zaun zweiköpfige Goldadler, das Gebäude selbst modern. Meine Frau ist Architektin und behauptet, das sei, formal gesehen, ganz anständige Architektur, ebenso wie einige andere, ähnliche Gebäude mit gerundeten Ecken, die bestimmt irgendwann Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger gebaut worden sind. Aber auf ein genutztes Gebäude kommen drei verlassene, mit abschreckend zertrümmerten Fensterscheiben – schließlich ist diese Stadt für dreitausend Menschen erbaut worden, jetzt wohnen gerade einmal noch sechshundert darin.
Das sind Dauersporen – ihre einzige Funktion besteht darin, die russische Präsenz auf Spitzbergen zu sichern. Das Bergwerk ist angeblich außer Betrieb, die ganze Arbeit der Bergleute besteht darin, die Geräte, Gebäude und Maschinen zu konservieren. Das orthodoxe Kirchlein ist achtseitig, wie die russischen Gebetstürme der Altgläubigen, die schon im siebzehnten Jahrhundert nach Grumant kamen – wie sie Svalbard damals nannten –, um Walrösser, Bären und Füchse zu jagen. Diese kleine Kirche ist aber in Wirklichkeit kein Sakralbau, sondern ein Denkmal für die Opfer der Flugzeugkatastrophe von 1996. Manchmal kommt ein orthodoxer Priester nach Barentsburg, seine Gottesdienste hält er aber nicht in dieser Scheinkirche ab, sondern woanders.
So viel dazu. Wir kommen aus dem Hotel – es ist zum Lachen, gerade mal gut zehn Tage sind vergangen, und schon hat man Sehnsucht nach zivilisatorischen Errungenschaften wie einer Klobrille, einer Dose Cola und Bier. Ich nehme ein paar Dosen für die Freunde mit, die krank im Lager geblieben sind, wir zahlen die horrende Rechnung, die Ukrainerin an der Bar mustert uns mit berechtigter Belustigung und Verachtung: Sie wird dafür bezahlt, dass sie an diesem furchtbaren Ort lebt, wir haben dafür bezahlt hierherzukommen, haben dazu noch den ganzen Weg von Longyearbyen zu Fuß zurückgelegt, haben in Zelten gefroren, aus Angst vor dem Bären die ganze weiße Nacht lang am Lagerfeuer gewacht – all das will ihr zu Recht nicht in den Kopf, es ist ja auch tatsächlich eine Art dekadenter Perversion, und das schreibe ich hier ganz im Ernst, ohne einen Hauch von Koketterie. Askese ist es ja wohl nicht, dafür kostet das alles zu viel.
Ich ziehe keine Schlüsse. Es gibt keine Schlüsse. Die Konzeptualisierung der gesellschaftlichen oder menschlichen Wirklichkeit ist überhaupt immer die Erfindung dieser Wirklichkeit, und erfinden will ich nichts. Hinter dem, was ich gesehen habe, verbirgt sich nichts, es gibt keine Zeichen der Zeit, es gibt nur ein ausgedehntes Universum des Unerkennbaren.
Wir kehren zurück. In der Spitzbergener Zeitung «Svalbard Posten», die vor Ort geschrieben und redigiert, aber in Tromsø gedruckt und mit dem Flugzeug hergebracht wird, steht viel über die Russen in Barentsburg. Darüber, dass Helikopter für kommerzielle Vorhaben vermietet werden, was absolut verboten ist, weil es die Vögel verschreckt. Darüber, dass Sammlungen des Barentsburger Pomor-Museums nach Longyearbyen gebracht worden seien, um sie eine Zeitlang in einem norwegischen Museum auszustellen. Und zuvor hat in Barentsburg ein Filmfestival stattgefunden, gezeigt wurde Elling aus Norwegen, wie amüsant.
Ich denke an das russisch-tatarische Mädchen, das dreizehn Monate auf Svalbard gelebt hat und dessen kleiner, trauriger Leib jetzt im ewigen Eis ruht.
2009
Ich war mit meinem Sohn unterwegs nach Hause. Nach ganztägigem Schmuddelwetter hatte der Himmel aufgeklart, sogar die Sonne schien, in jenem warmen Farbton, in dem sie an späten Sommerabenden leuchtet. Also gingen wir, sahen uns das helle Blau in den Pfützen an, doch im Rücken hatten wir die Dämmerung und eine näher kommende Woge schwarzer Wolken, und als ich mich umdrehte, sah ich durchscheinende Regenvorhänge daraus hervorbrechen. Sie waren noch weit, aber von diesen dunklen Wolken her wehte ein Wind, ich kenne diese Wolken und diesen Wind gut und weiß, wie rasch sie das mit dem Backstag entfliehende Boot einholen können.
Mein zweijähriger Sohn versteht von alldem nichts. Ich zeige ihm die schreckliche Wolkenfront, er aber hebt nur den Finger und schreit auf seine Art: «Jaaaa!» Der Wind reißt das Gras und Laub des letzten Jahres vom Boden, im nackten Gezweig einer Birke pfeift eine Amsel, pfeift wie verrückt, ganz laut. Als hätte sie Angst.
Wir stehen auf der Veranda, ich öffne die Tür zum Haus. Lerne, Angst zu haben.
Das stille Sterben der Schiffbrüchigen in der Polarnacht: an Hunger, Skorbut oder vergiftet von der Bärenleber, die eine für den Menschen tödliche Dosis Retinol enthält. Oder das laute Sterben, in Gletscherspalten, im Maul eines Bären, im eiskalten Wasser, durch Messer oder Kugeln. Oder der Tod im Hufgedonner, wenn auf den Rücken der niedrigen, stämmigen Moris türkische, mongolische und indoeuropäische Bogenschützen die Steppe durchstreifen, Völker des Xiongnu, Mongolen, Kasachen und Kosaken, Eroberer Pekings und Moskaus, Moslems, Buddhisten, Orthodoxe und jene, die an die Seelen von Tieren und Steinen und Schamanenrituale glauben. Dschingis Khan und Ferdinand Ossendowski, Attila, Arpad und Fjodor Romanowitsch, Baron von Ungern-Sternberg, Suche-Bator und Georgi Konstantinowitsch Schukow, der den Titel «Held der Sowjetunion» zum ersten Mal dafür errang, dass er die Kwantung-Armee am Chalchin-Gol zerschlug, alle zusammen, ihr Schweiß und Urin, vermischt mit dem Urin und Schweiß der Pferde, und dem Blut, das in die trockene Erde sickert. Und selbst wenn man die völlig leere Steppe betrachtet, die reglose Wasserfläche des Chöwsgölsees, selbst dann hört man ihre Pferde, so wie man auf Spitzbergen noch das Rauschen in den Kopfhörern der deutschen Funker hört, die während des Zweiten Weltkriegs verschlüsselte Wettervorhersagen aus ihren zwischen den Gletschern versteckten meteorologischen Stationen funkten.
In der Landschaft kann man eigenartiges, geheimnisvolles Leben beobachten, eigenartig wie das Leben auf anderen Planeten: das Leben der in Svalbard überwinternden Rentiere, Schneehühner und Polarfüchse, das willfährige, stille, auf der Lauer liegende Leben der Sklaven von Winter und Nacht. Die Erniedrigung der sich in den Tälern versteckenden Rentiere, deren knochige Leiber der Wind zu Boden drückt, und der Polarfüchse, die auf zugefrorenem Meer furchtsam dem weißen König des Nordens nachhetzen, um einen elenden Rest von seinem Schmaus zu ergattern.