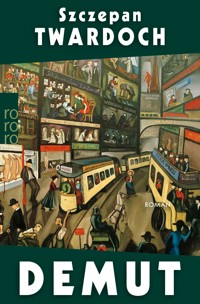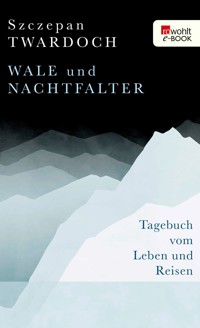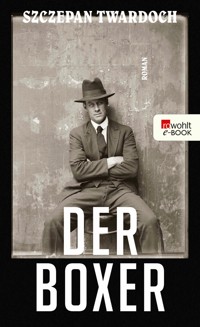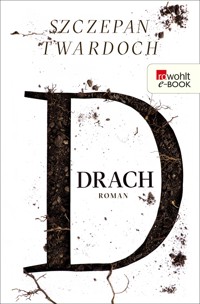19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Kampf eines Mannes, der nichts zu verlieren hat. Gegen die Welt und sich selbst. Einst war Konrad Widuch begeisterter russischer Revolutionär, kämpfte in der Reiterarmee. Unter Stalins Herrschaft verliert er alles, den Glauben an die Sowjetunion, seine junge Familie, die Zukunft. Aus den Schrecken des Gulag kann sich Widuch mit äußerster Härte befreien – und steht vor dem Nichts: in den Weiten der Taiga, einer atemberaubend schönen wie tödlichen Welt. Zusammen mit der Russin Ljubow und dem mitgeflohenen Gabaidze wird er von den Ljaudis gefunden. Bei dem archaischen Volk entdeckt Widuch ein fremdes Leben voll arktischer Exotik, ungeahnter Stille, eine Welt mit unbegreiflichen Göttern; der versehrte Gabaidze wird zum Schamanen. Als ein russisches Flugzeug landet, müssen Widuch und die schwangere Ljubow sich wehren und sind bald wieder auf der Flucht, allein im höchsten Norden. Szczepan Twardoch schickt seinen Helden auf eine zum Zerreißen spannungsvolle Lebensreise, die Konrad Widuch immer wieder nur mit Gewalt bestehen kann. Russland, der hohe Norden, das 20. Jahrhundert in all seinen Abgründen prägen diesen Weg. Wie oft kann man sich selbst besiegen, ohne seine Menschlichkeit zu verlieren? Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2025 in der Kategorie Übersetzung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Szczepan Twardoch
Kälte
Roman
Über dieses Buch
Der Kampf eines Mannes, der nichts zu verlieren hat. Gegen die Welt und sich selbst. Einst war Konrad Widuch begeisterter russischer Revolutionär, kämpfte in der Reiterarmee. Unter Stalins Herrschaft verliert er alles, den Glauben an die Sowjetunion, seine junge Familie, die Zukunft. Aus den Schrecken des Gulag kann sich Widuch mit äußerster Härte befreien – und steht vor dem Nichts: in den Weiten der Taiga, einer atemberaubend schönen wie tödlichen Welt. Zusammen mit der Russin Ljubow und dem mitgeflohenen Gabaidze wird er von den Ljaudis gefunden. Bei dem archaischen Volk entdeckt Widuch ein fremdes Leben voll arktischer Exotik, ungeahnter Stille, eine Welt mit unbegreiflichen Göttern; der versehrte Gabaidze wird zum Schamanen. Als ein russisches Flugzeug landet, müssen Widuch und die schwangere Ljubow sich wehren und sind bald wieder auf der Flucht, allein im höchsten Norden.
Szczepan Twardoch schickt seinen Helden auf eine zum Zerreißen spannungsvolle Lebensreise, die Konrad Widuch immer wieder nur mit Gewalt bestehen kann. Russland, der hohe Norden, das 20. Jahrhundert in all seinen Abgründen prägen diesen Weg. Wie oft kann man sich selbst besiegen, ohne seine Menschlichkeit zu verlieren?
Vita
SZCZEPAN TWARDOCH, geboren 1979, ist einer der herausragenden Autoren der Gegenwartsliteratur. Mit «Morphin» (2012) gelang ihm der Durchbruch. Für den Roman «Drach» wurden Twardoch und sein Übersetzer Olaf Kühl 2016 mit dem Brücke Berlin Preis geehrt, 2019 erhielt Twardoch den Samuel-Bogumił-Linde-Preis. Zuletzt erschien der hochgelobte Roman «Demut», den die «Neue Zürcher Zeitung» als «Höhepunkt seines Schreibens» bezeichnete. Szczepan Twardoch lebt mit seiner Familie in Pilchowice/Schlesien.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel «Chołod» bei Wydawnictwo Literackie, Krakau.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Copyright © 2022 by Szczepan Twardoch
Copyright © 2022 by Wydawnictwo Literackie, Kraków
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Scott’s Last Expedition, Dog Team Resting. Fotografie von Herbert George Ponting/Victoria and Albert Museum, London
ISBN 978-3-644-01757-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorrede
Im Sommer 2019 hatte ich das Gefühl, ich muss weg, und damit beginnt diese Geschichte.
Die Schlinge des Lebens zog sich mit jedem Tag enger um mich zusammen, wie immer, wenn ich zu lange in der Welt verharre, zu der ich gehöre. Menschengesichter und Menschenstimmen quälten mich, Freunde und Feinde ärgerten mich gleichermaßen, ich hatte genug von der Liebe und dem Hass der Menschen, genug auch von den Städten, durch die ich kam, und von der schlesischen Provinz, in der ich wohne.
Jeden Morgen kostete das Aufstehen mich mehr Mühe, so als hätte jemand mir in der Nacht zusätzliche Gewichte auf die Last gelegt, die ich ohnehin auf meinen Schultern trug, mein Schritt wurde immer schwerer, ich selbst immer reizbarer; immer öfter stachen mir Fressen ins Auge, die dringend meine Faust zu brauchen schienen. Ich merkte einfach, dass ich dorthin flüchten musste, wohin ich seit fünfzehn Jahren immer fliehe, nach Spitzbergen – um dann nach der Rückkehr weniger wütend auf die Welt, die Menschen und mich selbst zu sein.
Also kaufte ich ein Flugticket, packte Rucksack und Gewehr und stieg bald darauf am Flugfeld in Longyearbyen aus. Die Kalte Küste grüßte mich wie üblich – mit kühlem Wind und tief hängendem, stahldunklem Wolkengewölbe. Ich schlug mein kleines Zelt auf einem Campingplatz in der Nähe des Flughafens auf, saß dann in der verfensterten Messe, trank Kaffee und schaute auf den Fjord und die Berge am anderen Ufer hinaus, sah die Schmarotzerraubmöwe den anderen Möwen nachjagen und den silbrigen Polarfuchs zwischen den Steinen schnüffeln.
Am nächsten Tag bestieg ich die Schnellfähre nach Pyramiden, dem seit den neunziger Jahren verlassenen sowjetischen Bergbaustädtchen, in dem seit einigen Jahren eine Handvoll Russen in einem renovierten Hotel den zähen Touristenstrom bedienen. Die mehrstündige Fahrt verlief ruhig, ich stieg am provisorischen Kai aus, warf mir den Rucksack über die Schulter, das Gewehr auf den Arm und marschierte durch die Gebäude des Geisterstädtchens, um ins Landesinnere zu gelangen.
Geführt wurde ich von einer russischsprachigen Ukrainerin, die am Kai auf eine Touristengruppe aus Moskau gewartet hatte, die mit demselben Schiff wie ich eintraf – es war drei Jahre vor dem Krieg, und trotz der Besetzung von Krim und Donbass durch Russland 2014 lebten Ukrainer und Russen in Pyramiden im Grunde einträchtig. Auf den ersten Blick jedenfalls.
Die Fremdenführerin war etwa fünfundzwanzig und hatte dicke Zöpfe, die sich am Tragriemen des über die Schulter gehängten alten Stutzens ringelten. Sie gefiel mir ein bisschen, und ich glaube, auch ich habe ihr gefallen, womöglich bilde ich mir das aber auch nur ein. Wir unterhielten uns im Gehen vielleicht zehn Minuten, so wie sich Leute unterhalten, die wissen, dass sie gleich getrennte Wege gehen und sich nie mehr begegnen werden. Sie komme aus Charkiw, sagte sie, wohne aber jetzt in Irkutsk, in Russland. – Dort war ich schon mal, erwiderte ich, sogar mehrere Male, aber das ist lange her, zwanzig Jahre. – Irkutsk verändert sich nicht, sagte sie und fragte dann, offenbar spöttelnd, vielleicht gar herausfordernd, ob ich keine Angst hätte, allein ins Landesinnere zu gehen, wo doch erst vor zwei Tagen hier ein Bärenweibchen mit zwei Jungen gesichtet worden sei. – Doch, Angst habe ich schon, erwiderte ich, aber das – und dabei fuhr ich mit der Hand über den Horizont – ist es wert. Sie wurde ernst: Ja, die Landschaft sei schön, aber sie sei zum Arbeiten hier, sie werde bezahlt und verstehe nie, warum jemand in seiner Freizeit hierherkommt, zum Urlaub. Urlaub mache sie immer auf Kreta.
Ich versuchte nicht, ihr etwas zu erklären. Ich sagte nur, Kreta mag ich auch, aber hier, das ist etwas ganz anderes. Wir verabschiedeten uns, sie wünschte mir Erfolg und küsste mich ungeschickt auf beide Wangen, was mir angenehm war. Weiter ging ich allein.
Ich wollte zur Skansbukta hinübergehen, am Gletscher Jotunfonna vorbei, fand aber den Weg nicht, doch war auch gar nicht die Skansbukta mein Ziel, sondern die Flucht vor der Welt und dem Leben, das ich hinter mir gelassen hatte.
So floh ich, sah eine Woche lang kein menschliches Gesicht, zog durch verzweigte Täler und Canyons, schlug mein Zelt an Bächen auf, machte ein kleines Lagerfeuer, wenn ich einige von Geologen zurückgelassene Bretter fand, und saß in den weißen Nächten an seinen Flammen, maß sorgfältig den Bourbon aus einer Plastikflasche mit Markierung ab, damit der Dreiviertelliter Alkohol mir für die ganze Reise reichte.
Ich schwieg. Meditierte nicht, dachte nicht einmal viel. Ich aß, ging, suchte mir einen Lagerplatz, schlug mein Zelt auf, schlief.
Abends stellte ich rings um den Lagerplatz Alarmstangen auf, deren Schnur bei Berührung durch einen unachtsamen Bären Knallpatronen zünden sollte, um ihn zu vertreiben, mich dagegen zu wecken, dann kroch ich in meinen Schlafsack und schlief in der weißen Nacht, unter der nicht untergehenden Sonne, voller Urangst ein, die Hand auf dem Gewehrkolben, fürchtete mich im Schlaf und stand glücklich auf, machte mir Wasser auf dem Gaskocher, goss die gefriergetrocknete Mahlzeit und löslichen Kaffee auf, aß langsam, zog mich an, packte meine Sachen und zog weiter.
Ich aß, ging und schlief. Ich schwieg, bis mir am Ende, nach sieben Tagen Wanderung, das Essen und der Alkohol ausgingen und ich nach Pyramiden zurückkehrte, dreckig, erschöpft, insgeheim und geheimnisvoll glücklich, besänftigt von der Einsamkeit.
Das Schiff, auf dem ich nach Longyearbyen zurückkehren wollte, sollte erst in zwei Tagen kommen, deshalb stieg ich in dem einzigen bewohnten Gebäude dieser verlassenen Bergbausiedlung ab, dem Hotel, das Russen aus Barentsburg renoviert hatten, als ihnen nach zehn Jahren das touristische Potenzial des früheren Städtchens bewusst wurde.
Das Hotel war ziemlich mies, immerhin hatte es eine Bar, an die ich mich nach einer Dusche und dem Wechsel der Thermounterwäsche gegen das letzte saubere Merinohemd begab, um etwas zu trinken.
Gesellschaft suchte ich nicht, nach einer Woche absoluter Einsamkeit hatte ich keineswegs das Bedürfnis danach, auch nicht nach Stimmen oder Gesichtern, deshalb setzte ich mich an eine Ecke der Bar und bestellte einen doppelten Bourbon, ohne Eis. Ich hatte vor, ihn wortlos zu trinken, dabei ein Buch zu lesen, vielleicht Notizen zu machen und mich anschließend zur Ruhe zu begeben.
Da sah ich sie das erste Mal. Sie saß mir gegenüber, an der anderen Seite des Tresens. Gedrungen und klein, sie wirkte wie siebzig, trug eine ausgeblichene, früher mal rote Fleecejacke, ihr Haar war völlig weiß, kurz geschnitten, das Gesicht gebräunt, intelligente, wachsame Augen, die Wangen gerötet von Dutzenden winziger Erfrierungen, eine Landkarte geplatzter Gefäße, die sich durch die Canyons der Runzeln schlängelten wie ein arktischer Fluss.
Sie hob ihr Glas zu einem wortlosen Toast und entblößte beim Lächeln die abgewetzten, leicht gelblichen Zähne; auch ihre Augen lächelten, klein, eng stehend, hellblau.
Das passte mir nicht. Ich wollte hier unter den Statisten der Bar sitzen, Polarreisenden, Wissenschaftlern und Touristen, und trinken, unbehelligt, wollte überhaupt ganz langsam, gleitend aus meiner Einsamkeit auftauchen. Aber da sie nun einmal Blickkontakt mit mir aufgenommen hatte, blieb mir nichts übrig, als blöde zurückzulächeln. Auch ich hob mein Glas, da kam sie schon, sichtlich gesprächsbedürftig, sofort heran, setzte sich auf den Hocker neben mir und sagte freundlich:
«English, Deutsch, по-русски …?» Dass ich kein Wort Norwegisch konnte, hatte sie offenbar sofort erraten.
Sie selbst sprach ein vorzügliches Englisch, lediglich ein kaum hörbarer fremder Akzent ließ mich vermuten, dass das nicht ihre erste Sprache war.
English oder Deutsch, erwiderte ich, but rather English. Sie fragte, was ich hier tue, also erzählte ich ihr in drei Sätzen von meiner einsamen Woche in der Einöde, davon, dass ich auf dem Weg zum Tordalenberg die Abzweigung zur Skansbukta nicht gefunden hätte, und die Wände der Canyons seien zu steil, worauf sie erwiderte: Klar, man muss über den Gletscher gehen, das sei nämlich kein abgehender Gletscher, ein breen,sondern ein fonna,eine Eismütze, die keine gefährlichen Spalten aufweist, man brauche keine Steigeisen, Ketten um die Stiefel reichten. Dann weiß ich ja nächstes Jahr Bescheid, antwortete ich lachend und fragte höflichkeitshalber, was sie hierherführe, obwohl mich das keinen Deut interessierte. Sie antwortete ohne Zögern, dass sie seit Langem schon jeden Sommer mit ihrer Jacht nach Svalbard komme und so lange bleibe, wie die Eisverhältnisse es erlauben. Dieses Jahr habe sie den ganzen Archipel umsegeln wollen, doch stellte sich bald heraus, dass das Eis im Sommer nicht gewichen war, der ganze Norden von Svalbard sei vereist, einschließlich der Meerenge von Hinlopen, deshalb treibe sie sich hier herum, zwischen Longyearbyen, Pyramiden und Ny-Ålesund.
Die Jacht interessierte mich, ich fragte sie aus und bekam umso bereitwilliger Auskunft, je detaillierter ich fragte, gewiss war sie erfreut von den elementaren Segelkenntnissen, die ihr Gegenüber verriet. Sie sagte mir, ihre Isbjørn sei eine stählerne Reise-Ketsch von fünfzig Fuß Länge, mit wasserdichten Schotten, Wasseraufbereitungsanlage, starkem Motor, Stromgenerator, fast dreitausend Litern Treibstoff, mehreren Segelgarnituren, Heizung, Kühlschrank, Satellitentelefon, verbautem Brückenhaus, sodass man im Warmen steuern kann, und so weiter. Sie erzählte lange, der Stolz auf das Schiff war ihr anzumerken. Es sei schwer, allein zu steuern, sagte sie, immerhin ein ganz schöner Brocken, aber sie habe alles so eingerichtet, dass sie das schaffe.
«Ich heiße Borghild Moen», sagte sie schließlich und reichte mir die Hand.
Ich schüttelte sie und stellte mich vor.
«But you can call me Stefan, I know that Szczepan is impossible to pronounce», fügte ich, wie üblich in solchen Situationen, hinzu.
Sie bestand darauf, dieses seltsame szcz auszusprechen, und es gelang ihr nahezu perfekt. Sie fragte, woher ich komme. Aus Polen, erwiderte ich, obwohl ich kein Pole bin, bezweifelte aber, dass sie an langen Ausführungen über die Wirrungen der komplexen ethnischen Identitäten im ehemaligen polnisch-deutsch-tschechischen Grenzgebiet interessiert wäre. Sie lächelte und überraschte mich mit der Frage: Also bist du Schlesier? Ich bestätigte und gab mich erstaunt, dass sie mein God-forsaken land überhaupt kannte. Da winkte sie nur ab, wollte nicht weiter darüber reden, und als ich dann nach ihrer Herkunft fragte – schließlich stammte niemand von hier –, da zeichnete sie einen weiten Bogen und sagte, von überall und nirgendwo, sie sei seit vierzig Jahren auf See.
«Der Ozean ist meine einzige Heimat», fügte sie hinzu.
Das Kind einer Sirene und eines Triton werde sie ja wohl nicht sein, lachte ich, und sie erklärte schließlich, sie besitze einen norwegischen Pass, an dem ihr aber nicht viel liege.
Sie fragte, ob ich segeln könne. Ein bisschen schon, erwiderte ich, bin im Sommer auf Ostsee und Adria geschippert, aber das heißt natürlich nichts, so ein Urlaubssegeln, ein gestandener Seewolf sei ich nicht.
Da schlug Borghild Moen vor, mich mit nach Longyearbyen zu nehmen. Sie hatte hier vier Leute abgesetzt, die in Pyramiden blieben, und natürlich könne sie allein weiterfahren, das tue sie seit Jahrzehnten, aber deshalb wisse sie Gesellschaft umso mehr zu schätzen. Morgen früh gehe es los, die Isbjørn sei am Kai neben der Schnellfähre vertäut, die Fahrt nach Longyear werde gewiss einige Stunden dauern.
Ich war ohne lange Überlegung einverstanden. Ich wollte nicht länger in Pyramiden hocken, hatte keinen Grund dazu, und mit einer Reisejacht zu segeln ist immer ein Abenteuer, selbst wenn es nur einige Stunden dauert. Borghild bestellte den nächsten Whisky, wir tranken aus, verabschiedeten uns, und ich ging schlafen, bevor mein Eindruck, sie sei eine ganz reizende Gesellschaft, sich verflüchtigen konnte.
Andern Morgens erschien ich als Erster bei der Isbjørn, eine Viertelstunde vor der vereinbarten Zeit. Ich warf meinen Rucksack auf den Kai, setzte mich darauf und steckte mir die erste Zigarette seit Wochen an. Das Päckchen Djarum hatte ich ständig mit mir herumgetragen, nicht einmal die Folie war aufgerissen, nun bekam ich Lust darauf.
Die Isbjørn stand längs am Kai, solide vertäut mit zwei Schiffstauen und zwei Halteseilen. Es war eine imposante Jacht, gut gepflegt, hervorragend ausgestattet. Die Bordwände des mächtigen Stahlrumpfes waren rot gestrichen, das dunkle Teakholz des Decks blank gescheuert, Großsegel und Besan auf die in den Masten eingelassenen Roller gewickelt, die Dreiecksegel auf festen Stags aufgerollt. In einem Heckkorb steckten lange Alustangen zum Abstoßen des Rumpfes vom Treibeis in ihren Halterungen, daneben zwei Angeln, eine lange fürs Schleppfischen und eine kurze mit Pilker, gewiss für den Dorsch.
Borghild kam eine gute Weile nach mir, mit einer kleinen Tasche und Stutzen auf den Schultern, wir begrüßten uns, dann sprang sie rüstig an Bord. Ich wartete, bis sie mich aufs Deck bat. Ich landete in dem von drei Seiten verdeckten Cockpit, Borghild öffnete den Niedergang, ich zog im Cockpit die Schuhe aus und ging in die Kabine.
Das Innere war nach Reederart eingerichtet, nicht wie eine Charterjacht, es gab nur drei abschließbare Kajüten mit Bad, zwei Gästekajüten im Bug und eine große am Heck. Kein Stück Stahl stand aus dem dunklen Mahagoni heraus, die Couchen in der Messe waren bordeauxrot bezogen, in der geräumigen Kombüse stand ein großer Herd mit Kardan-Aufhängung, unter den Fenstern an Steuerbord ein langes Bücherregal, und an der Mahagoni-Schott über dem Navigationsstand neben der AIS-Anzeige und dem Radar hingen antike, patinierte Geräte: Chronometer, Barometer und Hygrometer. Das Messinggehäuse des in der Mitte befindlichen Chronometers zierte die Inschrift Invincible, stammte also wohl von einer anderen Jacht.
Borghild sagte, ich solle mir eine der Bugkajüten aussuchen, ich entschied mich für die rechte, warf Rucksack und Gewehr auf die Koje und ging ins Cockpit. Sie stellte sich ans Steuer, drückte den Anlasser, ein feines Beben durchlief den Rumpf der Isbjørn, der Auspuff an der rechten Bordwand spuckte Wasser, der Dieselmotor unter dem Fußboden begann auf niedrigen Touren gleichmäßig zu laufen. Borghild fragte, ob ich mit den Schiffstauen zurechtkäme. Das gab mir einen leichten Stich. Ich segle seit zwanzig Jahren, erwiderte ich, da werde ich das wohl können, aber sofort darauf war mir das peinlich, formal stimmte es zwar, doch was war ich schon gesegelt in diesen zwanzig Jahren, und außerdem, nur wer sich seiner Fähigkeiten unsicher ist, muss sie betonen.
Borghild lächelte und bat mich, beide Schiffstaue loszumachen und uns einen Augenblick am Heckseil zu halten, dem Seil, das den Bootsrumpf mit dem Kai verbindet und vom Heck Richtung mittschiffs verläuft. Ich tat wie gewünscht, sie schaltete den Rückwärtsgang ein und legte das Steuer um, das Heckseil straffte sich, der Bug der Isbjørn entfernte sich langsam vom Kai, Borghild legte den Gashebel auf Leerlauf, wartete eine Sekunde und schaltete dann auf halb voraus, ich holte auf ihr Kommando das Seil an Deck, und ab ging’s.
Ich erinnere mich nicht, worüber wir damals gesprochen haben. Gewiss nicht über Cholod und auch nicht über die verschollene S/Y Invincible, auch nicht über Konrad Widuch.
Von alledem erfuhr ich erst später.
Wahrscheinlich haben wir überhaupt nicht viel gesprochen, etwas aber muss im Laufe dieser sieben Stunden gesagt worden sein, sonst hätte sich die Geschichte, die ich hier zu beschreiben versuche, nicht ereignet. Borghild muss mich irgendwann, während wir die dreißig Meilen zwischen Pyramiden und Longyearbyen zurücklegten, gefragt haben, ob ich nicht weiter mit ihr fahren wolle.
Das muss sie gefragt haben, sonst wäre ich nicht gefahren, und ich muss ihr geantwortet haben, das sei nett, aber absolut unmöglich, ich hätte schon ein Ticket für den Rückflug, außerdem Verpflichtungen daheim, Kinder, Arbeit. Borghild fragte nach meinem Beruf, und ich sagte, wie immer verlegen, ich sei Schriftsteller. Das fand sie interessant, sie fragte weiter, was ich schreibe, bat mich, den Namen zu wiederholen, und ob etwas in andere Sprachen übersetzt worden sei. Als ich die englischen und deutschen Ausgaben erwähnte, sagte sie, ja, jetzt schwane ihr etwas, mein Name käme ihr bekannt vor, sie lese deutsche Zeitungen, bestimmt deshalb. Mir schien damals, sie lüge, um nett zu mir zu sein, und ich fand das nicht nur nett, sondern auch intelligent von ihr. Aber vielleicht hat sie das erst im Hafen gefragt, in Longyearbyen? Ich weiß nicht mehr. Hat sie mir gesagt, wie lange sie unterwegs sein will? Ich weiß nicht.
Jedenfalls nein, ich konnte nicht bleiben. Ich hatte keine Zeit. In zwei Tagen ging mein Flugzeug, davor war ich noch in Longyear mit einer Bekannten, der Autorin Ilona Wiśniewska, zum Bier verabredet, und für danach hatte ich viele berufliche und persönliche Pläne.
Ich konnte nicht bleiben. Ich musste zurück nach Hause, ins Leben, in die Welt, zurück zu allem, wovor ich geflohen war.
Ich musste. Und doch kam es so, dass ich in Longyearbyen, als wir in dem überfüllten Jachthafen angelegt hatten, Waffe und Rucksack in der Kabine ließ und zum Einkaufen in das Städtchen ging. Bei Svalbardbutikken kaufte ich eine ordentliche Ozean-Segeljacke, dann setzte ich mich auf ein Bier, trank es aus und erledigte sechs Anrufe, von denen zwei in unangenehmen Streitereien mündeten, durch einen davon verlor ich sehr viel Geld, die übrigen drei endeten mit leicht unterkühlten Abschieden. Danach rief ich noch meine Söhne an und erklärte mit brüchiger Stimme, dass ich noch nicht zurückkäme, ein bisschen noch, eine Woche, vielleicht zwei, vielleicht drei. Oder mehr. Ich wisse es nicht. Es tue mir leid. Ich wusste, dass ich nicht recht handelte. Dennoch konnte ich nichts dagegen tun.
Der jüngere wollte überhaupt nicht mit mir sprechen, der Große sagte nur: «Du hast da wohl noch zu tun», mir brach fast das Herz und brach doch nicht. Ich kehrte mit dem weiter schlagenden Organ auf das Deck der Isbjørn zurück, wo Borghild gerade einen großen Wagen mit Einkäufen auslud. Sie fragte angesichts meiner trüben Miene, ob alles in Ordnung sei. Ich zuckte nur mit den Schultern. Nein, nicht alles war in Ordnung, im Grunde gar nichts, aber ich sah keinen Grund zu klagen.
Zwei Stunden später gaben wir die Vertäuung ab und fuhren auf die Gewässer von Isfjorden hinaus, woraufhin Borghild, nachdem sie sich wohl von meinen seglerischen Fähigkeiten überzeugt hatte, befand, es sei an der Zeit, mich allein auf Wache zu lassen, eingehakt mit dem Sicherheitsgurt an der Lifeline. Sie gab den Kurs 250 vor, fast schnurstracks Richtung Westen, und ging schlafen, während ich, warm angezogen, Tee mit Zitrone trank und am Steuer allmählich durchfror, trotz zweier Pullover, wollener Unterwäsche, Seejacke, Mütze und Handschuhen. Auf dem Meer bei Spitzbergen setzt man selten die Segel, dieses Mal aber stand ein idealer Wind, aus Osten, wir stellten daher die beiden vorderen Dreiecksegel auf Butterfly, Großsegel und Besan blieben eingerollt, das große Genua und Klüver brachten die Isbjørn mühelos auf sechs Knoten.
Nach sechs Stunden hatte die Jacht das Kapp Linné passiert, einen Augenblick später waren wir schon auf dem offenen Ozean, der Bug der Stahlketsch stach ins Wasser und zerteilte die langsam zunehmenden Wellen, im Stahlgrau des mit dem Meer verschwimmenden Himmels lauerte jene schreckliche Bedrohung, die ich jedes Mal fürchte, wenn ich aufs Meer hinausfahre. Ich habe den Ozean, seine düstere, heidnische Macht, immer gefürchtet. Deshalb habe ich ihn so geliebt. Ein altes englisches Sprichwort sagt: Nur Dummköpfe haben keine Angst vor dem Meer.
Ich musterte den Horizont durchs Fernglas, warf einen Blick auf die AIS-Anzeige mit integriertem Radar, vergewisserte mich, dass uns keine Kollision drohte, da am Horizont keine Spur von Schiff zu sehen war außer dem im Meer verschwimmenden grauen Bootsrumpf der norwegischen Küstenpatrouille, der Svalbard, die in der Ferne an uns vorbeifuhr und langsam Kurs auf Longyearbyen nahm. Ich stellte den Autopiloten an und ging hinunter in die Kabine, um Borghild zu wecken, Borghild aber schlief gar nicht, sie machte sich in der Kombüse zu schaffen und goss zwei Teller gefriergetrocknetes Gulasch mit heißem Wasser auf. Sie bat mich, die Seejacke noch nicht auszuziehen, wir würden eine Wende machen, ich sollte die Segel trimmen helfen, also kehrte ich ins Cockpit zurück. Kurz darauf kam auch Borghild, in einer leichten Jacke, aber mit sorgfältig zugeknöpfter Sicherheitsweste. Sie zeigte mir, wo man sich bei der Arbeit an den Segeln mit der Lifeline sichert, wir zogen Klüver und Genua ein, was für die Wende nötig war, anschließend ergriff Borghild das Steuer, und wir querten über Heck die Windlinie, ich arbeitete mit den Schoten, Borghild setzte den Kurs auf 180, also geradewegs nach Süden, wir trimmten die Segel an das Backstag der linken Halse, fuhren so eine Weile, ich legte die Gegenschoten an, der Wind nahm leicht zu, er hatte eine Stärke von etwa fünfzehn Knoten, gleichmäßig, ohne Böen, Borghild schaltete den Autopiloten ein, prüfte den Horizont rundum, und wir kehrten in die Kabine zurück.
In zwei Sätzen berichtete ich über die letzten Stunden meiner Wache, sagte, dass die KVSvalbard an uns vorbeigekommen sei, Borghild fragte, ob sie uns angefunkt hätte, und ich verneinte wahrheitsgemäß, sie nickte dazu nur, als würde dieser fehlende Anruf etwas bedeuten, warf einen Blick auf die Multifunktionsanzeige des Kartenplotters, der sowohl die AIS-Daten als auch das Radar zeigte, und reichte mir dann den Teller mit inzwischen gut durchgezogenem Trockengulasch. Wir setzten uns in die Messe, aßen schweigend, dann fragte Borghild, was ich trinke, ich fragte zurück, was sie habe, woraufhin sie das Türchen zur reichlich gefüllten Bar öffnete und sagte: Alles, einschließlich tausendjährigen Gletschereises, das vorzüglich zum Whisky sei. Ich bat um einen Bourbon und wenn schon vom Gletscher, dann bitte mit Eis, sie goss mir einen doppelten ins Glas, legte eine Tafel Schokolade auf den Tisch, sich selbst schenkte sie Kaffee ein.
Ich sagte, ich würde mich gern am Proviant beteiligen, sie habe ja viel eingekauft und ich wolle ihre Gastfreundschaft nicht ausnutzen. Sie war einverstanden, nannte einen Betrag, es waren wohl zweitausend Kronen, ich zählte die Scheine ab und reichte sie ihr, sie nahm sie, dankte, zählte nach und steckte sie ein. Jetzt könnte ich sie eigentlich fragen, wohin wir fahren, dachte ich, und für wie lange, doch ich ließ es.
Vermutlich wollte ich es noch nicht wissen.
Heute ist mir klar, dass ich, als ich auf der Isbjørn anheuerte, noch immer weglief, viel weiter, als ich es bei meiner Wanderung durchs innere Dickson-Land hätte tun können. Mein Satellitentelefon ruhte im Gepäck, ausgeschaltet, nicht einmal diese beschränkte Form des Kontakts mit der Welt wollte ich, ich war weder bereit zu Telefongesprächen noch zu fleißig in die numerische Tastatur getippten SMS wie in den neunziger Jahren. Sogar das war mir zu viel.
«Ich wollte dir das nicht vor der ersten Wache sagen, du solltest das Meer und mein Prachtstück hier genießen. Aber für die Zukunft, da ist es besser, die Wache in der Kabine zu verbringen, am Steuerpult, an dem Navigationstisch. Solange man nicht durch Treibeis oder die growler der Gletscher fährt, die man von der Kabine aus leicht übersieht – eine Kollision mit dem Eis ist wie der Zusammenstoß mit einem Felsen –, und solange kein Sturm herrscht, der den Autopiloten überfordert. Aber ich segle nicht gern im Sturm. Ein zweites Ruder gibt es nicht, du hast hier aber das Steuergerät zum Autopiloten, da brauchst du das Ruder gar nicht anzufassen, dazu den Gashebel und die Motoranzeigen, AIS und Radar, auch gute Sicht ringsum, am schwierigsten ist es heckwärts, deshalb kann man den Kurs im Warmen korrigieren, in so wenig befahrenen Gewässern wie diesem hier reicht es, einmal in der Stunde rauszugehen, und natürlich, wenn die Segel zu trimmen sind», sagte Borghild, und das war die längste Äußerung, die ich bis dahin von ihr gehört hatte.
Natürlich gab ich ihr recht. Der Ozean ist nicht die Adria, hier gibt es weder so viel Verkehr noch ist es so warm, dass man acht Stunden im Cockpit am Ruder sitzen müsste, wenn man vom Navigationspult in der Kabine auch die Einstellungen des Autopiloten korrigieren kann und durch das dicke, gegen die Polarwogen verstärkte Glas des Steuerhauses keine schlechte Sicht hat.
Ich sagte etwas von meiner Sehnsucht nach dem Meer, nach dem ungeheuren Horizont, der wächst, je weiter man sich vom Festland entfernt, und dass ich dafür auch gern einmal bis auf die Knochen durchfriere.
Sie nickte nur und sagte, ich solle ausschlafen.
Etwas an ihr faszinierte mich. Sie war gut einige Jahrzehnte älter als ich und nahm daraus diese Ruhe, die Sicherheit, niemandem mehr gefallen zu müssen, schließlich war sie Reederin und Skipperin ihrer eigenen, großartig ausgerüsteten Reisejacht, auf der ich nur als Besatzungsmitglied diente. Im Rückblick scheint mir, es war das in ihr verborgene Geheimnis, das mich faszinierte. Gewöhnlich stehen die Menschen mir sperrangelweit offen, ich lese in ihnen wie in einem, wenn ich das sagen darf, offenen Buch, Borghild dagegen blieb undurchdringbar, ihr Gesicht war durchpflügt von den tiefen Runzeln der Menschen auf See, ihre kräftigen, rot gefrorenen Hände mit den kurz geschnittenen Nägeln, das schlohweiße Haar sagten mir nichts weiter als das, was ohnehin offensichtlich war – die See war ihr Zuhause.
Ich trank den Bourbon aus, aß zwei Stückchen von der Bitterschokolade und ging schlafen. Kaum in den Schlafsack gerutscht, war ich schon weggedämmert, erschöpft und traumlos im Schwarz, gewiegt von den Wellen und dem stillen Raunen des Meeres, das mit dem Stahlrumpf der Isbjørn schäkerte, die besser gedämpft war als jede andere stählerne Jacht, auf der ich je gewesen bin.
Ich schlief einen schwarzen Schlaf, und als ich erwachte, war es hell und grau, ich schaute auf die Uhr, sie zeigte zehn, und ich wusste nicht, ob es zehn Uhr morgens oder abends war. Ich ging in die Messe, ohne daran zu denken, dass ich nur schwarze Thermounterwäsche trug, die zwar den ganzen Körper bedeckte, aber dennoch nicht geeignet war, darin vor Fremden zu paradieren, und kaum war mir das eingefallen, wurde mir auch schon klar, dass Borghild sich überhaupt nicht daran störte.
Ich konnte hier in Unterhosen rumlaufen, als wäre ich mit Kumpeln unterwegs, nicht mit einer schweigsamen Seglerin, die meine Mutter, wenn nicht Großmutter, hätte sein können.
Borghild saß in dem drei Stufen über der Messe gelegenen Steuerhaus, am Navigationstisch, auf dem ein gepanzerter Laptop militärischen Typs geöffnet war. Daneben lag ein mir vertrautes Gerät: ein mit dem Stromkabel und einer Außenantenne verbundenes Satellitenmodem.
«Ich habe im Internet gesucht und herausbekommen, wie dein Vorname sich schreibt», lächelte Borghild. «Du bist tatsächlich Schriftsteller», fügte sie hinzu und bestätigte meine Ahnung, dass ihre vorherige Behauptung, sie kenne meinen Namen aus deutschen Zeitungen, gelogen war.
Später wurde mir klar, dass sie das gar nicht jetzt hatte prüfen können: Wir waren weit von jedem Funknetz entfernt, und der Datenfluss durch das Satellitenmodem reichte gerade für das Lesen von Mails und Wettervorhersagen, der Zugang zu Webseiten war nicht möglich, somit konnte sie auch keinen Namen in die Suchmaschine eingegeben haben.
Hatte sie vielleicht vorher überprüft, wie mein Name sich schreibt? Ich weiß es nicht, antwortete einfach mit einem Lächeln und indem ich den Teekessel auf den Gasherd stellte. Ich fragte, ob sie nicht hungrig sei, ich würde gern etwas kochen. Klar, erwiderte Borghild, was auch immer, die Kombüse gehört dir. Ich sah die Vorräte durch und briet, ohne lange nachzudenken, ein Omelett mit Schinken und einigermaßen frischem Gemüse. Während ich kochte, zog Borghild ihre Jacke und den Sicherungsgurt an und ging mit dem Fernglas ins Cockpit, kam kurz darauf zurück, und wir setzten uns gemeinsam an den Tisch in der Messe, aßen und tranken, ich Kaffee, Borghild Bier.
Während ich schlief, sagte sie, hätten wir über fünfzig Meilen zurückgelegt, die ganze Zeit wehe ein Wind von fünfzehn bis siebzehn Knoten aus Nordost, und wir befänden uns auf der Höhe des westlichen Torell-Gletschers. Nach zwanzig Meilen, also ungefähr in drei Stunden, würden wir am Hornsund vorbeikommen, nach zehn Stunden an den Inseln am Südrand von Sørkapp, wo wir anluven und so weit nach Osten gehen würden, wie der Wind erlaube. Die Prognose sei gut, die Eisverhältnisse – was hieß, kein Eis – für uns ideal, für den Planeten weniger günstig.
«Wohin fahren wir?», fragte ich und merkte sofort, dass ich eine unausgesprochene Vereinbarung zwischen Borghild und mir gebrochen hatte.
«Es ist kein Geheimnis, aber die Antwort auf diese Frage ist lang und kompliziert, und ich müsste ab ovo anfangen. Einfacher ist es, du liest erst etwas. Das wird keine leichte Lektüre sein, aber ich glaube, dir als Schriftsteller wird sie gefallen. Vielleicht kannst du sogar etwas daraus machen.»
Wortlos breitete ich meine Hände aus – wir hätten hier ja sowieso nichts Besseres zu tun, also gern.
«Ich sehe schon, du kannst es nicht abwarten, du magst geheimnisvolle Geschichten, schließlich lebt ihr Schriftsteller davon, von fremden Geschichten, nicht wahr?»
«Ich schreibe Romane, keine Reportagen», protestierte ich.
«Aber lesen wirst du sie, oder?»
«Ja. Aber weißt du, ich höre so oft, dass jemand eine fantastische Idee für einen Roman hat …»
«Ich habe keine Idee, Szczepan», erwiderte sie unbeirrt. «Ich habe eine fertige Geschichte für dich.»
Nach dem Frühstück wusch ich ab, putzte mir die Zähne, zog Hose und Fleecejacke an, dann zog ich in der Kabine das Satellitentelefon aus dem Rucksack und überlegte einen Augenblick, ob ich es einschalten, mich bei denen melden sollte, die auf meinen Anruf warten.
Ich tat es nicht. Ich war nicht dazu in der Lage. Ich steckte das Telefon weg und ging ins Steuerhaus. Vielleicht warteten sie gar nicht mehr auf einen Anruf von mir. Borghild wies mir höflich einen Platz am Navigationstisch, auf dem kein Laptop mehr stand.
«Das ist deine Wache, die Jacht gehört dir. Ich gehe schlafen, und du kannst lesen. Kurs einhundertsechzig, bis wir das Sørkapp passieren, und achte auf das Echolot und die Karte, hier ist es manchmal seicht, die Karten sind nicht die allerneusten. Auch wenn es meist nicht notwendig ist, man kann nie vorsichtig genug sein.»
Ich stimmte ihr zu, zog die Jacke an, den Sicherungsgurt, nahm das Fernglas und ging kurz ins Cockpit, wo ich mich sofort mit einem Haken am Fenster beim Ruder festmachte.
Ich musterte den Horizont zuerst an Steuerbord. Das Meer war leer, stahlgraue Wellen bis zum Horizont. Backbord erstreckte sich fern am Horizont die dünne Linie der ebenen Küste, dahinter die weißen Zungen des Gletschers und die scharfen Gipfel des Korgfjellet. In den Wogen, einige Hundert Meter entfernt von der Isbjørn, bemerkte ich ein gutes Dutzend weißer Geschöpfe, die sich in den Wellen tummelten, und begriff, dass es eine Herde träge in Richtung Festland ziehender Weißwale war.
Eine Weile beobachtete ich sie durchs Fernglas, halb aus Neugier, halb um den Augenblick hinauszuzögern, da ich ins Steuerhaus zurückgehen musste. Am Ende wurde mir doch kalt, ich warf noch einen Blick auf die Segel, prüfte die Gegenschoten und ging in die Kabine hinunter.
«Ich habe Weißwale gesehen», sagte ich, als ich am Navigationstisch Platz nahm.
«Ein gutes Zeichen», erwiderte Borghild. «Weißwale sind immer ein gutes Zeichen.» Sie saß am Navigationstisch und hielt einen Band in den Händen, ein Notizbuch eher, zweifellos sehr alt, dick, doppelt in altes Leder geschlagen – doppelt, denn der schwere Einband war ebenso aus Leder wie das von drei Schnallen mit Messingklammern gehaltene Etui, das jetzt geöffnet auf dem Navigationstisch lag.
«Das ist für dich zum Lesen», sagte sie. «Das Original, auf Polnisch. Ich habe es nur in der Übersetzung gelesen, die ich vor langer Zeit in Auftrag gab. Ein polnischer Emigrant in London, angeblich General, hat es mir übersetzt … Aber er musste sich erst vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichten. Du verstehst, das ist eine bedeutende Sache.»
«Von wem sind die Aufzeichnungen?»
«Frag nicht. Du wirst selbst sehen. Mach damit, was du willst. Lies einfach. Ich gehe schlafen. Wir reden danach.»
«Gut. Aber ich möchte nicht, dass mich das zu irgendetwas verpflichtet, in moralischer Hinsicht, ja?», verwahrte ich mich, denn allzu oft belästigen mich Leute in der Überzeugung, sie hätten einen großartigen Vorschlag für ein Buch, das ich schreiben sollte.
«Verpflichtet? Überhaupt nicht, Szczepan. Du machst damit, was du willst. Wenn ich jünger wäre, hätte ich dir diese Geschichte niemals abgegeben. Aber weißt du, ich bin dreiundachtzig, und ich bin krank.»
«Wie alt bist du?», fragte ich erstaunt.
«Ja, dreiundachtzig, mein Lieber.»
«Ich hätte eher auf siebzig oder so getippt.»
«Offensichtlich hat das Leben auf See mir gutgetan. Leider habe ich schon mit fünfzig eher wie siebzig ausgesehen, aber jetzt habe ich mein Gesicht vom Alter her überholt, wie du siehst. Außerdem kümmert mich das nur noch wenig.»
«Ich hätte auch nie gedacht, dass du krank sein könntest.»
«Ja, ja, verstehe. Lassen wir das. Meinen fünfundachtzigsten Geburtstag werde ich wohl nicht mehr erleben.»
Ich sagte nichts. So bin ich erzogen, was soll’s. Wie es sich für den Wachführer gehört, kümmerte ich mich einen Augenblick lang um Plotter und Echosonde. Wenn meinen Großvater etwas bedrückte, ging er in seine Werkstatt im Keller und machte sich an irgendeine Arbeit. Meine Mutter fängt an zu putzen. Mein Papa werkelt im Garten. Also was sollte ich hier tun? Ich las die Position vom Plotter ab und übertrug sie in die Papierkarte, was eigentlich überflüssig war, weil wir auf der Isbjørn zwei unabhängige GPS-Systeme hatten, dazu ein händisches Ersatzsystem, aber im Kurs hatten wir gelernt, dass diese Redundanz manchmal Leben retten kann. Sodann vervollständigte ich den stündlichen Eintrag im papiernen Logbuch: Position, Kurs, Geschwindigkeit, Zustand der See, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Temperatur. Gute Seefahrerpraxis, hieß das.
Borghild sah lächelnd zu, wie ich mit Navigationsdreieck, Parallellineal und Stechzirkel über der Karte hantierte. Sie verstand, warum ich das gerade jetzt tat.
«Na gut, schon gut, ich hätte das nicht erwähnen sollen, offenbar hat es deine Laune verdorben. Das ist nicht wichtig, mach dir nichts draus. Fang einfach an zu lesen. Dann beschreib einfach, was du gelesen hast, beschreib es in deinen Büchern. Vielleicht wird die Geschichte irgendjemandem gefallen. Und lass die Isbjørn segeln. Kurs unverändert. Stör sie nicht. Pass auf sie auf, aber stör sie nicht, soll sie segeln. Das ist ein gutes Boot.»
So sagte sie: She’s a good boat, in der weiblichen Form, wie im Englischen üblich. Kurs unverändert. Steady as she goes.
Ich war mit der Karte fertig, griff nach dem dicken Notizbuch und wog es in der Hand, traute mich nicht, es aufzuschlagen.
«Na lies, lies», drängte sie. «Und lies mit Verstand.» Borghild stand auf, streichelte mir den Kopf, wie einem Kind, und ging schlafen.
Ich blieb allein mit dem mir anvertrauten Buch. Ich schlug es aufs Geratewohl auf – die Seiten waren eng mit einer zierlichen, unregelmäßigen, steilen Schrift beschrieben.
Was von diesen in graziler Kursiva bedeckten Seiten wahr ist und was Fiktion, was unbewusste Verdrehung der Fakten und was Illusion, das wollte ich weder damals endgültig entscheiden, noch will ich es heute tun, da ich diese Worte schreibe. Ich selbst glaubte dem Autor der Aufzeichnungen schon bald und glaube ihm bis heute, aber glauben und über die Wahrhaftigkeit befinden, das ist zweierlei.
Das Notizbuch des Konrad Widuch
16. Juni 1946
Ich – ein Mensch?
War ich je Mensch?
Oben habe ich das Datum hingeschrieben. Seit acht Jahren habe ich nie gewusst, welcher Wochentag ist, welcher Tag im Monat, oft nicht einmal, welcher Monat. Nur so ungefähr. Jetzt weiß ich. Den Kalender habe ich zur Hand. Heute ist Sonntag. Der Tag des Herrn.
Ich schaue meine Hände an. Versuche, die eine zu strecken, das Notizbuch zu halten, mit der linken, denn ich bin Rechtshänder, in der rechten halte ich den Bleistift. Beide sind von Narben gezeichnet, Überbleibsel von Geschwüren nach einer alten Krankheit, an der rechten fehlt mir ein Glied des kleinen Fingers, vor langer Zeit abgefroren, an der linken ein ganzer kleiner Finger und der größte Teil des Ringfingers, ein Unfall beim Holzfällen. Oder nein, kein Unfall, ich erinnere mich nicht. Vielleicht hat Rebane das damals mit Absicht getan. Schließlich bedeutete sein Nachname im Estnischen so viel wie Fuchs. Sagte er. Vielleicht mit Absicht. Fuchs. Vielleicht liegen diese Finger dort noch irgendwo, die Knochen meine ich, drei Glieder von jedem, im Streu, im Moder vergraben, unter den Strohwischen der Puschitza mit ihren windgezupften weißen Flaumbüscheln.
Ich weiß nicht, wie Puschitza auf Polnisch oder auf Deutsch heißt, aber auf Russisch heißt es genauso, пушица, ein Gras mit Büscheln wie die Baumwolle, wächst in der Senducha, jenseits der Baumgrenze. In Cholod wurden aus diesen Büscheln Dochte für Steinlampen gemacht, die mit Seehundfett brannten. Die Jukagirin Ibisi brachte mir bei, wie man aus diesen Fasern zwischen den Fingern ein handliches Seil drehen kann, zu schwach als Takelgarn, als Docht dagegen vorzüglich. Das beste wuchs in Sewjer, am Fuße des großen, rauchenden Berges, dort waren die Büschel der Polarbaumwolle am größten, das Garn so kräftig, dass man auch Fäden daraus machen konnte.
Dort aber, wo ich die Finger verlor, das konnte nicht die Puschitza gewesen sein, dort gab es noch Bäume und das dichte Unterholz der Taiga, woher sonst der Holzschlag, Senducha und die Puschitza der Senducha, und Moos, und bodenkriechende Weiden, das war später. Wann anders. Lange vor allem.
Vielleicht liegen sie also unter einem Strauch voll saftiger, süßer Beeren, die aßen wir im Holzschlag, man musste nur auf der Hut sein, von einigen konnte man krank werden, und ein Kranker an dem Ort, dessen Namen ich nicht aussprechen will, der war so gut wie tot.
Möglich, dass sie dort liegen. Leid tat es mir nicht um sie, sie waren sowieso kaputt vom Drücken des Handgriffs, krumm wie Krallen, außerdem, sieben und zwei Drittel Finger habe ich noch, da konnte ich zwei der Erde lassen. Die Beeren sogen alle Süße aus ihnen, aus meinen Fingern, die das Leben mir genommen hatte. Und die, die mir geblieben sind, sehen aus wie die Finger meiner Urgroßmutter, von Gicht geplagt, verbogen, zerbrochen, zusammengewachsen. Aber noch sind sie mir zu Diensten. Drücken den Abzug.
Ich schreibe diese Worte langsam, der Bleistift quietscht. Eine Feder wäre mir lieber, aber ich habe keine. Außerdem, hier im Север, im Norden, frieren die Federn ein, der Bleistift schreibt auch im Frost. Obwohl, jetzt ist es warm. Vielleicht haben sie irgendwo in der Welt schon Federn, die auch im Frost schreiben.
Der Große hat mir dieses Heft und den Stift gegeben, als er ging. Er würde sie nicht mehr brauchen, hat er gesagt. Das war kurz nachdem er mir die Nase gebrochen hatte, aber zu schreiben habe ich erst jetzt angefangen, nach zwei Monaten Einsamkeit.
Der Große hieß natürlich irgendwie anders, Jean oder so, ich konnte das nicht aussprechen, auch wenn ich es mir notiert hatte. Der Kleine hieß Jules, wie Verne, den ich als Kind so gern auf Deutsch gelesen habe, aber ich nannte sie lieber den Großen und den Kleinen, denn so viel haben wir auch nicht miteinander geredet, obwohl ich mehrere Sprachen kann.
Deutsch zum Beispiel habe ich auf der Grundschule gelernt, Polnisch später, in den Selbstbildungszirkeln der polnischen Sozialisten, schwer war das nicht, denn zu Hause sprachen wir eh unsere Sprache, da fiel mir das Polnisch leicht, Englisch habe ich dann auf der Marineschule gelernt, ein bisschen verstehe ich, auch wenn ich wahrscheinlich das meiste vergessen habe. Russisch habe ich erst gelernt, als ich mit Radek nach Moskau gegangen bin, aber dafür gründlich, siebzehn Jahre bin ich mit diesem Russisch in Russland über die Runden gekommen, mit Sofie sprach ich auch Russisch, obwohl sie besser Deutsch als Russisch konnte. Ein bisschen Angst hatte man ja vorm Deutschsprechen, klar.
Jedenfalls, der Große und der Kleine redeten Französisch, das heißt reden tat der Kleine, er konnte auch ein paar Worte Englisch und Deutsch, und am Anfang haben wir uns auch etwas erzählt, das heißt, erzählt hat hauptsächlich der Kleine, ich hörte zu, schließlich werde ich ihm nichts von dem Ort sagen, dessen Namen ich nicht erwähnen will, oder von Cholod oder von Sewjer und seinem großen, rauchenden Berg. Der Große sagte so gut wie gar nichts, als hätte er die menschliche Sprache vergessen.
Vielleicht spreche auch ich kein Wort mehr in einer menschlichen Sprache, sondern plappere alles nur nach wie ein Papagei. Unser Kommandant am ersten der Orte, deren Namen ich nicht aussprechen will, verzeih mir, meine unselige, weil nicht existierende Leserin, hatte so einen Papagei, ganz grau, nur der Schwanz rot, der saß im Käfig und schrie immerzu «Zum Teufel mit Trotzki!» und «Lenin Pfundskerl! Stalin Pfundskerl!», aber dann wurde er trübsinnig, rupfte sich die Federn aus und ist am Ende verreckt, und der Kommandant erklärte beim Appell, daran seien mal wieder die trotzkistischen Ratten schuld, und deshalb würden wir jetzt eine Stunde früher zur Arbeit gehen.
Vielleicht bin ich jetzt auch schon wie dieser Papagei, der schließlich nicht wusste, wer Trotzki ist, warum er dort in diesem Mexiko oder Paris sitzt, der nicht wusste, wer Lenin und Stalin sind, vielleicht rede auch ich nur noch diese Wörter nach und weiß nicht, was dahinter steht.
Schreiben tue ich schon noch, oder? Ich schreibe auf Polnisch. Kyrillisch habe ich nach alldem nie gern geschrieben, auf Polnisch dagegen, obwohl nicht ganz korrekt, das weiß ich, schreib ich jetzt ganz gern, hab’s auch leicht gelernt, nachdem die Genossen von der polnischen PPS uns in Zaborze einen Selbstbildungszirkel organisierten, stellte sich heraus, dass dieses Polnisch unserer Mundart ganz ähnlich ist, nur hochtrabender, bisschen so, als würde ein affektierter Graf sprechen, und diese Aufgeblasenheit macht es, glaube ich, besser zum Schreiben geeignet, Polnisch reden dagegen ist ganz albern, ich habe mich immer dafür geschämt, weil wenn jemand Polnisch redet, mit all diesen Pan und Pani, ą und ę, dann klingt das sofort, als wenn sich da ein polnischer Adliger aufplustert und den kleinen Finger von der Teetasse spreizt wie das Flügelchen eines zarten Vogels, einfach grotesk klingt das, wenn jemand Polnisch spricht, wie der Hanswurst, unsere Sprache normal, wie es sein sollte, ohne Aufgeblasenheit, wie unsereins, eben normal. Russisch auch normal, ohne Firlefanz, ohne Pan und Pani, ą und ę, wie ein Kerl oder ein Weib, normale Leute, keine hochwohlgeborenen Scheißer.
Aber schreiben auf Polnisch ist besser, das geht irgendwie von der Hand, sogar diese ą und ę. So ist das eben mit den Sprachen und dem Schwätzen und dem Schreiben.
Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal geschrieben habe. Wann ich das letzte Mal eine Füllfeder oder einen Bleistift in der Hand hielt.
In Cholod gab es keine Schreibutensilien. Niemand brauchte sie, weil niemand dort irgendwas schrieb, die Leute merkten sich mehr, als dass sie schrieben. Sie wussten es in der Seele. An dem Ort, dessen Namen ich nicht aussprechen will, gab es auch nichts zu schreiben, wozu oder worüber denn, auch wenn ich dort einen Dichter gesehen habe, der auf irgendwelchen Papierfetzen seine Gedichte notierte und sie dann auswendig lernte, was ihm auch nicht viel geholfen hat, als er dann ganz simpel verhungerte. Ich habe nichts notiert und wollte auch nichts auswendig lernen. Also noch früher. Viel früher schrieb ich oft, beinahe täglich, hauptsächlich Briefe, zuerst an Sofie aus dem Krieg und später nach dem Krieg, als wir in den Kaukasus verlegt wurden, wo wir genauso hungerten wie die Pferde, die mit schimmligem Stroh von den Dächern der Bauernkaten gefüttert wurden. Später, als Sofie und ich schon zusammen in Moskau wohnten, schrieb ich an alte Genossen, neue hatte ich keine, ich schrieb sogar nach Deutschland, ziemlich unvernünftig, doch damals machte ich mir noch Illusionen über die Freiheit im Vaterland des Proletariats, und später, als wir nach Radeks Sturz in einer Kommunalwohnung in Murmansk wohnten, um halbwegs abzutauchen, am besten ganz zu verschwinden, da hatte ich Angst zu schreiben, denn jedes falsche Wort bedeutete den Tod. Besser nicht schreiben, weder Brief noch Postkarte, Tagebuch schon gar nicht.
Dabei übten wir noch mit Wilena, haben mit dem Kind geschrieben, Buchstaben im Heft, weder Polnisch noch Deutsch trauten wir uns ihr beizubringen, auch wenn Sofie ganz normal Norwegisch mit ihr gesprochen hat, das war damals, als unsere zweite Tochter geboren wurde, der gaben wir den Namen Ninel, das war Lenin rückwärts gelesen, damals wurde gar nicht mehr geschrieben. Sämtliche Aufzeichnungen, aus dem ganzen Leben, alle Notizen, Zettel, empfangene Briefe und die durchgepaust verschickten verbrannten wir damals mit Sofie, es half sowieso nichts, schaden konnte es aber auch nicht. Erinnerung soll Erinnerung bleiben, fließend und wandelbar wie wir Menschen, die Materie verwandelt sich in uns, wir essen, verdauen, Teilchen setzen sich in unserem Körper ab, andere scheiden wir aus, nichts ist fest in unseren Körpern, wir sind aus Materie wie die Woge aus Wasser, tauchen auf, schwellen an wie die Woge und erlöschen, und unsere Erinnerung mit uns, wandelbar, Abbild eines Abbildes, gut also, dass wir alles, was wir aufgeschrieben hatten, verbrannten. Es tat mir weder damals noch heute leid. Und dies schreibe ich dir nur, weil niemand es lesen wird, dir lieben, wenngleich nicht existierenden Leserin.
Als ich das letzte Mal schrieb, konnte ich den mir gereichten Füller kaum in den gebrochenen Fingern halten. Mir gegenüber am Tisch saß dieser nette, wohlwollende Mensch, der aussah wie ein distinguierter Professor oder Chirurg, grau meliert, runde Nickelbrille auf der Nase, kurz geschnittener, weißgrauer Schnauzer, glatte Wangen und sogar der Duft von gutem Rasierwasser. Bestimmt einem englischen. Wenn irgendwas gut ist für den Menschen, dann kommt es immer aus England. Nur die Politik von denen ist Scheiße. Also, er sah aus wie so ein Professor, ein englischer sogar, edel mit diesem Oberlippenbärtchen.
Nur die Uniform passte ihm irgendwie nicht. Nicht wegen der Größe, die grüne Bluse saß wie angegossen an seinem – übrigens sportlichen – Leib, bestimmt nach Maß genäht zusammen mit den blauen Breeches mit schmalen roten Tressen, wie sie die Offiziere von alters her sich bestellten. Sie passte einfach nicht zu seinem ruhigen, freundlichen Gesicht, diese Uniformbluse mit den karminroten Kragenpatten und den Majorsabzeichen, dem sorgfältig auf die Schulter gestickten und mit drei Messingknöpfen verschlossenen NKWD-Wappen mit Schwert und Schild; an diese Knöpfe erinnere ich mich so gut.
Ich hielt den Bleistift oder die Feder in den Händen, der Mensch mit dem Professorengesicht schob mir ein Blatt Papier zu, das von der Maschine ganz mit meinen und doch nicht meinen Worten beschrieben war. Na, Konrad Wilgelmowitsch, fragte er, was ist, rauchen Sie eine? Ich nickte oder nickte auch nicht, da zog er eine schön verzierte Schachtel Troika aus dem Schreibtisch, die waren teuer. Außen war sie mit einer altrussischen Szene mit Troika-Gespann bemalt, innen am Deckel war eine hübsche Kreml-Ansicht. Er bog das Zierpapier weg, nahm eine dicke Zigarette mit goldenem Mundstück aus der Schachtel, steckte sie an, nahm einen Zug, damit sie nicht ausging, und steckte sie mir dann zwischen die geschundenen, geschwollenen Lippen, nachdem er zuvor persönlich die Schraube gelockert hatte, die das Brett auf der Schreibtischplatte befestigte, in dem meine beiden Hände staken.
Er tat das selbst, weil er zuvor den Starschina, den Unteroffizier, entlassen hatte, der für solche Dinge zuständig war. Soll nach Hause gehen, hat Kinder, der Mann, die sollen mal ihren Vater zu Gesicht bekommen, soll ihnen Märchen vorlesen, Radio hören, sagte er mit herzigem Lächeln.
Meine Hände waren zuvor flach auf die Tischplatte gepresst, befestigt mit einem Brett mit Ausschnitten, damit der Mensch mit dem Professorengesicht es leichter hatte, mich davon zu überzeugen, dass ich meine Schuld gestehe, was ich aber nicht vorhatte, jedenfalls eine Zeit lang nicht, denn ich war fest überzeugt, dass Sofie, Ninel und Wilena schon in Sicherheit wären.
Und selbst wenn sie nicht in Sicherheit waren, dann drohten ihnen andere Gefahren als dieser Keller hier, in dem ich mit diesem Menschen und seinem freundlichen Gesicht saß, und das ärgerte ihn, dass er nicht über Sofie, Ninel und Wilenka an mich herankam, er fragte sogar, wo sie sind, ein Fehler von ihm, jetzt konnte er nicht mehr behaupten, sie hätten sie gefasst.
Ich wusste ja auch, dass sie nicht gefasst waren. Deshalb tobte nun der Major mit dem Professorengesicht, und meine Hände waren auf die Tischplatte gepresst durch diese raffinierten Klötze mit Scharnieren, und der Major schlug mit dem Hammer auf meine Hände, also versuchte ich sie zu Fäusten zu ballen, versuchte es nicht, sondern tat das unwillkürlich, ruckte und brüllte, natürlich vergebens, denn der Keller war tief und der Schreibtisch des Majors narrensicher am Boden festgeschraubt.
Der nette Major wünschte nicht, dass ich die Hände zu Fäusten balle, deshalb streckte er mir einen Finger nach dem anderen aus und nagelte ihn an die Schreibtischplatte, durch den Fingernagel, mit dünnen Tapezierstiften, bis ich ohnmächtig wurde und der Major selbst aufstehen, einen Eimer nehmen und mich mit eisigem Wasser wieder wach bringen musste, denn den Starschina hatte er ja schon entlassen, die Kinder brauchen ihren Vater.
Da sagte ich mir, was soll’s, ich unterschreibe. Reicht ja vielleicht jetzt. Am Ende unterschreiben alle, sagte der Major, und recht hatte er, mit einer Zange zog er die Nägel heraus, behutsam, damit es nicht zu weh tat, schraubte das Brett ab, das meine Hände auf der Platte hielt, gab mir in die blutenden, zitternden Finger die Zigarette mit goldenem Mundstück, gab mir ein Blatt Papier und Bleistift und sagte, na dann unterschreibt mal, Konrad Wilgelmowitsch, dann sind wir fertig für heute, und ich unterschrieb, was blieb mir anderes übrig.
Damals, glaube ich, habe ich das letzte Mal geschrieben. Unterschrieben hat man auch später manches, ganz sicher, schließlich hing ich danach noch nackt an der Decke, aufgehängt an den hinter dem Rücken zusammengebundenen Handgelenken, und der Genosse Major versuchte mich zu überzeugen, dass ich nach dem Geständnis, ein polnischer Spion zu sein, doch nun auch noch meine Komplizen verrate. Ich glaubte eigentlich, ich hätte mich als deutscher Spion bekannt, aber dieser Unterschied spielte für mich keine Rolle mehr jetzt, da mir mein eigenes Gewicht die verdrehten Arme aus den Schultergelenken zu kugeln drohte. Am Ende verriet ich alle möglichen, ich weiß gar nicht mehr wen, alle, nach denen man mich fragte, sogar dass Sofie für die Norweger spioniert, aber das erst später, damals sagte ich, ich allein sei Spion, sodass mich der Starschina, den der Major diesmal nicht nach Hause geschickt hatte, losband; sie kreuzigten mich zu einem X, fesselten die Extremitäten an Eisenringe, die an den Boden geschraubt waren, und der Unteroffizier nahm eine Lötlampe, dann packte er meine Genitalien mit einer Hand, drückte sie so, dass Schwanz und Eier aus dieser Faust herausstanden, als wären sie schon von meinem Körper abgetrennt. Dass das nicht so war, davon konnte ich mich überzeugen, als er die Lötlampe benutzte.
Also damals schrieb ich auch noch und unterschrieb, was sie mir vorlegten, schrieb sogar eigenhändig, mit zitternder Hand, irgendein Geständnis ab, mit einem Pflaster mussten sie mir Daumen und Zeige- und Mittelfinger mit dem Bleistift verkleben, ich schrieb, befleckte das Papier mit ein bisschen Blut, wofür der Major mich gutmütig tadelte, wie ein Pauker in der Grundschule rügte er mich, mit dem Zeigefinger. Was ich gestand, weiß ich nicht mehr, vermutlich alles. Danach gab es keine Gelegenheit mehr zu schreiben. Auch keine Lust.
Wozu schreiben, ist schon viel zu viel geschrieben worden. Ich galt später als Glückspilz. Erstens, weil ich aus dem Fenster zu fliehen versuchte, als sie mich holen kamen. Was haben sie mich beneidet damals, ein Professor, Entomologe angeblich und, als wäre das nicht genug, dazu noch Jude, erzählte mir im Holzschlag, als sie ihn holten, habe er ihnen noch Tee gemacht, dabei hatten sie ihm schon Gürtel und Schnürsenkel weggenommen, schließlich war er unschuldig, und das musste ein Irrtum sein. Sie nickten, Tee, gern, sie tranken und sagten, bestimmt ein Irrtum, komm mit, wir klären das, mitnehmen brauchst du nichts, wir haben es warm, Essen gibt’s auch, falls ihr hungrig werdet. Da ging er mit und bekam den Paragrafen 58–2 und zehn Jahre wie nichts, und der Entomologe konnte sich nie verzeihen, dass er ihnen diesen Tee gemacht hatte, dass er freiwillig mitgegangen war, schließlich war das ein Irrtum, und alles würde sich klären. Alle hatten diese Erinnerung, sie waren doch unschuldig, also gingen sie mit, um das klären zu lassen.
Und das wurde geklärt, wenn sie ihnen die Finger brachen, ihnen den Kopf unter Wasser steckten oder sie ununterbrochen schlugen, eine Stunde lang, allerdings in einen Teppich gewickelt für den Fall, dass ihre Aussagen im Prozess gebraucht wurden, dort mussten sie ja einigermaßen aussehen, nicht wie weich geklopftes Fleisch. Und ich wusste das. Darum beneideten mich meine Genossen an dem Ort, dessen Namen ich nicht nennen will, ich wusste es, sodass ich die Flucht versuchte und einem von denen, die mich festnahmen, eins in die Fresse gab. Ich tat, was ich konnte. Im Guten bin ich nicht mitgegangen, nein.
Was für ein Unterschied, könnte jemand meinen, ich saß genauso lang wie sie an dem Ort, dessen Namen ich nicht nenne, und doch macht es einen Unterschied, ob man zehn Jahre absitzt und sich in der Nacht fragt, was wäre, wenn man Widerstand geleistet hätte. Ich brauchte mir diese Frage nicht zu stellen, der Professor sehr wohl, aber im Grunde hatte das keine große Bedeutung, ob er sich die Frage stellte. Denn am Ende haben die beiden Kriminellen, der schon erwähnte Rebane und ein gewisser Gabaidze, von dem ich noch erzählen werde, diese beiden Urks haben ihn eines Nachts vergewaltigt und umgebracht, nachdem er Gabaidze nicht seinen Anteil von der Fällarbeit überlassen wollte. Zwei Tage zuvor hatten sie dem Häftling, der für die Gefängnisbilder zuständig war, befohlen, dem Professor das Wort «петух», also «Schwuchtel», und einen Davidstern auf die Stirn zu tätowieren, dann zwangen sie ihn, Gabaidze mit dem Mund gefügig zu sein, und setzten ihm das Messer an die Kehle. Die Tätowierung war natürlich nicht freiwillig, der Professor wehrte sich gar nicht erst, er wusste, was dann passieren würde – Rebane sagte, wenn er Theater macht, dann haut er ihm mit der Axt den Schädel ab und stickt ihm dann die «Schwuchtel» drauf, ganz wie er will. Er wollte es lieber auf nicht abgehacktem Kopf. Und später, am anderen Tag, taten wir auf unseren Pritschen im Dunkeln so, als hörten wir nicht, wie Rebane und Gabaidze lachen und stöhnen, wie der Professor winselt, wie sie ihn über die Bank gelegt und die Hände an die Beine der Bank gefesselt hatten, ihm die Hose vom Hintern zogen, Gabaidze ihm eine Schlinge um den Hals legte und anzog, damit der Professor nicht strampelte, denn sonst würden sie ihn gleich erwürgen, deshalb strampelte er gar nicht erst, sondern war gleich halb erstickt, und Rebane, groß, tätowiert, mit Lenin und Stalin auf der Brust, Schulterstücken, einem nackten Weib auf dem Bauch, mit Symbolen und Buchstaben auf den Handrücken, stellte sich hinter den Professor, packte ihn wie ein Weib an den Hüften und vergewaltigte ihn und keuchte, und wir alle taten so, als hörten wir nichts, und erst am anderen Morgen fanden wir den Entomologen, als wir zur Arbeit gingen, über die Bank gebogen, schon erkaltet, den Hintern immer noch rausgestreckt, die Hose an den Knöcheln, die Hände an die Bankbeine gefesselt mit ganz blauem Gesicht und rausgestreckter Zunge, schon schwarz. Das war ein bisschen unheimlich.
Fanden jedenfalls manche.
Ich war froh, das gebe ich zu, dass da der Professor kalt auf dieser Bank lag und nicht ich, denn ich hatte ja Pläne, Mann, wirklich. Ich hatte noch so einiges vor.
Es hieß später, sie hätten ihn nicht umbringen, sondern nur ein bisschen quälen wollen, damit er einen ordentlichen Anteil am Holzschlag an die Diebe im Gesetz abgibt, die überhaupt nicht arbeiten gingen, was half ihnen ein toter Professor, nur habe Schwesterchen Gabaidze, das ihm die Schlinge um den Hals legte, etwas zu doll zugezogen, und Rebane brauchte zu lange, und als er endlich kam, war der Entomologieprofessor tot.
Na jedenfalls, Professor hin oder her, soll der jetzt im Jenseits seine Schmetterlinge oder Käfer erforschen, ich konnte mir jedenfalls nicht vorwerfen, dass ich die Flucht nicht versucht hätte. Hab ich nämlich, hab das Fenster eingeschlagen, um aufs Schuppendach zu springen und weiter über den Zaun, wollte blöderweise zum Wasser, zum Hafen, aber meine Hose blieb schon am Zaun hängen, dort haben sie mich gekriegt. Widerstand habe ich auch geleistet, einer kriegte was in die Fresse, dass er taumelte, mir war klar, dass sie mich vor dem Urteil nicht umbringen konnten, mich verhören mussten, und eine Leiche kann man nicht verhören, deshalb setzte es nur was mit Gewehrkolben für diesen Schlag, und ich durfte die restliche Zeit an dem Ort, dessen Namen ich nicht aussprechen will, an diesen Schlag zurückdenken. Sie flüsterten: Als Konrad Wilgelmowitsch geschnappt wurde, da hat er einem Soldaten in die Fresse gehauen. Sogar die Diebe zollten mir Respekt, in Maßen zwar, aber immerhin. Niemand wagte es, mich so zu behandeln wie den Professor.
Im Guten kriegten sie mich nicht. Das hielt ich mir die ganze Zeit vor Augen.
Und dass Sofie und die Mädchen schon außerhalb ihrer Reichweite waren. Ich hatte bleiben müssen, denn wäre ich am Morgen nicht auf dem Amt erschienen, dann hätten sie unterwegs alle vier von uns geschnappt, zack. Ich konnte nicht mit. Mich hätten sie nicht so weit aus der Stadt gelassen, bis an die Küste, denn ich war damals ein unsicheres Element. Radek hatte auch schon Feuer unterm Arsch. So nahm Sofie die Mädchen, setzte sie auf den Schlitten, nahm den Passierschein, den sie mit der Begründung bekommen hatte, dass sie ihre Eltern besuchen will, nahm unser ganzes Bargeld und alles Gold, viel war es nicht, aber für Bestechungen musste es reichen, und fuhr nach Zypnawolok, wo ihr Vater stellvertretender Vorsitzender des Dorfsowjets war.
Dort in Zypnawolok sollte sie ein Motorboot stehlen und in der Nacht nach Westen fahren, nach Vardø, bei schlechtem Wetter wenigstens bis zur finnischen Seite der Grenze, in das damals finnische Petschenga, was auf Finnisch Petsamo heißt.
Sofie, Tochter eines Fischers aus Zypnawolok, kannte diese Gewässer besser als jeder Grenzer, kannte das Meer, hatte keine Angst, nachts zu fahren. Sie musste es schaffen. Sie hatte das im Blut. Ich weiß nicht, ob man so etwas im Blut haben kann, Sofie jedenfalls hatte. Sie stammte von den Norwegern auf Kola ab, die die treulosen Ufer der Halbinsel vor hundert Jahren besiedelt hatten und vom Fischfang in der Barentssee lebten. Arktische See floss in ihrem salzigen Blut, sie kannte es von Kindheit auf, deshalb glaube ich, sie