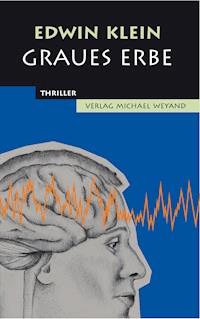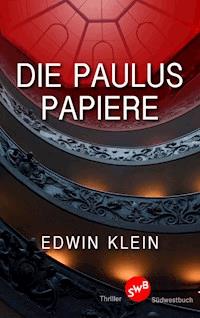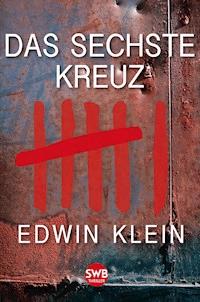
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SWB Media Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während eines Attentates sterben Gregors Frau und sein Sohn. Die sechzehnjährige Tochter wird entführt und taucht nach einem halben Jahr hochschwanger wieder auf. Gregor selbst wird schwer verletzt, ist seitdem körperlich ein Wrack und sitzt im Rollstuhl. Fünf Jahre dauert es, bis er wieder einige Meter laufen kann. Aber sein Plan, von Rache genährt, wird im Augenblick der Tragödie geboren und wächst jeden Tag. Nach zehn Jahren macht sich Gregor auf die Suche nach den Attentätern aus dem Kosovo, die einen jugoslawischen Diplomaten überfallen haben. Er wollte dem europäischen Gerichtshof entlastende Beweise für den Völkermord unterbreiten und dadurch den Kosovo belasten. Für Politik und Diplomatie hat Gregor nichts übrig. Ihn interessiert nur, wenn er hinter einem Namen ein Kreuz machen kann. Dann gibt es einen Attentäter weniger. Aber außer Gregor gibt es noch jemanden, der Kreuze macht, um alle Spuren der Vergangenheit zu verwischen. Und Gregor steht auch auf der Liste des Unbekannten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Es ging ihr gut – das glaubte sie zumindest. Ihre neue kleine Welt war scheinbar in Ordnung. Schon seit Längerem fühlte sie sich nicht mehr eingeengt. Sie durfte sich frei im Haus bewegen, ungehindert von ihrem Zimmer über den Flur in die Küche und ins Wohnzimmer oder sogar hinterm Haus auf die Toilette gehen. Auch ins Obergeschoss konnte sie, wo sich eine schlicht eingerichtete Mansarde und ein Abstellraum befanden. Oder in das Souterrain mit zusätzlich vier kleinen, nicht allzu komfortablen Zimmern. Sogar auf die Terrasse setzte sie sich manchmal und schaute träumerisch über die Pinien ins Tal, wo sich ein kleiner Fluss schlängelte. Und hinter ihr der dicht bewaldete Berg, an dem sich das Haus anlehnte, majestätisch, wuchtig, scheinbar unüberwindbar. Im vergangenen Winter war sogar die Kuppe einmal in Weiß getaucht, was, wie man ihr sagte, eine Seltenheit sei und nur alle paar Jahre vorkomme. Wie gesagt, es ging ihr eigentlich gut. Warum also sollte sie sich beschweren? Warum sich mit der Vergangenheit beschäftigen?
Nur wenn sie von der Terrasse die wenigen Stufen hinunter bis auf den mit Gras bewachsenen Vorplatz gehen wollte, kam sie nicht allzu weit. Dann spannte an ihrem rechten Fußgelenk die Kette, die silbern glänzte und leicht rasselte, wenn sie sie hinter sich herzog. Sie war nicht schwer, eher feingliedrig und unscheinbar mit einem kleinen Schloss und am Knöchel mit Leder unterlegt, damit es keine blutenden Stellen mehr gäbe.
In den ersten Tagen kam sie sich angeleint vor wie ein Tier. Immer wieder hatte sie versucht, die Kette von ihrem Fußgelenk abzustreifen. So lange, bis es blutete und sich die Stelle entzündete und pochte.
Die Kette war so filigran, dass sie in ihre Finger schnitt, falls sie sich einmal unter der Tür verklemmte und sie unüberlegt etwas heftiger an ihr zog. An den Holzrahmen der Türen waren deshalb knapp über dem Fußboden ihre Spuren eingeritzt, ebenso an den Stuhl- und Tischbeinen.
In die Hand genommen, vermittelte sie ihr das Gefühl, sie wäre nie in der Lage, diese Kette ohne fremde Hilfe abzustreifen. Jeden weiteren Gedanken, eventuell das Schloss mit einem Messer oder einer Gabel aufzuhebeln, hatte sie bereits nach den ersten Versuchen aufgegeben. Als sogar das Fleischerbeil, mit dem sie die auf ein Holzbrett gelegte Kette malträtierte, um sie sprichwörtlich zu köpfen, keine Wirkung zeigte, da hatte sie ihre Versuche endgültig eingestellt und sich gefügt. Dieser deutsche Stahl, auch in noch so feine Glieder gegossen und geschmiedet, war unzerstörbar.
An die kettenlose Zeit davor verblasste die Erinnerung mehr und mehr. Das war gut so, denn inzwischen hatte sie sich sogar mit der Kette arrangiert. Kleine Söckchen konnte sie anziehen, Strümpfe nur, wenn sie sie herunterrollte oder die Kette zum Teil in ihnen verschwinden ließ. Schuhe bereiteten überhaupt keine Probleme. Und das Duschen auch nicht, falls genügend warmes Wasser vorhanden war.
Am einfachsten war es, wenn sie ein Kleid oder einen Rock anzog, was bedeutete, sie hatte beides über den Kopf zu streifen. Slips trug sie deswegen zu Beginn keine. Bis sie auf die Idee kam, eine Seite aufzuschneiden und zwei Knöpfe und kleine Schlaufen anzunähen.
Wollte sie eine lange Hose anziehen, war ihr Bewegungsradius um die Länge des Hosenbeines reduziert, denn die Kette ragte dann zuoberst am Gürtel heraus.
Sogar an das Geräusch der Kette hatte sie sich längst gewöhnt. Ein feines Schaben auf dem groben Holzboden, ein leises Klackern auf den Fliesen in der Diele und im Bad und ein leichtes Scheppern, wenn sie die Treppe nach oben stieg oder wieder hinunterging. Falls es jemand darauf anlegte zu wissen, wo sie sich im Haus befand, die Kette verriet immer ihre Position.
Sie erschrak nur noch dann, wenn jemand unerwartet an der Kette zog und ihr damit zu verstehen gab, etwas von ihr zu wollen. Und falls sie sich nicht beeilte, diesem Kettenwunsch nachzukommen, wurde der Ruck heftiger und schmerzhafter. Doch sie merkte auch, dass es ihr von Tag zu Tag schwerer fiel, so behände wie früher den Kettenwünschen nachzukommen. Ihr Rücken schmerzte, und ihr Bauch wurde immer dicker. Manchmal glaubte sie, dass sich dort bereits etwas bewegte, und dann schlich sich ein Lächeln auf ihr Gesicht. Nur dann.
Er sträubte sich manchmal gegen die Erinnerung. Sie zeigte ihm zu offensichtlich, was er alles verloren hatte. Nun musste er sich arrangieren, jeden Tag aufs Neue. Es fiel ihm nicht leicht. Mit den Jahren hatte er gelernt, kleine Schritte zu machen und nicht den großen nachzutrauern. Er war demütig geworden. Und verbittert. Aber nicht entmutigt. In ihm kochte und brodelte es. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Und irgendwann würde er … Ja, das würde er. Für ihn gab es nur noch dieses Ziel. Und wenn sich auch nur ansatzweise ein Zweifel meldete, dann brauchte er sich nur zu erinnern.
Hundert Meter hatte er geschafft. An guten Tagen waren es auch schon mal hundertfünfzig, aber mit seiner heutigen Leistung war er dennoch zufrieden. Er setzte sich auf eine Bank nicht weit entfernt von den Gleisen der Straßenbahn, verschnaufte und betrachtete die Passanten. So ausgiebig und intensiv, wie er das tat, schien er nach einer ganz bestimmten Person Ausschau zu halten. Einigen blickte er etwas länger nach, ohne richtig sagen zu können, warum. Irgendein Aspekt musste ihn interessiert haben.
Eine Straßenbahn hielt gleich neben ihm. Menschen sprangen heraus, andere hinein, ein Einkaufskorb schlug gegen seine Schulter. Die Entschuldigung war wohl zu leise für ihn ausgesprochen worden, denn er hatte nichts gehört. Ohne sich darüber aufzuregen, sah er der jungen Frau mit dem Kind an der Hand hinterher, die es sehr eilig hatte.
Nach wenigen Minuten stand er auf und machte sich auf den Rückweg zu seiner Wohnung in der Prinz-Georg-Straße. Wegen seiner Art zu gehen, würden viele im ersten Augenblick vermuten, er hätte zu viel getrunken. Leicht schwankend und einen Fuß wie suchend vor den anderen setzend, bewegte er sich vorsichtig und langsam, als sei ihm der Gleichgewichtssinn abhandengekommen und als hätte er Angst vor Unebenheiten. Seine Arme schaukelten dabei, als müssten sie etwas ausbalancieren. Und das rechte Bein zog er auch noch etwas nach, wobei seine Hüfte leicht einknickte.
Schaute man jedoch in sein Gesicht, verflüchtigte sich der Eindruck, man habe möglicherweise einen Betrunkenen vor sich. Äußerst konzentriert wirkte er, die Lippen aufeinandergepresst, und auf seiner Stirn standen kleine Schweißperlen. Den Kopf trug er leicht nach vorn geneigt, denn eine Stolperstelle zu übersehen, konnte für ihn sehr schmerzhaft sein und schlimme Folgen haben.
Bei Nummer 126 angekommen, schloss er die Eingangstür auf und schwebte mit dem Fahrstuhl in den fünften Stock, eine großzügige Penthouse-Wohnung mit Blick über Düsseldorf. Er zog seine Jacke und die kräftigen Schnürschuhe aus und schlüpfte in Pantoffeln, mit denen er gleitend den Teppich umrundete und durch das Wohnzimmer in die Küche schlurfte. Dort blieb er einige Sekunden unschlüssig stehen – ein Gedanke, dem er nachging –, schließlich trank er ein Glas Wasser.
Wieder zurück im Wohnzimmer setzte er sich in einen Sessel, dessen Sitzfläche etwas erhöht war, und massierte sein linkes Knie. Warum er das linke massierte, wusste er nicht, denn es war nahezu gefühllos und bestand aus Titan. Es war bereits sein zweites Implantat, denn das erste hatte sich nach zwei Jahren aus dem Unterschenkelknochen gelöst. Zu gut erinnerte er sich daran, wie die Ärzte auf den Zement geschimpft hatten.
Um alles zu massieren, was ihn schmerzte, dafür hatte er nicht genug Hände. Sein rechter Knöchel, wo ein großes Stück des Knochens herausgerissen worden war, machte sich bei jedem Schritt und erst recht beim Wetterumschwung bemerkbar. Gleichfalls die rechte Hüfte, wo sich ebenfalls ein Ersatzteil befand, mit dem er sich aber inzwischen gut angefreundet hatte. Von ihm gingen die wenigsten Beschwerden aus. Mit Abstand die meisten Probleme bereitete ihm hingegen seine Wirbelsäule im Lendenbereich, an der man drei Wirbelkörper versteift hatte, um die Schmerzen einigermaßen zu lindern und den Druck auf die Nerven abzumildern, was aber seiner Meinung nach fehlgeschlagen war. Eine Folge dieser Maßnahme war seine aufrechte Körperhaltung mit durchgedrückter Wirbelsäule, als hätte er, wie man landläufig sagte, einen Stock verschluckt.
Einen Blick auf die Uhr, noch hatte er etwas Zeit. Im Fernsehen sah er sich die Nachrichten an, las einen Artikel in einem Magazin, erhob sich anschließend und ging in sein Arbeitszimmer zum PC. Im Internet war er schon lange auf der Suche nach einem ganz bestimmten Zeichen. Es war ein sechszackiger Stern, bei dem ein Zacken umgebogen oder umgeklappt war. Auch heute wurde er nicht fündig. Viele Möglichkeiten zu suchen blieben ihm nicht mehr. Es war wie verhext, und manchmal fragte er sich, ob er sich vielleicht nicht doch getäuscht hatte und er in der Aufregung möglicherweise etwas anderes gesehen hatte. Immerhin war er schwer verletzt gewesen, hatte starke Schmerzen empfunden und war kurz darauf von einer Bewusstlosigkeit erlöst worden. Exakt an diesem Punkt schalt er sich einen Idioten. War es schon so weit, dass er sich selbst nicht mehr glaubte? Die Ungewissheit nagen ließ? Und das ausgerechnet bei der für ihn wichtigsten Sache der Welt?
»Sechszackiger Stern, ein Zacken umgebogen oder umgeklappt«, knurrte er vor sich hin in einem Ton, der ihm zeigte, er war wütend auf seine seltsamen geistigen Kapriolen. Mit der flachen Hand schlug er wie zur Bestätigung auf den Tisch und beendete dadurch seine Diskussion mit sich selbst. Alles konnte er gebrauchen, nur keine Selbstzweifel. Dann würde seine schöne Version einstürzen, und alles ergäbe keinen Sinn mehr.
Es wurde Sturm geklingelt. Tochter Vivian, bepackt mit Tüten, und Enkel Sebastian standen erwartungsvoll vor ihm. Er ließ sie eintreten, schloss die Wohnungstür und ging zu seiner Tochter, die in der Küche die Einkäufe auspackte.
»Was gibt es Neues?«, wollte sie wissen.
»Am Vormittag ein Anruf vom Bundeskriminalamt. Mal wieder.« Gregor verdrehte leicht die Augen, als wollte er damit eine gewisse Belanglosigkeit andeuten.
»Und, interessantes Gespräch?« Vivian strich sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht.
»Eigentlich so wie immer«, entgegnete Gregor. »Wie es uns gehe, ob wir mit allem zufrieden seien, und ein paar allgemeine Fragen. Man sei immer noch an dem Fall. Aber das klang irgendwie, als wollte man sich für die Untätigkeit entschuldigen. Und dass man sich lange nicht gemeldet habe. Man werde die Angelegenheit demnächst einer neuen Abteilung übertragen. Ich gehe davon aus, dass man uns bald besucht, und zwar von dem neuen Sachbearbeiter.«
»Wollten sie auch was von mir?«, fragte Vivian ohne eigentliches Interesse.
»Nein. Wir haben nicht über dich gesprochen.«
»Dann scheinen sie sich ja an unsre Vorgaben zu halten.«
»Möglich. Aber intern wirst auch du immer noch ein Thema sein.«
Vivian stellte sich auf die Zehenspitzen und hauchte ihrem Vater einen Kuss auf die Wange. »Ich weiß nicht, was du hast. Ich erinnere mich nicht mehr. An nichts. Was also können sie von mir wollen?« In ihren grünblauen Augen blitzte es übermütig.
Gregor lächelte und legte einen Arm um die Schulter seiner Tochter, die es dem Aussehen nach mit jedem Model hätte aufnehmen können. Allerdings war Vivian wesentlich sportlicher, und wenn Gregor ihr den Rücken streichelte, dann spürte er die ausgeprägte Muskulatur. Das Ergebnis eines äußerst intensiven Fitnesstrainings an mindestens zwei Abenden in der Woche und vielen Selbstverteidigungskursen.
Sie gingen ins Wohnzimmer, wo mittlerweile Sebastian mit der Fernbedienung versuchte, den für ihn richtigen Sender einzustellen.
»Kannst du am Wochenende auf Basti aufpassen?«, fragte Vivian. »Von Samstagnachmittag bis Sonntagabend?«
»Sicher, ich bin zu Hause.«
»Prima, danke.«
Vivian war oft unterwegs, als versuchte sie, sich durch eine andere Umgebung abzulenken. Sie brauche das, hatte sie ihm einmal gesagt. Auch über die Woche, wenn sie abends ausging, hie und da mit Kunden zu einem Geschäftsessen oder auch schon mal mit Freundinnen auf einen Plausch. Das bringe sie auf andere Gedanken. Nachmittags bummelte sie in der Stadt oder sie fuhr zum Shopping nach Köln. Nicht zuletzt brachte es auch ihr Beruf mit sich, dass sie viel reiste. Oft spielte er dann den Babysitter. Und wenn er keine Zeit hatte, kam bereits seit Jahren immer das gleiche Kindermädchen, dem Alter nach doch wohl eher eine Kinderfrau, denn sie ging auf die vierzig zu. Sie besaß ihr volles Vertrauen, blieb auch schon mal über Nacht und schlief dann im Gästezimmer.
Gregor setzte sich neben seinen Enkel und streichelte seinen Kopf.
»Wie war der Sport?«
»Klasse.«
»Wen hast du heute umgenietet?«
Sebastian schaute ihn von der Seite an, als zweifelte er am Verstand seines Großvaters. »Wir nieten niemanden um«, stellte er richtig.
»Ach so, habe ich vergessen. Was also habt ihr heute gemacht?«
»Falltechniken geübt.«
»Das kann doch jeder«, bagatellisierte Gregor, um Sebastian etwas zu kitzeln.
»Aber du nicht mehr«, konterte der knapp Zehnjährige.
»Da hast du recht.«
Unaufgefordert stand Sebastian auf, stellte sich auf den Wohnzimmertisch, bemerkte nicht das besorgte Gesicht seiner Mutter, sprang runter auf den Teppich, knickte ein und rollte seinen Körper so ab, dass er, ein Bein auf dem Boden, das andere aufgestellt, gebückt zum Stillstand kam und sogleich aufstehen konnte.
»Siehst du, das haben wir geübt.« Als sei nichts gewesen, setzte er sich wieder neben seinen Großvater.
»Toll. Das hätte ich auch früher nicht gekonnt«, gab Gregor zu. »Du bist ja eine Kanone.«
Sebastian grinste den Älteren von der Seite an. Er hatte ein lustiges Lausbubengesicht mit Sommersprossen, Stupsnase und einer riesigen Zahnlücke im Oberkiefer, wo einmal die vorderen Schneidezähne sein würden.
Wer denkt, die Wege des Herrn sind sonderbar, der kennt noch nicht die mancher Behörden und Verwaltungen. Dort werden Entscheidungen gefällt, auch und besonders wenn es um Bewerbungen auf eine bestimmte Stelle geht, die in ihrer nicht nachvollziehbaren, konspirativen und verschlungenen Art auch ohne weißen Rauch nur noch durch die des Klerus übertroffen werden. Die Eingebung durch den Herrn auf der einen Seite wird im weltlichen ersetzt durch die Floskel: Nach eingehender und intensiver Prüfung … Manchmal muss auch die Formulierung herhalten: Nach Abwägung aller Optionen und Alternativen sind wir zu dem Ergebnis gekommen …
Das Prinzip der Nichtüberprüfbarkeit wird zur Maxime erhoben, die Qualität bleibt auf der Strecke, Seilschaften haben Dauerkonjunktur, als treffe das Sprichwort zu, nur Dumme können keine Fehler machen. Eben weil sie sogar dazu zu …
Jeder wusste, eigentlich hätte Giselle Haverkamp die neue Abteilungsleiterin im Bundeskriminalamt werden müssen. Nicht nur, ihre profunden Kenntnisse, ihre Erfahrungen, ihr logischer und extrem belastungsfähiger Verstand – sogar ihre soziale Kompetenz, vielleicht die einzige Schwachstelle, hätte allen Anforderungen vollauf genügt.
Für alle überraschend bevorzugte man eine Kollegin, der auch ihre größten Neider nicht annähernd Giselles Qualifikationen zugestanden. Und erst recht nicht ihr Äußeres. Aber vielleicht war es gerade ihr phänomenales Aussehen, welches ihr im Wege stand, denn die Erfüllung der Frauenquote war ausschließlich geschlechtsspezifisch zu verstehen und nicht gekoppelt an frauliche Attribute. Nirgends stand geschrieben, dass Frauen schön und apart sein sollten – was für ein Glück für ihre Rivalin Carla Meutgens. Nie kämen Männer in Carlas Gegenwart bei Besprechungen in die Verlegenheit, sich durch körperliche Reize ablenken zu lassen. Weil nicht vorhanden, konnten sie sich umso intensiver mit den ihnen vorliegenden Unterlagen befassen, bei klarem Kopf denken, ihre Vorgesetzte emotionslos und ohne erhöhten Pulsschlag anschauen und sich schnell wieder abwenden.
Untergebene hatten den Eindruck, sich einem Wesen fügen zu müssen, welchem man, gestraft durch all die nichtvorhandenen Merkmale, denen sich Frauen gern rühmten, als Ausgleich die Leitung der Abteilung übertragen hatte. Unvorstellbar, dass ihre unverheiratete Chefin in den kommenden Jahren auch nur ansatzweise ihren Beruf und dem Ansehen des Amtes durch Affären beeinträchtigen könnte. Und alle Ehefrauen stimmten seit der Amtseinführung und dem anschließenden zwanglosen Treffen sofort zu, wenn ihre besseren Hälften wieder einmal Überstunden für Carla zu absolvieren hatten. Wo, so fragten sie sich, waren sie besser und gefahrloser aufgehoben als im Dienst?
Zugutehalten musste man der neuen Abteilungsleiterin, dass man es für unmöglich hielt, Carla hätte sich durch die Betten ihrer diversen Vorgesetzten nach oben geschlafen. Vielleicht war das genaue Gegenteil der Fall?
Wie auch immer, Carla war die neue Abteilungsleiterin. Inzwischen hatte Giselle Haverkamp die scheinbare Schlappe längst überwunden, nur zweite Wahl gewesen zu sein und verloren zu haben. Als Siegertyp waren zweite Plätze nun mal nichts für sie. Aber sie konnte sich bereits nach wenigen Tagen wieder darüber amüsieren, wie ihre Vorgesetzten sich bemühten, ihr die seltsame Entscheidung zu erklären. Wie sie zu stammeln anfingen, wenn sie ihnen in die Augen sah, sich ein Lächeln in ihr Gesicht schlich und dabei so ihre Mundwinkel veränderte, dass sie kein Wort zu sagen brauchte, damit ihr Gegenüber ihre Auffassung erkennen konnte. Und die tat sie auf ihre Weise ungeschminkt und brutal kund. Allein schon, wenn sie ihre Hand auf den Unterarm eines Kollegen legte, ihn zu einer Tasse Kaffee einlud, sich bei ihm unterhakte und mit ihm zur Kantine spazierte, sie bei ihm den unsicheren Gang, kurz vor dem Stolpern, bemerkte, war sie ausgesprochen erfreut darüber, mit all dem gesegnet zu sein, was ihre Rivalin sich immer wieder im Kino anschauen musste.
Oftmals waren es kleine, fast unscheinbare Signale, die eine große Bedeutung hatten. Und Giselle konnte sie deuten. Ohne dass sie auch nur ein negatives Wort über ihre Niederlage verlor, war man bemüht, sie zu besänftigen, und installierte ihretwegen eine neue, kleine, schmucke Abteilung, die ausschließlich denen der Chefetage Rechenschaft abzulegen hatte. Allerdings war ihre Aufgabenstellung nicht allzu erfreulich und man begründete sie damit, dass man ausgesprochen viel von ihr hielt, von ihrer Logik und ihrer Intelligenz, weswegen man selbstverständlich auch nur sie allein mit dieser speziellen, äußerst wichtigen Angelegenheit habe betrauen können. Wenn überhaupt, dann war allein sie ihr gewachsen. Zu offensichtlich waren die Schmeicheleien, um von ihr ernst genommen zu werden. Zur durchsichtig die Taktik, mit vielen schönen Worten zu umschreiben, dass ein verflixt harter Job auf sie zukommen würde.
Giselle erschrak schon etwas, als sie in Begleitung des Vizepräsidenten zum ersten Mal ihr neues Büro betrat. Auf ihrem Schreibtisch türmten sich insgesamt neun Fälle. Die wichtigsten, die es in der Nation zu lösen gebe. Etliche von ihnen seien bereits zehn Jahre alt und mehr, deren Aufklärung sei auch eine Frage der inneren und äußeren Sicherheit, wie der Vizepräsident betonte. Sicherlich für sie eine besondere Herausforderung, genau und explizit an diesen Fällen zu arbeiten, an denen sich bereits mehrfach hochgeschätzte Kollegen und ganze Abteilungen die Zähne ausgebissen hätten, oder etwa nicht?
Im süffisanten Unterton verwies der schlanke, grauhaarige Mann mit Brille auf einen besonderen Fall, an dem sich, er senkte vertraulich die Stimme, sogar der jetzige Präsident des Amtes über Jahre vergeblich um Aufklärung bemüht habe. Es sei derjenige mit der blauen Schraffur auf der Rückseite des Ordners. Vielleicht könne sie sich genau diesen zuerst … Sie persönlich und ausschließlich, nicht ihre Kollegen, wegen der Brisanz, sie verstehe schon … Und wenn erfolgreich gelöst, dann stünden ihr doch wohl alle Türen offen, sogar die nach ganz oben.
Giselle schaute den Vertreter des Präsidenten an, der sich, wenn er ihren lasziv herablassenden Blick richtig deutete, offensichtlich von ihr nicht ernst genommen fühlte. Er hüstelte, stellte ihr die neuen Kollegen vor, spielte unentwegt an seinen Manschettenknöpfen und verabschiedete sich schnell nach einigen salbungsvollen Worten, leider ein unaufschiebbarer Termin. Aber wenn sie seinen Rat und seine Unterstützung wünschte, dann wisse sie ja, wo sie jederzeit …
»Schwätzer«, war alles, was Giselle sagte, nachdem der Endfünfziger im teuren Maßanzug und mit der sportlich antrainierten Figur, die von seinem Alter ablenken sollte, den Raum verlassen hatte.
Sie machte sich mit den neuen Kollegen bekannt, alle kurz vor und eben gerade vierzig Jahre alt, während sie bereits auf die fünfzig zusteuerte, was man ihr jedoch nie zugestanden hätte. Man hielt sie für vierzig, und jünger wollte sie auch nicht erscheinen und eingeschätzt werden. Vierzig, in voller Blüte ihrer Weiblichkeit und ihrer femininen Ausstrahlung, das genügte ihr. Und niemand außer ihr hätte verstehen können, dass sie drei Kilogramm oder sogar vier an bestimmten Stellen abzuschmelzen beabsichtigte. Käme dieses Thema einmal zur Sprache, würden nach entsprechendem Protest, das habe sie doch wirklich nicht nötig, die Blicke der Männer immer wieder auf ihrer Oberweite haften bleiben und ihre Augen in Vorstellung der drei oder vier Kilogramm einen bedauernden Ausdruck annehmen. Etwa nach dem Motto: aber doch bitte nicht genau dort und hier. Wäre eigentlich schade drum.
In den kommenden dreißig Minuten ließ sich Giselle von ihren Mitarbeitern, die sich bereits seit einigen Tagen in die neue Materie eingearbeitet hatten, über die neun Fälle aufklären. Einige total alte Kamellen, an die niemand mehr interessiert sei. Dann einer, der überwiegend in Süddeutschland spielte, Neonazis, wieder einmal Neonazis mit Verbindungen nach Tirol. Sollte kein allzu großes Problem sein.
Aber der vom Guru angesprochene, damit war der Vertreter des Präsidenten gemeint, der habe eine enorme Brisanz, weil er seit mehr als zehn Jahren bis in die Neuzeit ausstrahle. Dieser spezielle Fall war also ausschließlich für sie bestimmt, sozusagen als Test oder was auch immer. Und wenn sie ihn nicht löste, war es gleichzeitig eine Rechtfertigung, warum man sie bei der Stellenvergabe nicht berücksichtigt hatte. So zumindest sahen es ihre Kollegen, und sie lagen damit genau richtig.
»Gut, dann werden wir mit dem beginnen, was bedeutet, er wird für mich der Schwerpunktfall sein, und beim Misserfolg wird allein mein Kopf rollen. Ihr kennt den Fall ja bereits in Grundzügen und übernehmt die anderen, sprecht euch ab und arbeitet mir zu, falls erforderlich.«
Giselle schaute die drei Männer an, von denen sie bereits zwei kannte. Und der Dritte fühlte sich unausgesprochen aufgefordert zu erklären, was er denn hier suchte.
»Klaus Behring, ich komme vom Landeskriminalamt. Spezialgebiet Forensik und psychogene Analyse.«
»Interessant.« Giselle nickte und lächelte leicht. Interessant war vieles für sie, es war eine Art Brückenwort, welches ihr Zeit verschaffen sollte, bis sie sich eine Meinung gebildet hatte. Interessant war auch, was sie überhaupt nicht interessierte. Und je nachdem, wie sie das Wort aussprach, konnte man das auch heraushören.
Behring schlug die Augen nieder, und Giselle kam es nicht zum ersten Mal so vor, als wäre sie als Vollblutfrau genau damit auch etwas im alltäglichen Umgang gestraft. Obwohl sie, wie sie es sich gegenüber immer wieder gern zugeben musste, genau diesen Umstand der weiblichen Bevorzugung genoss. Und die Tatsache, die Klaviatur aller ihr von der Natur mitgegebenen Waffen geschickt einsetzen zu können. Erst recht, wenn ihr Gegenüber, von der geballten Fraulichkeit in die Defensive gedrängt, als Ausgleich hoffte, es möge doch bitte nicht auch noch allzu viel an Intelligenz hinzukommen, um nicht ganz ins Hintertreffen zu geraten. Leider musste Giselle die Hoffenden enttäuschen, manche sogar auf eine Art, dass sie sich verprellt und fortan gehemmt fühlten und ihr aus dem Weg gingen. Oder nicht unbedingt mit ihr zusammenarbeiten wollten.
»Dann wollen wir uns mal diesen Fall vornehmen. Ich gehe davon aus, ihr habt euch bereits darüber informiert. Wer ist mit den Grundzügen vertraut?«
Es war Fallauf, seit zwölf Jahren beim BKA, der sich bereits mehrmals mit diesem Fall beschäftigt hatte und deshalb die Einführung übernahm. Ein aufsehenerregendes Ereignis vor ziemlich genau zehn Jahren, als man mitten in der Stadt Luxemburg ausgangs eines Autobahntunnels einen Konvoi gestoppt und den wichtigen Insassen, ein jugoslawischer Parlamentarier, gekidnappt hatte. Der Unterhändler war von Belgrad kommend mit entlastenden Beweisen angereist. Diese waren gedacht für den damals einsitzenden und sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu verantwortenden ehemaligen Ministerpräsidenten seines Landes, Milošević.
»Und warum ist er in Luxemburg gelandet und nicht in Brüssel oder Amsterdam?«, wollte Giselle wissen.
Fallauf blätterte in seinen Unterlagen. »Wenn ich mich recht erinnere, sollte in Luxemburg vorab ein Treffen mit verschiedenen Europa-Abgeordneten stattfinden.«
Fallauf fand den entsprechenden Hinweis. »Die wollten sich informieren«, fügte er hinzu. »Deshalb der Umweg über Luxemburg oder der Zwischenstopp.«
»Was bedeutet«, warf Giselle ein, »die Attentäter waren ausgezeichnet informiert.«
»Sind es überhaupt Attentäter?«, wollte Behring wissen. »Oder nur Gangster oder Verbrecher.«
»Von allem etwas«, entgegnete Giselle. »Geiselnehmer sind sie auch noch. Zumindest scheint mir die Tat politisch motiviert, lassen Sie uns deshalb bei Attentäter bleiben.«
Giselle verwies auf die Akten, in denen auch immer wieder von Attentätern gesprochen werde. Nachdem dieser Aspekt geklärt war, wandte man sich wieder dem eigentlichen Thema zu.
»Gab es da nicht auch noch einige tragische Momente?«, glaubte sich Giselle zu erinnern und gab dadurch dem Gespräch eine andere Richtung. »Kamen nicht Unbeteiligte zu Schaden?«
Fallauf nickte, und Kollege Behring ging zu einem Fernseher und schaltete ihn ein.
»Das Material haben wir aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. Deshalb die unterschiedlichen Blickwinkel und die unterschiedliche Qualität.« Fallauf zuckte mit der Schulter, als wollte er sich dafür entschuldigen und öffnete einen Jackenknopf. »Wir …«, er meinte Schwind, Behring und sich selbst, »… wir haben es uns bereits gestern und heute mehrmals angeschaut.«
Nach einigen schwarzen Flecken, schrägen Querbalken und kaum zu erkennenden unterschiedlichen Ziffern, die rasend schnell vorbeiflimmerten, waren die ersten Bilder zu sehen. Ein Stau auf der Umgehungsautobahn E44 vor dem Howalder Tunnel, der von außen fast uneinsehbar mitten im Waldstück Buchholz Bos liegt. Die Ursache war ein quer stehender Lkw. Aufgenommen von einem Luxemburger Autofahrer mit seinem Handy, und die deutlich besseren Bilder von einem Touristen mit einer Kamera.
»Geschickt eingefädelt«, erklärte Fallauf. »Kurz vor dem Lkw ist das Fahrzeug mit dem Serben, den man gerade vom Flugplatz Findel abgeholt hat. Davor ein Begleitfahrzeug und eines dahinter. Scheinen ihn also doch wichtig genommen zu haben. Der Lkw blockiert den folgenden Verkehr und stellt sich am Tunneleingang quer, sodass niemand mehr durchkommt. Die drei Fahrzeuge sind somit total isoliert.«
Das Bild im Fernseher sprang um, jetzt war der Howalder Tunnel von der anderen Seite zu sehen, allerdings waren die Aufnahmen von der gegenüberliegenden Spur aufgenommen worden. Wieder aus einem Auto mit einem Handy, wie Fallauf kommentierte.
»Hier der vordere Lkw, der verhindert hat, dass der kleine Konvoi weiterfahren konnte. Man hatte ihn also zwischen zwei Lkws in die Zange genommen. Und genau vor und in diesem Lkw waren die Täter. Sie sprangen aus zwei Fahrzeugen und aus dem Lkw, liefen zu dem kleinen Konvoi und wollten den Serben und dessen Unterlagen einkassieren.«
Giselle schaute sich die Bilder an und ließ sie sich ein zweites Mal zeigen.
»Wie kamen sie an die Lkw?«, fragte Giselle den Kollegen Fallauf.
»In der Nacht zuvor auf einem Rastplatz an der deutsch-luxemburgischen Grenze gestohlen. Die Fahrer lagen gefesselt und geknebelt im hinteren Teil der Kabine auf den provisorischen Betten.«
»Was geschah in dem Tunnel?«, wollte Giselle wissen.
»Eigentlich spielte sich alles wenige Meter außerhalb ab. Unglücklicherweise ist gleich zu Beginn der Aktion ein Auto, das hinter dem letzten Lkw gefahren ist, noch gerade so am schleudernden und sich quer stellenden Lkw vorbeigeschrammt. Wie der Fahrer später angab, sei er am Überholen gewesen, habe nicht mehr bremsen können und sei ausgewichen, um einen Unfall zu vermeiden.«
»Hat der Fahrer überlebt?«
Fallauf nickte.
»Und wer waren die unbeteiligten Opfer?«, fragte Giselle nach, denn sie erinnerte sich immer deutlicher an diesen Vorfall.
»Da komme ich gleich dazu.«
Fallauf ging an die Seitenwand und klemmte ein großes Schaubild unter die Magnete. Dargestellt waren als Skizze die Fahrzeuge und einzelne Personen in unterschiedlichen Farben.
»Der Fahrer des nachfolgenden Kombis, in ihm eine deutsche Familie, Vater, Mutter, Tochter und Sohn, die gerade aus ihrem Urlaub in Holland gekommen sind, schrammt also vor dem Tunnel am letzten Lkw vorbei und ist plötzlich mitten im Konvoi, sogar noch etwas vor dem mittleren Wagen, als er am Ausgang des Tunnels zum Stehen kommt.«
Fallauf zeichnete mit einem Laserpointer den vermuteten Verlauf nach und deutete auf das entsprechende Fahrzeug.
»Die Attentäter kommen angelaufen, verteilen sich, sind mit Pistolen und Maschinenpistolen bewaffnet, insgesamt mindestens zehn oder zwölf, sichern den Tunnelausgang, springen zu dem mittleren Fahrzeug des Konvois und reißen die Tür auf. Der Insasse und dessen Unterlagen waren ihr Ziel. Aus den Begleitfahrzeugen springen Polizeibeamte«, Fallauf deutete gleichfalls auf sie, »zwei von ihnen werden mit einer kleinkalibrigen Pistole sofort erschossen, die anderen werfen sich nach einem Kommando des Anführers auf den Boden und schieben ihre Waffen weg.«
»Haben die Beamten nicht etwas spät reagiert?«, fragte Giselle.
Fallauf zuckte mit der Schulter. »Es waren normale Polizeibeamte, keine Spezialisten oder ein Einsatzkommando. Werden wohl erst mal abgewartet haben.«
Fallauf ließ den roten Punkt des Laserpointers auf bestimmte Punkte der Planskizze laufen und erläuterte die einzelnen Personen mit ihren Funktionen und gab ihre Zeugenaussagen wieder.
»Vielleicht wäre alles glimpflicher verlaufen, wenn da nicht diese deutsche Familie gewesen wäre. Der Anführer und zwei weitere gehen auf das Fahrzeug zu und lassen die Insassen aussteigen. In der Hand des Familienvaters ist eine Kamera. Der Anführer schlägt ihm mit der Pistole auf den Kopf und will die Kamera an sich nehmen. Irgendwie klammert sich der Mann daran und lässt nicht los. Ohne Vorwarnung schießt der Attentäter dem Mann in den Hüft-Bauchbereich und in mindestens ein Bein.«
Fallauf stellte den Fernseher wieder an, und zu sehen waren Aufnahmen aus einem schrägen Winkel von unten nach oben.
»Der Mann filmt ja weiter«, erstaunte sich Giselle.
Fallauf nickte. Man sah, wie ein hochgewachsener Mann in Stiefeln und dunkelblauer Kleidung, die wie eine Uniform aussah, zu dem Verletzten auf dem Boden schaute. Das Gesicht war durch eine Maske unkenntlich gemacht worden. Auch die anderen Attentäter trugen ähnliche Kleidung und Masken.
Der Anführer wandte sich nun erst zu dem mittleren Fahrzeug, in dem der Informant mit seinen Unterlagen saß, beugte sich hinein und war nur noch teilweise zu erkennen.
»Kommt es mir nur so vor oder hat der Anführer dem Familienvater die Kamera deswegen gelassen, damit er weiterfilmen konnte?« Giselle schaute zu ihrem Kollegen.
Fallauf nickte. »Genau das vermuten wir. Er liegt schwer verletzt am Boden und filmt weiter.«
Zu sehen war, wie der Anführer einen Mann aus dem Fahrzeug zerrte, während gleichzeitig wenige Meter entfernt ein Hubschrauber landete.
Fallauf stoppte die Bilder. »Der Hubschrauber hat keine Kennzeichen, man hat ihn vorher nicht auf dem Radar gesehen, er ist irgendwie zwischen den Tälern geflogen, wohl von der Mosel kommend. Und genauso geheimnisvoll ist er später wieder verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen.«
»Ist nicht gleich in der Nähe der Flughafen?« Skeptisch runzelte Giselle die Stirn.
Fallauf bestätigte dies und strich sich über seine dunklen Haare, die in der Mitte bereits lichter wurden. »In etwa fünf Kilometer Entfernung, weiter weg ist er nicht, eher weniger«, meinte er mit einem sarkastischen Unterton, als wollte er damit andeuten, dass er den Umstand, man habe den Helikopter nicht bemerkt, nicht nachvollziehen konnte. »Ich habe seinerzeit die Videoüberwachungen des Towers gesehen, da war tatsächlich nichts. Später hat man sogar mit einem Luxemburger Hubschrauber die Szene nachgestellt, weil man daran zweifelte. Aber auch ihm gelang es durch geschicktes Ausnutzen des Geländes und ohne auf dem Radar zu erscheinen, zum Tunnel zu kommen und wieder unerkannt wegzufliegen. Er hat den Weg dicht über der Autobahn gewählt, zuerst die E44 dann am Gasperischer Kreuz die E25, und zwar bis in das Moseltal, um diesem anschließend zu folgen. Für die Autofahrer sah es aus, als kontrollierte man den Verkehr. Keiner hat Verdacht geschöpft.«
»Satellitenaufnahmen?«
Fallauf schüttelte den Kopf. »Leider nein. Zehn Minuten später hätten wir sie gehabt.«
»Die Täter haben über ausgezeichnete Ortskenntnisse verfügt«, sprach Giselle nachdenklich mehr zu sich selbst. »Ob es da vielleicht Hilfe von außerhalb gab?«
Sie ließ Fallauf verstehen, den Fernseher wieder anzustellen. Erneut waren Bilder aus der ungewöhnlichen Perspektive zu sehen. Am Rande erschien ein Frauengesicht, daneben das eines Mädchens. Wenige Sekunden später, die beiden Gesichter waren verschwunden, das eines Jungen.
»Seine Frau und seine Kinder«, kommentierte Fallauf. »Im Nachhinein eine makabre Szene. Es kommt einem vor, als wollten sie sich von ihrem Ehemann und Vater verabschieden.«
Der BKA-Beamte lockerte etwas seine Krawatte, ihm war heiß. Deutlich zu sehen war ein kleiner Bauchansatz, den er möglichst immer zu verstecken versuchte. Er kommentierte die Bilder weiter: »Der Informant wird zum Hubschrauber gezerrt, der Anführer kommt mit weiteren Attentätern auf den Filmenden zu. Er gibt seinen Gefolgsleuten ein Zeichen, sie schnappten sich die Frau und die Kinder. Die Kamera wackelt, als wollte sich der Verletzte erheben. Der Anführer grinst ihn an und schießt erneut, zwei- oder dreimal. Die Kamera schwankt, die Bilder wackeln, sie kommt auf dem Boden zum Liegen. Der Anführer wendet sich für einige Augenblicke ab und gibt Zeichen, die Personen zum Hubschrauber zu bringen, plötzlich ist nichts mehr zu sehen, das Bild bricht ab.«
Fallauf trank ein Schluck Wasser und schaute in die Runde, bevor er seinen Bericht fortsetzte. »Keine Bilder von umliegenden Häusern, der Tunnel liegt in einem Waldstück und ist kaum einsehbar. Was wir vom weiteren Geschehen wissen, haben wir von den Zeugen auf der Gegenfahrbahn erfahren, dort hat sich der Verkehr gestaut. Der Anführer geht zu dem Verletzten und reißt ihm die Kamera aus der Hand. Dann wendet er sich ab, der Hubschrauber startet mit dem Informanten, der Ehefrau, den zwei Kindern und zwei Attentätern. Er hebt also ab, und als er etwa fünfzig Meter hoch ist, fällt der Junge, er ist dreizehn Jahre, aus dem Helikopter, kommt auf der Leitplanke auf und ist sofort tot. Die restlichen Attentäter verschwinden in Richtung Gaspericher Kreuz. Teilweise in ihren Autos, die vor dem ersten Lkw gestanden haben, einige fliehen mit Motorrädern, die in den Lkws versteckt waren. Später wurden die Fahrzeuge, allesamt in der Nacht zuvor gestohlen, gefunden, aber von den Motorrädern und dem Hubschrauber keine Spur, trotz der größten Fahndung, die es jemals in Mitteleuropa gegeben hat.«
Im Anschluss war es eine geraume Zeit still. Die Männer beobachteten ihre neue Chefin, als wollten sie sie insgeheim einer Prüfung unterziehen – wie das nun mal bei neuen Chefs üblich war, bei Frauen erst recht.
Fallauf selbst hatte sich bereits längere Zeit mit diesem Anschlag beschäftigt, allerdings hatte er in den vergangenen drei oder vier Jahren nichts mehr damit zu tun gehabt. Aus für ihn unverständlichen Gründen lag der Fall auf Eis in der Hoffnung, es würden sich eventuell neue Ansatzpunkte ergeben.
»Lebt der Familienvater noch?«
»Ja«, antwortete Behring.
»Verdammt, was war der kaltschnäuzig. Filmt trotz Verletzung, wird angeschossen, filmt weiter und behält auch noch den Nerv, zum Schluss den Chip aus der Kamera herauszunehmen.«
Die drei Männer waren etwas enttäuscht, weil Giselle sofort den Zusammenhang erkannt hatte. Wie sonst wären sie an die Bilder gekommen?
»Vor zehn Jahren«, sprach sie weiter, »da war die digitale Technik noch nicht so weit. Handelt es sich um einen SD-Chip?«
Das bestätigte man ihr.
»Welche Speicherfähigkeit?«
»500 Megabyte«, antwortete Fallauf.
Giselle stand auf, stellte sich ans Fenster und schaute aus dem vierten Stock hinaus auf den Stadtrand von Wiesbaden.
»Keinen Helikopter entdeckt, die Attentäter geflüchtet und nicht gefasst, der Informant nie mehr aufgetaucht«, fasste sie die Eckpunkte zusammen. »Draus ergeben sich eine Menge Fragen, die man bisher nicht geklärt hat.«
Fallauf lachte auf. »Und es werden noch verdammt viel mehr, liebe Kollegin«, sagte er in einem harten Ton, »wenn Sie auch noch die restlichen Unterlagen gesichtet haben.«
Giselle bedankte sich und betrachtete den dritten Kollegen im Bund, der etwas jünger war und sich mit Schwind vorgestellt hatte. Kein Wort war ihm über die Lippen gekommen, aber seinem Gesichtsausdruck nach hatte er jedes aufgesaugt.
Nicht jeder Tag war wie der andere. Manchmal fiel es ihm so schwer und er quälte sich derart, dass er alles infrage stellte. Wenn der Sinn verloren geht, gibt es auch keinen Platz mehr für die Motivation. Heute jedoch konnte er zufrieden sein, denn es waren wesentlich mehr als hundert Meter. Gregor saß auf einer Bank und schaute sich die Strecke an, die er zurückgelegt hatte. Und das Tempo war auch für seine Verhältnisse hoch gewesen, denn an warmen Tagen fiel es ihm immer leichter als an kalten oder wenn es regnete.
Er massierte leicht sein Knie, rollte mit der Schulter und drehte vorsichtig den Oberkörper. Keine Auffälligkeiten, Schmerzpegel im gewohnten Bereich. Nach fünf Minuten erhob er sich, ging langsam und konzentriert zurück und fuhr mit dem Fahrstuhl hoch in seine Wohnung. Noch hatte er mehr als eine halbe Stunde, die er ausgiebig nutzte, um einen Teil seines täglichen Fitnessprogramms abzuspulen.
Es klingelte, sein angekündigter Besuch war pünktlich. Nach wenigen Augenblicken öffnete er die Wohnungstür und war dann doch etwas überrascht. Er stand einer ausgesprochen gut aussehenden Frau gegenüber mit langen, dunklen Haaren und türkisfarbenen Augen, die ihn neugierig und interessiert betrachteten, aber auch zugleich einzuschätzen versuchten. Um ihren Mund bemerkte er einen leicht spöttischen Zug, als wäre sie über irgendetwas amüsiert.
»Walter Weber?«, fragte sie mit einer gutturalen Stimme, für viele Männer eine Aufforderung zu fantasievollen Gedankenspielen.
»Ja. Seit nunmehr zehn Jahren.«
»Giselle Haverkamp«, stellte sie sich vor. »Wir haben telefoniert.«
»Bitte.«
Er ließ sie eintreten und ging langsam voran ins Wohnzimmer, wobei er immer mit einer Hand nach einer Unterstützung tastete. Sei es die Rückenlehne eines Stuhles, die Ablage an der Garderobe oder eine Vitrine.
»Was kann ich Ihnen anbieten?«, fragte er, nachdem sie Platz genommen hatte. »Kaffee?«
»Ein Wasser wäre mir recht.«
Wenig später stellte er das Glas vor sie auf den Tisch und setzte sich.
Sie lächelte leicht. »Ihrer Tonlage nach glaubte ich am Telefon herauszuhören, dass Ihnen mein Besuch, wie soll ich sagen … unangenehm ist.«
»Nein, nicht unangenehm, nur sinnlos. Vielleicht auch etwas lästig, eben weil sinnlos.«
»Warum sinnlos?«, fragte Giselle, die sich jede weitere Reaktion verkniff und nicht auf die Ablehnung reagierte, die ihr sprichwörtlich entgegensprang. Man hatte sie gewarnt, aber sie dachte, mit Charme, und davon konnte sie eine Menge anbieten, würde sie etwas mehr erreichen können als alle anderen.
Er schob eine Schale mit Pralinen in Giselles Richtung, ohne jedoch selbst zuzugreifen, als testete er ihre Widerstandskraft. Frauen sollen es ja auf die Leonidas aus Belgien geradezu abgesehen haben, hatte man ihm gesagt. Figur hin, Figur her, der Verlockung konnte kaum jemand widerstehen.
»Das BKA hat sich nach dem … Ereignis mindestens zwanzigmal bei mir gemeldet, zugegeben, in den letzten Jahren immer weniger.«
»Aber die vergangenen zwölf Monate überhaupt nicht«, verbesserte sie ihn.
»Bei all den Besuchen ist nie etwas herausgekommen. Unentwegt Versprechungen, man war den Kriminellen angeblich auf der Spur, alles sei nur noch eine Frage der Zeit. Bedeutet das, es gibt heute einen Grund, warum Sie gekommen sind?«, fragte er mit einem leicht provokanten Ton.
Giselle nickte.
»Und welchen?«, wollte er wissen, ohne jedoch allzu großes Interesse zu zeigen.
»Ich habe Ihren Fall übernommen.«
»Das sagten Sie bereits am Telefon. Meinen Fall, wie das klingt«, sinnierte er, die Augen starr auf die gegenüberliegende Wand gerichtet, seine Züge um den Mund wurden hart. »Es ist doch eigentlich nicht mein Fall, sondern der meiner Frau und meines Sohnes.«
Er schaute sie an, und Giselle war erschrocken über seinen Blick. Augen mit einer Intensität, wie sie es noch nie erlebt hatte, schienen sie nicht nur an-, sondern in sie hineinzuschauen. Körperlich spürte sie die Kraft dieses hypnotischen Blickes, aus dem sie einiges herauszulesen glaubte: Willensstärke und Hass. Und vielleicht auch noch eine unendliche Wut. Falls es irgendwo nach der langen Zeit auch noch Trauer gab, dann hatte er sie sehr gut versteckt.
»Ja, es ist eigentlich der Fall Ihrer Frau und der Ihres Sohnes«, gab sie zu, nahm das Glas in die Hand und schaute darauf, um diesen brennenden Augen auszuweichen. Sie trank bewusst langsam, als wollte sie Zeit gewinnen. Interessiert betrachtete sie anschließend ein Bild an der Wand, in dessen Glas sich sein Profil spiegelte.
»Außer, dass Sie den Fall, wie Sie sich ausdrücken, übernommen haben: Gibt es noch einen weiteren Anlass?« Das Wort Fall betonte er, weil er darauf hinweisen wollte, dass es Menschen waren, um die es ging. Und Tote.
Giselle legte es nicht darauf an, diesen Mann mit ihrer Fraulichkeit zu beeindrucken. Im Augenblick hätte sie keine Chance, das sagte ihr ihre Intuition. Unter anderen Umständen würde sie vielleicht sogar dagegen ankämpfen, um es sich selbst zu beweisen. Nicht, dass sie es nötig hätte, aber es tat immer wieder gut, sich von ihrer Wirkung zu überzeugen. Heute jedoch ließ sie es. Schon von Beginn an war ihre Bluse zugeknöpft, und wenn sie sich setzte, achtete sie sehr darauf, dass ihr Rock nicht allzu weit hochrutschte. Zudem war auch der Grund ihres Besuches nicht dazu geeignet, ihre speziellen Waffen einzusetzen. Doch etwas freundlicher und entgegenkommender hätte sie sich ihren Gastgeber schon gewünscht.
»In Ihrem ersten Leben hießen Sie Gregor Hausen.«
Er lauschte diesem Namen, und Giselle glaubte, er erweckte bei ihm eine Erinnerung. Schließlich nickte er.
»Aus Gründen der Sicherheit erhielten Sie damals Personenschutz und eine neue Identität, weil man überzeugt war, Sie seien gefährdet.«
»Meine Tochter und ich. Sie durfte ihren Vornamen behalten.«
»Ihnen und Ihrer Tochter«, bestätigte Giselle. »Sie zogen von Heidelberg zuerst nach Stuttgart und dann nach Düsseldorf und leben nun seit …«
»… mehr als neun Jahren in dieser fröhlichen Stadt am Rhein«, konnte er sich die Ironie nicht verkneifen. »Und ich durfte mir damals einen Namen aussuchen. Mir hat Walter Weber gut gefallen.«
»War das eine Laune?«, wollte Giselle wissen.
»Wie bitte?« Die Augenbrauen wanderten einen Tick nach oben.
»Ich meine, dass Sie einen solchen Namen … Allerweltsnamen gewählt haben?«
Gregors Mundwinkel verzogen sich leicht, aber alles andere in seinem Gesicht war wie eingefroren. »Favorit war eigentlich Walter Schmitt. Mit doppeltem t.«
»Und wie fühlen Sie sich heute? Als Walter oder als Gregor?«
Er sah sie zweifelnd von der Seite an. »Muss ich die Frage beantworten? Und warum stellen Sie Fragen, deren Antwort Sie bereits kennen? Oder deren Sinn ich erraten soll? Wenn sie denn überhaupt einen Sinn ergeben.«
»Also immer noch Gregor. Aber warum Walter Schmitt? Weil es ein solch häufiger Name schwieriger macht, nach Ihnen zu suchen?«
»Genau.«
»Glauben Sie, man hat nach Ihnen gesucht?«
Er nickte.
»Tut man es immer noch?«
Er zuckte mit der Schulter. »Möglich.«
»Weswegen?«
Er schaute sie nur an, als müsste sie die Antwort kennen.
»Wegen des Videos?«
»Noch etwas Wasser?«, meinte er, ohne auf ihre Frage einzugehen, wodurch er sie allerdings auch indirekt beantwortet hatte.
»Nein danke.«
Giselle stand auf und schaute sich in der Wohnung um. Hell und freundlich, so ganz anders, als es in dem Mann aussehen musste.
»Wie oft haben Sie schon gehört, dass man Sie gut verstehen, sich in Ihre Lage versetzen könne?«
»Hunderte Male.«
»Ich kann es nicht. Ich kann Sie weder verstehen noch mich in Ihre Lage versetzen. Ich habe einen Fall übernommen, ich habe die Videoaufnahmen gesehen, ich kenne die Begleitumstände, mehr aber auch nicht.«
»So ehrlich wie Sie war bisher noch niemand«, bemerkte er sarkastisch.
Giselle blieb vor dem Rollstuhl stehen.
»Sie benötigen ihn immer noch?«
»An manchen Tagen.«
»An welchen Tagen?«
»An denen mir mein Körper aufzeigt, dass er stärker ist als mein Geist und mein Wille. Tagen, an denen ich mich ganz klein fühle und die mir zeigen, jeder von ihnen ist ein Stück in Richtung Tod.«
»Regentage?«, fragte Giselle spontan, um sich von der Überraschung zu erholen. Das Morbide war unüberhörbar gewesen, und sie glaubte, es sogar zu spüren.
Gregor zögerte etwas mit der Antwort, als hätte er mit jeder Frage gerechnet, nur nicht mit dieser. »Ja, auch.«
»Und welche noch?«
Sie wandte sich ihm zu, aber er antwortete nicht.
»Seit zwei Wochen ist mir Ihr Fall bekannt. Und seit zwei Wochen frage ich mich, in den letzten Tagen immer häufiger, was ich wohl an Ihrer Stelle empfunden und wie ich gehandelt hätte.«
»Gehandelt hätte?«, kam es von ihm wie ein Echo. »Gibt es dafür etwa ein Rezept?«
»Wir wissen genau, dass Sie auf eigene Faust recherchiert haben«, entgegnete Giselle.
In einem seltsam ruhigen Tonfall, obwohl die Wahl der Worte eine Anklage war, begann Gregor: »Sie warten jeden Tag auf eine Nachricht, eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht wäre, dass man die Verbrecher verhaftet hat. Und eine sehr gute, sie haben sich gewehrt und sind erschossen worden. Aber wenn diese Nachrichten ausbleiben, seit mehr als zehn Jahren ausbleiben, hätten Sie es dann nicht auch getan? Recherchiert, sich so viel Wissen wie möglich angeeignet? Bin ich denn nicht als Vater und Ehemann in der Pflicht, genau das zu tun? Damit die Toten endlich hier drin Ruhe geben?« Er tippte sich gegen die Stirn.
Giselle überlegte. »Ja, ich hätte es wohl auch getan«, gab sie zu. Sie sah ihn an und wandte sich schnell wieder ab. So etwas war ihr bisher noch nicht passiert, dass sie ihrem Gegenüber nicht in die Augen schauen konnte. Zwar hatte Behring sie vor dem Eisklotz, wie er ihn nannte, gewarnt und auch angeboten, sie zu begleiten, doch sie hatte abgelehnt. Sie wollte ihn allein kennenlernen, das erste Gespräch mit ihm unverbindlich führen. Noch nicht einmal allzu sehr auf Fakten bezogen, sondern einfach, um möglicherweise den Menschen kennen und verstehen zu lernen, der dieses schreckliche Schicksal erlitten hatte. Und um zu sehen, was aus ihm geworden war, wie er alles verarbeitet hatte, wenn überhaupt, und ob die Jahre auf irgendeine Art mildernd eingewirkt hatten. Das schien nicht der Fall zu sein.
»Bis zu welchem Punkt wären Sie gegangen?«, wollte Gregor wissen.
»Dem endgültigen Punkt der Sicherheit, der Aufklärung«, antwortete Giselle.
»Und dann? Wenn Sie die Lösung haben? Sie wissen, wer dahintersteckt. Was dann?«
Giselle glaubte, eine gewisse Spannung aus seiner Stimme herauszuhören. Sie hob den Kopf und hielt nun dem Blick stand.
»Sagen Sie es mir«, forderte er Giselle auf.
Mehr als zehn Sekunden wich keiner den Augen das anderen aus. Giselle, der es vorkam, als begännen ihre zu brennen, senkte schließlich den Blick und fuhr mit einer Hand über den Reifen des Rollstuhls, als prüfte sie das Profil.
Wieder bemerkte sie bei ihm dieses irritierende, angedeutete, eingefrorene Lächeln, als würde jemand seine Mundwinkel um wenige Millimeter nach unten ziehen. Nur seine Mundwinkel.
»Ich weiß nicht«, begann sie zögernd, »was dann geschehen wäre. Wenn ich etwas hätte in Erfahrung bringen können, um anschließend womöglich auf eigene Faust zu handeln und gegen die Verbrecher vorzugehen. Ich weiß es wirklich nicht.«
»Ich auch nicht. Aber wenn ich einmal an diesen Punkt kommen sollte, dann lasse ich es Sie wissen.«
Gedanklich immer noch mit dem Rollstuhl beschäftigt, wollte Giselle wissen: »Wie ist das, wenn man so etwas benutzen muss?«
»Wenn der liebe Gott mir eine Krankheit geschickt hätte, vielleicht hätte ich mich damit abgefunden. Zumindest bin ich davon überzeugt, ich hätte mich mit ihr arrangieren können.«
»So haben Sie es noch nicht? Sich arrangiert, damit abgefunden?«
»Das werde ich nie«, antwortete er, und nun waren seine Worte genau so kalt und steril wie sein Blick. Giselle erschrak etwas.
»Es ist entwürdigend, es macht mich wütend, dass jemand zum Spaß auf mich geschossen und aus mir einen Krüppel gemacht hat. Aber was mich am meisten wütend macht, ist der Umstand, dass ich eingeschränkt bin in meiner Bewegungsfähigkeit. Falls ich einmal zu dem Punkt kommen sollte, den Sie vorhin angesprochen haben, wird es wohl aus physischen Gründen für mich kein Weiterkommen geben. Es wird dann vielleicht der Moment kommen, an dem ich die Wahrheit kenne, aber ohnmächtig bin, etwas dagegen zu tun. Und genau davor habe ich Angst.«
Giselle löste sich von dem Rollstuhl und nahm wieder Platz.
»Noch etwas Wasser, bitte.«
Gregor erhob sich und schlurfte in die Küche. »Ich würde das an Ihrer Stelle auch tun.«
»Was tun?«
»Testen, wie beweglich und körperlich fit ich bin.«
Giselle fühlte sich ertappt. »Das war nicht meine Absicht«, log sie.
»Das war nur Ihre Absicht«, entgegnete er und kam mit dem gefüllten Glas zurück. »Und um Ihnen genau dazu Gelegenheit zu geben, habe ich die Flasche beim ersten Mal nicht mitgebracht. Jetzt kann ich sie ja ruhig auf den Tisch stellen.« Sein Lächeln war ein Tick freundlicher, als er die Flasche genau vor Giselle platzierte und sich wieder setzte.
Giselle spürte, wie sie errötete. Ein Umstand, der in den vergangenen Jahren, wenn überhaupt, dann wohl nur aus Versehen oder Berechnung eingetreten war. Aber aus Überrumpelung oder vor Überraschung, daran konnte sie sich nicht erinnern.
»Aber Bewegung tut mir gut«, fügte er in einem sanfteren Tonfall hinzu, da er sie offensichtlich ertappt hatte.
Giselle trank langsam. Erneut wollte sie Zeit gewinnen, und auch die Oberhand in der Unterhaltung. »Ich frage mich, warum Sie damals weitergefilmt haben. Der Anführer hatte auf Sie geschossen, und das mehrmals …«
»Fünfmal.«
»Sie waren schwer verletzt, mussten mit dem Schlimmsten rechnen, und trotzdem haben Sie gefilmt. Können Sie mir die Beweggründe erklären?«
»Das steht in den Akten.« Was sollte Gregor sonst sagen? Dass er mit dem Tode gerechnet hatte? Es eine seltsame Art Zweikampf war zwischen dem Anführer und ihm und er nicht zurückweichen wollte, obwohl er überhaupt keine Chance hatte? Er von seiner Familie ablenken wollte, damit sie verschont blieb, und genau das war ihm nicht gelungen. Im Gegenteil, sie hatten sie vielleicht sogar deswegen mitgenommen. Nur so konnte er sich erklären, warum ihn der Anführer verschont hatte. Er sollte später leiden, unendlich leiden und um seine Familie bangen.
»Was ich dort gelesen habe, sind das Ihre tatsächlichen Beweggründe gewesen? Dass Sie geahnt haben, was geschehen könnte? Man Ihre Familie entführen würde?«
Gregor nickte.
»Nein, dass allein kann es nicht gewesen sein«, konstatierte Giselle. »Mir klingt das zu hypothetisch.«
Gregor reagierte nicht.
»Wollen Sie mir nicht antworten?«
Noch immer zeigte er keine Reaktion.
»Herr Weber, das finde ich jetzt aber etwas unhöflich.«
»Ich finde es unhöflich, mir etwas anderes als das, was ich gesagt habe, zu unterstellen und darauf zu pochen, es auch noch zuzugeben. Soll das eine Bestätigung werden für Ihre Mutmaßung? Passt dann meine neue Antwort besser in Ihr Schema?«
Giselle spürte, dass sie etwas zu weit gegangen war. Allerdings konnte sie aus ihrem Raster auch kein Mittel herausgreifen, welches sie möglicherweise jetzt und hier zu ihrem Vorteil hätte anwenden können. Giselle, die keine Handtasche dabeihatte, griff in ihre Jacke und zog ein kleines Notizbuch hervor.
»Genau das ist der Unterschied«, bemerkte Gregor. Als Giselle ihn fragend anschaute, fügte er hinzu: »Ich brauche kein Notizbuch.«
Giselle, die nach Punkten unweigerlich mehr und mehr in die Defensive geriet, bemühte sich, den Anschein zu erwecken, als hätte sie die Bemerkung nicht getroffen.
»Unseren Unterlagen nach waren es zwölf Männer, manchmal denken wir auch, es könnte einer mehr gewesen sein, und wir vermuten sehr stark, es hat sich um Soldaten oder Elitekämpfer einer ausgebildeten Truppe gehandelt, und zwar aus dem Kosovo. Nicht zuletzt die Uniformierung und die Waffen sprechen dafür. Und natürlich die Patronen, die wir gefunden haben. Einige stammen ja aus ihrem Körper, die anderen aus denen der zwei Begleitpersonen.«
»Und die Lederschuhe oder Stiefel. Schnürschuhe mit achtzehn Löchern an jeder Seite. Ähnlich denen, wie sie in der ehemaligen DDR anzutreffen waren.«
»Aber sie trugen keine Gürtel. Das verwundert uns etwas.«
Gregor zuckte mit der Schulter. »Warum hätten sie Gürtel tragen sollen?«
»Zum Beispiel, um ihre Pistolen zu befestigen. Oder ihre Messer.«
»Hatten Sie Messer?«, fragte Gregor.
»Ja, an den Waden.«
»Da man gewöhnlich zwei hat … Gibt es nicht so komische Pistolenhalter für den Oberschenkel? Solche mit einem Klettverschluss?«
Giselle ging nicht weiter darauf ein. »Wir wissen nicht die Namen der Attentäter, kennen nicht ihre Einheit, haben zwar einmal im Rahmen der Amtshilfe von der UN eine Liste mit potenziellen Kandidaten erhalten, die sich jedoch bisher als gegenstandslos erwiesen hat, wir haben nichts.«
Gregor runzelte die Stirn. »Einer Ihrer Kollegen hat mir am Telefon gesagt, es gebe einige seltsame Todesfälle, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem damaligen … Vorfall stehen könnten.«
»Ja, diese Todesfälle«, seufzte Giselle. »Es sind eher Hinrichtungen. Zwei Schüsse, einer ins Herz und einer mitten in die Stirn. Inzwischen ist es weltweit Mode geworden, diesen Modus der Hinrichtung bei jeder Gelegenheit anzuwenden.«
»Wie viele sind es denn?«
»Mit dem vor zwei Monaten insgesamt fünf. Alle stammen aus dem Kosovo und sind zwischen vierunddreißig und vierzig Jahre alt. Einige haben ein Tattoo, wie man es bei Militär öfter antrifft. Eine Maschinenpistole auf dem Oberarm.«
»Vorausgesetzt, es sind wirklich die fünf, die bei dem Überfall dabei waren, dann bleiben noch sieben oder acht übrig. Und wer ist der Killer? Etwa einer aus den eigenen Reihen?«
Giselle nickte und erhob sich. »Letzteres, Herr Weber, wissen wir nicht genau, aber so könnte es wohl sein. Falls es einen Zusammenhang gibt. Und wenn es ihn gibt, dann drängt sich die Frage auf, wer lässt nach so vielen Jahren die ehemaligen Attentäter hinrichten, und warum?«
Gregor erhob sich gleichfalls und brachte Giselle zur Tür. Sie wurde von außen geöffnet, und ein Junge stürmte an ihnen vorbei.
»Hallo Opa«, jauchzte er im Vorbeirauschen und rannte auf die Tür eines Zimmers zu. Ihm folgte eine junge Frau, die Gregor einen Kuss auf die Wange hauchte und erst dann Giselle zu bemerken schien.
Gregor stellte Tochter Vivian und Enkel Sebastian vor. Einen blonden Lockenkopf mit blauen Augen, so wie seine Mutter. Er brachte Giselle bis zum Fahrstuhl, wo sie sich verabschiedete und zu ihm sagte: »Irgendwie bin ich jetzt aber wirklich beruhigt.«
»Weshalb?«
»Sie können sogar lächeln.«
Zu Beginn hatte sie überhaupt nichts verstanden. Sie unterhielten sich in einer Sprache, die sie nicht kannte. Richteten sie das Wort an sie, dann auf Englisch. Aber ihr Englisch klang fremd und hart und war unterlegt mit einem seltenen Singsang. Sie sprachen abgebrochen und machten kaum ganze Sätze, als wären sie der Sprache nicht allzu mächtig.
Das erste Mal, so glaubte sie, sich zu erinnern, sprach man sie nach einer Woche an, in der sie sich überhaupt nicht wohlgefühlt hatte.
»Du kochen«, blaffte einer, der sich die meiste Zeit im Haus aufhielt. Wie viele es waren, konnte sie nicht genau sagen, denn einige waren länger unterwegs, andere verschwanden für zwei oder drei Tage, um dann plötzlich aus dem Nichts wieder aufzutauchen.
Sie musste sich ungeschickt angestellt haben, denn der Sprecher zerrte sie zu einem Vorratsraum, in dem Lebensmittel lagerten, dann zu einem längst aus der Mode gekommenen Kühlschrank und dann zum Herd, der noch ausschließlich mit Holz befeuert wurde.
»Du kochen.«
»Was soll ich kochen?«, fragte sie auf Englisch zurück.
Der Angesprochene grinste anzüglich. »Du kochen.«
Sie bemühte sich redlich, etwas zusammenzustellen, aber wie sollte es überhaupt funktionieren, wenn sie in ihrem Leben bisher noch nie eigenständig gekocht hatte? Und dann auch noch auf diesem unberechenbaren Holzofen?
Irgendwie bekam sie die Nudeln hin und auch das Gulasch aus der Dose. Sie deckte den Tisch, beobachtet von sieben gierigen Augenpaaren, die sich mittlerweile aus unterschiedlichen Zimmern kommend in der Küche um den großen Tisch versammelt hatten. So schnell, wie sie die Teller füllte, so schnell wurden sie auch wieder von den Männern geleert. Es stellte sich heraus, sie hatte deren Hunger total falsch eingeschätzt, und nur der Schnaps aus dem Vorratsraum konnte die Männer etwas besänftigen.
Sie verzog sich in ihr Zimmer und beobachtete die Männer. Einige kamen ihr ungepflegt vor mit den langen Haaren und den Bärten, während zwei, darunter ein Blonder, die sie einige Tage nicht gesehen hatte, genau ein anderes Bild vermittelten. Gepflegt, keine Bärte, nicht so klobige Schuhe. Sie waren auch zurückhaltender, was den Schnaps betraf. Und sie beteiligten sich auch nicht so sehr an der Unterhaltung, die lauter und lauter wurde. Schließlich waren die Männer an einem Punkt angelangt, an dem einer eine Bemerkung machte und die übrigen sich vor Lachen auf die Schenkel klopften. Von Mal zu Mal warf einer der Männer einen Blick in ihre Richtung, als wollte er sich davon überzeugen, ob sie noch anwesend war. Wo hätte sie denn hingehen sollen mit ihrer Kette? Wie weit hätte sie denn überhaupt mit dem entzündeten und blutenden Knöchel laufen können?
Sie war in ihrem Zimmer, saß auf dem Bett und bemühte sich, an nichts zu denken. Wenn sie an etwas dachte, dann an die Vergangenheit, an die letzten Tage und Abende und Nächte, und genau das wollte sie vermeiden. Übel würde es ihr noch früh genug werden. Genau wie an den Abenden zuvor, wenn die Männer so viel getrunken hatten, dass es für sie keine Hemmschwelle mehr gab.
Noch bevor sie den Gedanken zu Ende gedacht hatte, erhob sich der Erste, zog demonstrativ seine Hose höher, fasste sich in den Schritt und schaute triumphierend in die Runde. Dann stand er auch schon in ihrem Zimmer, öffnete die Hose, zog ihren Rock nach oben und fiel über sie her. Einen Slip trug sie zu der Zeit noch nicht. Sie starrte gegen die Decke, weinen konnte sie schon lange nicht mehr, und sich wehren auch nicht. Sie ließ es geschehen und träumte, sie säße auf einem Schiff und die stetigen Wellen würden sie an einen Strand tragen, wo nur sie allein wäre.
Giselle saß an diesem trüben regnerischen Junimorgen nachdenklich an ihrem Schreibtisch und sah aus dem Fenster. Die gestrige seltsame Unterhaltung mit Walter Weber – oder sollte sie ihn Gregor nennen, was viel besser zu ihm passte – ging ihr durch den Kopf. Sie sah seine Augen, das markante Gesicht, die zusammengekniffenen Lippen. Und mit einem Mal konnte sie nachvollziehen, was dieser Mann bisher alles hatte aushalten müssen. Seine Krankengeschichte war gleichfalls in der Akte abgeheftet. So etwas wie Bewunderung, was bei ihr auf Männer bezogen ausgesprochen selten vorkam, empfand sie für ihn. Bewunderung, wie dieser Mann bisher sein Leben gemeistert hatte und welch enorme Willensstärke er hatte. Bewunderung auch für seinen Intellekt, den sie zu spüren bekommen hatte. Und das nach vielen Jahren mit der neuen Identität, die ihn ihrer Einschätzung nach nicht übermäßig forderte, denn den Beruf als Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte hatte er aufgeben müssen. Allerdings wäre er in den ersten Jahren nach dem Überfall überhaupt nicht in der Lage gewesen, ihn auszuüben. Und heute könnte er es wegen seiner Physis auch nicht, überlegte sie. Er würde für immer gezeichnet bleiben.
Giselle nahm die Kurzversion der Akte, die auf ihrem Schreibtisch lag, überflog die ersten Seiten, als testete sie sich, ob sie auch nichts vergessen hatte, und ging anschließend in den kleinen Besprechungsraum am Ende des Flures. Gerold Schwind, den dritten Mann ihrer kleinen Abteilung, begrüßte sie besonders freundlich, weil sie hoffte, ihm eine Brücke bauen zu können, damit er seine Schüchternheit überwand. Ein Mann um die vierzig, der bei jeder noch so unbefangenen Bemerkung errötete und ins Stottern geriet. Wie sollte man einen solchen Mitarbeiter hinaus an die Front schicken?
Nachdem Giselle die Unterhaltung mit Weber geschildert hatte, auch auf Feinheiten und rhetorische Spitzen sowie seine provozierende Ablehnung eingegangen war, meinte Hans Behring: »Genau, wie ich es gesagt habe. Immer noch ein Eisklotz.«
Giselle ging nicht auf die Bemerkung ein.
»Lebt seine Tochter noch bei ihm? Und sein Enkel?«, fragte Norbert Fallauf.
»Der Garderobe nach schon. Sie kam gerade, als ich gehen wollte. Kurze, knappe Begrüßung, mehr nicht. Ich habe das Thema in unserem Gespräch bewusst vermieden. Aus der Akte geht hervor, wie allergisch er immer reagiert bei unseren Versuchen, mit ihr zu sprechen oder mit ihm über sie.«
»Sie weiß nichts«, kommentierte Behring, stülpte die Lippen auf und schüttelte den Kopf. »Sie weiß überhaupt nichts.«
Giselle betrachtete ihren Kollegen einige Sekunden und schwenkte gezielt zu einem anderen Thema. »Abgesehen von den vielen noch offen stehenden Fragen, die sich aus der Akte ergeben, würde mich interessieren, was der eigentliche Grund für diesen Serben war, nach Luxemburg zu kommen. Wie war noch mal sein Name?«
»Stepan Stiglic«, antwortete Behring.
»Also, meine Herren? Klären Sie mich auf. Ihr seid zum Teil schon einige Jahre mit dem Fall beschäftigt. Was war seine eigentliche Mission?«
»Angeblich wollte er zuerst einigen EU-Parlamentariern in Luxemburg und anschließend dem Den Haager Strafgerichtshof Beweise vorlegen, welche die Unschuld Miloševićs aufgezeigt hätten.«
»Und wo sind die Beweise? Ist irgendetwas von ihnen später aufgetaucht?« Sie schaute in die Runde.
Ihre Mitarbeiter zuckten wie verabredet mit der Schulter. »Direkt aufgetaucht nicht, aber es gab immer wieder mal im Umfeld so seltsame Gerüchte«, meinte Fallauf.
»Welche denn?«
»Dass man in diesem Milošević einen angenehmen Schuldigen gefunden habe, den der damalige jugoslawische Ministerpräsident Zoran Djindjic im Jahre 2001 auf Druck der EU an den Gerichtshof ausgeliefert hat. Die Serben wollten immerhin in die EU. Und dieser Djindjic ist im März 2003 erschossen worden.«
»Also war es gewissen Kreisen in Serbien recht und angenehm, dass diese Beweise nie aufgetaucht sind?«
»So kann man es sehen«, sagte Fallauf und erklärte weitere Hintergründe, wonach nicht alle an die alleinige Schuld Miloševićs glaubten und verwies darauf, dass die Anklage auf viele Meineide aufgebaut worden sei. Zudem habe der Gerichtshof mehr als eintausend entlastende Beweise von UN-Diplomaten nicht zugelassen mit dem Argument eben ihrer Diplomatentätigkeit, was kaum einer habe verstehen können. Deshalb, so fügte Fallauf hinzu, damals das außerordentlich große Interesse für diese Unterlagen und für diesen jugoslawischen Überbringer.
Giselles Mitarbeiter kamen auf den Jugoslawienkrieg zu sprechen und die Umstände, die ihn erst zu einem internationalen Konflikt hatten ausweiten lassen. So das angeblich 1999 von Milošević in Auftrag gegebene Massaker in dem kleinen Bauerndorf Rugovo, als serbische Spezialeinheiten unschuldige Zivilisten hingerichtet haben sollten.
»Was stimmt denn nicht daran?«