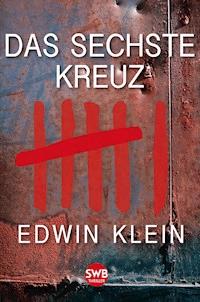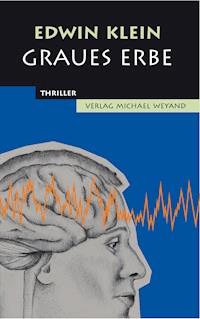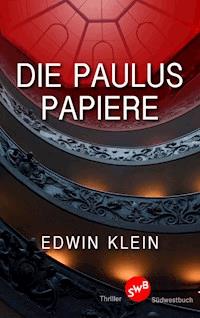Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SWB Media Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Videos im Internet werden zum absoluten Hit. Unbekannte kämpfen gegen den IS, wenden die gleichen Mittel an, foltern und köpfen ihre Gegner. Die öffentliche Meinung ist gespalten, aber der Erfolg gibt den Unbekannten Recht. Und der IS hat Angst, ihm laufen die Gotteskrieger davon. Ein Deutscher soll der Drahtzieher sein. Ansgar, so sagt man, heiße er. Politik und Medien fordern, gegen ihn, einen Afghanistan-Veteranen, vorzugehen, bis die Tochter eines Ministers und eine Ärztin in die Hände des IS fallen. Nun sind auf einmal alle Mittel erlaubt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edwin Klein
Der Kuss des Todes
swb media publishing|thriller
Teil I
Immer wenn der Weise kam, versammelten sich viele Neugierige um den großen Dorfplatz. In der Mitte errichtete man ein Podest und darüber spannte man als Schutz vor der Sonne eine Plane. Jeder konnte den Weisen sehen, jeder zu ihm gehen und ihn um Rat fragen. Heute war der Andrang wieder einmal sehr groß.
Der kleine Junge, vielleicht sieben oder acht Jahre alt, wartete geduldig, bis er an der Reihe war. Zögernd, als überlege er es sich noch einmal und als sei er sich noch nicht schlüssig, stieg er die zwei Stufen hinauf, rieb die Hände an seinen Oberschenkeln und blieb etwas verlegen stehen.
Der alte Mann deutete auf einen Stuhl und der Junge setzte sich auf die vordere Kante. Seine nackten Fußspitzen konnten gerade so den Boden berühren.
„Hast du lange gewartet?“
Der Junge nickte.
„Haben sich andere vorgedrängelt?“
Erneut nickte er.
„Das ist gut, denn du bist jetzt der Letzte, und ich habe alle Zeit der Welt für dich.“
Der Junge schluckte und schaute auf seine Hände. Er wirkte unsicher und verlegen. Nur für ihn war jetzt der Weise da.
„Wie heißt du denn?“
„Beraim.“
„Woher stammen die blauen Flecke? Die Wunde an der Stirn?“
Der Junge zuckte mit der Schulter.
„Wie kann ich dir helfen?“
„Sie sind doch der Weise, den man um Rat fragen kann. Sie sollen alles wissen.“
Der alte Mann lächelte, Falten sprangen in sein Gesicht, die Augen wurden kleiner und versteckten sich dahinter. „Nicht alles, weiß Gott nicht alles. Aber einiges weiß ich schon. Zumindest behauptet man das von mir. Was also willst du wissen?“
Zögernd, als überlegte sich der Junge seine Worte ganz genau, begann er zu sprechen. „Ich habe gehört, wie Sie gesagt haben, man darf Gewalt nicht mit Gewalt beantworten.“
„Das stimmt.“
„Ich habe mich daran gehalten.“ Langsam hob Beraim den Kopf. Er schaute den alten Mann an, als sollte der alles Weitere in seinen Augen lesen. Immerhin war er ja der Weise.
„Man hat dir Gewalt angetan?“
Beraim nickte.
„Und du hast dich nicht gewehrt?“
„Ja.“
„Daher also diese blauen Flecke und die Wunde.“
„Ich habe noch nicht einmal geschrien. Es hat so weh getan, aber ich habe nicht geschrien.“
„Und es hat nichts genützt? Ich meine, nicht wehren und nicht schreien?“
Beraim drehte seine Handflächen nach oben. „Er ist größer und älter und stärker als ich und er hat nur gelacht.“
Der Weise nickte, als könne er nun verstehen.
„Hast du versucht, mit ihm zu sprechen? Worte haben auch nicht gewirkt?“
„Ich fand einfach keine Zeit dazu. Der andere hat mich sofort geschlagen. So wie sonst auch immer.“
Der Alte stützte seinen Kopf mit der Hand und überlegte.
„Wenn du ihn das nächste Mal siehst, hebe beide Hände und sage: Halt.“
„Und dann?“
„Frage ihn, was du tun musst, damit er dich nicht mehr schlägt.“
Der Junge überlegte, als schien ihn etwas zu stören. „Ich soll ihn nicht fragen, warum er es macht?“
Der Weise verneinte. „Er weiß es selbst nicht. Er hat seinen Spaß daran, sich zu bestätigen, weil du der Jüngere und Kleinere bist. Frage ihn also, was du machen kannst, damit er aufhört.“
Der Junge nickte schließlich und versprach: „Ich werde es probieren. Vielen Dank.“
**
Die Hitze stand über der mit Gras bewachsenen Ebene und die Luft flimmerte. Keine Wolke am Himmel, hie und da ein zaghafter Windstoß, zu schwach, um Kühlung zu bringen. Aber wiederum so stark, dass dürre Grasbüschel von ihm bewegt wurden. Träge trudelten sie umher, stießen gegen andere oder hüpften über sie hinweg. Staub wirbelte auf, feiner, pudriger, roter Staub.
Halbrechts ein großer Baum, stark belaubt, auf dem viele Vögel saßen. Es schien, als machten sie Siesta. Von Zeit zu Zeit richtete sich einer auf, breitete seine Flügel aus, als wollte er etwas verscheuchen, um gleich darauf wieder die angestammte träge Haltung einzunehmen. Am Schatten konnte man erkennen, dass die Sonne ziemlich senkrecht stehen musste.
Nicht weit entfernt einige Militärfahrzeuge in der für sie typischen Farbe, beige-grau-oliv. Besonders das Olive deutete an, sie kamen aus einem anderen Land. Olive als Tarnfarbe war in diesen Breiten eher auffällig.
Ein Mann mit weißer Hautfarbe schaute durch ein Fernglas. Er war der einzige und nannte sich Berater. Um ihn herum mindestens dreißig bewaffnete Farbige, die ihn nicht aus den Augen ließen. Seit einigen Wochen war er mit ihnen unterwegs, um sie zu schulen, zu warnen und auf den Feind vorzubereiten. Dabei kannte er ihn noch weniger als sie. Aber, so erzählte man sich, er sollte ein Experte sein. Und die kannten eben alles. Das war bereits von ihm bewiesen worden.
Der Weiße, hochgewachsen und blond in einer Militäruniform ohne Rangzeichen, wandte den Kopf und schaute zu seinem Nachbarn, einem massigen, übergewichtigen Major mit dem schönen Namen Ngabud. Er hatte seinen Körper in die zu kleine Uniform gezwängt, und der Stoff verstärkte jede seiner wulstigen Rundungen. Tief grub sich der Gürtel seiner Hose in den Leib und verschwand irgendwo. Und die Schweißränder unter seinen Achseln reichten bis zum Bund.
„Das Dorf und die wenigen Hütten stehen vor uns in der Senke. Und ich glaube, ich habe auch einige Funkantennen ausgemacht“, sagte der Weiße auf Englisch.
„Dann stimmt die Meldung also doch, Mister Meyer.“
Meyer nickte. „Erster Kontakt mit dem Hinweis vor vier Stunden. Könnte hinkommen. Sie sind meiner Meinung nach noch in dem Dorf, denn die Funkantennen sind ja fast immer auf Autos montiert.“
„Und wie viele?“, wollte Ngabud wissen. Sein Englisch war längst nicht so gut wie das von Meyer.
Meyer zuckte mit der Schulter. „Ich weiß es nicht. Vor vier Stunden, der Kontakt, er sprach von etwa vierzig.“
Der Massige schien zu schrumpfen. „Dann müssen wir auf Verstärkung warten“, meinte Ngabud. „Wir sind gerade mal dreißig.“
Angsthase. Aber das sprach Meyer nicht aus. „Es ist so verdammt ruhig“, sagte er stattdessen. „In dem Dorf sollen doch auch noch etwa hundert Menschen wohnen. Warum ist alles so ruhig?“ Ob die Bevölkerung inzwischen geflüchtet war? Man sie vielleicht sogar vorher gewarnt hatte, überlegte er.
Ngabud fand keine Antwort und zuckte mit der Schulter. „Vielleicht hat man sie alle gefangen und gefesselt“, glaubte er als Lösung anbieten zu können. „Oder sogar schon getötet“, setzte er noch einen drauf. Denn das Töten war eine der Spezialitäten ihres Feindes. Je grausamer, desto mehr schien es ihn zufriedenzustellen. Um die Gegner einzuschüchtern.
Meyer wackelte unschlüssig mit dem Kopf. „Seit einer halben Stunde beobachten wir alles. Zwei Späher waren bis auf dreißig Meter an der ersten Hütte. Nichts, keine Regung und kein Geräusch.“
„Ich weiß. Man wartet auf uns.“ Für Ngabud war das die nächstliegende Erklärung. Und er wusste genau, was das bedeutete: den sicheren Tod. Der Gegner war sehr gut mit modernen Waffen ausgerüstet. Und er war für seine Kompromisslosigkeit bekannt. Nie fragen, nur schießen und töten. Vielleicht noch etwas quälen und verstümmeln.
„Nein. Dann hätten sie uns schon längst angegriffen. Sie sind doch immer so gut bewaffnet. Noch nie haben sie sich versteckt.“
Das stimmte auch wieder, gab ihm der Major recht. Er nagte auf seiner Lippe, denn es lag an ihm, eine Entscheidung zu fällen. Stattdessen fragte er jedoch: „Was sollen wir tun?“
„Wir schleichen zum Dorf, schicken zwei oder drei als Vorhut, mal sehen, was geschieht.“ Meyer, der Experte, bot eine alte Taktik an, die man bereits im Kampf gegen die Indianer im Wilden Westen angewandt hatte, als sei es der letzte Schrei.
„Dann können wir uns immer noch zurückziehen“, meinte der Major und war beruhigt, als Meyer dazu nickte. Der unehrenhafte Rückzug war allemal besser als ein ehrenhafter Tod. Immerhin hatte er drei Frauen und vierzehn Kinder zu ernähren. Die vierte Frau war vor einem Jahr durch den Feind gestorben. Das wäre eigentlich ein Grund gewesen, ihm dankbar zu sein.
Auf einen Wink von Ngabud machten sich drei Männer langsam auf den Weg in Richtung Dorf. Man sah ihnen an, dass sie nichts von ihrem Auftrag hielten. Sie nutzen jede sich bietende Deckung aus, und das war hier und da ein Busch. Ihnen kam zugute, dass man sie aus dem Dorf noch nicht sehen konnte, weil es etwas tiefer lag.
Im gebührenden Abstand folgten die anderen Soldaten. Vier ließ man zurück, um die Fahrzeuge zu bewachen.
Zehn Minuten später schlichen die ersten drei an den Hütten vorbei. Nichts. Keine Regung, keine Reaktion, kein Geräusch, kein Schuss.
Nach weiteren zwei Minuten winkten sie aufgeregt in ihre Richtung. Sie standen offen zwischen den Hütten, also gab es von dort keine Gefahr.
Bevor sich die Soldaten mit Meyer und Ngabud in Bewegung setzten, sprach der Weiße noch etwas in ein Satellitentelefon. Er wartete auf eine Antwort, nickte verstehend und sagte zu dem Schwarzen: „Im Umkreis von dreißig Kilometern keine weiteren Fahrzeuge. Wir können also.“
Offen gingen sie nun auf das Dorf zu, die Soldaten hatten ihre Waffe im Anschlag.
Aufgeregt deutete einer von der Vorhut auf die erste Hütte. Meyer und Ngabud gingen hinein und mussten einige Sekunden warten, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Auf dem Boden lagen einige Männer, allesamt in unterschiedlichen, zusammengewürfelten Uniformen und Tarnanzügen, sie waren gefesselt. Und eine Erklärung, warum es keine Geräusche gegeben hatte, gab es auch. Man hatte ihnen den Mund zugeklebt. Zudem waren sie so aneinander gebunden, dass sie sich kaum bewegen konnten. Und noch etwas war zu sehen, ihre Hosen standen offen.
Meyer, der nun alles klar erkennen konnte, stutzte und blieb erstarrt stehen. Neben ihm der Major stöhnte auf. Dann sahen sie sich an, als wollten sie sich vergewissern, das Gleiche gesehen zu haben.
Meyer beugte sich zu dem ersten Gefesselten. In seinen Augen war nicht nur eine grenzenlose Angst, sondern auch unendlicher Schmerz. Ohne mit dem Mann gesprochen zu haben, wusste Meyer nach einem Blick auf dessen Unterleib sofort, dieser Boko Haram Terrorist würde nie mehr im Leben eine Frau vergewaltigen können.
**
Jeder hat im Leben schon mal aus unterschiedlichem Grund einen Wendepunkt – oder auch mehrere. Man orientiert sich neu, ist voller Hoffnung und möchte nur eines: alles besser machen als zuvor, Erinnerungen und vieles andere abstreifen, sogenannte Altlasten endgültig hinter sich lassen. Befreit von allem wird dann durchgestartet in der Hoffnung, nicht die vergangenen Fehler zu wiederholen. Manchmal klappt es auch. Aber die meisten verfallen in alte Schemata, und das Spiel beginnt unter anderen Vorzeichen von vorn und dauert – bis zum nächsten Wendepunkt.
Bei ihm war es anders. Seine Veränderung war nicht gewollt, sondern zwangsweise. Wenn die militärisch stärkste Nation der Welt nach jemandem sucht und man nicht entdeckt werden will, dann geht das nicht ohne ein Mindestmaß an Aufwand. In seinem Fall sogar unterstützt durch die Regierung seines Landes. Er verschwand von der Bildfläche, als sei er verschluckt worden. Dass es ihn einmal gegeben hatte, ließ sich allerdings nicht leugnen. Zu prägnant war die Spur, die er hinterlassen hatte. Zu sehr mit Blut und Tod und Demütigung behaftet.
Und wenn sein Untertauchen eine Flucht war, dann für ihn eine schöne. Andere, die Gleiches oder Ähnliches wie er durchgemacht hatten, versteckten sich vielleicht über Jahre wie in einer Höhle, er jedoch suchte die Weite, das Leben, auch das Unbekannte und den Nervenkitzel. Das konnte er auch unbesonnen tun, denn ihm war eine absolut neue, glaubhafte und jede Überprüfung standhaltende Identität zugestanden worden. Nicht aus Dankbarkeit oder um ihm einen Gefallen zu erweisen, sondern aus Selbstschutz des Kanzleramtes, weil er zu viel wusste und nie in die Verlegenheit kommen sollte, etwas auszuplaudern.
Einen unbedeutenderen und unauffälligeren Nachnamen hätte er sich nicht aussuchen können als denjenigen, den man ihm verpasste. Seit einigen Monaten nannte er sich Schmitt, Ansgar Schmitt. Und er war ausgestattet mit einem echten Pass, so wie man Menschen ausstattete, die durch ein Zeugenschutzprogramm geschützt werden sollten. Ihn musste man auch schützen, unbedingt schützen. Weil es den Interessen Deutschlands diente, was immer man auch darunter zu verstehen hatte.
Was er selbst wählen durfte, war sein Aufenthaltsort. Weit weg, angenehmes Klima, freundliche Menschen, nichts, was ihn an die Vergangenheit erinnerte. Südafrika. Englisch sprach er perfekt, ein Relikt aus seinem Vorleben als Bundeswehrsoldat mit besonderer Mission in Afghanistan. Anpassungsschwierigkeiten kannte er nicht, denn er bewegte sich bereits seit einigen Monaten in dieser südafrikanischen Region und die ersten Kontakte waren längst geknüpft. Als Student gab er sich aus, war auch schon mal an der Universität in Stellenbosch zu sehen. Und weil es ihm in seiner neuen Heimat so gut gefiel, hatte er sich sogar vor wenigen Wochen ein Apartment direkt in der ersten Strandlinie mit Blick auf das Kap gekauft.
Wie magisch zog es ihn in die Höhe, seitdem er Kapstadt und Umgebung als seine neue Heimat ausgewählt hatte. Heute ging es wieder hinauf auf den Tafelberg. Er hatte gehört, es solle da einen Verrückten geben, der bereits mehr als viertausend Mal auf dem Gipfel – sicherlich die falsche Bezeichnung für ein großes, flach geneigtes Plateau – gewesen sei. Diesen Rekord wollte er nicht brechen. Aber die zehn würde er heute vollmachen.
Er stieg aus der Gondel, schritt eine leichte Anhöhe hinauf, wandte sich nach links und schaute, wie all die Male zuvor auch, zuerst einmal auf die Metropole mit den sie umschließenden Bergen auf der einen und dem Hafen auf der anderen Seite. Halblinks das Stadion der Weltmeisterschaft wie ein riesiger, silbrig glitzernder, gestrandeter Wal. Im Hafen die gigantischen, abgewinkelten Arme der Schwerlastkräne. Und mittendrin, wie eine sich erhebende Insel, verglaste und kühn geschwungene Hochhäuser mit zwanzig Geschossen und mehr.
„Immer wieder schön, nicht wahr?“
Ohne den Kopf zu wenden und den Sprecher anzuschauen, nickte er zustimmend.
„So viele Millionen können sich nicht irren“, meinte der Hinzugetretene und spielte auf die Faszination des Tafelberges an, um den sich viele Mythen rankten. Wenn Wolken ihn umschlossen, dann hatte er eben sein Tischtuch aufgelegt. Und falls Nebel aufkam, dann nur deswegen, weil seine Besucher nicht den schönen Blick hinunter verdient hatten.
„Warum treffen wir uns auf diese Weise?“, wollte Ansgar wissen. „So konspirativ. Ich gehe davon aus, du bist seit mindestens einer Stunde hier oben.“
„Mindestens. Und lass es uns auch weiterhin so handhaben. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht.“
Die beiden Männer begrüßten sich mit einem Nicken, ein Handschlag, das wäre vielleicht zu auffällig gewesen.
Ansgar war wenige Zentimeter größer als Helge Wommerding, dafür hatte Letzterer etliche Kilogramm mehr anzubieten, die jedoch immer noch einigermaßen gut verteilt waren. Auch seine Harre waren länger als die von Wommerding, der einen kurzen Bürstenschnitt bevorzugte. Zudem trug er einen Vollbart, während der etwa zehn Jahre Ältere glatt rasiert war.
„Helge, schau dir doch mal diese Farben an.“ Ansgar deutete auf einige Sträucher in blau und violett und auf die Protea einige Meter entfernt. „Jetzt, im Frühjahr, blühen sie ungemein intensiv.“
„Wir haben doch November.“
„Aber hier ist Frühling.“
Wie die vielen anderen Besucher auch, spazierten sie dem Anschein nach ohne rechtes Ziel umher, schauten sich hier etwas an, wandten sich in eine andere Richtung oder machten Fotos von einer der schönen Buchten am Atlantik, in denen die Gischt wie ein weißes schäumendes Band bei Camps Bay die Küstenlinie nachzog.
„Ich bin der Einzige, der deine neue Identität kennt.“
Ansgar betrachtete Wommerding von der Seite. Er wusste, dass dieser ihn zu beruhigen versuchte. Trotz des professionellen Wechsels seiner Identität schwang immer etwas mit, was er aber niemals als Angst bezeichnen und noch weniger zugeben würde. „Dann weiß ich ja auch, wer daran schuld ist, wenn sie auffliegt.“
Wommerding wechselte das Thema. „Hast du es dir überlegt?“
Ansgar zuckte mit der Schulter. „Bin noch dabei. Gar nicht so einfach nach alldem, was ich erlebt habe.“
„Keine Lust auf Abenteuer?“ Der etwas Übergewichtige lächelte.
„Hatte ich von denen denn nicht genug?“, stellte er die Gegenfrage.
Und das hatte er, wie Wommerding zugeben musste. Afghanistan, das war für Ansgar ein Alptraum gewesen. Damals nannte er sich noch Daniel, seine afghanische Freundin war mitsamt ihrer Familie durch eine amerikanische Rakete getötet worden. Und genau damit begann der Alptraum für die Amerikaner, mit der Rache von Daniel, die er auf ungewöhnliche Weise umgesetzt hatte. Deshalb suchten sie nach ihm, ohne ihm jedoch im Grunde genommen etwas vorwerfen zu können. Es war ihre Rakete gewesen, die amerikanische Bürger traf und tötete. Unter ihnen auch hohe Experten der CIA und der NSA, was wohl besonders wurmte. Und weil sich die Amerikaner nicht erklären konnten, wie es dazu gekommen war, sie nie und nimmer – Fehler machten nur andere – sich selbst als Verursacher sahen, wollte man unbedingt Ansgar in die Hände bekommen, denn eine ihrer Spuren führte zu ihm. Und dann würden sie aus ihm das herausstanzen, was sie benötigten, und es als Geständnis bezeichnen. Den Weg, wie sie dazu gekommen wären, würde man nie nachvollziehen können.
„Geld gibt es genug.“
„Geld habe ich genug.“
„Dann kannst du also nur mit der Aufgabe umgestimmt werden?“ Wommerding schmunzelte. „Wenn sie einen Sinn hat oder du einen Sinn in ihr siehst.“
Ansgar schaute seinen Nachbarn nur an, ohne zu antworten.
„Vor wenigen Tagen gab es ein geheimes Treffen in Knokke. Seltsamerweise waren sich alle beteiligten Nationen einig, sogar die Russen haben zugestimmt. Ihnen scheint es mit allem ernst zu sein.“
„China war aber nicht dabei, oder doch?“, wollte Ansgar wissen.
„Die sind nie dabei. Aber es gibt noch einen erweiterten Kreis, ich nenne sie mal extreme Sympathisanten, Japaner, Jordanier und Ägypter. Und es werden immer mehr, die nur das eine wollen.“
Ansgar deutete auf eine Bank. Sie setzten sich. „Fast so wie vor zwei Jahren in Gibraltar“, meinte Wommerding, spielte damit auf ihr erstes Treffen an und fügte hinzu: „Hier gibt es auch Affen, wie ich gehört habe.“
Sie schwiegen eine Weile. Wommerding, Mitarbeiter im Bundesnachrichtendienst und in besonderer Mission gleich dem Kanzleramt unterstellt – und dort einem Staatssekretär namens Augustin – überlegte, wie er Ansgar überreden konnte. Aus seiner Sicht machte die geplante Aktion nur Sinn, wenn der erfahrene ehemalige Soldat mit von der Partie war. Und er bestand gegenüber dem Staatssekretär förmlich auf Ansgar, ohne dessen Hintergrund preiszugeben, weil er über mehr als ein Jahr mitbekommen hatte, welche Fähigkeiten der Jüngere vorweisen konnte.
„Es geht um den internationalen Terrorismus“, begann er vorsichtig. „Besonders um die vier oder fünf bekannten großen Gruppierungen, die Lösegeld erpressen, Videos ins Internet stellen …“
„… und ihre Gefangenen enthaupten, verbrennen, die Kehle durchschneiden ...“
„Genau um die geht es.“
„Die einen Kalifenstaat zu gründen versuchen und sich durch eine extreme Form von Gewalt und Menschenverachtung auszeichnen.“
„Du hast es verstanden“, schmunzelte Wommerding. „Geld spielt keine Rolle. Sackweise schütten sie die Dollars und Euros aus, nur um dieses Mal schneller gewinnen zu können.“
„Gewinnen?“ Ansgar drehte seinen Kopf und sah Wommerding an. „Unmöglich, wenn du deinen Gegner permanent unterschätzt, weil du denkst, er handelt eventuell genauso rational und logisch wie du. Habe gewisse Prinzipien und Grundsätze, beachte gewisse Regeln und die Menschenrechte. Auf die Art und Weise, wie gewisse hohe Herren und die sogenannten Experten es sich vorstellen, ich meine die Regierungen der westlichen Staaten, klappt das nie.“
„Was stellen sie sich denn deiner Meinung nach vor?“
Ansgar seufzte. „Den Moralischen unter dem Druck der Weltöffentlichkeit spielen und demonstrieren, dass die Demokratie über das Unrecht siegt. Verhandeln statt kämpfen, Worte anstelle von Patronen. Alle Parteien an einen Tisch bringen und das Problem mit rechtsstaatlichen Mitteln lösen. Und warum gehen sie so vor, weil sie Angst haben. Vor den Medien, vor den Wählern, weil sie sich rechtfertigen müssen, aber am meisten Muffe haben sie vor der Unberechenbarkeit der Terroristen. Und dass es denen scheißegal ist, wenn sie drauf gehen. Ich meine die Islamisten.“
Wommerding schwieg einige Sekunden. „Alle an einen Tisch und verhandeln und Probleme lösen, davon sind die abgekommen“, widersprach er. „So zumindest mein Staatssekretär, der an dem Treffen teilgenommen hat. Wenn ich dir gleich das Video aushändige, damit du es dir zu Hause in Ruhe anschauen kannst, dann sei bitte nicht überrascht, wenn sich niemand mit Namen anspricht. Sie kennen sich, mit Ausnahme des Russen, bereits seit mindestens zehn, manche schon mehr als zwanzig Jahre. Und es ist ihnen gelungen, bisher alles unter der Decke zu halten. Du musst wissen, dass diese Gruppe nicht erst seit einigen Wochen aktiv ist. Und Rechtsstaatlichkeit, das haben sie sich abgeschminkt.“
Ansgar schaute den etwa Vierzigjährigen skeptisch von der Seite an. Was er zu hören bekam, passte nicht in das Schema, welches er kannte. Zu seiner Zeit in Afghanistan hatte er über jede Patrone Rechenschaft abzulegen. Bevor ein Befehl ausgeführt, ein Angriff umgesetzt wurde, glühten die Drähte mit dem Auswärtigen Amt und dem Kanzleramt in Berlin und mit dem Bundesnachrichtendienst. Und natürlich auch diejenigen mit den Amerikanern, der Nato und der ISAF, die über alles informiert wurden. Kein Angriff, wenn sich Zivilisten in der Nähe befanden und zu Schaden kommen konnten, lautete die Devise. Die Deutschen versuchten sich daran zu halten und bliesen auch schon mal eine bereits angelaufene Aktion deswegen ab. Aber weil dies nicht immer umzusetzen war, auch Kinder den Tod fanden, viele Kinder, war sich Deutschland vor der Weltöffentlichkeit ständig am Rechtfertigen. Andere Staaten genossen es, den Weltmoralapostel an seiner eigenen Moral zu packen und ihn vor allen zu entblößen. Beispielhaft das Desaster von Kundus mit den Tankwagen, bei dessen Beschuss mehr als hundert Zivilisten den Tod fanden. Der deutsche Makel in Afghanistan!
„Wie soll denn die sogenannte Befehlsstruktur verlaufen?“, wollte Ansgar wissen.
„Jedes Land, insgesamt sind es zehn, benennt einen Koordinator. Ich bin derjenige für Deutschland und mir fällt die Aufgabe zu, eine Einheit von ca. fünfzig Experten zusammenzustellen. Rechenschaft muss ich allein dem Staatssekretär gegenüber ablegen. Aber ich bin nicht verpflichtet, ihm alles mitzuteilen. Was er nicht weiß …“
Ansgar runzelte skeptisch die Stirn. „Und die Öffentlichkeit? Die Medien?“
Wommerding lachte und warf einen Blick über die Schulter. Sie waren allein, niemand interessierte sich für sie. Mehr als zwanzig Meter entfernt pilgerte eine Touristengruppe unter Anleitung einer Dame eifrig fotografierend über das Plateau.
„Ganz einfach, uns gibt es nicht. Wir existieren nicht, alles wird abgestritten, weil das, was wir tun, mit der Rechtsstaatlichkeit vielleicht nicht immer konform geht. Befehle haben einen verdammt kurzen Instanzenweg, bis zur Umsetzung dauert es vielleicht ein oder zwei Sekunden. Und wenn es euch Spezialisten nicht gibt, dann gibt es auch keine Fragen, dann gibt es keine Rechtfertigung und auch im Zweifelsfall keine Anklage.“
„Also illegal.“ Ansgar sprach diese beiden Worte ohne Emotion aus, unaufgeregt und mit neutraler Stimme, als habe er etwas in der Art erwartet. „Blackwater auf Deutsch“, fügte er in Anlehnung an die in Verruf gekommene Privatarmee der Amerikaner im Irak hinzu, die sich mehr durch illegale Verhörmethoden und Folter einen Namen gemacht hatte als durch militärische Erfolge.
Wommerding schüttelte den Kopf. „Ganz legal, nur unsichtbar und ohne Beweis für eure Existenz. Ich als Bindeglied bin der Einzige für die deutschen Teilnehmer, der alles weiß. Und für den Fall, dass mir etwas passiert, werde ich eine notarielle Absicherung einbauen. Ihr werdet bezahlt, kommt, wenn ihr euch verletzt, in ein Krankenhaus und die Familie erhält einen finanziellen Zuschuss, falls ...“
„... einer von uns auf der Strecke bleibt.“
„So ist es.“ Wommerding lehnte sich zurück. „An wen soll ich denn dein Geld überweisen? Etwa an deinen Vater?“
Ansgar lachte abfällig. „Bitte nicht an diesen Oberschullehrer. Dann noch eher an meinen Bruder.“
„Gut, werde ich erledigen.“
„Moment mal, so weit sind wir noch nicht“, protestierte Ansgar. Er stand auf und wanderte in kleinen Schritten umher. „Welche Strategie wollt ihr denn anwenden?“
„Ich dachte, die würdest du uns bieten.“
Der Jüngere schaute zu Wommerding hinunter, der sitzengeblieben war und ihn beobachtete. Der schien sich zu amüsieren. In seinen Augen blitzte es.
„Hast du schon eine?“
Ansgar verneinte. „Ich weiß nur, wie es nicht funktioniert. Amerikanische Jäger und Tarnkappenbomber können nichts gegen kleine mobile Einheiten ausrichten. Außerdem kostet eine Tomahawk mehr als eine Million Euro, die sprichwörtlich in den Wind geschossen werden. Und die Drohnen wissen nicht, wer der Feind ist. Er trägt keine Markierung. Handysignale sind auch kaum ein Allheilmittel, denn man weiß nicht wie in Afghanistan, wer eines benutzt und welche Nummer er hat. Einfach drauflos ballern, wie sie es bisher versucht haben, geht in die Hose. Beispiele dafür gibt es genug.“
„Das weiß man inzwischen. Genau deswegen bin ich ja hier. Hast du nicht das Allerwichtigste vergessen? Das Grundprinzip, wie du einen Gegner zermürben kannst?“
Ansgar nickte. „Du musst sie einschüchtern, ihnen eine wahnsinnige Angst machen und sie im Ungewissen lassen. Nichts darf sich wiederholen, wir müssen unberechenbar und zugleich unsichtbar bleiben. Es gibt uns nicht, nur unser Ergebnis. Zuschlagen aus dem Nirgendwo, blitzschnell, tödlich. Und die Art ihres Todes darf nicht dazu beitragen, ehrenhaft in das Paradies einzukehren.“
Wommerding nickte zustimmend.
„Das alles funktioniert womöglich in Syrien, dem Irak, auch Pakistan, Afghanistan, Nigeria und Algerien. Aber was ist mit Europa?“
„Wie, Europa?“
Ansgar lächelte hart. „Die Rückkehrer, die genug von dem IS und der Front haben und sich mit neuen Identitäten unter die Flüchtlinge mischen. Allesamt exzellent ausgebildet, immer noch fanatisch, mit Beziehungen und allem was dazu gehört. Wie wollt ihr die bekämpfen? Siehe England und Frankreich, wo sie mehrfach zugeschlagen haben, zuvor jedoch als Asylant in Deutschland eingereist waren. Also wie?“
„Was spricht dagegen, es auf eine ähnliche diskrete Art und Weise zu tun?“, antwortete Wommerding süffisant lächelnd.
**
Die einen sagen, es sei schon immer so gewesen, das Leid dieser Erde habe nicht zugenommen. Es werde lediglich durch die weltweite Verbreitung intensiver darüber berichtet, wodurch gewisse Gruppierungen sich animiert fühlten, als Nachahmer aufzutreten. Erst recht, wenn sie sich des Medieninteresses sicher sein konnten. Aber Nachahmen allein genügte den meisten nicht mehr, denn das Spiel lautete nun: Mach mehr daraus, sei ausgefallener, schriller, grausamer, perverser, tödlicher.
Viele sind jedoch ganz anderer Meinung. Wenn die Dummheit der Menschheit grenzenlos sei, wie Einstein vermutete, dann auch die Phantasie, sich Gräueltaten auszudenken und perverse Möglichkeiten, um, aus welchen niederen Motiven auch immer, gegen die eigene Spezies vorzugehen. Weder Dummheit noch Intelligenz seien dazu prädestiniert, allein das Krankhafte im Menschen selbst genüge. Und das sei nun mal bei jedem vorhanden. Es stelle sich allein die Frage, mit Hilfe welcher moralischen und ethischen Grundwerte jeder für sich selbst entscheidet, dem Krankhaften nachzugehen oder ihm zu entsagen. Intelligenz sei zweitrangig, aber sie führe in der negativen Variante oft dazu, die Perversion zu perfektionieren.
Wie auch immer, wo es Leid gibt, finden sich auf der anderen Seite Einrichtungen und Menschen, es zu bekämpfen. Oftmals sogar uneigennützig, ganz im Dienste des absolut Guten, wie Kant es wohl formuliert hätte.
Trotzdem gehörte viel Mut dazu, sich als Arzt freiwillig zu Einsätzen in den Hauptkrisengebieten der Welt zu melden.
Viele meinten, es sei doch schon ein gehöriges Maß an Leichtsinn, sich zwischen streitenden, kriegsführenden Parteien für die notleidende Bevölkerung einzusetzen. Andere wiederum waren der Auffassung, es sei noch längst nicht genug, es müsse noch mehr getan werden, egal wie viele Bomben fielen.
„Man braucht uns, deshalb sind wir hier“, ist die oft zu hörende lapidare Antwort der Ärzte ohne Grenzen. Finanzielle Interessen, die einige ihnen gerne unterstellen würden, um deren Entscheidung besser verstehen zu können, gab es absolut nicht. Alles ist Mangelware, Medikamente, Hilfspersonal, die Unterbringung, Gerätschaften und erst recht die Entlohnung. Und einmal vor Ort hatten sie auch noch mit der Bürokratie des Landes zu kämpfen, als wollten einige Staaten nicht zugeben, dass sie auf Hilfe von außerhalb angewiesen seien.
Melanie Albers, noch keine dreißig, hatte gerade ihre Zeit als Assistenzärztin in Stuttgart beendet. Es waren Bilder im Fernsehen, die das Leid der Bevölkerung aufzeigten und die sie bewegten – da unverheiratet und ohne Kinder und feste Bindung –, sich zu einem solchen Einsatz im Irak zu verpflichten. Sie wusste genau, was auf sie zukam, sie wusste auch, was eventuell auf sie zukommen könnte. Ihre Entscheidung war nicht spontan, sondern wohlüberlegt.
Ihre Familie beruhigte sie, indem sie argumentierte, sie sei ja gerade mal sechzig Kilometer von Bagdad entfernt. Sozusagen auf sicherem Terrain.
Als sie jedoch in Kertul ankam, auf dem halben Weg nach Samarra, war sie selbst nicht mehr so von ihren eigenen Worten überzeugt. Am Straßenrand demolierte Pkw, ausgebrannte Militärfahrzeuge, zerstörte Häuser und viele Menschen, die zu Fuß unterwegs waren. Busse fuhren keine.
In Kertul bekam sie zu hören, man schicke sie mit einem kleinen Team einige Kilometer weiter in Richtung des Thertar Sees in einen kleinen Ort namens Egolan, dort sei gerade die Cholera ausgebrochen. Eine Krankheit, die man inzwischen schnell und wirkungsvoll bekämpfen konnte. Die Vorhut sei bereits damit beschäftigt, die Räumlichkeiten, eine ehemalige kleine Krankenstation aus der Zeit des Irak-Krieges, herzurichten.
Als Melanie ankam, bestanden die Räumlichkeiten aus zwei Zimmern in einem halb zerstörten Haus und einem Zelt davor. Insgesamt vier Liegen aus Metall und mit einer dünnen Matratze bestückt fand sie vor, und für die Helfer eine notdürftige Unterkunft in einem weiteren Zelt. Keine Dusche, keine dem westlichem Verständnis entsprechende Toilette, nur das fließende Wasser war einigermaßen sauber. Und Strom hatte man, wenn überhaupt, höchstens zu gewissen Tageszeiten.
So ganz vertraute man sicherlich nicht der offiziellen Version, dass es relativ ungefährlich sei, sich in dieser Region zu bewegen. Warum sonst hatte man dem kleinen Team insgesamt sechs Soldaten als Bewachung mitgegeben? Da aber auch sie keine Gefahr erkannten, dösten sie im Schatten, und ständig waren zwei von ihnen unterwegs, um etwas zu besorgen. Meist waren es Bier und Zigaretten. Und Hefte mit bunten Bildern, überwiegend unverschleierten und nackten Frauen.
Über fehlende Patienten brauchte sie sich nicht zu beklagen. Sie kamen mit allen Wehwehchen, Übelkeit, Durchfall, Armbrüchen, Verletzungen an den Beinen. Unter ihnen auch ein Junge, der auf eine Mine getreten war und den Unterschenkel verloren hatte. Sie konnten ihn versorgen und in ein weiter entferntes Krankenhaus bringen lassen. Aber kein Fall von Cholera.
Melanie telefonierte mit Kertul, es gebe keine Cholera, zumindest sei noch kein Patient bei ihr aufgetaucht. Aber man bestand darauf, es habe bereits Fälle gegeben und diese seien auch den Behörden gemeldet worden.
Die Woche begann an diesem Montag ohne einen Patienten. Das war ungewöhnlich. Niemand wartete, niemand stand vor dem Behandlungsraum. Gegen elf am Morgen erkannte Melanie eine Gruppe dunkel gekleideter Frauen, die auf dem Weg zu ihnen waren. Wenn sie überhaupt etwas störte, dann der Umstand, dass sich kein Kind unter ihnen befand. Werden wohl schon älter sein, konstatierte sie.
Als die Frauen noch zwanzig Meter entfernt waren, ließen sie ihre schwarzen Umhänge und Kleider fallen, rissen Maschinenpistolen hoch und schossen auf die dösenden Soldaten. Zwei waren sofort tot, die beiden Verwundeten brachen zusammen und wimmerten vor sich hin. Die restlichen zwei waren zu ihrem Glück wieder einmal unterwegs. Und genau das war Melanies Hoffnung, als man sie und das andere Hilfspersonal in das Gebäude zerrte und fesselte und ihnen ein Band über den Mund klebte.
Finstere, dunkel gekleidete und vermummte Gestalten, von denen eine massive physische Bedrohung ausging, starrten sie nun an. Das Gesicht fast ganz verdeckt, nur die stechenden Augen waren zu sehen.
Als einer der Verwundeten, sich auf Händen und Ellbogen abstützend, zum Haus gerobbt kam, wurde er von einem der Terroristen erschossen. Einfach so, ohne dass er auch nur eine Sekunde überlegte. Und anschließend grinste er auf eine Art, als sei er mit sich zufrieden.
„Pässe“, kommandierte einer der drei Männer auf Englisch, der vierte stand vor dem Haus. Melanie deutete mit dem Kopf auf die Tür zum Nebenraum. Dort stand ein Schrank und der Mann bediente sich. Er stellte sich vor die vier Gefesselten, zwei kamen aus Europa, die beiden Helferinnen, beide lediglich mit Kopftuch, stammten aus dem Irak.
Die Männer unterhielten sich leise und Melanie erkannte, wie die Irakerinnen zusammenzuckten und sie hilfesuchend anschauten. Hatten sie mitbekommen, was man mit ihnen plante?
Der Tote wurde in das Haus gezerrt, anschließend auch der zweite Verletzte, mit dem man nicht allzu zaghaft umging. Melanie erkannte, er hatte einen Bauchschuss und würde die Verletzung ohne sofortige Hilfe nicht überleben.
Zwei der Milizionäre beobachteten das Gelände vor der medizinischen Hilfsstation, einer telefonierte und der Vierte baute sich vor Melanie auf.
„Du kommst also aus Deutschland“, stellte er mit passablem Englisch fest und schien zufrieden zu sein.
Melanie nickte. Sie wusste, dass viele ausländische Kämpfer für den Islamischen Staat rekrutiert worden waren. Und dass es sich hier um diese Miliz handelte, war für sie ohne Zweifel.
„Stuttgart?“, fragte er, weil er einen Brief mit ihrer Anschrift entdeckt hatte.
Wieder nickte Melanie.
„Das ist gut.“
Zu ihrem Kollegen Jean-Claude gewandt, ein Franzose, änderte sich die Haltung des Milizionärs. Ohne Vorwarnung schlug er ihm ins Gesicht, anschließend rammte er ihm den Lauf der Maschinenpistole in den Unterleib.
„Warum bist du nicht zu Hause geblieben“, knurrte er. „Ihr habt Glaubensbrüder getötet.“
Ein Fahrzeug näherte sich. Weitere drei Terroristen betraten das Haus und brachten die zwei Soldaten mit, die sie unterwegs aufgelesen hatten. Inzwischen waren sie gefesselt worden und aus ihren Augen sprang förmlich die Angst.
Einer der Männer bediente eine Videokamera, zwei rissen den Verwundeten zu sich und drapierten ihn in ihrer Mitte.
Plötzlich hatte einer eine Art Machete in der Hand, stammelte einige Sätze, hielt für ein paar Sekunden ein Schild hoch, auf dem etwas auf Arabisch stand und begann dann, unkontrolliert dem Verwundeten den Kopf abzuschlagen. Das war gar nicht so einfach, erst beim sechsten oder siebten Hieb gelang es ihm.
Blut spritze aus dem zuckenden Körper und verteilte sich über die Kleidung des Zweiten, der den Hingerichteten gehalten hatte. Der fluchte in einer für Melanie fremden Sprache, die ihre Augen nicht von dieser Hinrichtung hatte abwenden können.
Die Kamera schwenkte, der Henker wollte auch den beiden anderen Soldaten den Kopf abschlagen, als er es sich aber überlegte und zu einer Maschinenpistole griff. Zwei kurze Feuerstöße, die Soldaten waren auf der Stelle tot, alles aufgenommen durch die Kamera.
Melanie und Jean-Claude wurden hochgezerrt und zum Auto geschleift, einem älteren japanischen Pickup-Geländewagen, mit einem Maschinengewehr, das man auf ein Stativ montiert hatte.
Die Gefangenen wurden brutal auf die Ladefläche gehievt, zwei Terroristen stiegen vorne ein, ein weiterer Feuerstoß war zu hören. Und die Schüsse aus dem Haus signalisierten Melanie, dass auch die beiden Irakerinnen tot waren.
Nach einigen Minuten, durchgeschüttelt von den harten Stößen der unbefestigten Straße, verlor Melanie jegliches Zeitgefühl. Ihr Oberkörper schlug gegen die Kante der Ladefläche, und wenn sie sich zu sehr zur Seite bewegte, um dem zu entgehen, traf sie der Fuß eines Milizionärs im Unterleib.
Sie wusste nicht, wie viele Stunden die Fahrt gedauert hatte. Eine kurze Pause, in der getankt wurde und man ihnen etwas Wasser zu trinken gab. Anschließend jedoch kam das Klebeband wieder auf ihren Mund.
Bereits mit den ersten Schüssen war für Melanie klar geworden, wie sich der weitere Ablauf gestalten würde. Sie und Jean-Claude waren willkommene Lösegeldopfer. Bei Jean-Claude war sie sich nicht so sicher, denn die Franzosen lehnten es grundsätzlich ab, auf die Forderungen von Terroristen einzugehen. Zudem hatten sie in Paris bitterböse Erfahrungen mit den Terroristen gemacht.
Es wurde bereits dunkel, als man das Ziel erreichte. Ein Dorf, vielleicht vierzig oder fünfzig Häuser und dazwischen etliche Zelte. Beim Näherkommen erkannte Melanie, dass man darunter Jeeps und andere Militärfahrzeuge versteckt hatte.
Die beiden Ärzte wurden in einen großen Raum gezerrt, in der Mitte eine Art Schreibtisch, auf ihm veraltete Telefone und wie zum Ausgleich daneben die neuesten iPhones und ein iPad.
Sie hatten sich aufzustellen und zu warten. Nach wenigen Minuten betrat jemand den Raum und setzte sich hinter den Schreibtisch. Sein Gesicht war nicht vermummt. Und es war ein westliches Gesicht, hell die Haut und blondbraun die Haare.
„Sie sind überrascht“, sprach er in einwandfreiem Englisch. „Wir sind internationaler als sie alle denken.“ Der Mann deutete sogar ein Lächeln an. Melanie und Jean-Claude schwiegen.
„Für Sie“, der Blonde deutete auf Jean-Claude, „könnte es ein Problem geben. Sie wissen warum?“
Jean-Claude nickte.
„Sagen Sie es.“
„Meine Regierung zahlt kein Lösegeld an Terroristen und Kidnapper.“
Der Mann nickte bestätigend. „Aber Sie“, er meinte Melanie, „Sie haben gute Karten. Deutschland hat bisher immer gezahlt. Vor einem Jahr auf den Philippinen fast fünf Millionen, vor drei Monaten in Algerien knapp vier und zwei Millionen in Somalia vergangene Woche.“ Zufrieden lehnte er sich in seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Alles an ihm strahlte eine unnachahmliche Überlegenheit aus, die allerdings auf lediglich einen einzigen Umstand zurückzuführen war: Er und seinesgleichen konnten eine unübertroffene Menschenverachtung vorweisen, die, da ohne Hemmschwelle, auf einer nach oben offenen Skala an Grausamkeiten bisher von niemandem überboten worden war. Und dieser Umstand, dass sie unsägliche Angst und Ekel und Abscheu verbreiteten, gab ihnen eine äußerst zweifelhafte Form von Macht.
Was der Milizionär sagte, war für Melanie allerdings keine Beruhigung. Sie wusste, wie schnell die Terroristen ihre Meinung ändern konnten. Falls es opportun war und das Video genau den Schock auslöste, den man beabsichtige, verzichtete man auch schon mal auf das Lösegeld und ging stattdessen gleich in das Internet. Zehn Millionen Klicks zeigten mehr Wirkung als fünf Millionen Euro Lösegeld.
„Unser Vorteil ist, dass ihr so leicht auszurechnen seid“, begann der Milizionär. „Ihr mit eurer Moral, eurer Hilfsbereitschaft, eurer Selbstlosigkeit, euch im Wettkampf mit den anderen Nationen genau darin gegenseitig zu überbieten. Wer leistet am schnellsten und am effektivsten Hilfe? Wer schickt die meisten Ärzte? Wer fliegt die meisten Schwerkranken von hier nach Europa? Wer bringt die meisten Millionen Euro in Form von Spenden auf, die jedoch nie dort ankommen, wo sie ankommen sollen?“ Der Blonde lachte laut, als habe er als Einziger das Spiel durchschaut. Als bereite es ihm einen Heidenspaß, seinen beiden Gefangenen eine Lehrstunde zu geben. „Und ihr“, er deutete mit einer Hand auf Melanie und Jean-Claude, „ihr fallt genauso auf alles herein. Man braucht nur das Gerücht Cholera zu streuen, euch den Ort zu nennen, prompt seid ihr unterwegs. Ihr wollt ja unbedingt helfen, weil ihr denkt, die ganze Welt schaut auf euch. Als wenn es in euren Genen liegen würde. Und schon können wir euch problemlos schnappen.“
„Es gab also keine Cholera?“, fragte Melanie fassungslos.
„Nein, absolut nicht.“
„Und nur um uns …“
Der Blonde zuckte mit der Schulter. „Nichts Persönliches. Ein Geschäft, und ihr seid die Ware. Und man kann euch bei uns freikaufen. Für den Kerl jedoch sehe ich schwarz.“ Er deutete auf den Franzosen, und dem war das auch bewusst. Schon jetzt gab er sich keinen Illusionen mehr hin.
Der Blonde spielte mit seinem iPhone. Drückte ein paar Mal auf die dunkle Fläche, nickte vor sich hin und erhielt schließlich sogar einen Anruf. Nur ein einziges Wort sagte er zum Schluss, was wohl, da in einer fremden Sprache ausgesprochen, ein Ja bedeutete.
„Inzwischen ist unser Video fertiggestellt“, meinte er aufschauend in einem ruhigen, zivilisierten Ton. „In weniger als einer Stunde darf die Welt an unseren Taten teilhaben.“
**
Auf den Reiz einer Stadt angesprochen, antworten viele ausweichend und umschreibend, sie habe Flair, was immer man darunter verstehen mag, oder Fluidum, Ambiente, das gewisse Etwas. Und weil man Flair samt verwandten Umschreibungen schlecht greifen, riechen oder schmecken kann, benutzt man den Begriff auch gerne in der Werbebranche, will man aus guten Gründen präzise Formulierungen vermeiden. Flair eines Kleides, eines Autos oder eines Parfüms, auch das von Wohnungen, Häusern und Frauen.
Falls überhaupt vorhanden, versteckt sich das Flair von Knokke, der belgischen Seemetropole, geschickt vor dem Besucher. Zyniker wiederum gestehen ihr ein gewisses Maß an Flair zu, allerdings nur auf die Vergangenheit bezogen, denn spätestens mit dem Wachsen der Betonhochburgen an der Küstenlinie, die nun einen uneingeschränkten Blick auf die Nordsee verhindern, soll auch Knokkes Flair mehr und mehr zubetoniert worden sein.
Nur die Bewohner der Stadt, noch mehr allerdings die zeitweiligen Bewohner, die sich in Knokke einen Zweitwohnsitz leisten können, bewegen und benehmen sich so, als habe ihre Stadt den Rang von Florenz, Pisa, Venedig, Nizza oder Monaco. In dieser Fehleinschätzung liegt ihr Verhalten begründet, welches, von einer alles vereinnahmenden Arroganz überlagert, zu lächerlichen Exzessen führt: Pelze im Frühsommer oder an warmen Tagen? In Knokke ja, ohne ihre Besitzer als singuläre Erscheinungen oder spleenige Exoten abtun zu können. Viele laufen bei jeder sich bietenden Möglichkeit so herum, auch bei Regen, dann allerdings unter einem durchsichtigen Cape, und versuchen ihre Physiognomie mit der Höhe des Bankkontos in Einklang zu bringen. Wen wundert es da, dass man sich in nicht abgesprochener Übereinkunft gerne dem Schein hingibt, um Wert vorzutäuschen? So auch mit der Raubkatze, die als unverkennbares Autosignum Geschmeidigkeit und Kraft verspricht, wobei sich beides allerdings in den typ- oder fabrikationsbedingt gehäuften Werkstattaufenthalten kaum entfalten kann. In Knokke fühlt sich ausgerechnet dieser Typ heimisch, noch weit vor Stern und Blau-Weiß, in gewisser Weise vereint mit Rolls Royce, obwohl beide Marken schon lange nicht mehr in englischer Hand sind. Vielleicht, weil passend zum Mantel?
Inzwischen waren die Scheiben des Abrissgebäudes blind geworden, der Putz fleckig grau und an einigen Stellen aufgeplatzt, die Architektur nicht mehr zeitgemäß, also zu viel Tradition und zu wenig Beton. Aber zumindest der Name Empereur, dunkel vom Schmutz der Jahre umkränzt und noch genau dort zu sehen, wo einst die Leuchtschrift angebracht war, korrespondierte augenfällig mit den anderen der Umgebung wie Carlton, Charls und Shakespeare, die mit ihren Hotelsternen protzen, was bissige Zeitgenossen zuweilen zu der Bemerkung veranlasst, man zähle wohl die des Cognacs mit hinzu. Vivaldi, Mozart und van Gogh, allesamt unzweifelhaft in ihrer Größe, rangierten nur unter „ferner liefen“ und bemühten sich, mit übertrieben großen goldenen Buchstaben, optisch schlichten Appartementhäusern zu mehr Ansehen zu verhelfen.
Das zum Sterben freigegebene Empereur suchten die Herren auf. Obwohl sie wegen des meist himmelwärts gerichteten Blickes der Anwohner vor Entdeckung sicher sein durften, bewegten sie sich umständlich und vorsichtig, ließen ihre Autos irgendwo abseits vom Zentrum am Beginn der Lippenslan oder der Elizabetlan stehen, um zu Fuß an ihrem Treffpunkt zu gelangen. Andere wiederum reisten mit dem Zug an, benutzten ein Taxi und stiegen zwei Querstraßen vorher aus. Eines allerdings hatten alle Männer gemeinsam, als sie die angegebene Adresse erreichten. Sie stellten sich zuerst einmal mit dem Rücken zum Haus, beobachteten wie ein Urlauber die Umgebung, blickten zur Nordsee und klopften erst, wenn sie sich vor einem Beobachter sicher wähnten, versteckt und in einem bestimmtem Rhythmus gegen die glatte Metalltür. Ohne Quietschen, weil gut geölt, wurde daraufhin geöffnet, der Ankömmling hereingebeten und die Tür sofort wieder verschlossen.
Als schließlich der Franzose eintraf, zählten sie zehn, und es fehlte keiner mehr. Unschlüssig, wie es schien, standen sie sich in dunklen Mänteln und ebensolchen Anzügen gegenüber, nickten sich zu, denn sie kannten sich bereits seit vielen Jahren. Nur der Russe war neu. Fehlte nur noch ein Chinese, dann wären auch alle vetoberechtigen Nationen der UN vertreten. Mit Befremden inspizierten sie die Baumaterialien, den zusammengekarrten Schutt oder die Palette mit Zement. Sie waren normalerweise eine andere Umgebung gewöhnt als kahle Räume und nackte Birnen, die ein grelles, ungefiltertes Licht verbreiteten. Ihre Augen verirrten sich, suchten die Wände ab, an denen es außer freigelegten Leitungen nichts zu sehen gab, wanderten dann weiter nach oben und blieben für eine Weile an dem Loch in der Betondecke hängen, durch das man ins nächste Geschoss und, durch ein weiteres, sogar bis ins übernächste blicken konnte.
Sie blickten sich der Reihe nach an, als gelte es, einen von ihnen auszugucken.
„Ich danke Ihnen, meine Herren, für Ihr Erscheinen“, begann der großgewachsene, blondgraue Luxemburger auf Englisch.
„Kein Problem, haben ja sowieso alle im Augenblick in Brüssel zu tun“, warf der Deutsche mit dem streng nach hinten gekämmten grauen Haar ein. Nicken und Murmeln reihum fasste er als Zustimmung auf.
„Nochmals vielen Dank. Nun“, begann der Luxemburger bedeutungsvoll, atmete wie zum Auftakt tief durch und rückte seine randlose Brille zurecht. „Sie werden diesen Treffpunkt als etwas ungewöhnlich empfinden, die Umstände auch, aber ich persönlich habe für uns keine andere Möglichkeit gesehen, so schnell und auf unbürokratische Art zusammenzukommen. Der Grund ist Ihnen allen geläufig. Offiziell treffen sich unter Leitung des amerikanischen Präsidenten mehr als zwanzig Sicherheitsexperten aus unterschiedlichen Ländern, und wir sind wieder einmal angehalten, wie bereits seit mehr als zwanzig Jahren, diese diskrete Variante zu nehmen. Eigentlich gibt es uns überhaupt nicht, und damit auch nicht das, was wir beschließen und wofür wir uns einsetzen. Es geht wie immer um den internationalen Terrorismus, besonders in Syrien und dem Irak, sowie in Nigeria, Somalia und Jemen. Algerien und die Philippinen nicht zu vergessen. Es geht um eine Form der Grausamkeit und Menschenverachtung, die wir bisher noch nicht erlebt haben. Entführungen, Tötungen, besonders Enthauptungen und Kreuzigungen. Wieder hat der internationale Terrorismus viele Todesopfer gefordert.“
Nach wenigen, als pietätvoll auszulegenden Augenblicken fragte der Luxemburger die Anwesenden: „Haben Sie sich in der Zwischenzeit schon die Möglichkeit eines effektiveren Vorgehens überlegt?“
Der Deutsche, niemand wusste, dass er ein Staatssekretär im Kanzleramt in Berlin war, durch und durch Politiker und mit allen Untiefen und Fußangeln seines Berufes vertraut, gab sogleich zu bedenken: „Wir drängen doch die Terroristen, besonders den IS, auf breiter Front zurück. Brauchen wir überhaupt andere Wege in der Bekämpfung? Genügt uns denn die manifestierte und vertraglich abgesicherte Zusammenarbeit zwischen unseren Staaten nicht mehr?“
„Zu viele Länderkompetenzen“, gab der Belgier dem neben ihm sitzenden Luxemburger Schützenhilfe. „Und dann der Instanzenweg. Bis wir uns geeinigt haben … siehe Irak und Syrien. Aber das heißt dann immer noch nicht, dass wir auch koordiniert vorgehen.“
„Wie soll denn der neue Weg aussehen?“, hakte der Deutsche nach. Keiner fühlte sich angesprochen, erst recht nicht bei einem derart heiklen Thema. Wie schnell konnte man sich in einem solchen Fall durch eine klare Aussage oder Einschätzung für alle Zeiten die politische Karriere verbauen! Unüberlegtes Vorpreschen war nicht ratsam.
Der Luxemburger griff daraufhin in seine Brusttasche und zog einen Zettel hervor. „Viele Jahre kannten wir grob und vereinfacht gesagt zwei Arten von Terrorismus: den zerstörenden, sich auf brutale Anschläge stützenden, der Todesopfer in Kauf nimmt, die Öffentlichkeit schockieren will, manchmal als Alibi schwammige politische Anschauungen anbietet, und dann die gezielte Entführung an sich zur Erpressung von Lösegeld, um die Kasse aufzufüllen.“
„Wodurch man dann genug Geld hat, Ersteres in die Tat umzusetzen“, knurrte der drahtige Franzose abfällig, denn er kannte sich in den Methoden der französischen Nationalplage, den kriminellen Algeriern, besonders gut aus. Inzwischen schien es in dem ehemaligen Kolonialstaat eine Art Volkssport zu sein, Touristen zu entführen und sie erst gegen ein horrendes Lösegeld wieder freizulassen. Auf Deutsche schien man sich konzentriert zu haben, denn die, so sagt man, zahlen immer.
„Ja, das ist und war oft der Kreislauf“, gab sich der Luxemburger resigniert und schränkte sofort ein: „Wenn man die philippinische und somalische Form des Kidnappings, die sich dort schon fast zum kriminellem Nationalsport ausgeweitet hat, vorerst ausklammert.“
„Und die nigerianische Variante?“ Der Belgier erhielt keine Antwort. So, wie man ihm vor zwanzig Jahren auf die Frage nach der ehemaligen IRA-Version auch keine Antwort hätte geben können, fiel es den Experten doch immens schwer, Konflikte von nationalen Minderheiten in irgendeiner Form dem Terrorismus zuzuordnen. Als Freiheitskämpfer bezeichneten sich die Terroristen damals wie heute meist selbst in falscher heroischer Anwandlung, wodurch der Bevölkerung suggeriert werden sollte, sie lebte in permanenter Unfreiheit. Und der Belgier konnte all dies wohl aus eigener Anschauung noch am besten beurteilen, weil in seinem Land Flamen und Wallonen von jeher zu Reibereien neigten, deren Ursprung, vereinfacht ausgedrückt, im sprachlichen Gegensatz zu suchen war, während die CGC, die kämpfenden kommunistischen Zellen Belgiens, sich einen Dreck um die Sprache scherten und mehr auf normalen, sprich brutalen Terrorpfaden wandelten. Damals, was waren das noch Zeiten, als es gewisse Gesetzmäßigkeiten gab, den Terror zu klassifizieren. Und heute? Die einzige Gesetzmäßigkeit schien zu sein, den jeweiligen Vorgänger in der Brutalität und Unmenschlichkeit zu überbieten. Noch mehr zu schockieren, Angst zu verbreiten, und sich dadurch der Medien und deren Aufmerksamkeit sicher zu sein.
Der Luxemburger faltete langsam seinen Zettel auseinander, benutzte ihn aber immer noch nicht. „Wie Sie wissen, meine Herren, waren das Kidnapping und die anschließende Lösegeldforderung nie unser Hauptproblem. Zum einen, weil jedes Kidnapping als solches von der Öffentlichkeit sofort als Verbrechen entlarvt wird, also der vorgetäuschten Ideologie zuwiderläuft. Zum anderen gibt es für diese Fälle seit langem speziell abzuschließende Versicherungen.“
„Bei Lloyds, wenn ich mich nicht irre“, sagte der Amerikaner.
„Genau.“
„Ist dadurch das Kidnapping heute als weniger gefährlich einzuordnen? Ich meine das Kidnapping von Personen im hochsensiblen Bereich, in der Politik etwa.“
„Nein, aber einem Kidnapper liegt meist nichts an seinem Opfer, er will Geld. Und die Versicherung garantiert es ja förmlich.“
„Genau deshalb werden auch so viele Opfer umgebracht, wenn man das Geld erst einmal hat“, entgegnete der Deutsche sarkastisch und dachte dabei an Vorfälle, die sich mit seinen Landsleuten im Ausland abgespielt hatten. Besonders in Algerien. Zuletzt auch auf den Philippinen.
Der Luxemburger überhörte dies und blieb freundlich. „Sie haben mir das Stichwort geliefert. Ein kleiner Schwenk in die Vergangenheit. Der Versicherer Lloyds hat vor vielen Jahren auf dem Höhepunkt der Entführungen, sozusagen in der Zeit des Booms, eine Antikidnapping beziehungsweise eine Antiterror Einheit ins Leben gerufen. Haben Sie davon schon gehört?“
Der Engländer, Lloyds war ja immerhin eine englische Gesellschaft, glaubte sich als Einziger zu erinnern, winkte aber trotzdem ab.
„Einer der Gründer war ein ehemaliger britischer SAS Offizier“, sprach der Luxemburger weiter. „Man gab der Einheit den Namen Control Risks Limited. Das Unternehmen expandierte, die Leistungen stabilisierten sich, gewannen an Qualität. Und da Sie, meine Herren, noch nichts von Control Risks und ihren Erfolgen gehört haben, ist zumindest ein weiterer Grundsatz der Gesellschaft erfüllt worden: Geheimhaltung. Absolute Geheimhaltung. Beides, Qualität und Geheimhaltung, bürgte seinerzeit für den bemerkenswerten Erfolg von Control Risks, deren Mitarbeiter sich fast ausschließlich aus ehemaligen Agenten der Geheimdienste rekrutieren. Natürlich gibt es auch Stimmen gegen eine solche Einrichtung, Stimmen aus der Politik und von Polizeiexperten, denen die Methoden nicht zusagen und die dadurch eine Schädigung ihrer Arbeit befürchten. Wir glauben doch auch alle, wenn wir ehrlich sind, dass die Bekämpfung des Terrors nur in den Aufgabenbereich des Staates fällt. Ist aber mit dieser Forderung auch zugleich der Erfolg gewährleistet?“
Der Luxemburger suchte die Blicke seiner Gesprächspartner, die ihm Mal für Mal entglitten. „Nein, es ist kein Erfolg gewährleistet“, beantwortete er sich seine Frage selbst, „sonst hätten wir das Problem des Terrors längst entschärft.“
Er machte eine Pause, in die der Deutsche provokant hineinplatzte: „Und jetzt sollen wir eine ähnliche Einrichtung gründen, unter Wahrung der absolutem Geheimhaltung, wenn ich Sie richtig verstanden habe.“
Der Luxemburger schüttelte den Kopf. „Nein. Aber lassen Sie mich erst einmal meine Ausführungen beenden. Control Risks hat in der Folgezeit einen Informationsservice aufgebaut, der die Bezeichnung CRIS trug. CRIS war wohl die umfangreichste Datenbank, was Terroristen, deren Arbeitsweise, Geldbeschaffung, Ruheräume, Plätze zum Untertauchen und ähnliches anbelangte. Nur wenn wir datentechnisch sofort reagieren können, haben wir eine Chance, den Kampf gegen den Terror zu gewinnen. Das ist es, was ich Ihnen zuerst vorschlagen möchte, meine Herren. Eine neue, nicht nur europaweite Datenbank, in die wir alle Informationen eingeben, die wir zur Bekämpfung des Terrors benötigen.“
Der Luxemburger faltete seinen Zettel zusammen und steckte ihn wieder in die Brusttasche. Der Franzose reckte sich auf seinem Hochsitz und gab zweierlei zu bedenken: „Überschätzen Sie da nicht unsere Möglichkeiten? Haben wir denn nicht auch schon bisher äußerst erfolgreich zusammengearbeitet? Interpol fällt mir da ein, mehr noch aber unsere Antiterror Einheiten. So einig wie seit Paris sind wir doch noch nie gewesen.“
Der Deutsche räusperte sich, da er den letzten Punkt nicht ganz zutreffend fand. Wie oft schon hatte sein Ministerium vergeblich versucht, Terroristen habhaft zu werden, die sich, trotz eines vereinten Europa, in Frankreich verschanzt hatten. Wie oft akzeptierten die Franzosen deren Auffassung, sie seien politisch verfolgt, um diese als Vorwand für eine Nichtauslieferung zu benutzen. Und erst die Jugoslawen? Das Spielchen mit deren Kriegsverbrechern? Nicht zu vergessen die Türkei und andere Staaten, in denen es zusätzlich noch den Religionskonflikt gab.
„Aber was nützt uns das Wissen um die Arbeitsweise der Terroristen, das meiste ist uns bekannt, was nützt es uns, ihre Schlupflöcher zu kennen, wenn wir keine Möglichkeit haben, schnell und hart zuzuschlagen. Nur mit einer neuen Datenbank ausgestattet, müssten wir immer wieder andere um Mithilfe ersuchen. Wie sieht es aber dann mit der von Ihnen so beschworenen Geheimhaltung aus?“ Der Luxemburger war dem Deutschen dankbar für den Einwand, so glasklar, wie dieser das eigentliche Problem ausgesprochen hatte. „Wir sind heute inoffiziell zusammengekommen, sind sozusagen unter uns. Es gibt kein Protokoll, kein Tonband, nichts. Wir können also frei unsere Bedenken äußern und, falls es sich ergeben und wir einer Meinung sein sollten, dementsprechend auf unsere Minister einwirken und sofort starten. Ohne Verzögerung. Und damit komme ich jetzt zum eigentlichen Anlass unseres Treffens, zu dem Punkt, über den wir uns möglichst schnell einigen sollten.“
Der Luxemburger rückte sich die Brille zurecht und wirkte nervös. „Sicherlich wäre es aus unser aller Sicht nicht erstrebenswert, eine aktiv operierende Einrichtung zu schaffen, die europaweite Befugnisse hat, mit allen Daten versorgt wird und gegenüber jeder Regierungsstelle Rechenschaft ablegen muss, liegt doch die Effizienz einer solchen Einrichtung überwiegend in ihrem offiziellen Nichtvorhandensein.“
Nach diesem Exkurs besann sich der Luxemburger endlich auf seinen Zettel und begann: „Heute benötigen wir mehr als noch vor vier oder fünf oder zehn Jahren. Noch mehr, als wir es in Jemen und in Mogadischu umgesetzt haben. Und in Somalia. Wir müssen uns wieder einmal anpassen, denn nicht wir bestimmen das Tempo, sondern die Gegenseite. Allerdings hat sich einiges geändert in den vergangenen Monaten. Geld spielt plötzlich keine Rolle mehr. Unser Etat ist schier unerschöpflich.“
Der Luxemburger, sie sprachen sich nie mit Namen an, sah auf, bemerkte die skeptischen Gesichter, ließ sich dadurch nicht irritieren und sprach besonnen weiter. Er ließ die Ereignisse der letzten Monate Revue passieren und kam auf die jüngste Vergangenheit zu sprechen. Auf das Schockierende. Auf kranke Fanatiker, die ihre Religion so auslegten, um jede noch so krankhafte bestialische Form zu rechtfertigen. Auf Kreuzigungen und Enthauptungen und auf Nachahmer, die sich dadurch ins Gespräch zu bringen versuchten, dass sie zu Trittbrettfahrern des Unmenschlichen wurden. Er sprach vom IS, von Boko Haram, Abu Sharif … Er sprach mit belegter Stimme, denn vor geraumer Zeit hatte niemand gedacht, dass sich einmal diese Form des Terrors überhaupt würde etablieren können. Mit der unendlichen Dummheit der Menschen, wie Einstein sie sah, geht auch das unendlich Krankhafte einher. Gehirne, die keine Grenzen kannten, wenn es um ein Höchstmaß an Brutalität und Grausamkeit ging.
Der Russe zwinkerte dem Amerikaner zu, der massierte seine Finger und grinste leicht. Was er bereits vor mehr als vier Jahren vorgeschlagen hatte, damals noch auf Al Kaida und besonders Afghanistan bezogen, schien sich nun plötzlich umsetzen zu lassen. Und zwar nicht im Alleingang, sondern mit Hilfe der übrigen Nationen. Nun hatte die Weltöffentlichkeit, falls es überhaupt dazu kommen sollte, auf zehn Schultern einzuprügeln und nicht mehr nur auf die breite amerikanische.
„Ähnlich wie Blackwater im Irak rekrutieren wir eine … anonyme Eingreifgruppe, die schnell, effektiv und vor allem besonders geheim arbeiten soll. Die keinen Zwängen unterliegt, die kein UN-Mandat benötigt, die keine Rechenschaft abzulegen hat. Warum auch? Es gibt sie ja überhaupt nicht.“
Die Anwesenden nickten, damit hatten sie gerechnet, dafür hatten sie sich bei ihren Regierungen bereits eingesetzt und Zustimmung erhalten. Etwas schaffen, was nicht zu greifen war. Und damit würde es auch bei Misserfolgen keine Schuldzuweisungen geben.
„Wir haben die Rüstungskonzerne im Boot. Insgesamt sieben von ihnen, vier amerikanische, ein englischer, ein deutscher und ein italienischer haben insgesamt fünfhundert Millionen in unsere Kasse gezahlt. Das ist amtlich.“
Als einzige Reaktion konnte man ein leichtes Raunen hören. Nicht der Umstand, dass die Konzerne mit dabei waren, sondern allein die Höhe ihrer Aufwendungen war dafür verantwortlich. Mit so vielen Millionen konnte man schon etwas anfangen.
„Wenn ich recht verstehe, dann arbeiten die zukünftigen Mitarbeiter in jeder Beziehung unlimited“, bemerkte der Deutsche. „Wie sie vorgehen, ist allein ihre Angelegenheit. Wen sie wann und wie lange foltern, einem den Hals abschneiden oder was auch immer, spielt absolut keine Rolle, allein der Erfolg ist maßgebend. Sie sollen effektiv sein, Angst verbreiten und die Moral der selbstsicher auftretenden Terroristen aushöhlen.“
Wenn der Deutsche gedacht hatte, nun würde jemand wegen seiner provokanten und überaus klaren Formulierungen protestieren, dann sah er sich getäuscht. Jeder den er anschaute nickte zustimmend.
„Juristisch haben wir es prüfen lassen, der Kampf gegen eine weltweit anerkannte Terrorzelle oder Miliz ist nach europäischem Recht nicht strafbar. Weder in einer fremden Armee, zum Beispiel in der der Kurden, noch in einer neu zu gründenden Einheit. Und es wird folglich keine Aufarbeitung durch Staatsanwälte geben, keine langwierigen Prozesse, keine Rechtfertigungen. Nichts von alledem.“
Wieder nur Zustimmung.
„Mit der Folter ist es allerdings etwas anderes. Aber das brauche ich wohl an dieser Stelle nicht zu erwähnen.“
Allgemeines Nicken. Das wusste man also auch.
„Dann gibt es eigentlich nur noch ein Problem: Wo in unseren zivilisierten Staaten finden wir genügend Kämpfer, die sich genauso menschenverachtend verhalten wie diejenigen, die wir bekämpfen wollen? Oder sogar noch mehr, wegen der Einschüchterung und der Angst?“
**
Mehrfach hatte sich Ansgar das einstündige Video vom Treffen in Knokke angeschaut. Wie der deutsche Staatssekretär Augustin – Wommerding hatte seinen Namen genannt – es hatte anfertigen können, interessierte ihn nur am Rande. Dazu gab es genügend Möglichkeiten. Die übrigen Teilnehmer werden wohl auch Aufzeichnungen gemacht haben, sagte er sich. Was ihn am meisten erstaunte war die Klarheit, mit der sich die Anwesenden, jeder ein politischer Vertreter eines demokratischen Landes, für eine Vorgehensweise aussprachen, die sogar der der Terroristen entsprechen durfte. Vorausgesetzt, der Erfolg stellte sich ein und die absolute Geheimhaltung wurde gewahrt. Genau aus diesem Grund teilte man die neue Einrichtung in der Art auf, dass jedes Land für sich und seinen Fähigkeiten entsprechend Spezialisten rekrutierte und zusammenfügte. Es müsse zudem einen Koordinator benennen, der allein und ausschließlich mit dieser Einheit verschmolzen war und sie nach außen abzuschotten hatte. Über diesen Koordinator sollten alle Befehle, Anfragen und auch die Geldtransfers laufen und er sollte niemandem Rechenschaft ablegen müssen außer gegenüber einem Ansprechpartner im Ministerium. Dessen Aufgabe sah man jedoch nicht darin, regulierend in die Einsätze einzugreifen oder gewisse Vorgaben zu machen, sondern lediglich die Aktion nach außen hin abzublocken, um ein mögliches politisches Desaster zu verhindern. Abstimmen wollte man allein die Einsatzgebiete, die Vorgehensweise jedoch war frei. Via Satellit, per GPS oder wie auch immer konnte jeder uneingeschränkt auf die für ihn notwendige Datenfülle zugreifen. Das hatte der Amerikaner zugesagt, die man schon seit jeher um ihre Terrorismusdatei beneidete.
Nur in einem Punkt wichen seine Informationen von denjenigen ab, die der Luxemburger kundgetan hatte. In den vergangenen Monaten war die Nachfrage wegen der Schandtaten des IS an einschlägigen Versicherungen enorm gestiegen. Mehr und mehr versicherten die Unternehmen ihre Mitarbeiter mit diesen Spezial-Policen, den sogenannten Kidnap and Ransom Versicherungen. In Deutschland selbst boten sechs Konzerne sie an und die Deckungssummen in einem Entführungsfall schwankten zwischen drei und fünfzig Millionen. Die Enthauptungen hatten einen regelrechten Boom ausgelöst und im vergangenen Jahr wurden mehr als tausend Policen verkauft. Manche von ihnen waren mit einer Jahresprämie von bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro versehen, was die Nachfrage jedoch bisher noch nicht schmälern konnte.
Aber Ansgar war im Zwiespalt. Ihm ging es gut, er spürte, wie seine Lockerheit zunahm, die Gedanken der Vergangenheit sich nicht mehr so nach vorne drängten. Verblasst jedoch waren sie noch lange nicht. Wieder und wieder sah er das Bild seine Freundin Ayalisha vor sich, die mit zwanzig Jahren hatte sterben müssen. Ein sinnloser Tod in einem sinnlosen Krieg, den man nie gewinnen konnte. Gegen historische Strukturen und die manifestierte Religion eines Landes kam keine noch so ausgeklügelte westliche Politik an. Tradition schlägt in solchen Fällen immer den Fortschritt.
Sollte er seinen Genesungsprozess, den Frieden, den er allmählich mit sich selbst machte, seine neue Identität und seine neue … Heimat aufgeben? Dem Wunsch Wommerdings nachkommen und sich zur Verfügung stellen, mit all seinen exzellenten Fähigkeiten, Menschen aufzuspüren und sie zu töten?
In Afghanistan war er legitimiert durch die Bundesregierung und ein UN-Mandat, denn Deutschland hatte man in eine Allianz eingebunden, zusammen mit anderen Nationen. Und nun das genaue Gegenteil. Kein UN-Mandat, keine politische Unterstützung, operieren im Geheimen, gelockt durch eine Unmenge von Geld. Allein Letzteres garantierte schon fast einen Erfolg, denn es würden sich immer wieder welche finden, die für Geld kämpften. Selbst die Terrororganisationen bezahlten ihre Krieger. Ausschließlich mit Koran und religiöser Überzeugung ließ sich kein Krieg führen. Es musste schon jemand geben, der seinen Finger am Abzugsbügel krümmte.