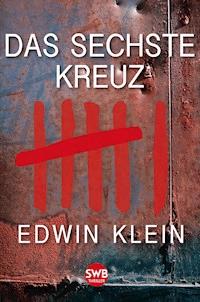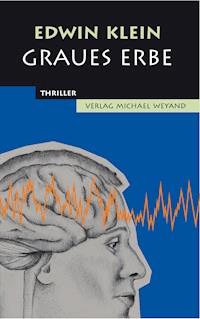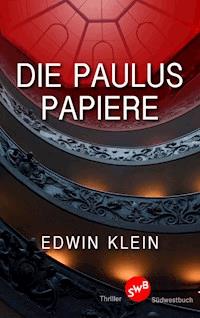Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SWB Media Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenig später registrierte er in der Ferne die Scheinwerfer eines Konvois, mindestens ein Dutzend helle Augen in der Dunkelheit. Sein Körper spannte sich, die Ruhe war wie weggewischt, er wirkte angriffsbereit. Für einige Sekunden blieben die Scheinwerfer hinter einer vorspringenden Waldzunge verschwunden, dann tauchten sie wieder auf und kamen direkt auf ihn zu. Als sie vielleicht noch fünfhundert Meter von ihm entfernt waren, stieß er sich ab und schwebte langsam zur Mitte der Autobahn. Während seiner kurzen, nur wenige Sekunden dauernden Reise legte er ohne Hast den länglichen Gegenstand über die Schulter, fixierte durch den Laserzielbeleuchter das dritte Scheinwerferpaar an, wanderte dann einen Tick höher bis zur Windschutzscheibe, hielt sie im Sucher fest und drückte ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Tochter des Attentäters
Edwin Klein
Umwelthinweis:
Dieses Buch wurde auf chlor- und
säurefreiem Papier gedruckt
1. Auflage 2011
© 2011 Verlag Jürgen Wagner
SüdWestBuch, SWB-Verlag, Stuttgart
Lektorat und Korrektorat: Catrin Stankov, Bernau
Titelfoto: © Wallenrock und © oriontrail
2011 unter Lizenz von Shutterstock.de
Titelgestaltung: Sig Mayhew, www.mayhew-edition.de
Satz: Heinz Kasper, www.printundweb.com
Druck und Verarbeitung: E. Kurz + Co., Druck und
Medientechnik GmbH, Stuttgart www.e-kurz.de
Printed in Germany
ISBN: 978-3-942661-09-6
www.swb-verlag.de
Dies ist ein Roman. Namen, Personen und Ereignisse sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit der Wirklichkeit sind zufällig und unvermeidbar.
Nona
Das Wetter kam seinem Vorhaben sehr entgegen. Viele Stunden hatte der Regen das Land aufgeweicht, nun wälzten sich die schweren, klumpigen Wolken nach Osten und schienen die Erde erdrücken zu wollen. Manchmal gelang es dem tief stehenden Mond, eine Lücke zu finden. Bizarre Lichtgebilde, die ständig ihre Konturen veränderten, krochen übers Tal und fraßen sich die bewaldeten Hänge hinauf. Dann wieder Schwärze, dämpfend, alles verschluckend und unter sich begrabend.
Er stand ruhig an einen Baum gelehnt, verschmolz mit seiner Umgebung und war ein Teil dieser Nacht. Alles an ihm war dunkel: Kleidung, Schuhe, Handschuhe, Kapuze und sogar die Augen, die man lediglich hinter den Schlitzen erahnen konnte.
Er schaute auf seine Uhr und schirmte das beleuchtete Zifferblatt ab. Eigentlich wäre das unter den gegebenen Umständen nicht nötig gewesen, genau wie die Kapuze, die sein Gesicht verbarg, aber so hatte er es nun mal in seiner Ausbildung gelernt. Viele seiner antrainierten Verhaltensmuster waren automatisiert und jederzeit abrufbereit, ohne dass er darüber nachdenken oder sie sich erst in Erinnerung rufen musste.
Er nickte, als hätte sich die Uhr nicht geirrt und nahm wieder seine Haltung ein. An seinen Augen konnte man erkennen, dass er die Umgebung beobachtete. Aber das tat er ruhig und ohne Aufgeregtheit, als gelte es, vor dem Einschlafen Schafe zu zählen.
Nach einer Weile löste er sich vom Baum und schnallte sich einen länglichen, runden Gegenstand auf den Rücken, den ein Plastiküberzug vor Feuchtigkeit schützte. Vorsichtig und auf den glitschigen Untergrund achtend stieg er eine Böschung hinauf, blieb geduckt stehen, schaute über die Kuppe zur Autobahn und lauschte. Monoton das an- und abschwellende Rauschen der wenigen vorbeifahrenden Autos, die einen feinen Sprühnebel hinter sich herzogen. Der Mann verharrte noch einige Sekunden, richtete sich auf und steuerte auf eine etwas erhöht stehende Gruppe von Eichen zu. Er schaute nach Westen in Richtung der belgischen Stadt Namur. Sie mussten längst in Brüssel abgefahren sein, überlegte er. Zehn Minuten blieben ihm noch.
Er war nicht das erste Mal an diesem Ort. Bereits vor einer Woche hatte er ihn ausgiebig inspiziert und sich diese Stelle bei den Eichen ausgesucht. Etwas tiefer auf der anderen Seite der Autobahn konnte man, wenn der Mond wieder einmal eine Lücke zwischen den Wolken fand, gleichfalls eine Baumgruppe ausmachen. Gestern hatte er von dort ein dünnes, fast durchsichtiges Nylonseil mit eingewebten Stahlfasern zu der Eiche geschossen, unter der er jetzt stand. Zehn Minuten war er damit beschäftigt gewesen, U-förmige Tritteisen in den Stamm zu schlagen, damit er problemlos hinaufklettern konnte, um das Seil zu arretieren und zu spannen. Mit fünf Millimetern war es so dünn, dass es tagsüber von der Fahrbahn aus gegen den helleren Himmel nicht zu sehen war.
Leichtfüßig kletterte er trotz der Dunkelheit bis zur ersten Gabelung und ruckte an dem Seil, als wollte er es ein letztes Mal prüfen. Während er sich mit einer Hand festhielt, löste er mit der anderen eine Art Flaschenzug aus seinem Gürtel. Er klappte den Bügel zur Seite, legte die Rolle auf das Seil und arretierte den Bügel. Wie ein Bergsteiger in einem Sitzgurt konnte er nach wenigen Augenblicken beide Hände benutzen, nahm den länglichen Gegenstand, streifte die Plastikhülle ab, faltete sie zusammen und verstaute sie unter seinem Pullover. Die Art, wie er sich die Panzerfaust unter den linken Arm klemmte und den Griff umfasste, zeigte, dass er mit diesem Gerät seine Erfahrungen gemacht haben musste. Mit dem Zeigefinger legte er zwei Hebel um – schwach leuchtete eine Scala auf -, gab auf einer Tastatur einen vierstelligen Code ein und überprüfte die weiteren Einstellungen. Abermals verschmolz er mit der Nacht, als er sich an einen Ast lehnte. Er wirkte fast gelangweilt, sogar die Augen hatte er geschlossen.
Wenig später meldete sich sein Handy, das vereinbarte Zeichen. Nach zwei Klingeltönen war es still. Demnach waren sie nur noch drei Kilometer entfernt.
Nun schien er zu erwachen. Er suchte sich einen sicheren Stand und spähte nach Westen. Wenig später registrierte er in der Ferne die Scheinwerfer eines Konvois, mindestens ein Dutzend helle Augen in der Dunkelheit. Sein Körper spannte sich, die Ruhe war wie weggewischt, er wirkte angriffsbereit.
Für einige Sekunden blieben die Scheinwerfer hinter einer vorspringenden Waldzunge verschwunden, dann tauchten sie wieder auf und kamen direkt auf ihn zu. Als sie vielleicht noch fünfhundert Meter von ihm entfernt waren, stieß er sich ab und schwebte langsam zur Mitte der Autobahn. Während seiner kurzen, nur wenige Sekunden dauernden Reise legte er ohne Hast den länglichen Gegenstand über die Schulter, fixierte durch den Laserzielbeleuchter das dritte Scheinwerferpaar an, wanderte dann einen Tick höher bis zur Windschutzscheibe, hielt sie im Sucher fest und drückte ab.
Das anvisierte Auto schien nach wenigen Zehntelsekunden von innen mit vielen starken Blitzen erhellt zu werden, setzte zu einem Sprung an und wurde augenblicklich von der Gewalt der Explosion zerrissen. Das Fahrzeug klappte wie eine Faltschachtel auseinander, Räder und Karosserieteile flogen durch die Luft und die Überreste gingen in Flammen auf. Ein Motorradfahrer der Eskorte konnte seine Maschine nicht mehr abbremsen und raste in das Inferno. Autoscheinwerfer tauchten die Szenerie in ein bizarres Licht, begannen zu tanzen und standen still. Türen wurden aufgerissen, Männer stürmten hinaus, ihre Kommandos hallten bis zu ihm.
Der Vermummte war mittlerweile auf der anderen Seite der Autobahn angelangt, klinkte sich aus, schulterte die Panzerfaust und kletterte am Baum herunter. Unten angekommen, nahm er aus der Hosentasche einen handlichen Sender und löste auf der anderen Autobahnseite an der Eiche eine kaum hörbare Explosion aus. In knapp einer Minute hatte er das Seil zusammengerollt und es sich über Kopf und Schulter gelegt. Zügig schritt er tiefer in den Wald. Bereits nach wenigen Minuten erreichte er einen PKW, öffnete die Heckklappe, verstaute die Panzerfaust und das Seil, streifte sich die Handschuhe ab und legte sie neben die anderen Gegenstände. Ohne die Scheinwerfer einzuschalten entfernte er sich auf dem glitschigen, unbefestigten Waldweg.
Sie lehnte sich an die Schulter des kräftigen Mannes und schloss die Augen. Eine Hand lag auf seiner Brust, die andere war unter ihr Kinn geklemmt. Die Stewardess kam vorbei und brachte eine Decke. Sie merkte, wie man sie vorsichtig über sie legte und bemüht war, sie nicht zu wecken.
„Danke, Paps“, murmelte sie ohne die Augen zu öffnen. Sie schlief nicht, sondern döste vor sich hin und hörte den gleichmäßigen, kräftigen Herzschlag ihres Vaters, der beruhigend auf sie wirkte.
Ohne dass sie es sehen konnte, wusste sie, ihr Vater würde jetzt lächeln. Sicherlich schaute er auf sie herab, so wie er es immer tat, wenn sie sich abends vor dem Kamin an ihn kuschelte oder sie gemeinsam draußen vor dem Haus auf einer Bank saßen, um den Sommerabend zu genießen. Und sie wusste auch, dass er sich wohl in der Rolle als Vater fühlte und stolz auf sie war. Genauso, wie sie ungemein stolz auf diesen Berg von einem Mann war, der jeder Situation gewachsen zu sein schien, für den es kein Problem gab, das er nicht lösen konnte, in dessen Beisein sie sich immer behütet vorkam und verstanden fühlte.
Das stetige Singen der Turbinen und die feinen Vibrationen hatten sie wohl doch einschlafen lassen. Ohne es sich erklären zu können, wachte sie plötzlich auf und sah ihren Vater an.
„Schlaf weiter Spatz, es ist nichts. Wir fliegen nur durch ein Schlechtwettergebiet. Der Kapitän hat es eben durchgegeben.“ Beschützend legte er einen Arm um seine Tochter.
Sie schaute aus dem kleinen runden Fenster, als könnte sie in der Dunkelheit etwas erkennen. Das Rütteln wurde stärker, sie richtete sich auf, ihr Vater wirkte angespannt. Unvermittelt meldete sich eine Stimme über Lautsprecher, man möge die Sicherheitsgurte anlegen, sich nach vorne beugen und den Kopf zwischen die Arme legen.
„Paps, was …“
Sie kam nicht mehr dazu, den Satz auszusprechen. Ein Knall, Bersten, plötzlich fielen die Sauerstoffmasken von der Decke, ein orkanartiger Sturm breitete sich in der Kabine aus, wirbelte Zeitschriften, Getränkebecher und Kleidungsstücke durch den Gang. Eine Stewardess, die wie eine Betrunkene auf sie zu- und vorbeitaumelte, versuchte vergeblich, sich irgendwo festzuhalten und war diesen gewaltigen Kräften hilflos ausgeliefert.
Ihr Vater umfasste ihre Oberarme, hielt sie mit beiden Händen von sich und sagte. „Nona, zieh meine Jacke an. Die wird dir helfen.“ Es gelang ihr, die viel zu große Jacke überzustreifen, als plötzlich die Seitenwand des Rumpfes aufriss. Ein ohrenbetäu-bender Lärm, Eiseskälte, der Wind zerrte an ihr und riss sie mit sich nach draußen. Erstaunt registrierte sie, dass es keine Jacke, sondern ein Fallschirm war, den ihr Vater ihr angezogen hatte. Sie schwebte nach unten, und neben ihr schwebte das Flugzeug. Ihr kam nicht in den Sinn, dass dies physikalisch überhaupt nicht möglich sein konnte. Immer wieder rief sie nach ihrem Vater. Sie sah ihn am beleuchteten Fenster, er winkte ihr zu, und seine Lippen formten die Worte: „Du weißt, was du zu tun hast.“
Sie starrte ihn an, streckte die Arme in seine Richtung und rief: „Paps, ich liebe dich. Bleib bei mir.“
Allmählich sank das Flugzeug schneller, fing an zu trudeln. Unvermittelt verwandelte es sich in ein Auto, ihr Vater saß nun auf dem Beifahrersitz, blutüberströmt und mit starrem Blick. Nona zwinkerte mit den Augen, aus dem Auto wurde wieder ein Flugzeug, und für wenige Augenblicke erkannte sie ihren Vater erneut. Er lächelte, winkte ihr zu und von seinen Lippen konnte sie ablesen: „Ich liebe dich auch, Spatz. Mache es gut.“
Mit einem Schrei wachte sie auf. Ruckartig setzte sie sich hin, fühlte ihr Herz am Hals schlagen, hörte den harten, stoßweisen Atem. Ihre Stirn war heiß und feucht. Nona versuchte, die Dunkelheit zu durchdringen, schaute in Richtung Fenster, sah dort den milchigen Glanz der Straßenlaternen und wusste wieder, wo sie sich befand. Aufstöhnend ließ sie sich nach hinten fallen, vergrub ihr Gesicht im Kissen und weinte. Immer wieder diese Träume, immer wieder dieser Flugzeugabsturz. Schon seit vielen Jahren.
„Warum bist du so früh gegangen“, murmelte sie in das Kissen. „Ich hätte dich noch so gebraucht.“
Allmählich beruhigte sie sich wieder. Sie rieb sich die Tränen aus dem Gesicht, schaute auf die Uhr und stand auf. Tapsig und noch etwas schlaftrunken ging sie ins Bad, machte das Licht an und blinzelte. Sie wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser, trocknete es ab und schaute in den Spiegel: leicht verquollen ihre Augen, wirr die dunkle Haarmähne, die lockig bis zu den Schultern fiel, fast genauso dunkel ihre Augen. Sie lupfte das Nachthemd und betrachtete wie jeden Morgen ihren Körper. Schlank war sie, die Brüste straff und voll, kein Fett an Bauch und Hüften. Auch ihr Rücken schien ihr zu gefallen, denn sie nickte anerkennend, drückte ihn durch und machte ein übertriebenes Hohlkreuz. Wieder nach vorne gewandt waren ihre Scham und die Oberschenkel an der Reihe.
„Hast wohl auch schon länger keinen Mann mehr gesehen“, murmelte sie vor sich hin und ließ das Nachthemd fallen. „Wird mal langsam wieder Zeit, dass du etwas zu tun bekommst.“
Sie schnitt Grimassen, stülpte die Lippe nach oben und nach unten, entblößte die Zähne, spreizte mit jeweils zwei Fingern ihre Augen, als wollte sie sie größer machen und streckte sich die Zunge heraus.
Nona war fünfundzwanzig und gab sich überaus emanzipiert und selbstbewusst. Die meisten ihrer männlichen Bekanntschaften gelangten noch nicht einmal bis zur Tür ihrer Wohnung und, wie es schien, immer weniger schafften es hinein. Das lag jedoch nicht nur an den hochgesteckten Kriterien, die Männer bei ihr zu erfüllen hatten, sondern auch daran, dass viele vorzeitig aufgaben und sie als kompliziert, anstrengend und launisch bezeichneten. Ihr von Zeit zu Zeit den Tipp mit auf den Weg gaben: „Werd‘ erst einmal erwachsen.“ Andere wiederum meinten, ob sie überhaupt wisse, was sie wolle.
Nona wusste es schon. Allerdings würde sie es erst ganz genau wissen, wenn der Richtige kam. So elegant redete sie sich heraus.
Sie brühte einen Kaffee, setzte sich an den Tisch und knabberte dazu zwei trockene Zwieback. Sich an den Traum erinnernd, stützte sie den Kopf mit ihren Händen und starrte auf das Fenster, wo sich der Morgen ankündigte. Ihre Stimmung verschlechterte sich, sie presste die Lippen zusammen und kämpfte erneut mit den Tränen. Seit zehn Jahren war ihr Vater tot, umgekommen bei einem Flugzeugabsturz, aber in ihren schrecklichen Träumen lebte er auf eine seltsame Art und Weise weiter. Als wollten sie signalisieren, dass sie ihn nicht vergessen möge. Warum sie jedoch immer wieder die gleiche Szene träumte, manchmal mit geringfügigen Abweichungen, sie wusste es nicht.
Kurioserweise wurde es nicht kurz nach dem Tod ihres Vaters oder in den ersten Monaten immer schlimmer, sondern die Träume begannen erst wesentlich später, nach einigen Jahren. Als benötigten sie dazu eine gewisse Anlaufzeit und Reife. Manchmal saß sie in ihrem Bett, weinte und schrie und tobte zugleich.
Noch einen Schluck Kaffee, sie stellte die Tasse in die Spüle, zog das Nachthemd aus, duschte, putzte die Zähne und schminkte sich. Etwas Lidschatten, die Augen betont, die Wimpern getuscht und einen Fettstift für die Lippen, mehr war nicht nötig. Es genügte vollauf, dass sich die Männer auf der Straße nach ihr umdrehten. Erst recht, wenn sie enge Jeans, einen ihren Körper betonenden Pulli, Schuhe mit Absätzen und dazu ihre kokette, abweisende Haltung trug.
Der alte Fiat, den sie fuhr, hätte dagegen etwas mehr Kosmetik vertragen können. Aber zumindest sprang er an und brachte sie in zehn Minuten zu ihrer Arbeitsstelle im Obergeschoss eines Touristbüros. Die untere Etage war das Reich ihrer Kolleginnen, welche die Aufgabe hatten, Interessenten zu beraten, ihnen ein Hotel anzubieten oder sie einfach nur mit Prospektmaterial zu versorgen.
Nona war verantwortlich dafür, dass die Besucher von Nürtingen, die statistisch zwischen zwei und fünf Tagen blieben, immer wieder ein abwechslungsreiches Programm angeboten bekamen. Zwar entsprach diese Tätigkeit nicht ihrer Wunschvorstellung – mehrere Jahre hatte sie in England studiert und mit gutem Erfolg zwei Master abgelegt, der letzte für Internationales Management –, aber zumindest war sie realistisch genug um zu wissen, dass Wunsch und Wirklichkeit nun mal auseinanderklaffen können. Sie erinnerte sich noch an den Spruch ihres Vaters, als es genau um dieses Thema ging und er zu ihr sagte: „Was hält dich davon ab, die Wirklichkeit zu deinem Wunsch zu machen?“
„Paps, immer willst du das letzte Wort haben, immer willst du im Recht sein“, murmelte sie vor sich in, während sie die Treppe in den ersten Stock hoch stieg.
„Sag mal, bist du am Träumen?“, meinte eine ihrer Kolleginnen, weil Nona nicht auf ihren Gruß reagiert hatte.
„Schön, dass wenigstens du einen guten Morgen hast“, entgegnete sie und schritt um die Ecke in ihr Büro. Warum, so fragte sie sich, während sie den Stuhl zurechtrückte, muss ich immer solch patzige Antworten geben. Kann ich nicht mal etwas freundlicher sein?
Nona sah die Post durch, warf den Computer an und sortierte ihre Mails. Die meisten verschwanden im Papierkorb, eine öffnete sie sofort. Wann man mit der nächsten Geschichte rechnen könne, wurde angefragt.
Nona hatte neben ihrer Haupttätigkeit vor einem Jahr die Idee für eine nicht unbedingt lukrative, dafür aber umso reizvollere Nebenbeschäftigung. Auf Reisen durch ganz Deutschland stellte sie alte Villen, Bauernhöfe, Gutshäuser, Stadthäuser und teilweise auch Ruinen und verfallene Anwesen vor, die sie mit einer Geschichte, meist die des Eigentümers und seiner Familie, verband. Ein Bauer, der immer kurz vor der Ernte aus unerklärlichen Gründen sein Kornfeld umpflügte, ein Gutsherr, der seherische Fähigkeiten hatte und beim Schlafwandeln vom Dach fiel. Sehr gut angekommen war die einer älteren Dame, in deren Garten man kurz nach ihrem Tod mehrere Leichen gefunden hatte. Allesamt Männer, die bis zu einem bestimmten Punkt an ihr Interesse gezeigt hatten. Aber alle vier waren unglücklicherweise über diesen für sie endgültigen Punkt nie hinausgekommen.
Nona nahm es nicht so ganz genau mit dem Wahrheitsgehalt und beanspruchte für sich die Freiheit, schmückendes literarisches Beiwerk einzuflechten, wo es denn von Nöten war. Eine Gabe, die, wie sie meinte, von ihrem Vater stammte, der ihr in der Kinder- und Jugendzeit immer spannende Geschichten geschrieben und erzählt hatte.
Nona wollte gerade mit dem fast alltäglichen Ritual beginnen und gedanklich wieder einmal einige Jahre zurückgleiten, hatte sich dazu schon im Stuhl nach hinten gelehnt, als das Telefon ging. Ihre Mutter rief an. Ja, der Herbst sei dieses Mal besonders kühl, nein, sie gehe nicht mehr bauchfrei, ja, sie nehme Vitamine, nein, es gebe da keinen neuen Freund. Ansonsten hätte sie als Mutter es als Erste erfahren.
„Bleibt es bei morgen?“
„Was, wie bitte?“
„Nona, morgen Nachmittag, du wolltest doch zu mir kommen.“
„Natürlich. Geht in Ordnung, ich bin so gegen fünf bei dir.“
„Soll ich dir was Besonderes kochen?“
Nona seufzte. Ihre Mutter würde sie nicht mehr verändert bekommen.
„Ach ja, ich hätte da einen Wunsch. Ein T-bone Steak, mindestens zwanzig Unzen, medium mit Kartoffelpüree. Und dazu einen Liter Bier. Alternativ eine Schweinshaxe. So wie auf dem Oktoberfest.“
„Nona, kannst du denn nicht mal ernst …“
„Entschuldige, Mam, aber irgendwie geht es mir heute nicht so gut.“
„Deine …“ Ihre Mutter sprach das Wort nicht aus, als sei es ein Unwort.
„Ja, meine Träume. Immer noch und immer wieder. Aber ich habe sie im Griff“, log Nona.
„Gut, also bis morgen“, verabschiedete sich ihre Mutter, weil diese nicht mehr wusste, was sie Nona im Augenblick und in deren momentanen Stimmungslage noch hätte erzählen können.
Nona konnte nicht anders, die Anspielung ihrer Mutter, dann die eigene harsche Reaktion, sie beschäftigte sich wieder mit ihren Träumen. Gemeinsam mit ihrer Mutter hatte sie seinerzeit verschiedene Ärzte und Psychologen aufgesucht, weniger um die Ursache zu ergründen, die kannte sie, sondern vielmehr um einen Weg, einen Rat oder das richtige Medikament zu finden, wie man die Träume abstellen oder zumindest mildern konnte. Vergeblich. Nona magerte ab, wurde zusehends schlechter in der Schule, verlor nach und nach alle Freundinnen – die Nona, die spinnt doch –, klagte permanent über Kopfschmerzen und musste sich häufig übergeben. Alle zeigten sie Verständnis, am meisten ihre Mutter, aber niemand wusste genau, wie es in ihr aussah. Trotz Zuredens der Psychologen war sie nicht bereit, über das tiefe Innere ihrer Emotionen zu sprechen. Ihre Ängste, was sie alles mit ihrem Vater erlebt hatte und die Gefühle zu ihm. Kurz bevor die Psychologen glaubten, nun auch durch die letzte Tür hindurchgehen zu können, schlug Nona sie ihnen immer wieder vor der Nase zu. Sie tat es nicht vorsätzlich, sondern aus einem inneren Drang heraus, niemanden an dem, was sie als ihre intime, private Schatzkammer bezeichnete, teilhaben zu lassen. Drei- oder viermal so kurz vor dem vermeintlichen Ziel die Tür zugeschlagen zu bekommen war für die Therapeuten sehr entmutigend. Umso mehr, wenn sie sich stets vor dem lang ersehnten Durchbruch wähnten. Für solche Fälle hatten die Experten schnell eine für alle Seiten plausible Ausrede parat: Nona war therapieresistent. Elegant umschrieben sie damit auch ihre eigene Unfähigkeit, einem Mädchen von fünfzehn oder sechzehn einen Teil ihrer Jugend zurückzugeben.
Nona selbst jedoch sah es anders. Es schien, als wartete sie auf denjenigen, dem sie als Therapeut Eintritt gewähren wollte. Auch hier hätte sie damals nicht sagen können, unter welchen Bedingungen sie dazu bereit gewesen wäre. Aber das war lange her. Sie erinnerte sich kaum noch, oder besser gesagt, sie blockte jede Erinnerung daran ab. Dass sie sich gewisse Eigenarten angewöhnt hatte, auch schrullige und teilweise absonderliche Verhaltensweisen, die nicht ihrem Naturell entsprachen, war ihr bewusst. Noch konnte sie damit leben. Aber sie merkte, dass irgendwann das Ende der psychischen Belastbarkeit erreicht war und sie diese zermürbenden Träume nicht länger durchstehen würde. Seit fünf Jahren hatte sie die Entscheidung immer wieder vor sich hergeschoben, erneut Hilfe zu suchen. Dabei bildete sie es sich nicht nur ein, dass die Träume in letzter Zeit wieder zugenommen hatten.
Verzeih, Mam, das hast du nicht verdient, sinnierte Nona, nachdem sie merkte, dass sie immer noch den Hörer in der Hand hielt und ihn endlich auflegte.
Du bist durch mich immer noch gestraft. Früher hast du gemeint, ich hätte keine Gefühle für dich, sondern nur für Paps, ich sehe noch dein Gesicht vor mir, wie du uns traurig und eifersüchtig angeschaut hast und dich überflüssig fühltest, und heute weise ich dich so ab. Aber ich kann nicht anders. Mam, tut mir leid. Vielleicht sprechen wir uns einmal aus.
Aber Nona wusste, sie würde sich mit ihrer Mutter wohl kaum aussprechen. Genauso wenig wie mit einem Therapeuten. An ihrer Mutter lag es nicht. Für ihre fünfzig Jahre sah sie noch hervorragend aus, elegant und sportiv zugleich. Sie könnte Männer haben, an jedem Finger einen. Und sie rechnete es ihr hoch an, dass sie nicht noch einmal geheiratet hatte. Nona war ehrlich genug, sich gegenüber einzugestehen, dass sie dafür kein Verständnis gehabt hätte. Nicht zuletzt auch deswegen, weil es aus ihrer Sicht dem Eingeständnis nahegekommen wäre, ihre Mutter hätte ihren Vater nicht, wie in der Kirche versprochen, über den Tod hinaus geliebt. Genau das war der springende Punkt.
Am kommenden Morgen, einem Freitag, machte sie sich bereits um 8 Uhr auf den Weg nach Koblenz. Unterwegs wollte sie noch in Bad Dürkheim, unweit des größten Fasses der Welt, im Weingut Zimmer vorbeischauen. Man hatte ihr eine neue Geschichte angedient. Hildegard Zimmer war vor dem zweiten Weltkrieg mit zwanzig Jahren in ein Kloster eingetreten und wenige Jahre später nach Südafrika in die Slums von Kapstadt gegangen. Ein gefährliches Unterfangen kurz nach dem Krieg. Nicht weil sie Deutsche war, sondern weil die Apartheid in dem südlichsten Staat Afrikas gerade ihrem Höhepunkt zustrebte. Hildegard hatte mehr als vierzig Jahre in den Slums gearbeitet – die Bewohner hatten dort ein Viertel und eine Straße nach ihr benannt – und nun war zu hören, dass der Vatikan sie seligsprechen wollte.
Gegen zehn rollte sie mit ihrem Fiat auf den Hof des Weingutes Zimmer. Ein junger Mann, allem Anschein nach der Sohn des Besitzers, war gerade damit beschäftigt, einen alten Traktor zu reparieren. Er schaute hoch, starrte sie an, und die Art wie er sie anstarrte ließ bei Nona schon den Aversionspegel nach oben schnellen. Ohne viel tun zu müssen merkte sie, wie ein kurzer Adrenalinschub sie auf das kommende verbale Gefecht vorbereitete. Und sie würde, wie so oft, wie eigentlich immer, keinen Deut zurückweichen. Untergang, wenn überhaupt, dann nur mit wehenden Fahnen. Und dass sie heute gewinnen würde, war ihr in diesem Augenblick bereits klar.
Sie stellte sich kurz vor, der junge Mann hieß auch noch Oskar – einer der Vornamen, die sie nicht ausstehen konnte –, und erklärte, warum sie gekommen war.
„Unser Hildchen“, meinte Oskar Zimmer. Er war tatsächlich der Sohn des Weingutbesitzers. Und Hildegard Zimmer seine Urgroßtante. „Allmählich wird sie immer berühmter. Schade, dass man dafür zuerst einmal sterben muss.“
„Bei den meisten nützt aber auch das nichts“, konnte Nona sich nicht zu sagen verkneifen. „Was ist denn mit dem 63-er Deutz“, fragte sie und deutete auf den Traktor.
Oskars Augenbrauen schnellten nach oben. „Woher weiß du, dass es ein 63-er Deutz ist?“ Oskar duzte sie einfach.
„Sieht doch jeder. Model D 30, achtundzwanzig PS, Einfachkupplung, und genau deswegen immer Ärger. Sie rutscht ständig. Und wenn sie greift, dann so scharf, dass er wie ein Maulesel hoppelt. Dein Vater oder Großvater hätte den D 30S mit Doppelkupplung kaufen sollen.“
Für einige Sekunden stand Oskars Mund etwas offen. Da kommt doch diese Tussi und will eine Geschichte über Hildchen schreiben. Sieht scharf aus, hat ein loses Mundwerk, etwas zickig, fast beleidigend, und erzählt mir was von meinem Traktor.
„Nicht die Kupplung“, wurde Nona belehrt. „Er springt nicht mehr an. Und wenn, dann rumpelt er einige Sekunden und geht wieder aus.“
„Wann hast du ihn das letzte Mal in der Werkstatt gehabt?“
Oskar schaute, als käme sie von einem anderen Stern. „Ich bin die Werkstatt.“
„Hast du denn wenigstens noch einige Unterlagen? So eine Art Betriebsanleitung?“
„Ich bin die Betriebsanleitung.“ Oskar grinste.
„Was du alles bist! Aber zum Laufen bringst du ihn nicht. Nutzlose Werkstatt, überflüssige Betriebsanleitung.“
Oskar runzelte die Stirn. Diese Tussi kratzte an seinem Ego. Der werde ich es geben. „Wenn einer ihn zum Laufen bringt, dann ich.“
Nona lächelte. „Aber nur, wenn du dich vorne anspannst und ordentlich ins Zeug legst.“
Nona merkte, dass allmählich ihre Chancen auf eine gute Tasse Kaffee und die Geschichte über Hildegard schwanden. Sie stellt ihre Tasche ab, atmete einmal tief durch, beugte sich zum Motorblock und fragte: „Hast du …“
Oskar unterbrach sie und war bemüht, etwas an Kompetenz zu gewinnen. „Die habe ich gereinigt. Alle Kerzen sind sauber.“
„Gut, dann schraube mal eine von den Dingern raus.“
Oskar machte sich widerwillig an die Arbeit und Nona betrachtete sie sich wenig später gegen das Licht.
„Abstand 0,8 mm?“
Oskar wunderte sich nun nicht mehr.
„Ja, exakt 0,8.“
„Viel zu viel.“
„Aber das ist die Werksangabe“, protestierte Oskar. „Ich erinnere mich genau.“
„Oskar, jetzt überlege doch einmal“, meinte Nona und baute sich vor dem hochgewachsenen jungen Mann auf, der noch nicht einmal so schlecht aussah. Eigentlich ein interessanter Typ mit der großen Nase und den braunen Augen. Und seine Ohren lagen auch schön an. „Wann ist das Ding gebaut worden?“
Oskar antwortete nicht, sie kannte die Antwort sowieso.
„Und was hatten wir damals für ein Benzin?“
In Oskars Augen blitzte es. „Genau, mit Blei.“
„Richtig, mein Junge“, lobte Nona ihn. „Und wie verhält es sich heute mit der Zündung, ich meine ohne Blei?“
Oskar konnte antworten. „Der Zündzeitpunkt setzt früher ein. Also …“
„… ist der Abstand zu groß. Ich würde sagen, 0,5 genügt.“
Fünf Minuten später startete Oskar den Motor, er spuckte, rumpelte etwas, ging wieder aus und beim dritten Versuch fing er an, rund zu laufen.
„Sei ehrlich, mein Junge, du hast heute zum ersten Mal die Kerzen eingestellt.“
Oskar nickte. „Ja, ich gebe es zu.“
„Und derjenige, der es vor dir getan hat, dein Vater vielleicht, der wusste von dem Problem. Und du hast seine Einstellung verändert. Na, dämmert dir was?“
Oskar wollte wissen, woher sie denn diese Erfahrungen mit einem 63-er Deutz hatte.
„Nicht nur mit einem 63-er Deutz“, antwortete Nona und warf ihm einen kecken Blick zu. Oskar führte Nona ins Haus. Der Kaffee war stark, die alten Möbel fand sie interessant und sehr gut erhalten. Von der Inneneinrichtung machte sie einige Aufnahmen, anschließend zeigte ihr Oskar Fotos von der ganz jungen Hildegard, als sie noch auf die Schule ging, sittsam in einem langen Kleid mit weißer Schürze. Dann als Schülerin und Nonne und zum Schluss als ältere Frau in Afrika, umgeben von Schwarzen. Die Fotos durfte Nona behalten und sie hatte den Verdacht, als gebe es davon noch mehrere Abzüge.
Nona hatte viele Fragen, und so wie Oskar antwortete, tat er dies nicht zum ersten Mal. Aber er vermarktete seine Urgroßtante gut. Zwei Stunden später hatte Nona ihre Geschichte über Hildegard Zimmer. Sie fotografierte noch die Außenansicht des Hauses und Oskar mit dem 63-er Deutz.
„Du kommst mit deinem Traktor in meine Sammlung“, scherzte Nona, als sie sich verabschiedete.
„Ich möchte dich auch gerne in meiner Sammlung haben“, konterte Oskar und wusste doch, daraus würde wohl nichts werden.
„Gedulde dich noch etwas. Warte, bis aus den Murmeln Eier werden. Ich möchte nicht die Erste sein. Noch einen schönen Tag.“
Zwei Stunden später rollte der Fiat in Koblenz entlang des Rheins und stoppte vor einem dreigeschossigen Haus in der Mainzer Straße unweit des Flussufers. Im obersten Geschoss hatte Nonas Mutter vor vielen Jahren, gleich nach dem Tode ihres Ehemannes, eine Eigentumswohnung gekauft. Nona, damals am emotionalen Tiefpunkt angelangt, hatte ihr in Anspielung auf den Tod vorgeworfen, die Wohnung mit Blutgeld, gemeint waren Versicherungsleistungen, bezahlt zu haben. Anschließend ging es Nona zwei Tage besser, ihrer Mutter aber einige Wochen nicht so gut.
„Hallo Mam“, begrüßte sie ihre Mutter und nahm sie kurz in den Arm. Nona spürte, ihre Mutter hätte diese Nähe gerne etwas länger genossen.
„Nona, du siehst dünn aus.“
„Aber ich kotze nicht. Heiliges Ehrenwort.“ Sie eilte an ihrer Mutter vorbei und stellte die Reisetasche in ihr Zimmer. Ein kurzer Blick, seit ihrem letzten Besuch vor zwei Monaten – im Grunde genommen jedoch seit knapp zehn Jahren – hatte sich nichts geändert. Mit Ausnahme des funkgesteuerten Radioweckers und eines aktuellen Wandkalenders.
„Warum bist du immer so schnippisch zu mir“, hörte Nona genau die Bemerkung, auf die sie gewartet hatte. „Was habe ich dir getan?“
Wie Nona diesen quengelnden Ton hasste. Leidend und vorwurfsvoll zugleich, als sollte sie sich schuldig fühlen. Sie schaute ihre Mutter an in der Hoffnung, sie würde ihren Blick verstehen. Auch heute war sie perfekt geschminkt und perfekt angezogen, die fünfzig sah man ihr weiß Gott nicht an. Als Nonas ältere Schwester wäre sie auch durchgegangen.
„Mam, ich bin fünfundzwanzig, lebe mein eigenes Leben und bin allein verantwortlich für mich. Und wenn du meinst, ich sei dünn, dann täuschst du dich. Seit meinem letzten Besuch habe ich zwei Kilogramm zugenommen. Bist du nun beruhigt?“
„Tatsächlich? Also, ich hätte …“
„Es ist die Jeans, die mich so schlank aussehen lässt“, half Nona ihrer Mutter.
„Das wird es wohl so sein.“
Notgedrungen lieferte Nona ihren Bericht ab, was sich so alles in den vergangenen zwei Monaten ereignet hatte und kam damit vielen Fragen ihrer Mutter zuvor. Sie zwang sich etwas zur Ruhe, vermied spitze Bemerkungen und erkannte an den sich mehr und mehr glättenden Gesichtszügen ihrer Mutter, was sie doch für eine brave Tochter war. Die Arbeit mache ihr Spaß, in drei Wochen fahre sie auf eine Touristikmesse und erst heute habe sie wieder Stoff für eine neue Geschichte bekommen.
„Du kannst so schön schreiben“, lobte ihre Mutter. „Ich habe all deine, Was geschah wirklich‘ Geschichten gelesen. Dein Vater konnte auch so schön schreiben.“
Nona, die ihre Mutter so weit kannte, dass sie schon wusste, was sie fragen und auch antworten würde, verbiss sich eine Bemerkung und ging duschen. In der Zwischenzeit bereitete ihre Mutter das Abendessen vor. Sie hatte extra Vanillepudding gekocht, weil Nona den so mochte.
„Und wie geht es dir?“, fragte Nona, als sie sich am Tisch gegenübersaßen.
„Wie soll es mir schon gehen? Ich helfe etwas in einem Abendgymnasium aus und gebe hier und da ein wenig Nachhilfeunterricht.“
„Etwa in Latein? Das spricht doch niemand mehr.“
„Nein, in Englisch und Geschichte.“
„An ein Gymnasium möchtest du wohl nicht mehr. Auch nicht mit halber Stelle?“
„Nein, mein Schatz. Dazu fühle ich mich inzwischen zu alt. Außerdem würde man das an anderer Stelle auch nicht gerne sehen wollen. Ich bekomme auch so meine Bezüge.“
In einer halben Stunde hatten sie die Verwandtschaft durchgehechelt, vom letzten Hochwasser im Spätsommer gesprochen und davon, dass Liza, Nonas Mutter, sich ein neues Auto kaufen wollte. Wieder ein Cabrio.
Immer noch auf dem Jugendtrip, wollte Nona schon einwerfen, konnte sich aber gerade noch zurückhalten.
„Hattest du nicht im Sommer mit dem alten Cabrio eine schlimme Erkältung?“, verpackte sie ihren Einwand geschickt. „Weil es so gezogen hat?“
„Genau deswegen kaufe ich mir ja ein neues. In dem zieht es nicht mehr. Komplett ausgestattet mit einem Windschott und einigen anderen Extras. Apropos Auto: Fährst du immer noch diesen alten … Fiat?“
„Ja, Mam, ich kann mir keinen anderen leisten.“
„Aber ich habe dir doch angeboten …“
„Ich will kein Geld von dir, verstehst du?“
„Schatz, das Auto ist so alt, hat keinen oder nicht so viele Airbags, ich sterbe fast vor Angst, wenn du damit unterwegs bist.“
„In der Formel 1 haben sie auch keine Airbags“, konterte Nona und damit war das Thema erledigt.
Nachdem Liza ausführlich vom letzten Migräneanfall und den anderen Zipperlein gesprochen hatte, die sich nun mal in ihrem Alter so einstellten – damit wollte sie kokettieren und Widerspruch provozieren, etwa in der Art: du siehst immer noch verdammt gut aus – erwartete sie, dass Nona von ihren Träumen und den Schlafstörungen zu sprechen begann. Aber Nona tat ihr nicht den Gefallen und meinte, es sei Zeit, die Nachrichten zu schauen.
Allabendlich die Nachrichten zu schauen war in ihrer Familie ein Ritual, so weit wie sie zurückdenken konnte. Und falls sie damals etwas nicht verstand, hatte ihr Vater immer die Hintergründe erklärt. Ohne es auszusprechen kam es Nona vor, als säße Ludger, ihr Vater, auch heute Abend wieder zwischen ihnen. Und genau das war wohl für beide der Grund, warum sie ihn in ihrer Unterhaltung ausklammerten.
Nach den Nachrichten blieb Nona einfach vor dem Fernseher sitzen und erweckte den Eindruck, als zeige sie Interesse für das nun folgende Pogramm. Ihre Mutter, die sich auf ein Gespräch mit ihrer Tochter gefreut hatte, ging nach einigen Minuten in die Küche, kam mit dem Pudding zurück und verbiss sich die Bemerkung: Den habe ich extra für dich gemacht. Sie wusste, Nona würde darauf allergisch reagieren.
„O, danke Mam.“ Sie gab ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange und aß mit sichtlichem Genuss den Nachtisch. „Hast du den extra für mich gemacht?“
„Ja.“
Auf diese spannende Art wäre der Abend wohl noch etwa zwei oder drei Stunden so weiter verlaufen, wenn es da nicht diese Tiersendung gegeben hätte. Alligatoren waren das Thema, und man zeigte ausgiebig diese gefährlich aussehenden Reptilien mit dem langen Maul und den scharfen Zähnen in Großaufnahme. Den Film hatte man in Florida gedreht, und dort schien es eine Spezies von Männern zu geben, die sich und der Umwelt beweisen mussten, wie mutig sie waren. Sie gingen auf die Reptilien zu, fassten sie am Schwanz, ein Zweiter warf sich auf den flachen Kopf und ein Dritter sprang gleich hinterher. Von so viel Gewicht erdrückt, verschlossen sie das Maul der ruhiggestellten Alligatoren mit einem Klebeband. Der Tierarzt konnte ihnen dann gefahrlos eine Injektion verabreichen und die Körpermaße festhalten. Auch verlud man die Tiere, weil sie an einen Zoo verkauft worden waren oder um sie an anderer Stelle wieder auszusetzen.
Wieder wurde das Maul einen Alligators mit einem Band zugeklebt. Groß war auf dem Bildschirm zu sehen, wie geschickt der Mann vorging, denn eine Lage Klebeband, so der Moderator, konnte die Alligatoren nicht davon abhalten, das Maul aufzureißen und zuzubeißen. Es mussten schon mehrere sein.
Liza beugte sich näher zu dem Fernseher, Nona vergaß zu schlucken, stieß einen Schrei aus und legte erschrocken eine Hand auf den Mund, als wollte sie ihn ungeschehen machen.
„Mam, Mam, hast du das gesehen?“ Nonas gestammelte Frage war überflüssig, ihre Mutter hatte es gesehen.
Aufgeregt sprach sie weiter: „Du, der Mann dort, der ältere, der mit dem Kinnbart, … genau wie Paps. Und den gleichen Fingernagel.“
„Ja, aber das ist doch nicht …“
Nona sprang auf, in der einen Hand den Teller, und deutete kurz vor dem Fernseher stehend mit dem Löffel auf eine bestimmte Stelle. „Hier, sieh hin, der Mittelfinger der rechten Hand. Der Nagel ist dreigeteilt. Zwei dünne Kerben vom Nagelbett bis … siehst du es?“
Neue Bilder wurden gezeigt, andere Männer traten in Aktion, bewundert und beklatscht von Zuschauern, die stets bei solchen Aktionen zugegen waren und schon mal die Akteure aufforderten, noch waghalsiger vorzugehen. Schließlich hatten sie Eintritt bezahlt.
Nona atmete tief durch, stellte den Teller auf den Tisch, legte den Löffel daneben und setzte sich gerade. Sie brauchte etwas Zeit, um sich von der Überraschung zu erholen.
„Bevor du anfängst, Nona, dein Vater ist vor zehn Jahren mit einem Flugzeug abgestürzt und tödlich verunglückt.“ Nonas Mutter hatte ganz ruhig gesprochen, als benötigte sie für sich selbst die Bestätigung.
Nona nickte, senkte den Kopf, legte ihre Hände in den Schoß, nickte erneut. „Ja, ich weiß.“
Einige Minuten, in denen der Fernseher weiterlief, sprachen sie kein Wort. Die Sendung war vorbei, Nona erkannte am Abspann, dass die Firma Gloriavision den Film für das ZDF produziert hatte und schaltete den Fernseher aus.
„Du kannst ihn nicht vergessen.“
„Nein, Mam, ich will ihn auch nicht vergessen.“
„Das sollst du auch nicht, mein Kind.“
„Wie viele haben wohl solch einen Fingernagel? Was meinst du, wie viele von einer Million Männer?“
Ihre Mutter wusste es nicht.
„Und das mit dem Alter kommt auch hin.“
„Nona, jetzt ist aber gut. Rede dir doch nichts ein. Hast du denn nicht gesehen, dass der Mann gleich neben dem Mittelfinger eine Verletzung hat? Ihm fehlt am Ringfinger fast das erste Glied. Wird wohl ein Alligator gewesen sein.“
Nona stand auf. „Schon gut, habe verstanden.“ Obwohl sie ruhig gesprochen hatte, war eine gewisse Traurigkeit herauszuhören, als sei sie wieder um eine Illusion ärmer. Eine Illusion, die es im Grunde genommen nie gegeben hatte. Sie machte nicht die Wirklichkeit zu ihrem Wunsch, um mit den Worten ihres Vaters zu sprechen, sondern sie wünschte sich die Wirklichkeit – auf Kosten der Realität. Nona nahm Teller und Löffel und brachte beides in die Küche.
Wieder im Wohnzimmer, stellte sie sich hinter ihre Mutter, legte ihr die Hände auf die Schulter, beugte sich zu ihr und küsste ihr den Nacken.
„Ich weiß, wir können nichts ändern. Aber er fehlt mir so. Und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer.“
Ihre Mutter wandte sich ihr zu und zum ersten Mal seit Jahren lagen sie sich in den Armen. Obwohl beide es vermeiden wollten, konnten sie die Tränen nicht unterdrücken. Zu ihrem eigenen Erstaunen genoss Nona die Nähe zu ihrer Mutter. In ihr machte sich ein Gefühl bemerkbar, von dem sie dachte, sie würde es nie mehr empfinden können. Sie küsste sie erneut und ging in ihr Zimmer.
Die Fernsehsendung hatte sie aufgewühlt. Als sie zu Bett ging, erwartete sie bereits, trotz der vorgetäuschten Ruhe und Gelassenheit ihrer Mutter gegenüber, dass sie nicht sofort würde schlafen können. Sie wälzte sich unruhig hin und her. Wie so oft tauchten auch heute wieder Bilder aus der Vergangenheit auf, die wichtigsten und schönsten und schlimmsten Bilder zugleich, die letzten Tage, die sie mit ihrem Vater gemeinsam erleben durfte. Und dann die schmerzliche Trennung. Was würde sie dafür geben, noch einmal eine Stunde mit ihm reden zu können! Ihn anzufassen, ihn lachen und auch schreien zu hören? Ihn zu ärgern und von ihm in den Arm genommen oder unter Wasser getaucht zu werden?
Sie wusste inzwischen, wie Wellen entstehen, warum es Gezeiten gibt, wo der Sand am Strand herkommt, weshalb man auf See eine Strecke in Seemeilen misst und welcher Unterschied zu Kilometern besteht. Dass die Nordsee ein Meer und kein Ozean ist und die tiefste Stelle aller Meere nicht immer jeweils wenige Meter vor ihr im Wasser, sondern weit weg bei den Philippinen über elftausend Meter tief versteckt in einem Graben liegt. So viel zu wissen, konnte langweilig machen. Und ihr war langweilig. Sie stand auf, schnappte sich ihre Bademütze, lief zu den ausfächernden Wellen der Nordsee, füllte die Mütze mit Wasser, eilte zurück und schüttete den Inhalt auf den nackten Oberkörper des Mannes, neben dem sie sich die ganze Zeit gelangweilt hatte. Wie erwartet, sprang dieser erschrocken hoch, schnappte sich die Attentäterin, rannte mit ihr zum Wasser und noch weiter hinein in die Wellen und tauchte sie unter. Zwei Sekunden Luft holen und erneut untertauchen. Und dann balgten sie sich im hüfthohen Wasser.
„Sag nur, Paps, du hast mich nicht kommen hören.“
„Auf keinen Fall, wie sollte ich auch.“
„Dann habe ich dich ja wirklich einmal überraschen können.“
„Das hast du, und so etwas muss belohnt werden. Ein weiterer Tauchgang für die Dame gefällig?“
Als sie sich wenige Minuten später abtrockneten und wieder auf die Strandtücher legten, fragte Nonas Vater erstaunt: „Du, was sind denn das für helle Flecken auf meiner Brust und meinem Bauch?“
Nona kicherte.
„He, was hast du mit mir angestellt?“
Nona deutete auf die Reste einer Zeitung. Fein säuberlich hatte sie sich die Teile so zurechtgefaltet, dass auf der Brust ihres Vaters ein Muster entstanden war, als hätte er beim Sonnen einen Bikini getragen. Und um den Baunabel war auch ein runder weißer Fleck.
„Du Biest.“ Ihr Vater schüttelte sich vor Lachen.
Zwei Stunden später aßen sie in Sluis am Kanal zu Abend, bummelten noch etwas in der bei Touristen sehr beliebten kleinen Stadt mit den vielen Sexshops und fuhren am späteren Abend nach Brügge in ihr Hotel.
„Willst du denn nicht wissen, warum es in Sluis so viele Sexshops gibt?“, fragte ihr Vater, während er sich in der Tiefgarage des Hotels die Badetasche schnappte. Auf dem Boden standen Wasserlachen, denn in der vergangenen Nacht hatte es heftig geregnet. Irgendwie schien das Wasser einen Weg nach unten gefunden zu haben.
„Weil du öfter dort bist?“
„Das ist der eine, unbedeutende Grund, aber verrate mich um Himmels willen nicht bei Mammi.“
„Sei unbesorgt. Und der andere?“
„In Belgien sind Sexshops verboten, und bis nach Sluis in den Niederlanden sind es von Brügge aus nur zwanzig Kilometer.“
Es war kurz nach Mitternacht, als Nona zum ersten Mal in das Zimmer ihres Vaters kam. Sie hatte einen Sonnenbrand und konnte nicht schlafen. Ihr Vater rieb sie mit einem Gel ein, das angenehm kühlte. Und drei Stunden später tat er es ein weiteres Mal. Als Nona gegen zehn am Morgen aufwachte, war ihr Vater verschwunden. Auf ihrem Nachttisch lag ein Zettel und daneben fünf Hundertmarkscheine.
„Mein allerliebster Spatz. Ich verlange sehr viel von dir, wenn ich dich bitte, mir zu vertrauen. Bei allem was mir heilig ist, und du weißt, was mir heilig ist – du und Mammi –, schwöre ich, mit dem, was man in den kommenden Tagen von mir behaupten wird, absolut nichts zu tun zu haben. Bitte nimm das Geld und fahre nach Hause. Gegen zwölf geht ein Zug von Brügge nach Luxemburg, dort musst du umsteigen in Richtung Koblenz.
Nona, mein Spatz, ich liebe dich wie ein Vater nur seine Tochter lieben kann. Und noch etwas mehr.
Paps.“
Wie lange sie mit dem Zettel in der Hand mitten im Hotelzimmer gestanden hatte, sie wusste es nicht. Erst als sie die dunkleren Flecke auf dem Papier registrierte und bemerkte, dass sie weinte, setzte sie sich an einen Tisch und legte den Kopf auf die Unterarme.
Nona starrte in die Dunkelheit. Ihre Augen brannten. Sie merkte selbst, dass sie die Lippen zusammenpresste und an ihnen nagte. Ihre Finger hatten sich in die Decke gekrallt, als hätte sie Angst, jemand könnte sie wegziehen. Sie schluckte, aber der Kloß saß fest in ihrem Hals.
An den gemeinsamen Urlaub in Holland und Belgien erinnerte sie sich noch in jeder Einzelheit, als wäre es gestern gewesen: Cola trinken an der Strandbude, dazu Pommes Frites mit Ketchup und Mayonnaise. Mit dem Ketchup hatte sie Bilder auf den Teller gemalt, während ihr Vater eine Apfelschorle trank und sie beobachtete. Sie im zweiteiligen Bikini, ihr Vater mit einer dunkelblauen Badehose. Auf einem großen, sonnengelben Badetuch hatten sie sich ausgeruht. Abends aßen sie in Sluis bei einem Italiener eine Pizza, der ein so lustiges Deutsch-Holländisch-Italienisch gesprochen hatte. Später im Hotel, als der Sonnenbrand zu beißen anfing und sie zum ersten Mal eingecremt worden war, hatte sie ihren Vater gebeten, ihr eine Gutenachtgeschichte zu erzählen.
„Sag mal, wie alt bist du denn inzwischen.“
„Paps, ich bin fünf und möchte die vom Walfisch hören, in der er das Kälbchen vor der Flut gerettet hat. Und dann machen wir noch etwas Schwabbel, ja?“
Sie wollte nicht Dumbo hören, nicht Benjamin Blümchen, sondern die selbst ausgedachten Geschichten ihres Vaters. Am liebsten wäre es ihr gewesen, er hätte etwas aus „Der Himmelreiter“ vorgelesen, einem Krimi, den ihr Vater für Kinder und ganz besonders für sie geschrieben und veröffentlicht hatte. Aber das Buch lag zu Hause. So musste er abends, falls es noch nicht zu spät war, ersatzweise von Dino und seinen Abenteuern in Ägypten erzählen.
Ihr Vater hatte gelacht, sie auf den Bauch gedreht und in schneller Folge ihren Körper in das weiche Bett gedrückt. Nona stieß dabei durchgehend einen Ton aus, der sich mit jedem Druck auf den Rücken veränderte.
„Genug Schwabbel gemacht?“
An ihrem letzten Abend hatte sie sich trotz ihrer fünfzehn Jahre wirklich wie ein kleines Mädchen gefühlt. Als wollte sie unbedingt die schöne Kinderzeit noch einmal durchleben.
Am Frühstückstisch ließ sich Nona nichts anmerken. Ganz beiläufig wollte sie wissen, ob ihre Mutter noch einige Erinnerungsstücke von ihrem Vater aufbewahrte.
„Ich meine nicht Fotos und Videos und so. Sondern ganz persönliche Gegenstände. Seine Mundharmonika zum Beispiel. Oder die alte Kamera.“
Ihre Mutter gestand, dass sie nach und nach fast alles entsorgt habe. Außer den vielen Büchern, die zum Teil in ihrem Zimmer und dann auch noch in einigen Kartons auf dem Speicher stünden.
„Hast du denn nichts Privates, nicht Intimes mehr von Paps?“
„Willst du etwa seine Briefe lesen, die er mir geschrieben hat?“
Nona kicherte. „Ja, würde ich gerne. War er romantisch?“
Ihre Mutter rührte umständlich in der Kaffeetasse. „Natürlich war er romantisch. Und sehr feinfühlig.“
„Hast du ihn geliebt, wirklich geliebt, so wie man vielleicht im Leben nur einmal einen Menschen lieben kann?“
Liza zögerte. „Ich weiß nicht, ob ich dass hier so sagen soll …“
„Ich habe Paps geliebt, wie man nur einmal lieben kann. Falls ich mal den Richtigen kennen lernen sollte, wird das natürlich eine andere Art von Liebe sein. Aber ob ich jemals wieder so intensiv lieben kann … ich weiß es nicht.“
Nona starrte aus dem Fenster, ihr Blick wanderte ins Nichts. Für einige Sekunden lächelte sie, ihre Augen wurden weich, die Erinnerung hatte sich mit ihren Gefühlen vermischt. Und schon kam auch wieder die Traurigkeit wie ein dämpfendes, sich über das Leben legendes Tuch.
Während ihre Mutter abräumte, bestellte sie sich per Internet eine CD der Fernsehsendung und gab als Absender die Adresse des Touristbüros in Nürtingen an. Sie bezahlte mit ihrer Karte und erfuhr, dass die CD sofort abgeschickt und in zwei bis drei Tagen bei ihr sein werde.
Anschließend betrachtete sie sich die Bücher ihres Vaters. Es waren überwiegend Fachbücher, denn Ludger Beckstein hatte in Trier an der Fachhochschule als Dozent für Maschinenbau unterrichtet. Sie nahm einige Bücher, blätterte in ihnen und hoffte, etwas Persönliches, einen handgeschriebenen Zettel, eine kurze Notiz zu finden. Was sie sah, waren Zahlen und kurze Wortabkürzungen am Rand, Hinweise auf eine andere Quelle und auch schon mal ein Fragezeichen, als hätte ihr Vater etwas nicht einfach so hingenommen. In einem Buch über Ballistik, was eigentlich nicht zum Fachbereich gehörte, fand sie die meisten Anmerkungen. In einem Karton in der Ecke waren Romane und Thriller gelagert, die er einmal gelesen hatte.
Ihre Mutter betrat das Zimmer, blieb stehen und beobachtete sie stumm. Nona kannte diese fragende Haltung, ihre Mutter wartete auf eine Erklärung.
„Mam, ich weiß nicht, ob du das verstehst. Aber wenn ich etwas anfasse, was er früher einmal angefasst hat, habe ich das Gefühl, ihn zu berühren.“
Liza hatte etwas im Auge. „Nona, mir geht es genauso.“ Sie wandte sich zu einem Schrank und legte einen Stapel Notizen auf den Tisch. „Das waren die letzten Aufzeichnungen für den Unterricht. Sein Programm für August und September vor zehn Jahren.“
Vieles war auf losen Blättern geschrieben, deren Reihenfolge wohl nur ihrem Vater bekannt war, einiges jedoch auch in Heften oder er hatte es, um eine gewisse Ordnung und Abfolge einzuhalten, zusammengeklammert.
„Hebe das bitte für mich auf, Mam.“
Liza nickte und öffnete die andere Schranktür. „Hier habe ich noch einige Kleidungsstücke. Weißt du noch, wie gut er in diesem dunkelblauen Anzug ausgesehen hat? Er trug ihn zu deiner ersten Kommunion. Oder diese Jeans und dazu die Sommerschuhe und ein Polohemd. Er sah darin so verdammt jung und abenteuerlich aus.“
Nona sah ihren Vater vor sich. Sie wandte sich ab und stellte sich ans Fenster. Die Erinnerung war zu heftig geworden. Und auch das Gefühl von Schuld, im entscheidenden Augenblick nicht für ihn da gewesen zu sein, ihm nicht geholfen zu haben. Nur ich, sagte sie, hätte ihm helfen können. Ich weiß, wie alles abgelaufen ist. Aber ich habe versagt, habe mich in Widersprüche verstrickt, man hat mir nicht geglaubt.
Auf dem Rückweg nach Nürtingen war sie so mit ihren Gedanken beschäftigt, dass sie unkonzentriert fuhr und mehrmals durch andere freundliche Autofahrer per Hupzeichen darauf aufmerksam gemacht wurde. Kurz vor der Abzweigung nach Heilbronn steuerte sie auf einen Rastplatz, stieg aus und vertrat sich etwas die Beine.
Was ist mit mir los, fragte sie sich. Was ist seit so vielen Jahren mit mir los. Bin ich überdreht, sehe ich alles zu einseitig, fange ich an zu spinnen oder tue ich es bereits schon? Warum beschäftige ich mich unentwegt mit der Vergangenheit? Irgendwann muss doch damit Schluss sein. Diesen Druck kann ich nicht länger aushalten. Und diese Träume auch nicht.
Sie setzte sich auf eine Holzbank, ein anderer Autofahrer wollte ein Gespräch beginnen. Nach zwei Sätzen und einem Blick in ihre abweisenden Augen entschuldigte er sich und schlich davon.
Weshalb brüskiere ich die Männer so? Weise sie ab, als hätten sie eine ansteckende Krankheit? Beleidige sie mit Worten und meinem Verhalten? Halte sie auf Distanz mit meiner sicherlich physisch spürbaren Ablehnung?
Nicht zum ersten Mal stellte Nona sich all diese Fragen. Und an einem bestimmten Punkt angekommen, wo sie eigentlich Antworten erwartet hätte, aber keine fand, testierte sie für sich immer wieder lakonisch als Fazit: Ich bin nun einmal so. Wer mich will, muss mich nehmen, so wie ich bin. Wer mich liebt, nimmt mich auch so wie ich bin. Aus, Schluss, basta. Dieser selbst ausgestellte Freifahrtschein, allzeit abrufbereit und ein Balsam für ihre Selbstzweifel, diente ihr schon lange als Alibi. Mit ihm ließ sich leben, solange sie sich nicht selbst in Frage stellte und hinterfragte. Sie nicht bei sich selbst die Ursache suchte, sondern sie andern zuschieben konnte. Leider erfüllte nun mal das andere Geschlecht nicht ihre Erwartungen.
Aber Nona war intelligent genug, um zu erkennen, dass es zwischen ihr und den vielen jungen Männern, die sich um sie bemüht hatten, erst gar nicht zu der Phase kam, wo sie oder ihr Gegenpart hätten Gefühle entwickeln können. Sie kippte im Voraus Wasser auf das Heu, damit es nicht brennen konnte. Sie würgte schon die ersten Ansätze ab, so dass sich alle schnell von ihr zurückzogen.
Paps, bist du an allem Schuld?, fragte sie sich. Bin ich zu sehr auf dich fixiert? Bist du der Gradmesser, an dem alle anderen scheitern? Hast du mir die Hypothek aufgebürdet – oder will ich es so?
Nona war längst zu der Auffassung gelangt, dass sie auf eine bestimmte Art im Kopf krank war, und dass einige ihrer Verhaltensweisen paranoide Züge trugen. Sie hätte sich weiter behandeln lassen können, aber vor Jahren sagte sie sich, es bringe nichts und blockte jede Entwicklung in diese Richtung ab. Und je mehr ihre Mutter sie drängte, desto massiver wuchs in ihr der Widerstand. Sie lullte sich ein mit der schrecklichen Vergangenheit, als sei sie darauf erpicht, Schmerz und Trauer und Liebe zugleich zu empfinden und zu konservieren. Ausschließlich für sich zu behalten, als ihr privates Geheimnis, an dem niemand sonst teilhaben durfte, abgesehen von ihrem Vater. Aber die Jahre hatten auch bewirkt, dass sie immer absonderlicher geworden war. Sie führte Zwiegespräche mit dem Toten, fragte ihn, wenn es galt, eine Entscheidung zu treffen, um Rat und wollte in der Umkleidekabine wissen, was er von der Hose, dem Rock oder dem Mantel halte. In all den Jahren hatte sie eine für Außenstehende undurchdringliche Welt geschaffen, nur für sich und ihren Vater. Sie merkte, dass sie Vorgefallenes verglorifizierte, genauso, wie sie ihren Vater mehr und mehr verglorifizierte. Er war längst kein Mensch mehr mit allen dazugehörenden Eigenschaften und Eigenarten, sondern eine makellose Statue, an der sie jeden Tag polierte, um sie noch makelloser zu machen. Und niemand außer ihr selbst durfte sie bewundern.
Paps, sage mir, bin ich verrückt? Natürlich antwortete ihr Vater, dass sie es nicht sei. Er gab ihr immer Antworten, die ihr gefielen und zugleich eine Brücke waren, neue Fragen zu stellen. So schaukelte sie sich höher und höher, die Bindung zu ihrem toten Vater wurde scheinbar immer intensiver, das gegenseitige Verständnis auch, obwohl Nona wusste, sie bewegte sich auf einer Einbahnstraße. Wohin führte sie? Wo war das Ende?
Was soll ich jetzt nur machen? Überlegte sie weiter. Warum habe ich mir eigentlich diese CD bestellt, was will ich damit erreichen? Warum vertiefe ich mich in den Nachlass meines Vaters, als sei ich auf der Suche? Auf der Suche wonach? Und warum habe ich vor, mich bei der Fluggesellschaft zu erkundigen, wie es zu dem Absturz hatte kommen können? Was will ich damit bezwecken? Mich weiter quälen oder nur einer Illusion nachjagen? Der Illusion, es könnte im Fernsehen doch der Finger meines Vaters gewesen sein, obwohl der Mann im Gesicht irgendwie anders ausgesehen hat? Gut, durch den Hut lag die obere Hälfte im Schatten und er trug einen Bart, aber was gab es sonst für Ähnlichkeiten?
Nona zuckte zusammen, denn sie merkte, dass sie laut gesprochen hatte. Sie blickte um sich und war erleichtert, dass niemand ihr Selbstgespräch mitbekommen zu haben schien. Zwei Lkw-Fahrer saßen abseits und beschäftigten sich intensiv mit ihrem Essen und einer Zeitung mit großen Buchstaben und vielen Fotos.
Verdammt, in mir sieht es nicht gut aus. Meine Psyche spielt verrückt, ich spiele verrückt, meine Gedanken quälen mich und ich lasse es nicht nur zu, sondern provoziere die Entwicklung jeden Tag aufs Neue.
Auch an diesem Punkt war sie schon oft angelangt, und stets hatte sie die Ausrede gefunden, so weiterzumachen wie bisher. Tagsüber war sie abgelenkt durch ihre Arbeit, abends lenkte sie sich ab, indem sie ins Kino oder in die Disko ging. Und es kam immer häufiger vor, dass sie vor dem Fernseher hockte und Wein trank. Manchmal eine ganze Flasche. Aber die Nächte gehörten dann ihrer eigenen skurrilen Welt.
Als Nona aufstand und zum Auto ging, war ihr bewusst, ohne fremde Hilfe nicht aus dieser emotionalen Klammer entfliehen zu können. Heute fragte sie nicht, ob sie es überhaupt wollte. Heute war sie zum ersten Mal seit langem bereit, Hilfe anzunehmen. Sicherlich war das auf die Fernsehsendung zurückzuführen, die ihr, falls sie den weiteren Weg allein beschritt, noch mehr den realen Boden unter den Füßen wegziehen würde.
„Verdammt“, entfuhr es ihr und sie starrte auf den Fiat. Sie hatte vergessen, die Scheinwerfer auszuschalten. Und das am helllichten Tag. Nona stieg in das Auto und der Fiat meinte es gut mir ihr. Mit der letzten Umdrehung sprang er an und erlöste sie von der Frage, wen sie hätte um Hilfe angehen können. Etwa die beiden Lkw-Fahrer, die grinsend zu ihr herüber sahen, weil sie das mit den Scheinwerfern mitbekommen hatten?
Den Artikel über Hildegard Zimmer ging sie gleich am kommenden Morgen an. Gegen zehn legte sie eine Pause ein, denn sie hatte ein Treffen mit einigen Kunsttherapiestudentinnen von der Fachhochschule.
Nona kam etwas zu spät, die jungen Damen akzeptierten ihre Entschuldigung, es habe ein überraschendes Telefonat gegeben und nickten verständnisvoll. Bei ihnen gab es in vergleichbaren Fällen auch immer überraschende Telefonate.
„Und, haben schon einige Besucher als Folge des Musenkusses ihren ersten Wohnsitz zu uns verlegt?“, wollte Nona von ihnen wissen. Vor zwei Wochen hatte sie mit den Studentinnen ein Projekt angekurbelt, wonach Touristen, die mehrere Tage in Nürtingen weilten, sich unter fachkundiger Aufsicht künstlerisch betätigen konnten. Zwei, drei oder vier Nachmittage – jeweils immer in Gruppen von sechs bis zehn Erwachsenen -, an denen sie unter Aufsicht und Anleitung einer fachkundigen Studentin etwas auf die Leinwand bringen sollten.
„Zuerst waren wir skeptisch“, ergriff Eva das Wort und sprach für die anderen, „aber dann hat sich die Sache fantastisch entwickelt. Wir dachten zuerst, da kommen ältere Herrschaften, klecksen uns die Leinwand voll und labern uns einen ab. Im Gegenteil, sie machen sich gut, sind voll bei der Sache und nehmen unsere Ratschläge an.“
Die anderen drei Studentinnen bestätigten dies. Das Gehörte deckte sich mit der Rückkopplung, die Nona von einigen der Touristen erhalten hatte. Sie schwärmten davon, wie gut es ihnen gefallen habe, wie nett die jungen Damen gewesen seien und mit wie viel Mühe sie versucht hätten, ihnen Anleitungen und Ratschläge zu geben. Gerne würden sie wiederkommen.
„Also mich hat es vor einigen Tagen umgehauen“, begann Tina, auf deren Nase eine antiquierte Nickelbrille schaukelte. „Da kommt doch eine zu mir, Mitte fünfzig oder auch schon sechzig, hört sich alles an, arbeitet auch genau nach meiner Anleitung. Was sie gemacht hat, ich war perplex. Die ältere Dame war um Klassen besser als ich. Und wisst ihr, was sich herausgestellt hat?“ Tina schaute in die Runde, niemand wusste es. „Sie ist eine bekannte Künstlerin aus Paderborn und ihre Bilder bringen so um die fünftausend das Stück. Stellt euch mal vor, wie ich mich gefühlt habe! Nicht, dass sie mich verarscht hat, im Gegenteil. Ohne sich zu outen sagt sie zu mir, ich hätte ihr sehr geholfen und ihr einen neuen Blickwinkel aufgezeigt. Erst zwei Tage nach ihrer Abreise habe ich erfahren wer sie ist.“
Nona war sehr angetan, wie ihre Idee sich entwickelte. Inzwischen war sie auch zu höherer Stelle vorgedrungen, einige der Touristen hatten sich höchstpersönlich beim Bürgermeister bedankt. Das tat gut.
Wieder allein in ihrem Büro, als sich ihre Gedanken wieder selbständig machen wollten, wählte sie spontan eine Nummer, die sie vor einigen Wochen auf ihre Unterlage gekritzelt hatte.
Nona war erstaunt, dass sie nicht das Vorzimmer am Telefon hatte, sondern gleich mit der Psychologin persönlich sprechen konnte.
„Andrea Curtius, was kann ich für Sie tun?“
Die Stimme klang schon mal sehr angenehm. „Mein Name ist Nona Willmann. Wenn Sie jemand anruft, dann können Sie sich schon denken, worum es geht. Ich brauche Hilfe.“
Am anderen Ende blieb es einige Sekunden still. „Frau Willmann, kommen Sie aus Stuttgart?“
„Nein, aus Nürtingen.“
„Das sind aber noch einige Kilometer bis zu mir. Ich könnte Sie in zwei Monaten einplanen. Mein Kalender ist voll.“
„Schade. Dann soll es eben nicht sein.“
„Wie kommen Sie ausgerechnet auf mich?“, wollte die Psychologin wissen.
„Eine Bekannte von mir hat vor einigen Wochen einmal ihren Namen erwähnt und gesagt, dass Sie ihr sehr geholfen haben.“
„Darf ich fragen, wer das war?“
„Eine gewisse Gerda Classen.“
Wieder blieb es einige Sekunden still.
„Könnten Sie morgen gegen 18 Uhr 30 bei mir sein?“
Erleichtert legte Nona auf. War sie erleichtert oder redete sie es sich nur ein? Wollte sie wirklich Hilfe in Anspruch nehmen oder wieder einmal bestätigt bekommen, dass sie nicht therapierbar sei? Und warum, so wunderte sie sich, hatte die Psychologin noch nicht einmal gefragt, welcher Art ihr Problem sei?
Zumindest hatte Gerda ihr eine Art Eintrittskarte besorgt. Nona war ihr vor geraumer Zeit im Theater begegnet, genauer gesagt anlässlich des Besuches einer Kleinkunstbühne. Sie unterhielten sich an diesem Abend sehr angeregt und sie hatten sich daraufhin mehrmals verabredet. Etwa vier Wochen nach dem ersten Kontakt hatte Gerda über ihre Probleme in der Ehe und zwei Suizidversuche gesprochen. Inzwischen waren die wöchentlichen Treffs ein fester Bestandteil geworden. Nona war jedoch im Gegensatz zu Gerda nicht allzu mitteilungsbedürftig gewesen. Ihr Vater war nur kurz zum Thema geworden, denn auch Gerda gegenüber hatte sie bisher nicht das Bedürfnis gehabt, sich über ein gewisses Maß hinaus zu öffnen.
Nach der Reaktion der Psychologin zu urteilen, sie nun doch zu behandeln, muss Gerdas Fall wohl noch schlimmer gewesen sein als von ihr geschildert. Warum sonst hatte sie so schnell einen Termin bekommen? Denkt sie nun, ich sei ähnlich suizidgefährdet?
War es Übermut oder der Anflug von guter Laune? Nona wusste es nicht, als sie im Internet recherchierte und wenige Minuten später die Fluggesellschaft Iberosun anrief. Nach zwei Weiterleitungen war sie mit einem Herrn Ballinger verbunden, der sich sehr über ihr Anliegen wunderte.
„Frau Willmann, was haben Sie für ein Interesse daran, sich über ein so viele Jahre zurückliegendes Unglück zu erkundigen?“
„Mein Vater ist dabei umgekommen.“
„Das tut mir leid.“
„Und ich war damals noch sehr jung, habe vieles nicht verstanden und möchte jetzt einige Auskünfte haben.“
„Wann genau war das … Desaster?“
Nona brauchte nicht zu überlegern. Der 6. Oktober würde ihr immer im Gedächtnis haften bleiben.
„Vor zehn Jahren sagten Sie. Und der Name ihres Vaters?“
„Beckstein, Ludger Beckstein.“
„Wie kommt es, dass Sie einen anderen Namen tragen?“
„Ich bin verheiratet“, log Nona.
„Selbstverständlich. Was könnte es sonst sein.“
Ballinger schien an seinem Computer tätig zu werden, Nona hörte das Klicken der Tastatur.
„Hm, dreiundachtzig Tote. Schlimm, sehr schlimm. Aber unsere Gesellschaft konnte nichts dafür, wie die Untersuchung ergeben hat. Grund war ein Fehler des marokkanischen Bodenpersonals in Rabat.“
„Aber mein Vater ist immer noch tot“, konnte sich Nona nicht verkneifen.