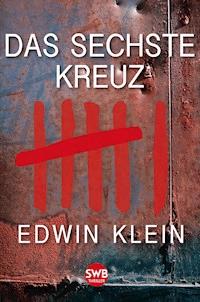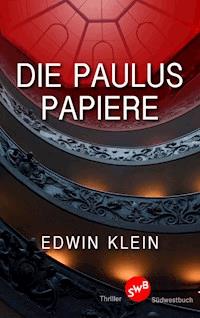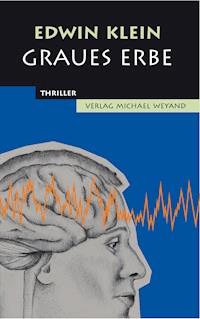
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Michael Weyand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach jahrelanger Entfremdung sieht Bodo seinen Vater, einen bekannten Hirnforscher, erst an dessen Sterbebett wieder. Er muss ihm versprechen, die Wahrheit herauszufinden. Aber welche Wahrheit? Möglicherweise findet sie sich in der wissenschaftlichen Hinterlassensschaft seines Vaters. Ein amerikanisches Institut macht Bodo ein lukratives Angebot für die Forschungsergebnisse, das er ablehnt. Ein Fehler, der Bodo zum Verhängnis zu werden droht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Verlag Michael Weyand
*
Edwin Klein
Graues Erbe
Impressum
© Verlag Michael Weyand GmbH, Friedlandstr. 4,
54293 Trier, www.weyand.de, [email protected]
Umschlaggestaltung: Sabine König
Lektorat: Gabriele Belker, Gabi Böhm, Dr. Hans-Joachim Kann
Druck und Bindung: Clausen & Bosse, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgend-
einer Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN 978-3-942 429-43-6 1. Auflage Mai 2006
Prolog
Nichts ist so faszinierend wie das Gehirn. Und nichts so beängstigend. Menschen in den Kopf zu schauen und zu heilen – schon bei den Ägyptern war das ein Wunschtraum. Der heutige scheint zu sein, Menschen zu manipulieren, ohne dass sie es merken. Ihnen einen fremden Willen aufzuzwingen und den eigenen auszuschalten. Kontrolle über ihre Gedanken zu erlangen – und damit die absolute Macht.
Die Wissenschaft ist weiter, als sie zugibt. Gedanken und Verhaltensweisen können Zählmustern zugeordnet und somit entschlüsselt werden, und mittels Impulslenkung steuert man von außen Gedanken und hierdurch Taten. In Amerika gibt es Patente für einen Psycho-Akustik-Projektor und eine Bewusstseinsveränderungsmaschine. Nicht zu vergessen die Massenbeeinflussungstechniken im US-Projekt Pandora, denn der Krieg der Zukunft findet nur noch in den Köpfen statt.
George Orwell müsste sein Buch »1984« neu schreiben – es ist längst überholt.
Die Handlung des Buches ist leider nicht in allen Belangen frei erfunden. Aber dafür immerhin die Personen.
1
2
Seinen Vater hatte er nie gekannt, dafür jedoch seine Mutter um so besser. Obwohl sie schon seit zwanzig Jahren tot war, glaubte er noch immer ihre Stimme zu hören. Leicht näselnd, oft mit Ironie unterlegt, dann aber auch wieder fordernd oder beschwörend, je nach Situation und Intention. Über viele Jahre hatte er bei ihr, so zumindest kam es ihm heute vor, eine Gehirnwäsche durchlaufen, von der er nicht wusste, ob sie ihm genützt oder geschadet hatte. Genützt als Wissenschaftler allemal, hatte sie ihn doch durch ihren permanenten Antrieb zu einem der bedeutendsten Biochemiker und Neurologen Amerikas werden lassen. Aber als Mensch kam er sich eher fremd und verloren vor. Über Gefühle und Emotionen und all die sogenannten menschlichen Schwächen hatte er zwar viel gelesen, sie selbst aber nie, wie er meinte, kennen gelernt. Über die er in der Öffentlichkeit, wenn sie zur Sprache kamen, stets lächelte, sie als unnützen emotionalen Ballast oder als Bremsklotz der Logik, Verhinderer der Innovation abtat. Dabei verspürte er jedoch innerlich eine unerklärliche Sehnsucht nach diesen Gefühlen, von denen seine Mutter stets behauptet hatte, sie seien vulgär und alltäglich und würden ihn nur am Fortkommen hindern. Eine Sehnsucht, wie er sie früher nach den verlockenden Kirschen aus Nachbars Garten verspürt hatte, denn genau wie sie wollte er auch diese süße menschliche Seite kennen lernen. Vielleicht die schönste.
»Wenn du darauf wartest, dann kommt es nie«, hatte seine Mutter ihm immer wieder eingetrichtert. »Nimm es dir einfach und bestimme den Zeitpunkt selbst. Sei der Macher!«
Schon seit er zehn Jahre alt war, hatte er nicht mehr gewartet. Ein Duncan wartet nie, hörte er seine Mutter. Und genommen hatte er sich alles, was er benötigte. Auch die Noten und die Examina auf der Universität und den Doktortitel. Einfach genommen, weil er so gut, so brillant war, dass es keinen Zweifel des Wartens gab. So gut, dass sein Doktorvater einmal zu ihm gesagt hatte: »Wenn ich mich mit Ihnen unterhalte, dann frage ich mich: Wer ist hier Doktorand und wer Doktorvater?«
»Bei den Duncans gab es noch nie einen Versager«, so seine Mutter, wenn er auch nur im Ansatz zu zweifeln schien. Nie und nimmer hatte sie Angst, er würde versagen. Ihre einzige, vielleicht klammheimliche Angst bestand darin, er könnte womöglich nicht der größte aller Duncans aus Virginia werden. Nicht größer als sein Großvater General Frederik Duncan, um den sich bei der Schlacht um Midway wahre Legenden rankten. Oder Robert, sein Vater, Abgeordneter im Repräsentantenhaus, eine Kapazität im Finanzwesen mit Beziehungen und einem ausgeprägten Loyalitätssinn gegenüber Konzernen, was sich auch auf seinem Konto widergespiegelt hatte. Nicht zu vergessen sein Urgroßvater Ronald, der wohl als einer der wenigen Glücklichen den Schwarzen Freitag an der Wallstreet zum schönsten Sommertag hatte gestalten können. Ein Sommertag, dessen schier unendlicher finanzieller Glanz bis in das neue Jahrtausend hinein schimmerte und den Urenkel mit genau dem Maß an pekuniärer Unabhängigkeit ausstattete, um selbstbewusst und fordernd auftreten zu können.
»Nimm es dir einfach, und dann bestimmst du den Zeitpunkt.« Sich darauf besinnend, hatte er auch geheiratet. Vier Wochen, nachdem seine Mutter verstorben war. Genommen hatte er sich jedoch seine zukünftige Frau bereits früher. Und sie konnte zwei Gründe vorweisen, die ihm das Nehmen enorm versüßten: Zum einen vergötterte sie ihn als Assistentin, das tat seinem Ego gut, und zum anderen stammte sie aus der wohl einflussreichsten Familie Virginias, das tat seiner Reputation gut. Dass Victoria darüber hinaus auch noch apart war und gut aussah, körperlich nicht allzu groß und damit für ihn ideal, nahm er als angenehme Beigabe hin. Und irgendwie mochte er sie auch.
Leider war ihre Ehe kinderlos geblieben, und so würde er wohl für alle Zeiten der größte aller Duncans bleiben. Es sei denn, er konnte sich doch noch dazu durchringen, seinen tiefgefrorenen Samen einer ihn verdienenden weiblichen Person zukommen zu lassen. Schon seit Jahren war er auf der Suche. Die Gene von Einstein, Schweitzer und Heidi Klum in einer Empfängerin vereint, aus seiner Sicht die geniale Mischung.
Nehmen musste er auch noch aus einem anderen Grund. Von Statur eher klein, hatte er permanent Durchsetzungskraft unter Beweis zu stellen, was man anderen, einen Kopf größer und mehr, allein schon von ihrer Physiognomie automatisch zutraute. So konnte es Charles Duncan nicht vermeiden, sich ständig auf allen Feldern mehr als andere behaupten zu müssen.
Inzwischen war er jedoch auf seinem Gebiet so herausragend, dass es ihm diebischen Spaß bereitete, fachlich auf alle anderen hinunterzuschauen. Und er trieb diesen Spaß sogar so weit, nur groß gewachsene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um sich zu scharen. Mittendrin der große kleine Duncan, zu dem sie, obwohl sie sich bückten, hochschauen mussten.
Und noch ein letztes Mal würde er sich etwas nehmen und nicht darauf warten. Er kannte viele, die ein Leben lang warteten und ihn dennoch nie erhielten: den Nobelpreis. Aber Charles Duncan würde ihn sich einfach nehmen mit den bahnbrechenden Entdeckungen auf dem Gebiet der Gehirnforschung. Seine sensibilisierten Antennen und der stetige Kontakt zu denen, die an der Spitze des Verleihungsteams saßen, signalisierten ihm, in spätestens einem Jahr war es so weit. Dann hatte er sein Ziel erreicht.
Mit seinen fünfzig Jahren sah Duncan recht stattlich aus, wenn er angezogen war. Und dass er gut angezogen war, dafür sorgte sein Schneider.
»Zuerst lassen sie die Luft aus ihm heraus, dann ziehen sie ihn an und pumpen ihn wieder auf.« So hatte ein Mitarbeiter von ihm zu verdeutlichen versucht, warum seine Anzüge immer so perfekt saßen. Und Perfektion, so Duncans Devise, hörte nicht beim Geist auf.
»Na, Darling, wie gefalle ich dir?«
Victoria trat aus dem Nebenzimmer der Suite, baute sich mit leicht gespreizten Beinen mitten im Raum auf und drehte sich einmal um sich selbst.
Es war von allem etwas zu viel: Etwas zu viel Make-up, etwas zu viel Schmuck und etwas zu viel Mode. Aber genau die richtige Mischung für den heutigen Abend.
»Du gefällst mir ausgezeichnet, Darling.«
»Charly, du bist ja noch nicht angezogen«, tadelte sie gespielt.
Er lag mit hinter dem Kopf verschränkten Händen auf dem gigantischen Doppelbett und sah an sich hinunter. »Bist du sicher?«, antwortete er. Socken hatte er bereits an, einen Slip und auch ein Hemd.
»Oh, ich verstehe.«
Victoria rauschte hinaus. Er hörte sie im Nebenzimmer. Duncan drehte den Kopf zur großen Glasfront und hatte einen atemberaubenden Blick auf New York. Genau aus diesem Grund hatte er das Peninsula Hotel ausgewählt. Weil die Zimmer und Suiten, auch die der geladenen Gäste, alle oberhalb des zwanzigsten Stockwerks lagen und es einen Swimmingpool gab, aus dem man in so luftiger Höhe scheinbar über die Stadt schwimmen konnte. Natürlich hatte sich das Hotel auch exakt seinem Vorhaben angepasst. Heute Abend wollte er wie alljährlich Rechenschaft ablegen gegenüber den Sponsoren. Und er erwartete, dass sie, wie so oft in der Vergangenheit, ihr Scheckbuch zücken würden, um das Pegasus-Institut mit seinen mehr als einhundert Mitarbeitern, dessen Direktor und Leiter er war, in angemessener, sprich mindestens sechsstelliger Höhe zu unterstützen.
»Darling, ich komme.«
Victoria hatte sich nur unwesentlich ihrer Kleider entledigt, als sie erneut in den Raum schwebte und sich neben ihn auf das Bett setzte.
»Wollen wir etwas nachdenken?«, gurrte sie.
»Haben wir noch so viel Zeit?« Demonstrativ warf er einen Blick auf seine Uhr.
»Mehr als eine halbe Stunde.«
Victorias rechte Hand, die zuerst nur sein Knie gestreichelt hatte, glitt höher in seinen Schritt. Die andere zog gleichzeitig seinen Slip nach unten. Duncan schloss die Augen und dachte mit immer noch hinter dem Kopf verschränkten Händen nach. Und er konnte hervorragend nachdenken, während Victoria sich ausgiebig mit seiner Körpermitte beschäftigte. Die Gedanken flossen klar und stetig, fast bis zum Schluss. Und mündlich war Victoria nicht zu schlagen. Wie gesagt, er konnte hervorragend nachdenken, fast bis zum Schluss. Nur die letzten zwanzig Sekunden, daa hatte er etwaaaas Schwiiiiiieeeerigkeiiiiten.
Wenig später zog Victoria im Bad ihre Lippen nach, er wusch sich die Farbe und den Samen vom Penis und zog sich den Slip an.
»Na, gut nachgedacht?«
»Du bist die Beste, Darling«, lobte er.
»Ich weiß«, kam es trocken von ihr. Aber Duncan fragte nicht nach, woher sie das wissen konnte.
Prüfend schaute er in den Spiegel, sah das glatte, fast faltenlose und leicht gebräunte Gesicht, die braunen Augen, Haarfarbe in Pfeffer und Salz, voll und ohne Geheimratsecken. Duncan bleckte die Zähne, auch damit war er zufrieden. Hatten auch viel Geld gekostet.
Er trug eine Creme auf, massierte sie ein, kämmte sich, knotete die Krawatte, zog seine Hose und die gelackten Schuhe an. Dann die Jacke darüber – im späteren Verlauf des Abends würde er den Anzug gegen einen Smoking tauschen – und ein erneuter Blick in den Spiegel. Nichts von der teigigen Masse um seine Hüften zu sehen, nichts von den dünnen Ärmchen und der fett aufgeschwemmten Brust.
»Auf in den Kampf«, verkündete er gut gelaunt und hob eine Faust wie einst ein ganz Großer nach Waterloo.
»Darling, du siehst zum Anknabbern aus«, schwärmte Victoria, hauchte ihm einen Kuss auf die Wange und unterstützte ihre Bemerkung, indem sie ihm zwischen die Beine fuhr.
3
Immer diese Träume. Diese quälenden und sich periodisch wiederholenden Träume. Zwei- oder dreimal die Woche. Und nach drei Monaten hatte er sie alle durch, das Martyrium begann von vorne, als hätten sie sich abgesprochen und die Reihenfolge neu ausgelost. Seit er sich erinnern konnte, ging das schon so, seit mindestens zwanzig Jahren.
Bodo schwang die Beine aus dem Bett, ein Blick auf die Uhr, es war sechs am Morgen. Vor Jahren hatte er sich wegen der Träume behandeln lassen, war von Therapie zu Therapie, von Therapeut zu Therapeut geeilt, nur um am Ende immer wieder erfahren zu müssen: Man könne ihm nicht helfen. Solch ausgeprägte, sich stets wiederholende Träume, und dann noch diese Vielzahl, das habe man noch nie erlebt. Da wisse man kein Heilmittel. Akupunktur und Akupressur, Tabletten und Pillen und Tropfen, Beruhigungs- und Schlafmittel jeder Art, Tests in Schlaflabors, Hypnose, Autosuggestion und was sonst noch alles, nichts hatte ihm geholfen.
Vor fünf Jahren hatte er den Parcours, seine Träume in den Griff zu bekommen, eingestellt. Er müsse halt mit ihnen leben, sich mit ihnen arrangieren, lautete der wenig aufmunternde Rat der Experten.
Nicht einmal ein Muster, auf das man aufbauen und mit dem man beginnen könne, hatten all die Psychologen und Therapeuten herausfinden können. Alles sei willkürlich angeordnet und ohne System, genau wie ein unlösbares Puzzle. Chaos in Sachen Träume, aber ohne Theorie.
Bodo ging ins Bad und trank ein Glas Wasser. Er schaute in den Spiegel. Vorhin, in seinem Traum, hatte er auch in einen Spiegel geschaut, einen großen Standspiegel. Von den Füßen bis hoch zum Kopf war sein Blick gewandert. Von den Stöckelschuhen über die Nylonstrümpfe, die wohl proportionierten Beine, die so gar nichts mit seinen kräftigen und behaarten gemeinsam hatten, hin zum kurzen Rock, hauteng über den Hüften liegend. Weiter zur Wespentaille, der weißen Bluse mit den deutlich sich abzeichnenden Brüsten, dem schlanken Hals, makellosen Gesicht, dem schulterlangen, brünetten Haar. Und wenn er dann im Traum sprach, hörte er aus dem Mund mit den geschminkten Lippen seine eigene dunkle Stimme. Aber die Hände und Finger, welche die Zigarette zum Mund führten, waren lang und schlank, die Nägel aufreizend violett lackiert. Dabei rauchte er überhaupt nicht.
Männer hatten um ihn herum gestanden, die ihn im Traum hofierten, ihm Komplimente machten, sich förmlich anbiederten und die anderen Konkurrenten auszustechen versuchten. Stets waren es vier Männer, gut aussehend, wie aus einem Journal entsprungen. Einer von ihnen etwas älter als die anderen, vielleicht Ende vierzig oder Anfang fünfzig. Wie ein englischer Gentleman, auch was seine Zurückhaltung betraf. Zu ihm fühlte er sich am meisten hingezogen, zu diesem vertrauten, freundlichen Gesicht mit den markanten Falten um den Mund.
Was hatte er nicht alles an Deutungen hören müssen, wenn er von diesem Traum erzählte. Möglicherweise kompensiere er seine Unzufriedenheit als Mann und lebe sein wahres feminines Ich in den Träumen aus. Ob er schon mal an eine Operation und Umwandlung gedacht habe? Daraufhin hatte Bodo den Therapeuten gewechselt. Aber der nächste bot nicht viel mehr und fragte ihn nach homosexuellen Neigungen. Er schien richtiggehend enttäuscht zu sein, dass Bodo auf diesem Gebiet keine Erfahrungen gesammelt hatte. Um Recht zu behalten, unterstellte er Bodo, dass er sich selbst belog. Ohne eine gewisse Grundehrlichkeit gegen sich selbst gäbe es nun mal keine wirkungsvolle Therapie.
Bodo seufzte, trank erneut einige Schluck Wasser und betrachtete sich im Spiegel. Gegensätzlicher als das Bild in seinem Traum konnte die Wirklichkeit kaum sein. Längeres, ungekämmtes, bis zum Nacken fallendes schwarzes Haar, Bartstoppeln, die dunkel schimmerten, als hätte er sich geschminkt, seine Nase gewölbt, irgendwo zwischen griechisch und indianisch, das Kinn etwas weich, die dicht behaarte Brust, darunter ein Bauch ohne Waschbrett, aber noch nicht über der Hose hängend, die Hüften, etwas entfernt von einer Wespentaille. Alles war noch gut zu verstecken unter Konfektionsgröße 54 oder 56, je nach Mode.
Bodo wusste, er bewegte sich zu wenig. Einmal in der Woche zum Fitnesstraining und ab und zu mit einer Kundin auf den Golfplatz, das genügte nicht. Er stellte sich in Positur, drückte die Brust nach vorn und spannte den Bizeps. Er stülpte die Lippen auf, seine Zähne gesund und weiß, aber nicht makellos in Reih und Glied. Alles in allem ein Typ mit Ecken und Kanten, wie er meinte. Mit weichen Kanten und ausgesprochen empfindsam, mit viel Verständnis für das Weibliche, einem phantastischen Fingerspitzengefühl, was Design und Kunst und auch Mode anbelangte und obendrein ein ungemein interessanter Gesprächspartner – so sahen ihn seine überwiegend weiblichen Kunden. Gleichgültig, ob verheiratet oder nicht.
Die Träume vergessen konnte er noch am ehesten unter der Dusche. Zuerst warm und anschließend eiskalt trieb er sich die vergangene Nacht aus dem Körper. Zu neuem Leben erwacht saß er am Frühstückstisch, dessen kulinarisch schlichtes Angebot ihn als Junggeselle verriet, trank Tee und aß einen Toast mit Streichkäse. Schnell überflog er die Zeitung. Unter den Todesanzeigen entdeckte er keinen Bekannten, Trier hatte wieder einmal im Fußball verloren und kämpfte um den Abstieg aus der Liga. Im Mittelteil entdeckte er seine Anzeige. Einmal im Monat wies er auf seine Dienste hin. ADA in Großbuchstaben, darunter die Erklärung: Art, Design und Antiquitäten. ‚Für das Unmögliche sind Sie selbst zuständig, das Mögliche ist unsere Aufgabe’, so lautete sein Slogan. Und darunter war hinzugefügt: ‚Vielleicht entdecken Sie, dass wir die gleiche Vorstellung haben’.
Nicht mehr, kein Preiscatcher, kein Hinweis auf ein Sonderangebot. Etwa ein Bild von Tiansen gekauft und als Dreingabe vierzehn Tage Wellness in der Türkei. Oder: Lothringer Barockschrank, gekoppelt mit Badeurlaub an der Copacabana, günstig abzugeben.
Kurz nach sieben Uhr saß Bodo in seinem Arbeitszimmer und verglich die Zahlen der beiden Geschäfte: Eines in Trier in der Nagelstraße und ein weiteres in Koblenz im Löhr-Center. Beide lagen in 1b-Lage und somit nicht im direkten Zentrum, aber er konnte sich über die Umsätze nicht beklagen.
Freunde von ihm meinten, er müsse einen besonderen Kniff, einen ungewöhnlichen Dreh haben, weil sich seine Geschäfte so hervorragend entwickelten. Bodo selbst konnte darüber nur schmunzeln. Er kannte seinen besonderen Dreh: die Ehrlichkeit. Er gab zu, dass die Plastik zu teuer sei, er habe sie schon überteuert eingekauft. Aber sie habe ihm nun mal gefallen. Er widersprach auch nicht, wenn die Dame des Hauses meinte, die Accessoires des Badezimmers überstiegen ihr Budget. Und er riet vom Kauf ab, falls ein Teppich oder eine Vitrine das ansonsten homogene Bild der Wohnungseinrichtung störten. Außerdem erklärte er sich bereit, sämtliche Gegenstände für eine Gebühr von fünf Prozent wieder zurückzunehmen.
Bodo hatte bisher noch jede Plastik verkauft, alle Teppiche und Vitrinen, etliche Wohnungen eingerichtet und in den vergangenen acht Jahren erst einmal etwas zurücknehmen müssen. Eine ausgezeichnete Quote.
Bodo wohnte in Altrich, einem kleinen Ort unweit von Wittlich, nahe der Autobahn. In weniger als einer Stunde war er in Koblenz, bis Trier benötigte er zwanzig Minuten. Und er musste auch öfter nach Trier als nach Koblenz fahren, denn in der alten Römerstadt an der Mosel tat Kontrolle gut. Vertrauen durfte er auf Koblenz.
Als Junggeselle und noch mehr als Geschäftsmann gehörte es sich in seiner Branche, dass er einen Porsche fuhr. Nur die Insider erkannten, dass es sich bei dem Carrera um das letzte luftgekühlte Modell handelte und der Sportwagen somit schon fast zehn Jahre alt sein musste. Wie günstig er ihn aber gekauft hatte, wusste nur Bodo.
Um neun Uhr stand er in Trier vor seinem Geschäft, auf die Verkäuferin wartend. Zehn Minuten später erschien sie und suchte errötend nach einer Entschuldigung. Heute war es der Bus.
»Das kann doch jedem mal passieren«, beschwichtigte Bodo. »Peinlich wird es nur, wenn ich ein Kunde gewesen wäre.«
Er inspizierte den Verkaufsraum, richtete hier etwas, verrückte dort einen Tisch, damit es sich besser darstellte. Im Büro ließ er sich die Verkäufe der letzten Tage und die Bestellungen zeigen. Dass er bereits zu Hause alles eingesehen hatte, weil er online mit seinen Geschäften verbunden war, verriet er nicht. Die Zahlen und Mengenangaben deckten sich mit denen, die er früh am Morgen studiert hatte.
Eine Kundin betrat den Laden. Monika Trossen, seine Verkäuferin, ging nach vorn und kam kurz darauf zurück.
»Frau Zienterra möchte nur mit dem Chef sprechen.« Sie äffte die Stimme der Kundin nach, die, das wusste Bodo, nicht ganz einfach war.
Bodo begrüßte Gabi Zienterra, mit der er wiederholt Golf gespielt und dabei geschickt verloren hatte.
»Hallo, Gabi.« Er hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. Sie umarmte ihn einen Augenblick zu lange und mit etwas zu viel Körperkontakt.
»Bodo, ich suche etwas.«
»Sonst wärst du ja nicht hier.«
»Es soll …, es soll ...«
»... ausgefallen, nicht teuer, aber qualitativ gut sein.«
»Genau.« Sie nickte ernsthaft, als sei sie überrascht, dass er ihren Wunsch erraten hatte.
»Für wen, für welche Gelegenheit oder für welche Örtlichkeit?«, wollte er wissen und zog sie etwas näher zum Schaufenster, damit vorbeieilende Fußgänger sie sehen konnten, falls sie einen Blick in das Geschäft warfen.
»Helen hat Geburtstag. Du kennst doch ihre Wohnung.«
Bodo nickte. Er hatte sie komplett eingerichtet. Und er wusste bereits, was er empfehlen würde.
»Und dann noch etwas für unsere Wohndiele. Es sollte ...«
»... zu dem Ghom, der vierköpfigen Holzplastik und den mit Leder bezogenen Möbeln aus Rattan passen.«
»Du erinnerst dich noch?« Gabi war erstaunt. »Das ist aber schon ... fünf Jahre her.« Bodo lächelte. »Gabi, alles zu wissen und miteinander zu kombinieren, das ist mein Geschäft. Übrigens: Für den leer stehenden Raum, das ehemalige Kinderzimmer, habe ich eine Idee.«
»Komm, lass hören.«
Bodo stellte sich vor sie und untermalte seine Worte mit Gesten. »Alles weiß, Boden, Wände, Decke, und an der dem Fenster gegenüberliegenden Seite zwei starke Spots. Mitten im Raum ein schwarz lackierter Stuhl. Und zwar dieser hier.« Er trat zwei Schritte zur Seite und deutete auf einen schlichten Stuhl, mit etwas erhöhter Lehne und leicht nach außen geschwungenen Beinen.
»Du meinst ...«
Bodo hob leicht eine Hand. »Das Zimmer ist doch nach Südwesten ausgerichtet, besser gesagt nach Westen.«
Gabi nickte.
»Die Abendsonne wird einen tollen Schatten zaubern. Der dunkle Stuhl, der weiße Boden.«
Gabi legte eine Hand vor den Mund, wirkte nachdenklich und nickte erneut.
»Und die Spots müssen so stark sein, dass sie auch am Tag gegen die Sonne ankommen. Dann wandert der Sonnenschatten im Raum, derjenige der Spots verharrt kurz vor dem Fenster und kreuzt ihn.«
Zwei Sekunden schien Gabi noch zu überlegen, dann begann sie zu strahlen. »Phantastisch, Bodo, wirklich phantastisch. Das machen wir. Und die Kosten?«
»Anstreicher, Bodenbelag, Stuhl, Spots, eventuell die Decke mit Glasfaser tapeziert, kaum mehr als viertausend, höchstens fünf.«
»Das machen wir«, wiederholte Gabi und es schien, als habe Bodo soeben ihre Wunschvorstellung ausgesprochen. »In zwei Wochen haben wir Gäste. Geht das?« Fragend schaute sie ihn an.
Bodo nickte zögernd. Dass er die Idee eines Freundes etwas abgewandelt hatte, erwähnte er nicht. Außerdem lebte der Freund in New York, war gerade fünfzig geworden, arbeitete für Harrison Ford, Liam Neesen, William Defoe und andere Filmgrößen und gehörte inzwischen zu den Top-Designern der Metropole.
Bodo verkaufte Gabi für ihre Freundin noch eine ausgesprochen schlanke und zierliche Silberplastik, die an etruskische Kunst erinnerte. Und für ihre Diele hatte er zufällig ein altes, vom Zahn der Zeit angenagtes und nicht mehr ganz gerade stehendes Eicheregal aus dem Baskenland, in das etwa fünfzehn Rotweinflaschen passten. Sehr dekorativ und günstig, wie Gabi meinte. Warum sollte Bodo ihr widersprechen?
Am frühen Nachmittag – Bodo hatte sich für kommende Woche mit Gabi zum Golf verabredet und anschließend in der Innenstadt in Anbetracht seines Körpergewichtes einen Salat gegessen – fuhr er über die Autobahn in Richtung Wittlich. In Altrich angekommen, steuerte er in einem neuen Wohngebiet auf ein äußerlich schlichtes Einfamilienhaus zu, das er vor zwei Jahren günstig ersteigert hatte. Wenn es ums Rasen mähen und andere Arbeiten ging, sehnte er sich allerdings nach seiner Eigentumswohnung zurück. Seit er stundenweise einen Gärtner beschäftigte, offiziell angemeldet, war die Sehnsucht nicht mehr ganz so groß.
Bodo nahm die Post aus dem Briefkasten, zog seine Jacke aus, schlüpfte in Hausschuhe – gut, dass seine Freunde und Freundinnen ihn nicht sehen konnten – besorgte sich in der Küche ein Glas Orangensaft und ging ins Wohnzimmer. Dort pflanzte er sich in einen Sessel und sortierte die Briefe. Werbung und solche aus den Briefzentren mit 33 Cent Portoaufdruck wurden zerrissen und in den Abfalleimer geworfen, die anderen geöffnet und überflogen. Bis auf einen Brief, den er schon zum zweiten Mal las.
Sehr geehrter Herr Ontara,
wir konnten Sie telefonisch nicht erreichen und schreiben Sie an im Namen Ihres Vaters, dem es sehr schlecht geht. Nach Auskunft der Ärzte wird er nicht mehr lange leben. Es ist sein inständiger Wunsch, dass Sie ihn besuchen und sich mit ihm aussöhnen. Bedenken Sie bitte, es ist wohl sein letzter Wunsch.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag Dr. Holger Gastinger
Alles in Bodo war Ablehnung. Über die seltsame Beziehung zu seinem Vater hätte er mit all den Therapeuten sprechen sollen und nicht über seine Träume. Seinen Vater, den er vor mehr als zehn Jahren zum letzten Mal gesehen, der ihn als Junge in ein Internat in die Schweiz und später zum Studium der Betriebswirtschaft nach England und Amerika verfrachtet hatte. Der zwar jeden Monat pünktlich den großzügigen Scheck ausgestellt, sich aber nie persönlich hatte blicken lassen. Und nun lag er im Sterben. Und Bodo sollte ihn besuchen. Ihn, der sich nicht um seinen Sohn gekümmert hatte, dessen einzige Verbindung die Schecks, zwei oder drei Besuche und ebenso viele Telefonate in all der Zeit und einige wenige Briefe waren.
Bodo stand auf, ging zur Bar, in der verloren fünf Flaschen standen, und schenkte sich einen Cognac ein. Langsam trank er die brennende Flüssigkeit als hoffte er, sie würde auch die Erinnerung wegbrennen.
Seine Mutter war kurz nach seiner Geburt gestorben. Geblieben war ihm nur der Vater mit seiner Arbeit, den vielen Terminen, Reisen, langen Zeiten der Abwesenheit. Nicht ein einziges Mal hatten sie zusammen Fußball gespielt, waren im Wald gewandert oder hatten eine Radtour unternommen. Lediglich an eine dreitägige Reise nach Stockholm, auf der er ihn begleitet hatte, konnte er sich erinnern. Sein Vater hatte Vorträge gehalten, während er allein die Stadt erkundete. Und nachts, als sie gemeinsam in einem Doppelbett schliefen, hatte er plötzlich und unerklärlich Angst vor seinem Vater bekommen. Ist das der Zeitpunkt, als meine Träume begonnen haben, fragte er sich? Ist etwas vorgefallen, was ich verdrängt, was ich tief in mir eingeschlossen habe, weil ich mich schäme? Weil ich ... Angst habe?
Bodo konnte sich die Fragen nicht beantworten. Er telefonierte mit Dr. Gastinger und bekam zu hören, dass sich der Zustand seines Vaters dramatisch verschlechtere. Es bleibe nicht mehr viel Zeit. Immer wieder frage sein Vater nach ihm.
Und die Ontara-Stiftung sei leicht zu finden. Dort liege sein Vater in einem speziell hergerichteten Raum. Nur wenige Kilometer von Simmern entfernt in Richtung Koblenz, mitten in der Natur.
4
Seit vier Tagen waren sie in England, und sie bewegten sich nicht nur wegen des Linksverkehrs ausgesprochen vorsichtig. Ihre Pässe wiesen sie als Spanier aus und waren so gut, dass es keine Beanstandungen gegeben hatte. In Wirklichkeit jedoch kamen sie aus Frankreich, aus der Nähe von Marseille, aber überwiegend tätig waren sie im Raum Paris.
Enrique, wie bei dem Jüngeren im Pass stand, deutete nach vorn auf einen Mann in hellem Trenchcoat mit dichtem grauen Haar.
»Das ist er.«
Pedro nickte und startete den Motor. Langsam rollten sie schräg versetzt hinter dem Mann her.
Sie wussten, was nun kommen würde. Der Graumelierte würde wie jeden Abend um sechs in Holmes Chappel, einer Kleinstadt etwa dreißig Kilometer von Manchester entfernt, noch in ein Pub gehen und nach einer halben Stunde ein Taxi rufen, die kurze Strecke nach Hause fahren, ins Haus gehen, sich einen Martini mixen, den Elektro-Kamin anwerfen, etwas lesen, einige Telefonate führen und später den Fernseher anschalten. Vielleicht würde er auch wieder wie vorgestern eine DVD einlegen und sich einen Pornofilm anschauen. Aber er würde auch so wie in den vergangenen Tagen allein sein und keinen Besuch empfangen. Und genau das war der entscheidende Punkt.
Pedro und Enrique sahen den Graumelierten im Pub verschwinden und fuhren die wenigen Kilometer zu einem etwas abseits stehenden Haus. Kurz vor dem Haus bogen sie nach rechts ab, näherten sich dem Gebäude von der rückwärtigen Seite und blieben somit für zufällig Vorbeikommende unsichtbar.
Ihre Hände schlüpften in Latex-Handschuhe, sie verbargen ihre Haare unter einer Kapuze, legten einen Mundschutz an. Dann erst begannen sie mit ihrer Arbeit.
Schnell hatten sie die primitive Alarmanlage ausgeschaltet, transportierten vier Koffer und zwei blumenkastengroße Geräte in das Haus, zogen die Vorhänge zu und machten nur notdürftig Licht.
Nach einer viertel Stunde stellte sich Pedro ans Fenster und beobachtete die Straße vor dem Haus.
»Er kommt«, sagte er wenige Minuten später über die Schulter. Enrique, der im Schlafzimmer mit Gerätschaften hantiert hatte, ging zum Eingang und stellte sich in die Garderobennische. Pedro löschte derweil oben das Licht und rührte sich nicht.
Die Eingangstür wurde geöffnet, das Taxi hatte bereits gewendet und fuhr davon. Der Graumelierte stellte seine Aktentasche ab, zog seinen Mantel aus und wollte ihn an der Garderobe aufhängen, als er Enrique bemerkte. Der drückte ihm blitzschnell ein Taschentuch auf den Mund, rammte ihm die Spritze in den Hals, presste den Kolben hinein und war noch nicht damit fertig, als er schon spürte, wie der Körper erschlaffte.
Er ließ den Mann einfach zu Boden fallen. Gemeinsam mit Pedro schleppte er ihn ins Schlafzimmer. Sie legten ihn auf das Bett, die Füße zum Kopfende, die Schuhe ausgezogen, den Oberkörper frei gemacht. Gekonnt begannen sie mit dem Anlegen der Elektroden, schlossen sie an die Apparaturen und überprüften deren Funktion. Zufrieden schauten sie sich an und kamen schnell zum wichtigsten Teil ihrer Arbeit. Zuerst zogen sie dem Graumelierten eine eng anliegende Folie über den Kopf und markierten einige Punkte auf der Stirn und der Schläfe des Besinnungslosen.
Pedro entnahm einem der Koffer eine metallbeschichtete Kapuze und legte diese exakt auf die vorher markierten Punkte. Von der Oberseite der Kapuze verliefen gebündelte Drähte in bereitstehende Computer, deren einzige Funktion es war, Daten zu speichern. Ohne Grafik und Soundkarte. Entsprechend ihrer Aufgabe waren auch die Speicher überdimensional ausgelegt. Insgesamt mehr als zehntausend Giga-Byte.
Gemeinsam überprüften sie sämtliche Anschlüsse, machten einen Testlauf und nickten wie auf Kommando.
»Komm, lass es uns durchziehen.«
Etwas in der Stimme von Pedro klang, als fühle er sich unbehaglich und wäre nicht mit Freude bei der Arbeit. Dabei gab es für jeden von ihnen hunderttausend Euro zu verdienen – steuerfrei! Aber die Art ihrer Tätigkeit, die sie über Wochen unzählige Male in Paris unter Aufsicht geübt und getestet hatten, behagte ihnen nicht sonderlich. Eine Pistole und eine Kugel, auch ein Messer oder eine Bombe, das war eine saubere, eine echte Sache. Aber das hier? Die Zeiten hatten sich eben geändert.
Gekonnt verabreichte Pedro dem immer noch Besinnungslosen eine Injektion in der Armbeuge. Auf einem Monitor kontrollierten sie die Veränderung. Als der Ausschlag in den roten Bereich überschwenkte, schalteten sie alle Geräte an. Ein leichtes Surren der Lüfter erfüllte als einziges Geräusch den Raum.
»Die erste Stunde bleibe ich hier, dann kommst du mich ablösen.«
Pedro nickte, ging ins Wohnzimmer und stellte den Fernseher an. Licht machte er nicht. Immer wieder stand er auf und beobachtete die Straße vor dem Haus. Nichts war zu sehen, keine Auffälligkeiten. Holmes Chappel ging früh zu Bett.
Als Pedro nach einer Stunde Enrique ablöste und das Zimmer betrat, hatte er wieder das gleiche flaue Gefühl wie die Male zuvor. Der Körper auf dem Bett zuckte und bewegte sich, unter den geschlossenen Augenlidern rollten die Augäpfel, die Adern an Stirn und Hals waren dick hervorgetreten.
»Noch drei Stunden, dann ist alles vorbei«, murmelte Pedro und empfand seltsamerweise Mitleid. Ein Wesenszug, der ihm ansonsten fremd war. Aber er hatte auch noch nie jemandem vier Stunden beim Sterben zugesehen, jede Kugel war da schneller und humaner. Dabei wusste er, dass sich die Aktivitäten des Graumelierten noch enorm verstärken würden. So stark, dass er womöglich – wie bei ihrem letzten Einsatz vor drei Wochen – aus dem Bett fallen würde, wenn sie ihn nicht festbanden. Und die Zeiger und Balken auf den Geräten tanzten einen immer wilderen Rhythmus. Ähnlich dem der Augäpfel.
5
Gemeinsam mit seiner Frau betrat Charles Duncan nach dem Stichwort des Conférenciers das Podium des großen Saales. Das Hotel Peninsula hatte sich nicht lumpen lassen. Blumenarrangements in Hülle und Fülle, vor den Wänden und an den Ausgängen Bambusstauden und Palmen, zu grünen Inseln drapiert, von der Decke baumelnd Girlanden mit verschiedenfarbigen Lampen, Lampions und Leuchten. Exakt nach Duncans Vorgaben hergerichtet, waren die Tische gewollt ohne erkennbares System aufgestellt worden, was eine gewisse Zwanglosigkeit demonstrieren sollte. Rosafarbene Orchideen und schwarze Rosen auf den Tischen, dazu die entsprechenden Getränke, die vom Mineralwasser bis Champagner der Marke Mumm reichten. Kellner in Lauerstellung, an jedem Platz zwei begehrte Karten der New York Snookers, die morgen Abend spielen würden, an jedem Platz ein Handy zur freien Verfügung während der Veranstaltung, an jedem Tisch ein Internetanschluss, auf jedem Tisch ein Notebook. Die Bühne selbst war sechs Stufen erhöht, dunkelblau eingerahmt und mit einem kardinalroten Vorhang. Ein festlicher Rahmen.
»Und nun, Ladies and Gentlemen, Professor Dr. Charles Duncan mit Gattin.«
Der Conférencier trat zur Seite und machte Platz für das Ehepaar. Die geladenen Gäste applaudierten.
»Vielen Dank.« Duncan verneigte sich leicht zu seinem Publikum.
»Auch im Namen meiner Frau Victoria.« Sie verneigte sich ebenfalls.
Er gab ihr einen Handkuss, sie verschwand mit dem Conférencier vom Podium und nahm an einem der vorderen Tische Platz, eingerahmt von zwei Senatoren.
»Es freut mich, Sie so zahlreich hier begrüßen zu dürfen.«
Duncan wusste genau, was seine Gäste hören wollten und wie sie es hören wollten.
»Ich möchte Sie nicht mit Banalitäten und wissenschaftlichem Einerlei langweilen«, begann er, nachdem er einige der wichtigsten Persönlichkeiten begrüßt hatte. »Das können Sie alles aus der Ihnen vorliegenden Pressemappe und aus dem Internet entnehmen. Was ich möchte, ist an Beispielen und Fakten aufzuzeigen, wie wegweisend und in der Welt führend das Pegasus-Institut bezüglich der Gehirnforschung ist. Und Sie werden feststellen, dass Sie, Ladies and Gentlemen, Ihr großzügig gespendetes Geld hervorragend angelegt haben.«
An dieser Stelle beklatschten sich die Anwesenden selbst.
Duncan drehte sich leicht um die eigene Achse und deutete auf eine große Leinwand.
Auf der Leinwand war ein Mann zu sehen, der, dem Sprecher nach, von der Halswirbelsäule abwärts gelähmt war. Allerdings, und das mutete verwunderlich an, saß er an einem Tisch und aß mit Messer und Gabel. Ein Raunen ging durch die Reihen der Zuschauer. Hatten sie Angst um ihr Geld?
Die Anwesenden wurden darüber aufgeklärt, dass die betreffende Person die Aktivitäten von Armen und auch Beinen über einen Computer steuern könne. Die Person rückte in die Bildmitte, Kabel und andere Verbindungen vom Kopf zu einem Computer waren zu sehen und von dort wiederum welche zu den Armen und Händen des Mannes. Die Verbindungen vom Computer zum Mann, so die Stimme, seien auf Muskelpartien fixiert, die über elektrische Impulse stimuliert würden. Und diese elektrischen Impulse wiederum kämen vom Kopf des Mannes, hätten den Ursprung also in dessen Gehirn, gingen von dort in den Computer, würden in ihm übersetzt und an Arme und Hände weitergeleitet. Die Zuschauer beobachteten, wie der Mann schon sehr geschickt mit Messer und Gabel umgehen konnte und zielsicher seinen Mund traf.
Als der Film zu Ende war, applaudierte man brav. Die Anwesenden wussten, dass Duncan dies nur deshalb zeigte, weil er es toppen konnte.
»Noch ein weiteres Beispiel aus old Germany«, scherzte Duncan.
Wieder Bilder auf der Leinwand. Ein Monitor, davor saß eine Frau. Auf dem Monitor exakt in der Mitte ein gelber Punkt auf blauem Untergrund. Weiterhin war zu erkennen, dass der blaue Untergrund in Raster aufgeteilt war, die obere Reihe hatte Buchstaben, die senkrechte war mit Zahlen versehen.
»Was Sie nun sehen«, verkündete eine Stimme, »ist die unglaubliche Leistung einer Frau, besser gesagt die ihres Gehirns, das man mit Hilfe des ZGF-Instituts in Mainz bei Frankfurt entsprechend trainiert hat. Ohne irgendeine Verbindung mit dem Monitor ist die Frau in der Lage, den gelben Punkt an jede beliebige Stelle wandern zu lassen.«
Ein Mann in einem weißen Kittel, der sich als Dr. Terres vorstellte, trat näher, neben ihm ein Notar, wie zu hören war, um zu zeigen, es sei alles geprüft, alles echt und ohne Tricks.
Auf einen Wink von Terres begann sich die Frau zu konzentrieren, und der Punkt wanderte langsam über den Monitor. Nach rechts, dann nach links, hoch und wieder hinunter. Schließlich beschrieb er einen Kreis.
»Nun wird der Punkt an jede beliebige Stelle auf dem Monitor wandern.«
Terres gab die Koordinaten vor, und der Punkt suchte das entsprechende Feld. Alle Vorgaben wurden erfüllt, kein Fehler, keine falsche Position.
Die Bilder auf der Leinwand erloschen, und während der Beifall abebbte, wandte sich Duncan wieder an sein Publikum.
»Was Sie hier gesehen haben, ist erstaunlich, sehr erstaunlich. Zeigt es doch deutlich, wie weit unsere Konkurrenz bereits gekommen ist. Und es zeigt auch, welchen Weg die Forschung noch vor sich hat. Aber wir vom Pegasus-Institut sind, und das werde ich Ihnen gleich beweisen, schon einen oder vielleicht sogar zwei Schritte weiter als unsere erfolgreichen Mitstreiter.«
Duncan, der bewusst das Wort Konkurrent vermieden hatte, verharrte einige Sekunden in nachdenklicher Haltung vor dem Mikrofon, beide Hände in die seitlichen Taschen der Jacke gesteckt. Lediglich die Daumen schauten hervor. Eine Position, die er vor dem Spiegel einstudiert hatte.
»Liebe Freunde«, begann er vertraulich. »Was wäre der Mensch ohne seinen Geist, ohne sein Gehirn, seine Intelligenz, seine Emotionen, die Möglichkeit, rational zu denken, Entscheidungen zu treffen, zu kommunizieren. Nichts wäre der Mensch ohne all dies, nichts als ein Tier unter vielen, allein seinen Instinkten ausgeliefert.«
Duncan schüttelte sich vor der Vorstellung und ließ seinen Blick über die mehr als einhundertfünfzig geladenen Gäste wandern. Darunter viele Frauen, wohl mehr als die Hälfte, die meisten in Vertretung ihrer termingeplagten Ehemänner. Den Anwesenden war bewusst: Was gespendet wurde, konnte von der Steuer abgesetzt werden.
»Der Mensch hat sich und seinen Geist stetig entwickelt. Aber manchmal stößt auch der Geist an Grenzen. Manchmal sind wir ohnmächtig und müssen zuschauen, wie gewisse Entwicklungen ungehemmt unseren Geist beeinflussen oder sogar zerstören. Das tut weh. Das tut verdammt weh«, betonte Duncan und seine Stimme vibrierte etwas.
Er trat einen Schritt zur Seite, betrachtete erneut die Zuschauer und erweckte den Eindruck, als suche er jemanden.
»Paul, würden Sie bitte einmal zu mir kommen«, sprach er ins Mikrofon.
Paul, ein älterer Mann über siebzig, leicht gebeugt gehend, stieg die wenigen Stufen empor. Duncan begrüßte ihn wie einen alten Bekannten und klopfte ihm jovial auf die Schulter.
»Paul, würden Sie bitte einige Worte an die Anwesenden richten?«
Paul nickte.
»Liebe Freunde«, begann auch er vertraulich. »Dass ich hier stehe, verdanke ich allein Charles ..., pardon, Dr. Duncan.«
Die Besucher lachten.
»Ich war krank, und er hat mir sehr geholfen. Angefangen hat meine Krankheit vor mehr als fünf Jahren. Ich war bei vielen Ärzten in Behandlung, aber niemand konnte mir helfen. Bis ich von Dr. Duncan hörte.« Paul machte eine kleine Pause. »Das ist nicht ganz richtig, denn es war meine Frau, die von ihm hörte. Ich hätte mich nämlich nicht bei ihm melden können. Nun, das ist jetzt mehr als ein Jahr her. Inzwischen haben wir einen Präsidenten in der zweiten Wahlperiode, nach und nach kommen unsere Soldaten aus dem Irak zurück, der Iran hat eingelenkt im Streit um die mögliche Herstellung von Atombomben, und ich bin gesund«, verkündete Paul und die Zuhörer klatschten. Einige ahnten es vielleicht, aber niemand wusste genau, unter welcher Krankheit Paul gelitten haben konnte.
Paul winkte in den Saal, stieg die wenigen Stufen hinunter und setzte sich wieder an seinen Tisch. Eine ältere Dame, Pauls Ehefrau, drückte fest seine Hand.
»Sie werden sich fragen, welche Krankheit Paul wohl hatte«, sagte Duncan. »Paul hat mir erlaubt, Ihnen hier einen Film vorzuführen, der vor etwa einem Jahr aufgenommen wurde.«
Auf ein Zeichen von Duncan waren wieder Bilder auf der Leinwand zu sehen. Paul ging, gestützt auf seine Ehefrau, in ein Zimmer. Am unteren Rand lief eine Uhr mit, die auch dann, wenn es einen Filmschnitt gab, die reale Zeit anzeigte.
Das Ehepaar begrüßte Duncan. Dann nahmen beide Platz.
»Würden Sie mir bitte Ihren Namen verraten«, fragte Duncan. Aber Paul reagierte nicht. Seine Frau stieß ihn an und deutete auf Duncan. Der wiederholte seine Frage. Paul reagierte immer noch nicht.
»Was sind Sie von Beruf?«
Keine Reaktion von Paul.
»Wie alt sind Sie?«
Keine Reaktion.
Die Uhr sprang eine Stunde weiter.
»Sie heißen Paul Basinger«, sagte Duncan.
Paul schaute ihn mit leeren Augen an.
»Würden Sie mir bitte Ihren Namen verraten?«
Paul antwortete nicht.
Die dann folgende Szene lief mehrere Male ab. Paul wurde aus dem Zimmer geleitet, Duncan und Pauls Frau blieben sitzen. Dann wurde Paul wieder in das Zimmer geführt. Immer wieder begrüßte er seine Frau und Duncan wie Fremde, während die Uhr um mehrere Stunden weitergelaufen war. Der Film war zu Ende.
»Sie haben es inzwischen bemerkt, Paul leidet unter Alzheimer. Wenn Paul vorhin gesagt hat, er ist gesund, dann stimmt das nicht ganz. Er ist im Wesentlichen gesund, und er wird mit der Zeit auch immer gesünder werden. Allerdings nur bis zu einem gewissen Grade, denn Wunder gibt es nicht. Dieses Wunder müsste die Chemie bringen, um das Voranschreiten der Krankheit, die Veränderung der grauen Zellen, zu stoppen. Nun, wie haben wir Paul helfen können?«
Duncan erwartete keine Antwort. Auf der Leinwand war wieder Paul zu sehen, mit einer Art übergestülptem Helm.
»Zuerst einmal haben wir in Pauls Gehirn die von der Krankheit befallenen Zellen lokalisiert. Dann haben wir uns nach Ausweichzellen umgeschaut. Von diesen intakten Zellen gibt es noch sehr viele, mehr als achtzig Prozent. Mit diesem Helm, den Sie dort sehen«, Duncan deutete zu den Bildern, »haben wir die intakten Zellen stimuliert und als Ersatz und neue Informationsträger herangezogen. Und anschließend mit Hilfe von umgewandelten Impulsen Paul einen Teil seines Gedächtnisses zurückgegeben. Nun, wir konnten Paul nicht alles zurückgeben. Noch ist Alzheimer nicht zu heilen, aber wir können die Krankheit enorm verzögern, um viele Jahre. Was allerdings vor einem bestimmten Zeitpunkt liegt, ist unweigerlich verloren. Aber Paul ist heute in der Lage, sich voll zu orientieren und am täglichen Geschehen teilzunehmen. Und er kann sich über viele Monate zurückerinnern.« Wieder zu Paul gewandt fragte er: »Wie heißen Sie?«
Paul stand auf und verkündete mit allem Ernst: »George W. Bush.«
Die Zuhörer lachten und klatschten Beifall.
»Alias Paul Basinger«, fügte er schmunzelnd hinzu.
Pause. Duncan verließ das Podium, ging zu diversen Tischen und begrüßte einige der Gäste persönlich. Dabei orientierte er sich an deren Wichtigkeit und Vermögen. Wo er auch hinkam, nur Komplimente für ihn und sein Institut. Glaubte man der Stimmung unter den Gästen, so schien deren Spendenbereitschaft bereits gestiegen zu sein. Charles nahm äußerlich alles bescheiden auf, frohlockte aber innerlich. Noch ein Jahr, dann habe ich dich, sagte er zu sich. Dann nehme ich dich in Stockholm in Empfang.
Duncan stand erneut am Mikrofon und wusste, er durfte seine Gäste nicht überstrapazieren. Er arbeitete gezielt und stimulierte ihre Bereitschaft, einen Scheck auszustellen. Dieses Procedere sollte nun mit der nächsten Präsentation verbunden werden.
»Liebe Freunde«, begann er. »Unser Institut erhält keine staatlichen Mittel. Einige Konzerne …« Duncan übertrieb, denn es war nur ein Konzern. Aber er wollte verhindern, dass der Eindruck entstand, es könne deswegen möglicherweise eine bestimmte Abhängigkeit geben. »Einige Konzerne unterstützen uns mit zwanzig Millionen Dollar jährlich. Aber wir haben eine ständige Finanzlücke von mehr als dreißig Millionen. Bisher konnten wir diese Lücke dank …«, Duncan umschloss mit einer Armbewegung die Geladenen, »… Ihrer Hilfe schließen. Für das kommende Jahr sind bereits sechs Millionen an Spenden eingegangen. Genau genommen sind es 6,2 Millionen.«
Während er sprach, stand eine junge, attraktive Frau von einem der vorderen Tische auf, verharrte einige Sekunden, bis sich viele Blicke auf sie gerichtet hatten, und ging dann wiegend hinaus.
»Helfen Sie hier und heute, unseren Etat für das kommende Jahr aufzustocken.«
Die junge Frau kehrte nach zwei Minuten wieder zu ihrem Platz zurück, und ein Helfer steckte Paul diskret einen Zettel zu.
»Liebe Freunde«, in Duncans Stimme war ein seltsamer Klang, als sei sie vor Rührung belegt, »wie ich soeben erfahren habe, beträgt unser neuer Spendenstand seit wenigen Minuten 11,2 Millionen. Das ist doch einen Applaus wert.«
Ohne einen Namen genannt zu haben, wusste jeder im Saal, wer der Spender, besser gesagt die Spenderin, war. Duncan verriet selbstverständlich nicht, dass er diesen Schachzug mit der Erbin einer Warenhauskette abgesprochen hatte. Sozusagen als Auflockerung, zur Überwindung der Hemmschwelle, um den Spendenfluss in Gang zu bringen.
»Ladies and Gentlemen«, Duncan deutete auf eine Schale aus massivem Silber, »was Sie hier sehen, sind die abgerissenen Hälften Ihrer Einladungskarten. Auf jeder ist eine andere Nummer. Sie haben die entsprechenden Gegenstücke, liebe Freunde. Sicherlich fragen Sie sich, warum ich darauf hinweise. Ich hoffe, Sie haben Ihre Einladungskarte noch nicht weggeworfen. Ganz einfach: Ich benötige Ihre Hilfe. Heute möchte ich direkt vor Ihren Augen demonstrieren, wie weit das Pegasus-Institut inzwischen in der Erforschung des Gehirns gekommen ist. Unter uns weilt auch Frau Matuba, ein Gast aus Sumatra. Frau Matuba, würden Sie bitte zu mir kommen?«
Eine dunkelhäutige Frau mit weitem Gewand stand mitten im Saal auf und trat zu Duncan.
»Frau Matuba kommt aus Sumatra. Fast ihre ganze Familie ist seinerzeit durch die große Welle ausgelöscht worden.«
Zwei Sekunden genügten als Gedenkminute.
»Aber nicht deswegen ist Frau Matuba bei uns, sondern wegen ihrer Sprache. Sie spricht ein Dialekt, welches nur noch knapp dreihundert Mitglieder ihres Stammes beherrschen. Und alle sind dunkelhäutig«, fügte Duncan hinzu, als sei das besonders wichtig. Er schaute lange in den Saal, als betrachtete er sich jeden der Gäste einzeln.
»Frau Matuba wird nun aus dieser Schale eine Einladungskarte ziehen, und ich bitte die betreffende Person, mit ihrem Gegenstück zu uns zu kommen. Bitte, Frau Matuba.«
Die Angesprochene beugte sich über die Schale, drehte den Kopf zur Seite, sah in die entgegengesetzte Richtung und zog die Karte. Duncan nahm sie und studierte die Nummer, als könne er von ihr bereits auf den Gast schließen.
»Wer bitte hat die Nummer 12, liebe Freunde?«
Gleich vorne am Tisch der Prominenten stand Senator Hastings auf und winkte mit der anderen Hälfte. Er stieg hoch zum Podium, begrüßte Frau Matuba und Duncan. Grinsend reichte er ihm die Hälfte seiner Einladungskarte. Duncan hielt beide Stücke aneinander, damit auch jeder sehen konnte, sie passten zusammen.
»Glauben Sie mir bitte, liebe Freunde, es ist purer Zufall, dass Senator Hastings der Auserwählte ist. Ihn hatte ich eigentlich für ein anderes Experiment vorgesehen«, scherzte Duncan, während er dem Senator jovial auf die Schulter klopfte.
Er wandte sich zu seinem Gast. »Frau Matuba, würden Sie bitte etwas in Ihrer Stammessprache sagen?«
Frau Matuba sagte einige Worte, die sich anhörten, als hätte man aus ihnen bestimmte Teile herausgeschnitten, umgedreht, gemischt und anschließend wieder zusammengefügt. Die Gäste klatschten, weil sie eine derartige Sprache noch nicht gehört hatten.
Duncan bat Frau Matuba und Hastings in die Mitte der Bühne. Ein Vorhang teilte sich, zwei Sessel waren zu sehen und etliche Apparaturen. Von den beiden Sesseln liefen sämtliche Anschlüsse und Kabel zu einem zwischen ihnen stehenden Gerät. Auf den Sesseln lagen kopfhörerähnliche Kappen, die jedoch in der Mitte des Bügels eine merkliche Verdickung aufwiesen.
»Bitte.«
Duncan wies auf die Sessel und führte Frau Matuba zu dem linken, den Senator zum rechten.
Von einem Zettel, den man Duncan reichte, las er die neue Spendenhöhe ab. »Vierzehn Millionen.« Applaus.
Während Duncan den Gästen versicherte, dass die bevorstehende Prozedur absolut ungefährlich sei, schloss man die beiden Personen an die Apparatur an.
»Senator Hastings, sprechen Sie die Stammessprache von Frau Matuba?«
Der Senator versicherte, er spreche viel, aber das könne er nun wirklich nicht.
Duncan erhielt von einem Helfer ein Zeichen, dass er beginnen könne.
»Freunde, Sie werden staunen. Wir sagen nun zuerst etwa einhundert Wörter in unserer Sprache, Frau Matuba wird sie anschließend in ihre Stammessprache übersetzen. Der Senator ist nicht mit Frau Matuba verbunden, sondern mit dem Gerät, das zwischen den beiden steht. Falls unser Experiment klappt, kann der Senator anschließend alle Worte in der fremden Sprache wiederholen, auch außerhalb der Reihenfolge. Er wird dies später natürlich ohne Kopfhörer und ohne irgendwelchen Kontakt zu einem Medium oder einem Mikrofon tun«, fügte Duncan noch hinzu. »Und Sie, liebe Freunde, nennen mir nun die hundert Wörter, die Frau Matuba übersetzen soll. Bitte merken Sie sich Ihr Wort, denn Sie sollen es später auch an den Senator richten.«